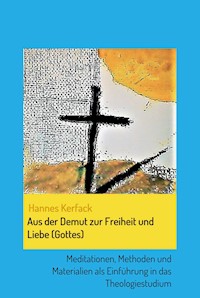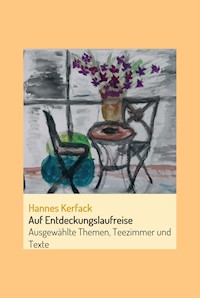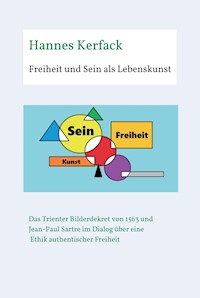
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Theologisch-philosophische Studienschriften
- Sprache: Deutsch
Dieser Band ist eine Zusammenfassung meiner beiden akademischen Arbeiten, der Magister- und Master-These, zu denen ich aufgrund der Gutachten weiter über eine Ethik authentischer Freiheit nachgedacht habe und aus den Anmerkungen "fehlerpädagogisch" gelernt und neue Zusammenhänge gefunden habe. Insgesamt geht es um die Behandlung mehrerer Fragestellungen, die in eine Hauptfragestellung münden: Wie können die exemplarischen, theoretischen und praktischen Entwürfe in der Theorie des spielerischen Verhältnisses von unsichtbarer und sichtbarer Freiheit, Sein, Subjekt und Objekt in Vergangenheit und Gegenwart verortet werden, und wie entsteht daraus eine spezifische, individuelle und kontextualisierte Ethik authentischer Freiheit? Welten, Universen, individuelle Vorstellungen - Alles kann faktisch zum Gesamt-Seins-System werden und sich alles wechselseitig bedingen, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, woraus auch mögliche, ethische Handlungsanweisungen entstehen: Was soll ich in diesem Seins-System jeweils tun? Wie wirkt sich das auch auf meine eigene Freiheit aus, was im historischen Kontext unterschiedlich verstanden wurde? Wie und warum kann ich Freiheit nutzen? Wo liegen die Grenzen meiner Freiheit in Hinblick auf Andere oder die Gesellschaft, die die Freiheit (auch durch Beschränkungen) mit garantiert? Wie bildet sich das vielleicht in einem lebenskünstlerischen Lebenswerk ab? Viele Fragen, viele Möglichkeiten, die einer Lehre vom Sein und der Freiheit in den Werken von Jean-Paul Sartre unterliegen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Freiheit und Sein als Lebenskunst.
Das Trienter Bilderdekret von 1563 und Jean-Paul Sartre
im Dialog über eine Ethik authentischer Freiheit
Theologisch-philosophische Studienschriften I
Hannes Kerfack
© 2020 Hannes Kerfack
Autor: Hannes Kerfack und s. Literaturverzeichnis
Umschlaggestaltung: tredition
Bilder: Hannes Kerfack und s. Bildunterschriften
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN: 978-3-347-08549-7 (Paperback)
ISBN: 978-3-347-08550-3 (Hardcover)
ISBN: 978-3-347-08551-0 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Die Freiheit ermöglicht die Erfindung des
leidenschaftlichen Seins
durch die Lebenskunst, der aber Grenzen
aufgrund der Freiheit der Gesellschaft gesetzt sind.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Das Trienter Bilderdekret von 1563
Einleitung
1.1. Quellengeschichte und Voraussetzungen des Dekretes über die Bilder- und Heiligenverehrung auf dem Trienter Konzil 1563
1.1.1. Das zweite Konzil von Nizäa und der Bilderstreit im 8. Jahrhundert
1.1.2. Die Position des Westens und die Antwort auf Nizäa: Die Libri Carolini
1.2. Bildkonzepte und Bilderkritik in der Reformation
1.2.1. Andreas Karlstadt und das Werk „Von der Abtuhung der Bilder“
1.2.2. Luthers Antwort in den Invokavit-Predigten
1.2.3. Calvins Position zu den Bildern und die Bilderstürme in Frankreich Anfang der 1560er Jahre
1.2.4. Religionsgespräche in Poissy und St. Germain
1.3. Das Trienter Bilderdekret als Summe der Quellenkontexte und gegenreformatorische Antwort
1.3.1. Die Entstehung des Bilderdekretes
1.3.2. Die Interpretation des Bilderdekretes
1.4. Byzantinische und spätmittelalterliche Frömmigkeit im Kontext der Bilderdekrete- und entwürfe
1.4.1. Die Ikonenmalerei in der Ostkirche
1.4.2. Kriterien des Heiligenstandes und des Prototyps
1.4.3. Chaos- und Kosmosvorstellungen
1.4.4. Virtus und repräsentia
1.4.5. Didaktische Funktion und Sozialisation durch Bilder
1.4.6. Fegefeuer und Ablassbilder
1.4.7. Laszive Darstellungen und emotionale Funktion der Bilder
1.4.8. Marienverehrung am Beispiel der Wallfahrt zur schönen Maria von Regensburg
Zwischendialog
Freiheit und Sein bei Sartre
2.1. Theoretischer und (un-) sichtbarer Ursprung der Freiheit
2.1.1. Der Ursprung der Freiheit im Sein
2.1.2. Der Ursprung der Freiheit im Nichts
2.1.3. Der Ursprung der Freiheit im Subjekt
2.1.4. Der Ursprung der Freiheit im Objekt
2.2. Praktischer und (un-) sichtbarer Ursprung der Freiheit
2.2.1. Juristische Entwürfe
2.21.1. Ein Entwurf des An-Sich-Seins zur Entwicklung eines Für-Sich-Seins: Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
2.2.1.2. Das Böckenförde-Theorem
2.2.1.3. Möglichkeiten der Freiheit zur Ermöglichung von Freiheit. Positive und negative Freiheitsauffassung im Grundgesetz
2.2.1.4. Der Religionsunterricht in Deutschland als Möglichkeit der Freiheitsbildung zu einem Für-Sich-Sein
2.2.1.5. Die Religionsgemeinschaft als Körperschaft öffentlichen Rechts
2.2.2. Philosophische Entwürfe
2.2.2.1. Ein Für-Sich-Sein durch Vertrauensbeziehungen entwickeln
2.2.2.2. Unternehmens- und Konsumentenethik
2.2.2.3. Egalitarismus als Möglichkeit zur Entfaltung von Freiheit
2.2.3. Theologische Entwürfe
2.2.3.1. Die natürlichen Ressourcen zu Brot und Wein. Die Umwandlung der Ressourcen in Heiliges
2.2.3.2. Lebensweltliche Bedingungen und der religiöse Markt
2.2.3.3. Die Praxis der Eucharistie. Ablauf des Abendmahles als Konstitution des Heiligen und der Freiheit
2.2.3.4. Das Taufkatechumenat und der Konfirmandenunterricht
2.2.3.5. Das Abendmahl als Kommunikation des Evangeliums
2.2.3.6. Religiöse Voraussetzungen und Grenzen der Gleichheit und Freiheit
Zwischendialog
Ethik authentischer Freiheit
3.1. Vorgedanken
3.2. Was ist (die) Welt?
3.3. Was ist (der) Gott?
3.4. Was ist (die) Ethik?
3.5. Was ist (die) Freiheit?
3.6. Was ist (die) Authentizität?
3.7. Was ist (die) Lebenskunst?
Nachwort
Quellen- und Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Anhang
1. Zusammenfassende Skizze zum Verhältnis von Freiheit und Sein
2. Zusammenfassende Skizze zum Böckenförde-Theorem
3. Arbeitsblatt Grundgesetz und 10 Gebote
Vorwort
Es sind meine Magister- und Master-Arbeit im Verbund, wie in einem Dialog, sodass es zwischen den Zeilen immer Anmerkungen und Gedanken aus den jeweils anderen Arbeiten geben kann. Vielleicht wird das Buch auch erst dann verstanden, wenn es einmal vom Anfang bis zum Ende durchgelesen wurde und dann wieder und wieder von vorne, bis man eigene Gedanken für das Buch oder andere Bücher entwickelt hat. Sie bestehen auch aus Entwürfen, die während des Studiums schon vorbereitet wurden. Jeweilige Zwischendialoge sind sowohl Zusammenfassungen als auch Überleitungen. Dieses Buch enthält viele Fragestellungen, die in eine Hauptfragestellung münden können: Wie können die exemplarischen, theoretischen und praktischen Entwürfe in der Theorie des spielerischen Verhältnisses von unsichtbarer und sichtbarer Freiheit, Sein, Subjekt und Objekt in Vergangenheit und Gegenwart verortet werden und wie entsteht daraus eine spezifische, individuelle und kontextualisierte Ethik authentischer Freiheit?
Ich habe die Arbeiten auch aufgrund der Gutachten von den Betreuern und Korrektoren verändert und weitergedacht. Z.B. hat ein Professor, als Betreuer der Master-Arbeit, eine Veröffentlichung dieser Arbeit für sehr gut befunden und mich dazu ermutigt, weiter über die Entwicklung einer "Ethik authentischer Freiheit" nachzudenken, auch weil das in der Forschung sehr wahrscheinlich rezipiert wird. Das habe ich getan, im dritten Teil der Arbeit, nach den beiden anderen Abhandlungen. Die Arbeiten sind zwar auf den ersten Blick sehr unterschiedlich, stammen sie doch aus völlig unterschiedlichen Zeiten, wo mehr als 500 Jahre dazwischen liegen, aber trotzdem durch die subjektive Deutung einen Bogen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft spannen können. Während die erste Arbeit in die Entstehung des Trienter Bilderdekretes von 1563 als Antwort auf die Bilderfrage der Reformation und die praktisch-theologischen Kontexte in der Bilderfrömmigkeit dieser Zeit einführt und überhaupt darstellt, dass Kunstwerke sich mit der Zeit verändern können oder auch legal „gefälscht“ werden können, um bestimmte gesetzliche Bestimmungen, wie dieses Dekret einzuhalten, und Quellen im Wachstum begriffen sind, so ist der zweite Teil der Arbeit eine Einführung anhand praktischer Entwürfe in die Freiheitslehre von Jean-Paul Sartre, Freiheit und Sein, und verdeutlicht, wie aus einem „unsichtbaren“, ontologischen System sichtbare Freiheit, wie in einem Kunstwerk entstehen kann. Auch das der Buchumschlag weiß und mit vielen, möglichen Farben und Formen ausgestattet ist, zeigt, dass sich ein Kunstwerk, ein Lebenslauf z.B., erst mal entwickeln muss, sich aber durch die „Dreiecke“ auch verändern und „angriffen“ werden kann.
Es können auch Lücken des Nichts bleiben, offene, weiße Stellen und viele Farben und Möglichkeiten. Bücher können weitergeschrieben werden. Auch hier in diesem Fall ist eine Ethik authentischer Freiheit niemals komplett abschließbar, sondern bezieht sich auf das gesamte, eigene Leben, das der Welt, das des Gegenübers usw. und ist in diesem Sinne auch eine Entdeckungsreise, zwischen zwei möglichen Wegen, Polen, aus denen die Ethik authentischer Freiheit im Grunde besteht. Wort und Gegenwort. Spiegel und Gegenspiegel. Gemeinschaft oder Allein-Sein. Nicht jede ethische Entscheidung muss gut sein, sondern das sind immer relative Entscheidungen und es kann gefährlich werden, wenn sie absolute Entscheidungen werden, da das „Gute“ nicht immer in Übereinstimmung mit der Entscheidung des Anderen sein muss. Wichtig sind dann auch Verhandlung und Akzeptanz, Empathie, aber auch ein Ausweichen, um sich selbst zu schützen oder seine eigene Freiheit oder die der Gesellschaft. Die Authentizität (die Übereinstimmung mit etwas, mit sich selbst, um zu leben, wie ein Bild) bewegt sich zwischen diesen Polen und wird dann wahrscheinlich für den Einzelnen mal oder weniger ausgeprägt sein oder in der Mitte liegen. Aber sie sollen auch das Bewusstsein für Grenzen schärfen, in Hinblick auf andere Menschen, auf die Gesellschaft, aber auch die eigenen Möglichkeiten möglicherweise erkennen lassen. Zwingen kann ich dazu nicht und das soll auch nicht sein. Es sind eher mehr Denkanstöße im Sinne eines „Sollens“ oder Imperativs. Aber wenn man sich nicht konkret ausdrückt oder etwas aus seiner Sicht, aus seiner „Blase“, unbedingt durchsetzen möchte, ohne Rücksicht und Empathie auf den Anderen, ist das auch nicht der richtige Weg. Daher ist eine eigene Wahl, auch bei Sartre, immer entscheidend, aber Denkanstöße und Angebote der Lebensentfaltung sind immer notwendig. Diese können ja auch von sich selbst aus weitergedacht werden, denn ich kann hier in erster Linie auch nur Angebote von meiner Seite machen, keine „Ratschläge“, aus meiner Perspektive, obwohl ich durch die zitierte Literatur auch andere Gedanken aufgenommen habe und mich zu ihnen verhalten habe. Das kann hier im weiteren Sinne auch geschehen. Aber ganz ohne eine Anleitung, darin steckt auch ein Risiko des Vakuums, das Freiheit auch missbraucht werden kann, gegen die andere Person, die eine andere Auffassung hat. Ethik und Freiheit sind daher auch ambivalente Dinge (Ethik und Anti-Ethik). Daher gibt es auch immer mehrere Wege und Alternativen beziehungsweise sollte es geben. Aber wenn eine persönliche Entscheidung so und so für sich getroffen wurde, ein Prinzip, dann ist das auch in Ordnung. Diplomatie und Demokratie sorgen dann für einen Austausch, aber das geht nur so lange gut, wie sich das jeweilige Gegenüber in seiner Authentizität, die er für sich schon gefunden hat, nicht angegriffen fühlt oder seine Meinung abändert. Das wäre dann zu respektieren.
Die Grenze der Freiheit ist die Freiheit selbst und sie setzt sich selbst als Grenze durch die Freiheit des Anderen, der Gesellschaft, die diese mit garantiert oder die Gesetze. Die Farben erinnern mich an die Zeitalter aus meiner fiktiven Welt der Griechen1, sodass auch die Fiktion (wie Filme, Bücher usw.) Material für die eigene Realität und Gestaltung haben können, das aber auch der eigenen Plausibilität und hermeneutischen Freiheit unterliegt, die aber in unterschiedlichen Epochen verschiedenartig ausgelegt wurde. Entscheidend sind auch Selbstverantwortung und Verantwortung für die Gesellschaft, da diese nicht losgelöst von der eigenen Freiheit stehen, da sie diese auch erst ermöglichen oder die Familie, die Gesetze und anderes. Freiheit braucht erst mal mögliche Angebote, zu denen man sich verhalten muss, auch verantwortungsvoll durch die kritische Betrachtung der eigenen Angebote, die erst durch jemand „Anderes“ geleistet werden können, durch die Lektüre von Büchern oder durch Lehrer, die besonders an der Universität die kritische Betrachtung von Sachverhalten einüben. Freiheit bewegt sich zwischen Gesetz und Ideal beziehungsweise Leidenschaft. Die Ethik authentischer Freiheit ist ein praktisches Ergebnis, ein Abgleich zwischen Freiheit und Gesetz, in welchen Spannungsfeldern wir uns im Leben befinden, diese Ethik aber immer ein Streben nach dem „Guten“ ist, der Leidenschaft, der Authentizität, der Hinwendung zu den eigenen Gefühlen, aber in Maßen und mithilfe einer kritischen Grundhaltung. Sie müssen nicht unterdrückt werden, z.B. aufgrund einer unbegründeten Angst. Vielmehr geht es darum, eine Art „gesunde Angst“ zu entwickeln.
Das Buch kann noch weiter geschrieben werden, ähnlich wie auf einer Entdeckungsreise, wenn die Ethik aufgeschlagen wird und in ihr weiter etwas notiert wird. Ich auch, indem ich z.B. neue Gedanken und Verbindungen (nicht alle Zusammenhänge sind aufzugreifen) in einer weiteren Auflage aufgenommen werden. Das Prinzip funktioniert ähnlich wie die so genannten „weißen Seiten der Offenheit“. Ich habe am Ende der jeweiligen Kapitel verschiedene Begriffs- und Wortpaare ergänzt, die für sich, im Spannungsfeld der Ethik authentischer Freiheit weitergeschrieben werden können, auch ich selbst. Denn Ethik ist eine Sache des Lebens, des gesamten, eigenen Lebens.
Sie ist nie abgeschlossen. Leben kann wie ein Kunstwerk sein, das von verschiedenen Quellen und Kontexten abhängig ist und dadurch im Entstehen begriffen ist, wie wenn man seine Erinnerungen dann darüber schreibt und sich Freiheit und Leben sichtbar machen, in einem Gegenstand, wie einem Buch, das zunächst „unsichtbar“ ist, leer ist, aber voll werden kann. In diesem Sinne spiegelt sich das auch in diesem Band wieder, indem ich z.B. die Anmerkungen von den Gutachten ernst genommen habe. Die Arbeiten wurden unter Zeitdruck erstellt und im Nachhinein habe ich Fehler und Zusammenhänge ausgebessert und auf die eher mäßigen Bewertungen dieser Arbeiten reagiert, die aber nach „oben“ offen waren, wenn ich noch etwas an ihnen weiterarbeite. Ein Punkt war die fehlende Arbeit mit den Quellen, also Editionen usw., aber an diese Stelle treten, durch den dialogischen Charakter der Arbeit, auch weitere Quellen, z.B. von Jean-Paul Sartre oder empirische Daten usw., um diese Lücke der Quellenarbeit für alle Arbeiten zu schließen und auch die alten Zusammenhänge durch neue Zusammenhänge harmonischer und besser zu gestalten. Aber darin liegt natürlich auch ein Risiko, dass der Blick auf das Wesentliche verstellt wird, dass ein Thema einfach aus seinem historischen Kontext gerissen wird. Aber andererseits gibt es menschliche Grundkonstanten im Denken und Wissenschaft lebt ja auch von neuen Vergleichen von Sachverhalten, um einen Mehrwert zu gewinnen, aber das sollte auch nicht unkritisch gesehen werden. Das habe ich z.B. bei den unterschiedlichen Auffassungen von „Freiheit“ innerhalb der historischen Zeitalter getan, da wir heute eher von einem Freiheitsbegriff, wie auch Sartre, aus der Aufklärung sprechen. Dieser kann nicht beim Trienter Konzil 1563 so vorausgesetzt werden, geschweige denn in der Antike. Aber es gibt Vorformen, z.B. die Suche nach Kompromissen auf den Konzilen als Teil der Demokratie, um einen Konsens in der Krise der Abgrenzung zur Reformation z.B. zu finden. Daher ist dieser Vergleich dieser unterschiedlichen Sachverhalte nicht unbedingt ein „Fehler“. Es kann ja auch einfach eine These bleiben, über die man sprechen oder sie auch abändern kann?
Das ist auch Teil meiner so genannten Fehlerpädagogik, die grundsätzlich von der Machbarkeit von Fehlern ausgeht, da diese von unterschiedlichen Kontexten, wie auch Quellen und anderen Schriftstücke beeinflusst werden. Dann ist aber entscheidend, dass Fehler ausgebessert werden, um aus ihnen zu lernen.
Die Arbeit ist auch Teil der letzten Reihe, in der ich Werke von mir aufnehmen werde. Neben "Fiktive Narrationen" und "Auf Entdeckungsreise", kommt jetzt als letztes die Reihe "Theologisch-philosophische Studienschriften" dazu, um mich sowohl zu spezialisieren als auch für eine weite Thematik zu öffnen. Mit den ersten drei Werken sind damit die Grundlagen insgesamt geschaffen, denke ich. Ich bedanke mich an dieser Stelle erneut für die Veröffentlichung dieses Werkes beim Tredition-Verlag und die kritisch-konstruktiven Anmerkungen, sowie für die Gutachter und ihre Betreuung der Arbeiten an der Universität Rostock und der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Nachträglich danke ich auch meiner Mutter für die künstlerische Mit-Gestaltung der Umschläge der Bücher.
Hannes Kerfack, Sassnitz im Juli 2020
1 Vgl. Kerfack, Hannes (2020): Quo vadis Graecus? Das Ende der Republik Griechenland von 2035 bis 2037 (Fiktive Narrationen, 1), Tredition: Hamburg.
Das Trienter Bilderdekret von 1563
Einleitung
Eine Frage zur Annäherung an diese Arbeit war, ob man einen „toten“ Gegenstand lieben und vergöttlichen kann? Diese Arbeit entstand aus einem Forschungsprojekt von 2016 und 2017, das nach diesen Formen der Liebe und Gefühle fragt und grundsätzlich erkannte, dass der Mensch in der Lage ist, alles lieben zu können, sodass man von einer Skala der Zuneigung sprechen kann und das sich diese zwischen Freiheit und Gesetz beziehungsweise Theologie und Anti-Theologie bewegt. Denn nicht jede Form der Liebe zu Gegenständen ist auch gott- und christusgemäß, indem Menschen innerhalb der Volksfrömmigkeit auch ihre eigenen Heiligen erstellen und anbeten konnten, und das jenseits der offiziellen Heiligenkriterien liegen konnte.2
Private, heilige Objekte (Autos, Talismane usw.) vergegenwärtigen nicht unbedingt den christlichen Gott und Jesus Christus oder bilden sie ab. Darin liegt ein Spannungsfeld. Was ist menschliches Werk und was ist göttliches Werk und wie viel Freiheit hat der Mensch, Göttliches für sich selbst zu erschaffen? Wird wirklich der christliche Gott oder ein privater, profaner Gott abgebildet? Bezieht sich das Bild auf ein Urbild, das durch das Bild als Abbild verehrt wird? Oder ist einzig allein das Bild selbst, die Materie, Ort und Gegenstand der Verehrung? Diese Fragen beschäftigen auch die Theologen in der Frage um die Bilder in der Kirchengeschichte. Was sichert eigentlich das Gedächtnis an Gott und wie können symbolische Formen an Gott erinnern?3 Das sind mehr einführende Fragen, die das eigentliche Spannungsfeld zwischen Theologie und Anti-Theologie oder Ethik und Anti-Ethik aufbauen, hinsichtlich Bildern und Objekten, wobei es in diesem Buch mehrere Fragestellungen und Thesen aufgrund der Verbindung gibt und sie durch „einfache“ Wissenschaft aufeinander bezogen werden.
Dieser Teil der Arbeit befasst sich, mithilfe eines praktisch-theologischen „Über-Systems“, mit der Bilderund Heiligenverehrung in der spätmittelalterlichen Volksfrömmigkeit, die von einem Streben nach Heil und göttlicher Ordnung im Chaos geprägt ist. Bilder und Heilige dienen der Vermittlung des göttlichen Heils und darüber hinaus sind es Trostspender angesichts von Endzeitängsten oder Fürsprecher für die verstorbenen Verwandten im Fegefeuer.4 In der Ostkirche werden die Ikonen auch als „Fenster zum Jenseits“5 bezeichnet, sodass es Analogien zwischen den Bildkonzepten in Ost und West gibt.
Kaum erforscht sind die Gefühlswelt und die innere Anziehung, die beim Betrachten von heiligen Bildern aktiviert werden, wie z.B. bei der Erfahrung des Schönen und Ästhetischen.6 Goldene Bildränder und mit Edelsteinen besetzte Bildtafeln sind Zeichen der präsenten Heiligkeit Gottes und stellvertretend des abgebildeten Heiligen. Gleichzeitig sind es Werbeelemente, um beispielsweise Pilger und Wallfahrer anzulocken. Bilderdarstellungen können gleichzeitig auch Reliquien sein und die Unterscheidung ist nicht immer klar, höchstens in der konkreten Form beziehungsweise Fläche der Darstellungen. Denn sie beinhalten beide die göttliche Kraft (virtus) des Heiligen, an den sie erinnern und ihn vergegenwärtigen. Dabei stellt sich zudem die Frage, wie man ein Heiliger und Prototyp auf einem abgebildeten Bild wird. Ist das Kriterium des Ausnahmemenschen entscheidend, sodass jeder aufgrund einer besonderen Leistung zum Heiligen wird, oder der Bezug zur Nachfolge und Nachahmung des Lebens und der Passion Christi?
Mit der Reformation endet in dieser Konfession die Vorstellung, dass die Bilder- und Heiligendarstellungen eine Gnade erwirkende Funktion haben. Sie sind ein Element der Werkgerechtigkeit, da die Verehrung von Bildern, Fürbitte für die Verstorbenen ermöglicht und durch die Verehrung Gnade für sich selbst erlangt werden kann, obwohl der Mensch die Gnade passiv empfängt.
Im Mittelpunkt stehen das Hören des Wortes durch die Predigt und der Empfang der Sakramente, die zum Glauben an Gott und zur Glaubensgerechtigkeit führen und gegen eine bloße Werkgerechtigkeit gerichtet ist, die eine aktive Verehrung zur Erlangung von Gnade und Heil voraussetzt (z.B. fußfällige Verehrung), wobei auch schon im Rahmen der Bilderverehrung Betonungen der Gnade aus dem Abendmahl auftauchen und es Parallelen der Kritik an der Bilderverehrung gibt.
Karlstadt und Calvin beziehen sich auf das alttestamentliche Bilderverbot, sodass eine Kultbild-Verehrung von Bildern Götzendienst ist, obwohl es auch andere Bilder im Alten Testament gibt, wie die Cherubim über dem Thron Gottes im Tempel Jerusalems und die Bilderkritik relativiert wird, da die Bilder auch für kultische Zusammenhänge verwendet werden, sie z.B. eine pädagogische Funktion haben und zum Glauben führen können. Andererseits betont Luther, dass die Bilder weder nützlich noch nicht nützlich sind und sie eine religionspädagogische Funktion haben. Sie vergegenwärtigen und erinnern an die Heilsgeschichte (auch schon während der Zeit des Alten Testaments) und unterstützen die Predigt anschaulich während des Gottesdienstes, durch die allgegenwärtigen Bilder im Gottesdienstraum.7 Trotzdem sollen die Obrigkeit und der Bischof über den angemessenen Gebrauch der Bilder unterrichten. Sie sind es auch, die in der Frage entscheiden, ob Bilder auf- oder abgehängt werden.
Auf die durch die Reformation Calvins ausgelösten Bilderstürme, besonders in Frankreich während des ersten Hugenottenkrieges und den Hilferuf des französischen Königtums, reagiert das Trienter Konzil 1563 in letzter Instanz. In einem Dekret über die Heiligen- und Bilderverehrung wird den Bildern ihre Gnade stiftende Funktion abgesprochen, was aber unter anderem im Widerspruch zur spätmittelalterlichen Vorstellung und Volksfrömmigkeit steht und ein Spannungsfeld zwischen Ideal und Wirklichkeit aufzeigt. Obwohl das Gesetz festgelegt wird, bedeutet das nicht unbedingt, dass es auch in der Praxis und im Alltag komplett umgesetzt wird. Das Trienter Konzil grenzt sich nicht allein von der Reformation ab. Sie nähert sich dieser auch an und nimmt auch eine kritische Instanz ein. Gleichzeitig intendiert es einen Religionsfrieden zwischen Katholiken und Calvinisten in Frankreich. Diese historischen Vorgänge und Kontexte haben sich in diesem Dekret von Trient 1563 niedergeschlagen und zeigen, dass Quellen immer auch „im Wachstum“ sind und sich individuelle Freiheit immer zu historischen Kontexten und Gesetzen verhält, die die eigene Leidenschaft (oder auch nicht) einschränken können. Denn es wird auch vermutet, dass das Trienter Bilderdekret zu einer Verstärkung der Volks- und Bilderfrömmigkeit geführt haben soll. Letztlich unterliegt dieses aber auch der eigenen Verantwortung gegenüber dem Seins-System Kirche und der Gesellschaft, sodass sich das Individuum in seiner Authentizität auch hier zwischen zwei und mehreren Polen bewegt, wie es sein Leben lebt oder überhaupt leben kann. Denn die Bilderverehrung hat eine Heilsbedeutung, eine Lebensermöglichung, sein Nichts, die Angst vor dem Fegefeuer, sein mögliches Chaos zu überwinden, hin zur Ordnung, zur Freiheit selbst, zur Leidenschaft, was im Spätmittelalter ein entscheidendes, ontologisches Über-System ist. Gleichzeitig soll Rücksicht und Empathie auf die jeweiligen, historischen Kontexte, wie z.B. die Bilderstürme genommen werden und sich mit der Realität, die zu diesen Tumulten geführt hat, auch kritisch auseinandergesetzt werden, um das Leben, die Freiheit, die individuelle Bedeutung der Bilder für den Einzelnen zu schützen beziehungsweise die Grundstandpunkte der Katholischen Kirche, die Wirkung von Gnade durch die Werkgerechtigkeit und nicht allein die Glaubensgerechtigkeit. Aber es gibt dennoch eine Art Kompromissbereitschaft und Annäherung an die Reformation, in Form des Trienter Konzils, um eine Eskalation zu vermeiden. In einem ersten Schritt geht es darum, die Geschichte und Entstehung des Trienter Bilderdekretes anhand der historisch-kritischen Methode, der Quellenanalyse und kritischen Reflexion der Sekundärliteratur, nachzuvollziehen. Das Dekret nimmt unter anderem Quellen aus dem zweiten nizänischen Konzil von 787 und den darauf folgenden Libri Carolini, die Antwort auf die Bilderfrage im Osten, auf. Die Bilderfrage ist nach dem Tridentinum nicht abgeschlossen und die letztgültige Entscheidung liegt in den Händen der Bischöfe und des Papstes. Das Dekret gibt eher offene Anweisungen über den rechten Gebrauch der Bilder, die auf den spezifischen Fall anzuwenden sind, z.B. im Falle der verbotenen leidenschaftlichen, lasziven Bilderdarstellungen, deren naturalistische Darstellungen ein Erkennungszeichen der beginnenden Renaissance-Malerei sind. Eine eigene Frage innerhalb dieser Arbeit ist daher: Wie wirken Bilder ästhetisch und emotional auf den Betrachter und warum? Hat das Tridentinum Auswirkungen auf die bildende Kunst gehabt? Als Hilfsmittel dienen kunstwissenschaftliche Methoden, die exemplarische Bilder nach ihrer Form, Farbe und Komposition untersuchen.
7 Ganzer, Volksfrömmigkeit, 24.
2 S. auch den ersten Abschnitt im Buch: Kerfack, Hannes (2020): Auf Entdeckungslaufreise. Ausgewählte Themen, Teezimmer und Texte (Auf Entdeckungsreise, 1), tredition: Hamburg und das Buch als Ganzes für die Einführung in das „Laufen mit Mehrwert“, um auch diese Ethik hier für sich weiterzuschreiben.
3 Lentes, Adiaphora, 213.
4 Lentes, Auge, 76.
5 Makrides, Ikonen, 156.
6 Lentes, Auge, 80.
1.1. Quellengeschichte und Voraussetzungen des Dekretes über die Bilder- und Heiligenverehrung auf dem Trienter Konzil 1563
1.1.1. Das zweite Konzil von Nizäa 787 und der Bilderstreit im 8. Jahrhundert
Da die jeweiligen Bildentwürfe je nach ihrem historischen Kontext zu bewerten sind8 und das Konzil von Trient im Bilderverehrungsdekret auf das Bilderdekret vom zweiten Konzil von Nizäa Bezug nimmt, gehe ich im folgenden Abschnitt auf die Bilderfrage in der Ostkirche ein. Der Bilderstreit kann nicht in seiner Gesamtheit behandelt werden. Daher beschränke ich mich auf die Konzile und Autoren, die unmittelbar Einfluss auf das zweite Nizänum nehmen. Zwischen der Bilderverehrung im Osten und Westen gibt es zudem Gemeinsamkeiten, die analysiert werden sollen.
Die Ursache des Bilderstreites im 8. Jahrhundert ist ein Vulkanausbruch, der als Ausdruck des Zornes Gottes gegenüber der Bilderverehrung Christi gedeutet wird. Freiheit und Kontexte oder Seins-Systeme sind daher auch von Schicksalen und Kontingenzen zwischen Gott und Natur abhängig, wie sie sich dadurch verändern und darauf je nach dem Zeitgeist (Tun-Ergehen-Zusammenhang, Sünde und Gnade) deutend und auch kritisch reagiert wird, um einen Konsens zu finden, der aber auch wieder zur Häresie führen kann, sodass Orthodoxie und Häresie im weitesten Sinn Spannungsfelder der Ethik authentischer Freiheit sind, auch wenn darüber eine höhere Instanz, das Konzil, und weniger das Individuum darüber entscheidet. Der byzantinische Kaiser Leo III. lässt daraufhin das eiserne Bild Christi am Tor seines Palastes in Konstantinopel zerstören.9 Auf der einen Seite wird argumentiert, dass die Bilder dem Bilderverbot im Dekalog widersprechen.10 Andererseits ist dieses Gebot im Kontext jüdischer Religion entstanden. Daher wird argumentiert, dass das Christus-Bild und kein Gottesbild direkt verehrt werden. Das tritt in Spannung mit dem dogmatischen Beschluss des Konzils von Chalkedon im Jahr 451. Da Jesus Christus wahrhaft Gott und wahrhaft Mensch ist, ist er nach seiner Göttlichkeit mit dem Vater wesenseins, in zwei Naturen unvermischt, ungetrennt und unteilbar. So ist er, wie Gott, nicht abbildbar.11 Das bilderfeindliche Konzil von Hiereia im Jahr 754 bestätigt diesen Beschluss und lehnt die Christusbilder ab. Wenn Christus gemalt wird, kann er nur in seiner menschlichen Natur gemalt werden. Dadurch trennt sich Christus von seiner göttlichen Natur. Zweitens ist Gott zugleich Heiliger Geist und somit nicht darstellbar. Die Verehrung gilt allein dem Geist und nicht dem Bild.12
Ein bilderfreundliches, zweites Konzil in Nizäa 787 rehabilitiert die Christusbilder und erklärt das Konzil von Hieraia für häretisch. Dazu ist der Beschluss und die Autorität eines wirklich ökumenischen Konzils notwendig. Andererseits verhindern kaiserliche Gardetruppen zunächst das Konzil in Konstantinopel als ursprünglichen Tagungsort, das dann nach Nizäa in der Zeit vom 28.9.13.10.787 verlegt wird.13
Dass das Konzil ökumenisch ist, bezeugt auch die Teilnehmerstruktur (350 Bischöfe aus West und Ost und zwei päpstliche Vertreter mit dem Namen „Petrus“ als direkte Abgesandte des Papstes, um das Konzil zu legitimieren). Durch den göttlichen Eifer und Befehl unseres Kaisers Konstantin und der gläubigen Kaiserin Irene, soll die göttlich inspirierte Überlieferung der Katholischen Kirche durch gemeinsamen Beschluss Geltung erlangen.14
Das Konzil wendet sich gegen die Häretiker des Konzils von Hieraia, die sich vom „rechten Denken“ abwenden und sich der Überlieferung der Katholischen Kirche entgegenstellen.15 Diese machen zwischen heiligen und profanen Bildern keinen Unterschied, da sie das Bild des Herrn und seiner Heiligen mit gleichen Namen bezeichneten, wie die Statuen der satanischen Götzen.16 Das Konzil folgt dem nizäno-konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis und dem ersten Konzils von Nizäa.17 Dieses bezeugt die Wesenseinheit von Jesus Christus und Vater und gleichzeitig die Zeugung durch Maria, nicht Schaffung, durch den Vater auf Grundlage von Joh 4,3.18 Jesus steht der Göttlichkeit des Vaters in Nichts nach. Jesus ist vollkommener Mensch und vollkommener Gott.19 Christus ist keine dritte Person, die losgelöst vom Heiligen Geist und Gott steht, resultiert Moeller.20
Die Ikonenmalerei stimmt mit der Botschaft des Evangeliums überein und dient der Beglaubigung des wirklichen, göttlichen Mensch-Geworden-Seins Jesu Christi. Sie unterstreicht die Beschlüsse des Konzils von Konstantinopel und Chalkedon und die Unterscheidung von den zwei Naturen Jesu Christi.21 Die Erinnerung an die Person Christi führen zur eigenen, inneren Erhebung und ermöglichen einen persönlichen Bezug zum Urbild, als Vorbild für sich selbst und seinen eigenen Glauben, sodass hier auch eine Art Angebot dargestellt wird, zu dem man sich verhalten oder nicht verhalten kann, um sein Leben und seine „Freiheit“ zu gestalten, wobei aber Alternativen durch die Häresie-Erklärungen eher ausgeschlossen werden.22 Authentizität liegt vor allem in der Anerkennung der jeweils höher gestellten Konzile und Autoritäten, da eine Häresie-Erklärung möglicherweise auch zur Ausgrenzung und Verfolgung führen kann. Freiheit versteht sich hier relativ und dieser Begriff muss jeweils im zeitlichen Kontext verstanden werden, wie sie die individuellen Seins-Systeme verändert. Von einem Freiheitsbegriff der Neuzeit oder Aufklärung kann noch keine Rede sein! „Wer das Bild verehrt, verehrt in ihm die Person des Dargestellten“23 und nicht das Bild als Materie selbst. Daher ist die Ikone etwas wesenhaft anderes als der Dargestellte selbst, die aber eins mit dem Namen des Dargestellten ist.24 Dadurch grenzen sich die Bilder vom Verdacht der Idolatrie ab. Die Anbetung gilt allein der göttlichen Natur im Bild, das das Urbild medial darstellt.25
An dieser Stelle rezipiert das Konzil das Bildkonzept von Johannes von Damaskus und seine Schrift: Die Darlegung des christlichen Glaubens. Das Urbild ist eine Nachbildung von dem, was abgebildet ist. Aber allein dem abgebildeten Urbild kommt die Verehrung zu und nicht der materiellen Nachbildung in Form des vom Künstler geschaffenen Bildes.26 Anders als der unsichtbare und unbegreifliche und gestaltlose Gott27, ist Christus dagegen eine menschliche Inkarnation Gottes und kann daher aufgrund seiner menschlichen Natur abgebildet werden. Das Bild übernimmt die Funktion der Erinnerung an diese einmalige Inkarnation Christi.28. Eine Gleichstellung der Bilder mit dem sakramentalen Abendmahl intendiert das Konzil von Nicäa nicht und wird in der Quelle nicht erwähnt. Es geht allein um die Gleichstellung mit Kreuz und Evangelium.29 Dazu gehören Verehrungsriten wie Weihrauch und Lichtbestrahlung.30
Es sind alle Bilder von jeder Art gemeint (Maria und Jesus). Auf heiligen Geräten, Wänden, Tafeln usw. Überall sollen Bilder von Gläubigen betrachtet werden können, innerhalb und außerhalb der Kirche, und dadurch ihre Allgegenwärtigkeit aufzeigen.31 Eine Abgrenzung im Sinne einer Wahl durch die Freiheit ist daher schwer vorstellbar und nur relativ zu betrachten. Im Alltag sind Christus-Prägungen auf Münzen, Siegel- oder Herrschaftszeichen allgegenwärtig. Sie sind Zeichen der Kaiserherrschaft und der Stellvertretung Christi durch den Kaiser, sodass das Konzil wahrscheinlich auch das Ziel der Legitimierung der theokratischen Herrschaft hat und eine Rechtfertigung des Bildes notwendig macht.32 Das Bild bekommt daher auch eine legitimierende Funktion des Über-Seins-Systems, so lange es nicht missbraucht wird und immer noch Gott oder der Kaiser über dieses verehrt werden. Es ist quasi ein Kompromiss zwischen Bilderverbot und Bildererlaubnis, zur Stärkung des Glaubens und der Loyalität gegenüber den staatlichen Organen.
Wer die Beschlüsse des Konzils ablehnt und die Evangelien in gemalter Form oder die Darstellung der menschlichen Natur Jesu Christi nicht zulässt, dem droht das Anathem und damit der Kirchenbann.33 Das Konzil grenzt sich vom Konzil von Hieraia ab, das die Christusbilder ablehnt. Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott und die Bilder dienen der Beglaubigung der Inkarnation und der Verkündigung des Evangeliums. Einzig allein die Eucharistie kann Christus vergegenwärtigen und abbilden und über die Konsekration die Materie durch Berührung mit den Händen mit Geist heiligen, ist die Gegenposition von Hieraia.34 Bilder sind dagegen Menschenwerk, die keine göttliche Kraft enthalten. Dieses wird nun durch Nizäa relativiert und abgelehnt, sodass es auch nur bedingt zu einer „Demokratie“, einem Austausch zwischen beiden Systemen und Vorstellungen kommt. Es gibt nur den „einen“ Weg. Der andere Weg muss daher häretisch sein, um die Einheit der Kirche als Ganzes zu schützen, gegen eine Pluralität, sodass Freiheit begrenzt wird, um diese „Freiheit“ zu schützen, auch wenn es eher eine relative ist, in Abgleich mit den Autoritäten und Konzilen oder der Allgegenwart der Bilderfrömmigkeit. Von einem Freiheitsbegriff im Sinne der Neuzeit kann so nicht die Rede sein, sodass eine Ethik authentischer Freiheit von den zeitlichen Kontexten abhängig ist oder wahrscheinlich von dem Begriff der „Freiheit“ überhaupt keine Rede sein kann beziehungsweise darf. Sie kann auch zur wechselseitigen Abgrenzung führen, im Sinne von Kirchenspaltungen oder Kirchenbann (aufgrund der hermeneutischen, theologischen und „freien“ Entscheidungen von anderen Glaubensrichtungen), aber auch Annäherungen aufgrund von konfessionellen Vermischungen und um Streit und Kriege zu vermeiden, da eine theokratische Herrschaftsform natürlich auch Einfluss auf politische und weltliche Entscheidungen hat, z.B. die Legitimierung des Kaisers durch Münzbilder und seine Darstellungen als von Gott legitimierter Kaiser. Die Konzile sichern damit auch die politische Stabilität des Byzantinischen Reiches, auch weil die Kirche von der Gunst des Kaisers wahrscheinlich abhängig ist. Das haben in früherer Zeit die Christenverfolgungen gezeigt.
Für die Frage nach der Bilderverehrung auf dem Trienter Konzil ist entscheidend, dass die Bilderverehrung aufgrund des Beschlusses des Konzils von Nizäas erlaubt ist. Auch die Androhung des Anathems, wenn jemand die Anbetung Christi ablehnt, korreliert mit dem Anathem im Bilderdekret Trients. Die Wirkung von Gnade durch die Bilder, die im zweiten Konzil von Nizäa noch vorausgesetzt ist, wird im Trienter Konzil aber ausgeschlossen. Die westliche Position, die in den Libri Carolini verdeutlicht wird, neigt zur ablehnenden Position des Konzils von Hieraia.
1.1.2. Die Position des Westens und die Antwort auf Nizäa: Die Libri Carolini
Als Verfasser gilt der fränkische Theologe Theodulf. Die Stellungnahme lehnt die von Nizäa legitimierten Gnadenbilder ab und verwirft die Entscheidung des Konzils insgesamt.35 Die Repräsentation der Heiligen in den Bildern dient allein didaktischen Zwecken. Einzig allein die Eucharistie kann die Gnade Christi vermitteln und vergegenwärtigen, nicht die Gnadenbilder.36
Die Bilder können keine Wunder bewirken und Heilungen vollbringen, im Gegensatz zu den Reliquien, die in unmittelbaren Kontakt und Berührung mit den Heiligen gekommen sind, um ihren virtus und ihre Gnade zu empfangen und aufzunehmen. In der Bibel sind keine Berichte über wundertätige, materielle Bilder zu finden.37 Wobei bei Luther die Cherubim oder Seraphim über dem Thron Gottes im Tempel Jerusalems erwähnt werden, sodass sich die Aussage relativiert und kritisch zu sehen ist.38 Trotzdem sind die Bilder als Ausschmückung für die Kirchen und zur Erinnerung an die Taten der Heiligen und Präsentation der biblischen Heilsgeschichte geeignet.39 Aber eine Anbetung des Bildes ist ausgeschlossen und verboten. Die Verehrung kommt allein Gott und Christus zu.40 Theodulf ist somit kein Bilderfeind. Er stuft sie aber als „vorsichtig zu betrachten“ ein und grenzt sich von der Idolatrie ab.41 Ein Idol, das anzubeten ist, ist ausgeschlossen. Denn dieses verweist nur auf sich selbst. Das Bild dagegen verweist möglicherweise auf ein Urbild, das in dem Bild abgebildet ist.
Der Begriff der Anbetung ist eine fehlerhaft zusammengesetzte Übersetzung aus den Worten latreia und proskynesis. Das nizänische Konzil unterscheidet richtig zwischen der Verehrung, die allein Gott vorbehalten ist, und der kniefälligen Verehrung, die den Bildern zukommt.42 Die Libri Carolini vermischen diese Bedeutung und setzen sie mit adoratio gleich.43 Wahrscheinlich ist aber, dass diese Nicht-Unterscheidung aus einem unterschiedlichen Weltverständnis resultiert. Zwischen einer Kirche, in der Ikonen selbstverständlich sind, und einer Kirche, in der sie es nicht sind, bestehen untrennbare Welten.44
Die Bilder sind einzig allein materielle Kunstwerke eines Künstlers und unterliegen seinem Schaffen, seinen Fähigkeiten und dem Verfall. Im Gegensatz zu den Menschen, als Werk Gottes, sind die Bilder Werke des Künstlers, anders als das Sakrament des Abendmahles, das ein Werk Gottes ist.45 Bilder können hässlich und schön sein.46 Wenn das Bild schön und gelungen ist, kann die Materie und der Künstler gelobt und verehrt werden, aber nicht das abgebildete Bild eines Heiligen.47 Das gute Werk vollzieht sich allein durch die Taten des Priesters und des Sakraments, nicht aber durch das Bild.48 Außerdem benötigen die Bilder eine Unterschrift, damit der abgebildete Heilige nicht mit einem anderen Heiligen verwechselt wird.49
Die Libri Carolini