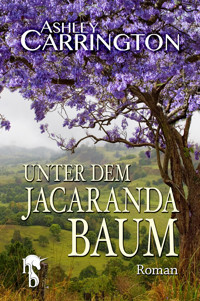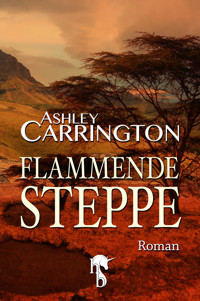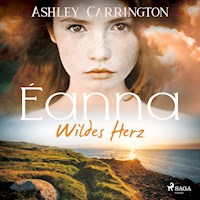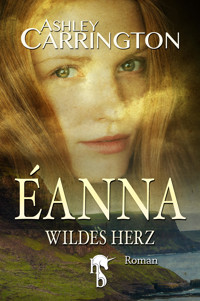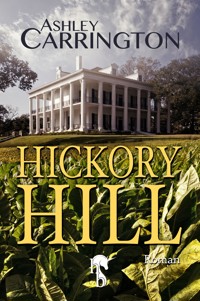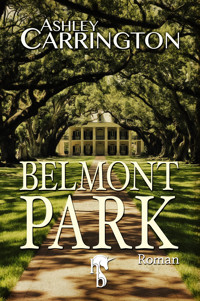6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Südafrika bricht das Diamantenfieber aus. Als Daniel Lundquist nach zwei Jahren in seine Heimat Hope Town zurückkehrt, erkennt er die kleine Siedlung nicht wieder, sie platzt aus allen Nähten. Abenteurer, Träumer, aber auch Schurken aus aller Welt strömen herbei, um ihr Glück zu machen: Im Griqualand wurde das größte Diamantenvorkommen der Welt entdeckt. Unter ihnen sind Alice Madian, Florence Ashburn und Gerrit Badenhorst. Doch sie alle müssen schnell feststellen, dass die Jagd nach den wertvollen Steinen wenig Platz für Menschlichkeit lässt. Der Diamantenrausch von Kimberley fordert seinen Tribut und wird nicht nur das Leben der vier für immer verändern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 817
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Ashley Carrington
Für immer und eine Nacht
Roman
Dedicated to Mary and Peter Terry, Highgrove House, Kiepersol, Eastern Transvaal. Thank you for an unforgettable time in your mountain-top paradise!
Teil 1: Griqualand
1
Zwölf Ochsen zogen den klobigen Planwagen über die weite Ebene im sonnendurchglühten Herzen des südlichen Afrika. Rotbrauner Staub stieg unter den Hufen der dahintrottenden Tiere auf. Die massigen Schädel mit den mächtigen Gehörnen hielten sie gesenkt, als duckten sie sich unter der Dezemberhitze, die wie eine unsichtbare Last über der ausgedörrten Halbwüste lag.
Auf dem primitiven Kutschbock, der aus einer breiten Holzkiste mit einer alten Decke als Polster bestand, saß ein junger Mann von einundzwanzig Jahren. Sein Name war Daniel Lundquist, und obwohl er unter der heißen Sonne Afrikas zur Welt gekommen war und keine andere Heimat kannte als das veld, wie die Buren die freie Natur nannten, hieß er bei vielen doch nur »Der Schwede«.
Er war von hochgewachsener, breitschultriger Gestalt und hatte von seinem schwedischen Vater das gelockte blonde Haar und die markanten Gesichtszüge geerbt, deren Vorzüge nicht so sehr in ihrer Schönheit als in ihrer Einfachheit und Klarheit lagen. Von seiner Mutter, einer burischen Farmerstochter aus Grahamstown am Great Fish River, hatte er die bernsteinbraunen Augen und das entwaffnende Lächeln, das einem unkomplizierten und prinzipiell zuversichtlichen Wesen entsprang. Über der muskulösen, sonnengebräunten Brust trug er eine Jacke aus Antilopenfell. Aus demselben strapazierfähigen Material war auch seine speckige Hose. Sein Gesicht, das vom täglichen Leben unter freiem Himmel bei Wind und Wetter gezeichnet war und um die Augen schon einen Kranz winziger Fältchen aufwies, schützte ein Lederhut mit breiter Krempe vor der sengenden Kraft der Sonne. Anders als die meisten Buren, die in seinem Alter darauf versessen waren, sich einen Bart wachsen zu lassen, griff er täglich zu Rasierseife und Rasiermesser. Wie lästig die morgendliche Prozedur manchmal auch war, erschien sie ihm doch als das kleinere Übel.
Daniel Lundquist verdiente sich seinen bescheidenen Lebensunterhalt als fahrender Händler und setzte damit die Tradition seiner verstorbenen Eltern fort, die östlich des Limpopo River im moskitoverseuchten Lowveld vom Gelbfieber dahingerafft worden waren. Drei Jahre lag der Tod seiner Eltern zurück, und seitdem zog er, nur von seinem schwarzen Gefährten Molefe vom Stamm der Khoikhoi begleitet, in unregelmäßigen Bahnen zwischen dem Limpopo River im Nordosten und dem Orange River im Südwesten hin und her. Für einen Vogel, der sich in die Lüfte erheben und geradewegs seinem Ziel entgegenfliegen konnte, lagen gute achthundert Meilen zwischen diesen beiden großen Flüssen, in deren Grenzen sich die freien Burenrepubliken Transvaal und Orange Freistaat gebildet hatten. Für einen smouse, einen fahrenden Händler, der mit einem schwerfälligen Ochsenwagen, auch Feldschoner genannt, zu abgelegenen Farmen und Bantustämmen unterwegs war, addierten sich die gewundenen Wegstrecken jedoch schnell zu einer doppelten Länge. Deshalb geschah es nicht selten, dass er ein dreiviertel Jahr und mehr benötigte, um von einem Fluss zum anderen zu kommen.
Diesmal hatten er und Molefe für ihren Treck zurück nach Süden zum Orange nur sieben Monate gebraucht. Sie hatten einmal keine Abstecher nach Westen ins Bechuanaland gemacht, sondern waren auf einer verhältnismäßig geraden Route durch das Mittelstück des Transvaal gezogen.
Aber ob sie nun sieben oder elf Monate unterwegs waren, war letztlich ohne Bedeutung. Zeit war kein Faktor, der in ihrem Leben eine wichtige Rolle spielte. Wenn ausreichend Futter für die Ochsen vorhanden war und die Tiere nicht unter Krankheiten litten, dann legte ein gutes Gespann auf normalem Terrain in der Regel seine zwei bis drei Meilen in der Stunde zurück. Es war gut, wenn sie an einem Tag achtzehn Meilen schafften, aber es war auch gut, wenn es nur zehn wurden. Sie sorgten sich nicht darum, wie schnell sie vorankamen. Sie nahmen alles mit gottgefälliger Gelassenheit hin, und das Wort Eile war ihnen fremd. Ihr Zuhause war der Wagen und das veld, wo immer sie sich befanden. So war es gewesen, seit sie sich erinnern konnten, und der Gedanke, dass es einmal anders sein könnte, kam ihnen gar nicht. Der Wagen rumpelte schwerfällig über eine Bodenwelle. Dass Daniel Lundquist die gut dreißig Fuß lange Peitsche, an einem biegsamen Bambusrohr von mehr als Manneslänge befestigt, über den Köpfen der Zugochsen knallen ließ, geschah mehr aus einem Reflex, der ihm in den Jahren auf dem Kutschbock in Fleisch und Blut übergegangen war, als dass er daran einen bewussten Gedanken verschwendete. Es klang wie ein Pistolenschuss in der drückenden Stille der scheinbar menschenleeren Wildnis, und für einen Augenblick stemmten sich die Tiere ein wenig energischer ins Joch. Doch schon nach einem halben Dutzend Schritten fielen sie wieder in ihren behäbigen Trott zurück. Das regelmäßige Knallen der Peitsche allein vermochte die erfahrenen Zugtiere nicht mehr in Trab zu versetzen. Um das zu erreichen, mussten sie die fore slock, das Lederende, das wie ein Rasiermesser tief in Rücken und Flanken einschneiden konnte, schon auf ihrer Haut spüren. Doch zu diesem Mittel griff ein erfahrener karweier, ein Fuhrmann, nur im Notfall.
Daniel Lundquist schenkte den Ochsen nicht halb so viel Aufmerksamkeit wie der Landschaft, die sich von Horizont zu Horizont dehnte. Molefe, der an der Spitze des zwölfköpfigen Gespanns ging und mit der sjambok, der kurzen Handpeitsche, bewehrt war, wusste noch besser als er, wie die Tiere zu lenken waren und was jeweils getan werden musste, um die Disziplin und eine gleichmäßige Geschwindigkeit zu wahren. Bei einem solch langen Gespann war jeder karweier für einen kundigen voorloper dankbar. Denn seine wichtige Aufgabe bestand darin, dafür Sorge zu tragen, dass die Leittiere auf den mehr oder weniger pfadlosen Wegen der Wildnis die richtige Richtung beibehielten und dass sie gefährliche Stellen mit spitzem Gestein oder Rissen im Boden mieden, die vom Kutschbock aus nicht so leicht zu erkennen waren.
Das Land, das sie auf ihrem Weg zum Orange River durchquerten und das viele als Niemandsland bezeichneten, wurde im Nordosten vom wogenden Grasland des Highveld, im Süden von der Halbwüste der Großen Karroo und im Nordwesten von der Kalahariwüste umschlossen. Es kam selbst einer halben Wüste gleich, denn der Boden war sandig und steinig, und die spärliche Vegetation bestand zum überwiegenden Teil aus genügsamen, niedrig wachsenden Sträuchern, hier und da ein wenig sprödem, strohartigem Gras sowie Kameldornbäumchen und Schirmakazien. Man konnte tagelang unterwegs sein, ohne einer anderen Menschenseele zu begegnen.
Daniel Lundquist liebte dieses karge, sonnendurchglühte und weite Land, das sich, wohin er auch blickte, wie ein Ozean aus Sand, Steinen und spärlicher Vegetation von einem hitzeflirrenden Horizont zum anderen erstreckte und bis auf eine kleine Anhöhe hier und da, kopje von den Buren genannt, flach wie ein Teller war. Diese scheinbar endlosen Landschaften Afrikas mochten auf andere abweisend und mit ihrer Lebensfeindlichkeit erschreckend wirken, für ihn waren sie der Inbegriff des natürlichen Friedens und der Zeitlosigkeit.
Der Eindruck vom menschenleeren Niemandsland täuschte jedoch. Die Bastards, die aus einer Rassenmischung aus Weißen, Hottentotten und Buschmännern hervorgegangen waren, lebten verstreut in kleinen Sippen in diesem wüstenähnlichen Landstrich, ebenso die zu den Bantus gehörenden Koranas. Hier und da hatten sich auch einige Buren niedergelassen und dem kargen Boden, auf dem Vieh erstaunlicherweise recht ordentlich gedieh, bescheidene Farmen abgerungen. Händler und Missionare waren ihnen gefolgt, und die gestrengen Männer, die den heidnischen Wilden das Wort Gottes brachten, fanden wenig Gefallen daran, dass dieser Volksstamm sich mit dem ihrem Empfinden nach anstößigen Namen Bastards schmückte und ein Nomadenleben führte. Die Versuche der Missionare, sie sesshaft werden zu lassen, scheiterten kläglich. Erfolg hatten sie jedoch in ihrem Bemühen, die Stammesbezeichnung Bastards aus der Welt zu schaffen. Sie gaben ihnen kurzerhand den Namen Griquas, und sie sorgten dafür, dass er sich im Laufe der Jahre auch durchsetzte, zumindest auf Karten und in offiziellen Dokumenten. Die Mehrzahl der burischen Siedler in diesem Gebiet zeigte sich jedoch weniger bereit, diese Neuerung anzunehmen. Sie nannten diese Schwarzen, die zum Teil einen Weißen in ihrer Ahnenkette aufweisen konnten und somit zu einem Achtel oder einem Sechzehntel weißes Siedlerblut in ihren Adern hatten, mit der ihnen eigenen Sturheit auch weiterhin Bastards, weil sie eben genau das in ihren Augen waren. Was die Siedler aber annahmen, war die Bezeichnung Griqualand für dieses Gebiet, an dem weder die britische Kapkolonie noch die beiden freien Burenstaaten Interesse zeigten – jedenfalls noch nicht.
Daniel Lundquist beobachtete gerade eine kleine Herde Antilopen, die in der Ferne in Richtung Süden durch das dürre Buschland zog und sich damit praktisch parallel zu ihnen bewegte, als ein Ruck durch den schweren Ochsenwagen ging.
»Baas …! Baas Daniel!«
Molefes Stimme riss ihn aus seiner versonnenen Beobachtung der Tiere. Er blickte wieder nach vorn und bemerkte sofort, dass die Ochsen auf einmal einen Schritt zugelegt hatten.
Der Schwarze vom Stamm der Khoikhoi, für die man mittlerweile auch die Bezeichnung Hottentotten verwandte, was später wie das Wort Kaffer einmal zu einem Schimpfwort werden sollte, gab seine Position an der Spitze des Ochsengespanns auf und ließ sich vom Wagen einholen.
»Weißt du, was das heißt, Baas?«, rief Molefe, noch bevor Daniel Lundquist mit ihm auf einer Höhe war. Er lachte und entblößte dabei seine makellos weißen Zähne.
Von der Statur her war er das Ebenbild des jungen Buren auf dem Kutschbock. Sein stattlicher, muskulöser Körper, an dem nicht ein Gramm Fett zu finden war, schien aus dem dunklen Ebenholz des Matabelelandes geschnitzt und von weichen Wolllappen in tagelanger schweißtreibender Arbeit blank poliert worden zu sein. Seine Bekleidung bestand aus einer Art Umhang, den er sich aus der Haut eines Ochsens angefertigt hatte, und einer knielangen Hose aus grobem Leinen. Festes Schuhwerk lehnte er ab. Er empfand Stiefel als unerträglich beengend und zudem als völlig sinnlos. Die Hornhaut seiner Fußsohlen stand, was die Unempfindlichkeit betraf, den Stiefelsohlen seines baas’ in nichts nach. Eine Kette aus Elefantenhaar, an der drei Löwenzähne baumelten, schmückte seinen Hals, und an jedem Unterarm trug er drei fingerbreite, kunstvoll gehämmerte Armreifen aus Messing. In der rechten Hand hielt er die sjambok, während er in der linken seinen kerrie trug, einen Stock aus Hartholz mit einem rund geschnitzten Knauf, der sich auch gut als Schlagwaffe eignete, wenn man damit umzugehen verstand, und Molefe wusste sehr gut, wie man sich gegen Mensch und Tier mit einem Kerrie erfolgreich zur Wehr setzen konnte. Einmal hatte er einem in Panik geratenen, wild gewordenen Ochsen mit einem einzigen Schlag den Schädel zertrümmert und damit ein Unglück noch im letzten Moment abgewendet.
»Die Ochsen legen sich ins Zeug, Baas! Und sieh nur, wie Kaiser und Groot Ossenbuil die Köpfe gehoben haben!«
Daniel Lundquist nickte. »Ja, sie riechen das Wasser, Molefe«, sagte er und erwiderte das fröhliche Lächeln des Hottentotten. Molefe war zwei Jahre älter als er und der Sohn der schwarzen Hebamme, die ihn, Daniel, zur Welt gebrachte hatte. Seit er denken konnte, war Molefe sein Begleiter gewesen. Sie waren zusammen aufgewachsen, und auch wenn sie eine andere Hautfarbe besaßen und damit in diesem Land zwei grundverschiedenen Klassen angehörten, so hatte er, das einzige Kind seiner Eltern, Molefe doch immer wie einen Wahlbruder betrachtet – und später, nach dem Tod seiner Eltern, wie einen Partner. Dass er dennoch der baas war, der Herr und Boss, stand für ihn dazu in keinem Widerspruch.
»Der Vaal River kann nicht mehr weit sein!« Molefe setzte seinen nackten Fuß auf das gebogene Tritteisen seitlich am Kutschbock und schwang sich zu Daniel Lundquist hinauf, um einen besseren Fernblick zu haben.
»Vielleicht noch drei, vier Meilen«, schätzte der Bure mit dem Spitznamen »Der Schwede« und deutete auf die grüne Linie, die sich vor ihnen von den eintönigen Farben aus Grau und Rotbraun abhob, welche im Hochsommer die Farbpalette vom Griqualand bestimmten. Diese unregelmäßige, gezackte Linie versprach Schatten und Kühlung und ein ausgiebiges Bad, setzte sie sich doch aus den grünen Büschen und weit ausladenden Weidenbäumen am hügeligen Ufer des Vaal zusammen, der wenige Tagereisen weiter südlich in den Orange River mündete. Das Ende ihrer Reise war nahe.
2
Träge wie eine Riesenschlange floss der Vaal mit unzähligen Windungen durch das öde Griqualand und segnete es an seinen Ufern mit einem schmalen Streifen saftiger Vegetation. In regenreichen Monaten wies der Fluss mit seinen vielen kleinen, von Gras und Buschwerk überwucherten Inseln an manchen Stellen eine Breite von bis zu vierhundert Fuß auf. Doch jetzt, nach einem langen und pulvertrockenen Sommer, füllten die trüben, schlammigen Fluten nur die Hälfte des Flussbettes aus.
Daniel Lundquist und Molefe überquerten den Vaal bei Klip Drift, wo eine Furt das Übersetzen erleichterte. Es blieb dennoch ein hartes Stück Arbeit, die zwölf Ochsen und den schweren Planwagen auf die andere Flussseite zu bringen. Die Uferbänke fielen steil zum Wasser hin ab, an manchen Stellen bis zu sechzig Fuß. Ein solch starkes Gefälle auf kurzer Strecke ohne Schaden zu überwinden, erforderte viel Geschick und Erfahrung.
Sie kampierten zwei Tage am Südufer des Vaal, um den Ochsen eine verdiente Ruhepause zu gönnen. Ganz in der Nähe lag die kleine Siedlung Pniel, eine deutsche Missionsstation, die schon vor mehr als zwei Jahrzehnten von Angehörigen der Berliner Missionsgesellschaft gegründet worden war. Als sie weiterzogen, statteten sie der bescheidenen Ansammlung armseliger Lehmhütten einen Besuch ab. Aber große Geschäfte waren hier nicht zu machen, und nach einer knappen Stunde waren sie schon wieder unterwegs.
Daniels Ziel war die Siedlung Hope Town am Orange River. Dort machte er bei seiner Rückkehr stets für ein, zwei Wochen Station, um Freunde wiederzusehen und sich mit frischen Vorräten und Handelswaren aller Art einzudecken, bevor er sich wieder nach Süden wandte und durch den Freistaat und Transvaal in Richtung Limpopo River treckte.
Auf ihrem Weg nach Hope Town kamen sie an einigen einsam gelegenen Farmen vorbei. De Kalk, die von der Burenfamilie namens Jacobs mehr schlecht als recht bewirtschaftet wurde, lag jedoch ein wenig abseits ihrer Route. Die Jacobs lebten mit ihren Kindern in einem winzigen Zweizimmerhaus, das reetgedeckt und aus Lehmziegeln errichtet war, sich aber immerhin einer kleinen überdachten stoep, einer Veranda, rühmen konnte.
»Wozu dieser Umweg, Baas?«, fragte Molefe, den es nun nach Hope Town zog. »Bei den Jacobs haben wir doch noch nie ein Geschäft gemacht, das auch nur ein paar Tropfen Schweiß wert gewesen wäre.«
Daniel zuckte mit den Schultern. »Sie freuen sich aber immer, wenn wir bei ihnen haltmachen. Und ihr Kaffee ist der beste zwischen Vaal und Orange River.«
Der junge Erasmus Jacobs saß mit seinen Geschwistern im spärlichen Schatten einer Akazie und spielte mit ihnen klip-klip, ein Kinderspiel, das sich um fünf Kiesel drehte. Als er das Ochsengespann sah, sprang er auf.
»Der Schwede ist da!«, rief er freudestrahlend, denn er wusste, dass Daniel Lundquist ihm und seinen Geschwistern immer eine kleine Leckerei zusteckte, und so sollte es auch diesmal sein.
Daniel ließ die Ochsen eingespannt, denn länger als auf einen Becher Kaffee wollte auch er nicht bleiben. Erasmus’ Vater war draußen bei seiner Herde, und so hielt er auf der kleinen Veranda mit Mevrouw Jacobs ein kleines Schwätzchen, während er ihren guten Kaffee genoss. Denn eine Kanne Kaffee stand immer auf der Veranda eines jeden Buren bereit. Und wer des Weges kam, auch jeder Fremde, war nach altem Brauch unaufgefordert eingeladen, sich zu bedienen. Die vorbehaltlose Gastfreundschaft der Buren rühmten sogar diejenigen Engländer, die sonst kein gutes Haar an den bulligen, bärtigen Siedlern in der Wildnis ließen.
Viel Neues gab es nicht zu berichten. Sie unterhielten sich über die lange Trockenheit und natürlich auch über die Briten, die 1806 in der Tafelbucht von Kapstadt mit ihrer Besatzungsflotte gelandet waren und die Kolonie an sich gerissen hatten. Dreißig Jahre später hatten Tausende von freiheitsliebenden Buren die Kolonie in dem längst zur Legende gewordenen Großen Treck verlassen, um jenseits der Grenzen der Kapkolonie und der britischen Vorherrschaft eine neue Heimat zu finden. Diese jahrelangen, entbehrungsreichen Trecks über das Highveld und die Drakensberge hatten nach verlustreichen Kämpfen mit den Xhosas und Zulus schließlich zur Gründung der beiden unabhängigen Burenrepubliken Transvaal und Orange Freistaat geführt. Aber die Jacobs hegten wie Daniel den Verdacht, dass die Briten ihren Einfluss im südlichen Afrika auf Dauer nicht auf die Kapkolonie beschränken würden und wohl schon längst ihr Auge auf das Land nördlich des Orange geworfen hatten. Daniel hatte seinen Becher geleert und befand sich wieder im Aufbruch, als Mevrouw Jacobs ihm vom Besuch ihres Nachbarn Schalk van Niekerk erzählte, dessen Steckenpferd die Mineralogie war.
»Sie wissen ja, wie verrückt er nach außergewöhnlichen Steinen ist. Neulich hat er mir doch tatsächlich einen kleinen Glaskiesel abkaufen wollen, den Erasmus irgendwo auf dem veld gefunden hat«, berichtete sie, während sie ihn zum Wagen begleitete. »Sie haben ihm bestimmt einen fairen Preis gemacht«, scherzte Daniel.
»Magtig, und ob ich das getan habe!«, versicherte sie lachend. »Ich habe ihm den Stein geschenkt. Es war doch bloß ein gewöhnlicher Glaskiesel.«
»Jedem sein Steckenpferd. Grüßen Sie Ihren Mann von mir, Mevrouw Jacobs«, verabschiedete sich Daniel von ihr, schwang sich auf den Kutschbock und trieb die Ochsen an. Das mit Schalk van Niekerk und dem Glaskiesel hatte er schon wieder vergessen, noch bevor De Kalk außer Sicht geraten war.
Die Farmen Dutoitspan und Bultfontein lagen nur wenige Meilen weiter südlich. Um Bultfontein machte er gern einen Bogen, denn Cornelis du Plooy, dem die Farm gehörte, war ein streitsüchtiger Geselle, und seine fast taube Frau, die mit Vorliebe über ihre Nachbarn herzog und dabei mehr Gift verspritzte als ein Dutzend Puffottern, war eine genauso wenig angenehme Gesellschaft.
Doch auf Dutoitspan kehrte er gern ein, denn mit Adriaan van Wyk verstand er sich recht gut. Eigentlich hatte Adriaan van Wyk die Farm ja in Dorstfontein umbenannt, als er sie vor sieben Jahren ihrem Vorbesitzer Paulus du Toit abgekauft hatte. Der neue Name hatte sich in der Nachbarschaft jedoch nicht durchgesetzt. Die Einheimischen hielten am alten Namen Dutoitspan fest – und so sollte dieses karge Stück Land auch in die Geschichte eingehen.
Was Dutoitspan den benachbarten Farmen voraushatte, war die pan, die große Mulde inmitten der flachen Landschaft, in der sich aufgrund der besonderen Bodenbeschaffenheit Wasser sammelte, ohne rasch zu versickern. Eine Pan konnte nur das Wasser auffangen, das nach Regenfällen vom höher gelegenen Umland in die Mulde rann, oder aber sie wurde von einer schwachen, meist schlammigen Quelle gespeist. Letzteres war auf Dutoitspan leider nicht der Fall, so dass es immer wieder Jahre gab, in denen die Pan im Hochsommer so ausgetrocknet und rissig unter der Glutsonne lag wie das übrige Land. In diesem Jahr stand das brackige Wasser immerhin noch einen guten Fuß hoch, wie der Bure nicht ohne Stolz erwähnte. Daniel und Molefe blieben zwei Stunden auf der Farm von Adriaan van Wyk, und wenn am Schluss nicht die Begebenheit mit dem schwarzen Viehhirten, einem Griqua, gewesen wäre, hätte sich Daniel später kaum mehr an diesen Aufenthalt erinnert.
Daniel hatte Adriaan van Wyk zwei Sägeblätter, eine solide Axt und einige Ellen Stoff für dessen Frau verkauft. Danach hatte er sich zu den van Wyks an den Tisch gesetzt und sich den Hammelbraten mit Kohl und Kartoffeln sowie das Pflaumenkompott zum Nachtisch schmecken lassen.
Als die beiden Männer nach dem Essen ihre Pfeifen füllten und sich auf die stoep setzen wollten, sah Daniel einen hageren, grauhaarigen Schwarzen in zerlumpter Kleidung bei Molefe am Wagen stehen. Gestenreich redete der alte Griqua auf ihn ein, und seine flehende Stimme wurde lauter und lauter.
»Was will der senile Kaffer von deinem Burschen?«, fragte Adriaan van Wyk, ungehalten über die mittägliche Störung, und schrie barsch zu Molefe hinüber: »Sag ihm, dass er verschwinden und sich gefälligst um die Ziegen kümmern soll!«
Daniel legte ihm beruhigend eine Hand auf den Arm. »Ich sehe mal nach, was da los ist«, sagte er und ging rasch zu Molefe und dem Griqua hinüber.
Molefe machte eine entschuldigende Miene. »Tut mir leid, Baas, aber der Kerl lässt sich so wenig abwimmeln wie eine Schmeißfliege«, grollte er.
»Was will er?«, erkundigte sich Daniel ruhig.
Molefe verzog das Gesicht. »Tabak, was sonst. Aber er kann natürlich nicht bezahlen. Dafür will er uns diesen Kiesel hier andrehen«, sagte er und hielt Daniel einen haselnussgroßen Stein hin, der aussah, als wäre er aus frostigem Glas. »Baas van Niekerk bringt die Kaffern hier in der Gegend offenbar auf die einfältigsten Gedanken. Ein Quarzstein für ein Päckchen Tabak, soweit kommt es noch!«
»Mooi klippe, Baas! Schöner Stein!«, betonte der ergraute Griqua. »Nur ein Päckchen. Habe schon seit Monaten kein Tabak mehr nicht. Ein halbes Päckchen, Baas, nur ein halbes!« Flehend sah er ihn an und legte dabei die Hände vor der knochigen Brust zusammen.
Daniel schaute in das verhärmte Gesicht des alten Mannes und vermochte ihn einfach nicht wegzuschicken. Sie hatten eine gute Reise hinter sich, und da konnte er sich hier und da ein wenig Mildtätigkeit schon leisten.
Er nahm den Stein aus Molefes Handfläche. »Gib ihm ein Päckchen!«
»Ja, aber …«, begann dieser zu protestieren.
»Schon gut, Molefe. Zerbrich dir nicht weiter den Kopf. Gib ihm den Tabak einfach«, schnitt er ihm das Wort ab, nicht unfreundlich, aber doch bestimmt.
Molefe seufzte geplagt. »Du treibst uns noch mal in den Ruin, Baas.«
Der alte Griqua bedankte sich überschwänglich, dass es Daniel schon peinlich war, und schnell wandte er sich ab, um zu Adriaan van Wyk zurückzukehren. Er hielt den Stein noch immer in der Hand und wollte ihn auf dem Weg zur stoep wegwerfen, doch um den Stolz des alten Mannes nicht zu verletzen, steckte er ihn ein.
»Was wollte der Alte, Schwede?«, fragte der Farmer.
»Ein bisschen Tabak betteln«, antwortete Daniel und setzte sich auf einen der Armstühle, deren Sitzflächen und Rückenlehnen aus geflochtenen riems, Lederstreifen, bestanden.
»Kaffer!«, brummte der Farmer abschätzig. »Gib ihnen Tabak und eine Flasche Fusel, und sie wähnen sich im Paradies auf Erden.«
Daniel fühlte sich versucht, die Partei der Schwarzen zu ergreifen, denn solche Pauschalurteile missfielen ihm, wie sie seinem Vater missfallen hatten. Aber nach dem guten und allzu reichhaltigen Essen fühlte er sich zu wohl und träge, um sich mit Mijnheer van Wyk in eine Grundsatzdiskussion einzulassen.
Als die Mittagssonne ein wenig von ihrer brennenden Kraft verloren hatte, verließen Daniel und Molefe Dutoitspan und treckten weiter. Zwei Stunden vor Einbruch der Dunkelheit spannten sie die Ochsen aus und schlugen ihr Nachtlager zwischen zwei Kopjes auf.
Im Sommer schlief Daniel wie Molefe unter freiem Himmel, so war er es seit seiner Kindheit gewöhnt. Das Buschland erwachte zu seinem nächtlichen Leben, und wie Diamanten funkelten die Sterne, die das Kreuz des Südens bildeten, über ihnen am samtschwarzen Firmament. Der Himmel über Afrika, ob bei Tag oder bei Nacht, zählte zu den großen Wundern der Natur, an denen sich Daniel niemals sattsehen konnte.
Als er sich schließlich auf die Seite drehte und schlafen wollte, bohrte sich etwas unangenehm in seinen rechten Oberschenkel. Er griff in die Hosentasche und fand den Stein des Griqua. Schon wollte er ihn hinaus in die Schwärze der Nacht werfen, besann sich dann jedoch eines anderen. Der Glaskiesel fühlte sich besonders schwer und zugleich angenehm in der Hand an. Ich behalte ihn als Talisman, beschloss er und steckte ihn in seinen ledernen Geldbeutel. Vielleicht bringt er mir ja Glück.
In der Woche darauf erreichten sie Hope Town am Orange River. Anfang Januar brachen sie wieder Richtung Nordosten auf. Als Daniel sich von seinem Freund Ryk van Dyke verabschiedete, dem in Hope Town die Schank- und Billardstube Witte Boom Canteen gehörte, da ahnte keiner von ihnen, dass dieser Treck der längste sein und sie weit über den Limpopo River hinaus führen würde. Und hätte ihm jemand im Dämmerlicht dieses anbrechenden Januartages gesagt, dass dieser Treck für viele Jahre, ja Jahrzehnte sein letzter sein und er danach nie wieder als fahrender Händler auf einem Kutschbock sitzen würde, Daniel Lundquist hätte es für einen gelungenen Witz gehalten und schallend darüber gelacht.
3
Zweiundzwanzig Monate später, im November 1869, kehrten Daniel Lundquist und Molefe nach Hope Town zurück – und sie hatten das Gefühl, in einen ihnen völlig fremden Ort zu kommen. Sie erkannten Hope Town nicht wieder. Das Hope Town, das sie vor fast zwei Jahren verlassen hatten, war eine überschaubare Ansammlung bescheidener einstöckiger Wohnhäuser und Läden entlang einer staubigen Hauptstraße gewesen, wo in der Sonne dösende Hunde selten einmal ihren Platz mitten auf der Straße einem näher kommenden Gefährt räumen mussten. Und solange sie sich erinnern konnten, bildete der Marktplatz mit dem zurückgelegenen outspan für die schweren Ochsenwagen und dem weiß gekalkten Bau der Holländisch-reformierten Kirche das Zentrum der verschlafenen Siedlung, in der die Zeit so träge dahinflog wie die braunen Fluten des Orange.
Doch nichts von dem, was einmal war, traf jetzt noch auf Hope Town zu. Die Siedlung schien aus den Nähten zu platzen, nein, das Opfer eines Überfalls geworden zu sein. Zelte, Wellblechhütten und provisorische Schuppen umgaben das Dorf wie mit dem festen Ring einer Belagerungsarmee. Und auf den Straßen ging es so hektisch und lärmend zu, wie Daniel es nur von Markttagen in großen Städten her kannte. Reiter, Pferdewagen aller Art und schwerbeladene Fuhrwerke bevölkerten die Straße und machten sich gegenseitig den Weg streitig. Die Luft war erfüllt von ungeduldigen Rufen, Verwünschungen und lästerlichen Flüchen, und dieses erregte Stimmengewirr vermischte sich mit dem Wiehern nervöser Pferde und dem Knallen vieler Ochsenpeitschen. Auch die Männer und Frauen, die zu Fuß unterwegs waren und in den seltsamsten Aufzügen dahineilten, waren von derselben Hektik erfasst. Niemand schien Zeit zu haben.
»Magtig …! Träume ich das, Baas, oder geht es hier wirklich zu wie in einem aufgescheuchten Bienenstock?«, sagte Molefe fassungslos. »Wo kommen bloß all die Leute her?«
Mit offenem Mund blickte er um sich. Sämtliche Rassen waren auf der Straße vertreten: schwarze Kaffern und braune Malaien, gelbe Kulis und Weiße aus aller Herren Länder. Und unter den Weißen fanden sich sämtliche sozialen Klassen. Da saß auf einem Ochsenwagen, der zum Transport von Diamantensuchern umgebaut und mit vier primitiven Sitzreihen versehen worden war, ein Seemann in derber Kluft Seite an Seite mit einem elegant gekleideten Dandy mit Seidenweste und Rüschenhemd, und da teilte sich die biedere Kaufmannstochter mit dem verstörten Blick unter dem Schutenhut eine harte Planke mit dem drallen, sehr offenherzig gekleideten Schankmädchen aus der Hafengegend von Kapstadt.
»Das mit den Diamanten muss tatsächlich stimmen«, sagte Daniel, ebenfalls überrascht von dem, was sich seinen Augen darbot. Daniel hatte auf den Farmen, die sie in den letzten Wochen aufgesucht hatten, Gerüchte und Andeutungen gehört, dass eine Horde von Glücksrittern zum Vaal strömte, weil man dort angeblich Diamanten finden konnte. Voller Verachtung hatten sie von den uitlanders gesprochen, die von den Diamanten angelockt wurden wie Geier von stinkendem Aas und die wie Ratten in der Erde wühlten, statt einer anständigen, gottgefälligen Arbeit nachzugehen. Doch auf das, was er nun in Hope Town zu Gesicht bekam, war auch er nicht vorbereitet gewesen.
Den Geschichten, die ihnen in letzter Zeit zu Ohren gekommen waren, hatte er auch deshalb keine große Bedeutung zugemessen, weil schon immer Prospektoren in diesen Regionen nach Bodenschätzen gesucht hatten, ohne dass sich viel daraus ergeben hätte. Er hatte die Sache daher für eines jener bekannten Strohfeuer von Spekulanten und Aufschneidern gehalten und geglaubt, dass es sich nur um vereinzelte Funde handelte, von denen die Rede war. Auch dass so viele Menschen zum Vaal strömen sollten, hatte er so nicht für bare Münze genommen. Denn wenn ein burischer Farmer von ganzen Horden von verdomden uitlanders sprach, dann musste man wissen, dass ihm gewöhnlich schon eine Handvoll Engländer in seinem Bezirk reichte, um von einer halben Invasion zu reden.
Jetzt aber stellte Daniel mit großer Verwirrung fest, dass keine der vermeintlichen Übertreibungen der Wirklichkeit auch nur halbwegs gerecht wurde. Dieses Hope Town war ihm fremd, und zum ersten Mal hatte er Mühe, auf dem Outspan einen Platz für sein Ochsengespann zu finden.
Kaum hatte er mit Molefes Unterstützung seine Ochsen in die Lücke bugsiert und die Bremse angezogen, als ein korpulenter Mann aus dem Schatten des Vordachs bei der Tränke trat und zu ihm kam. Ihm fehlte der rechte Arm, und die linke Hand war verkrüppelt.
»Macht zwei Shilling«, sagte er ohne jeden Gruß. »Wenn Sie auch noch über Nacht bleiben, kostet es drei. Wasser und Futter werden extra berechnet.«
Daniel sah den Mann verständnislos an. Er wusste erst gar nicht, wovon die Rede war. »Zwei Shilling? Wofür?«
»Na, dass Sie hier mit Ihrem Wagen und Ihren Ochsen stehen dürfen, Mister.«
Daniel war im ersten Moment sprachlos. Dann trat eine erboste Miene auf sein Gesicht. »Ich habe immer hier gestanden und nie auch nur einen Penny dafür gezahlt. Das wäre mir und jedem anderen auch niemals in den Sinn gekommen. Das hier ist ein öffentlicher Outspan, und ich weiß nicht, woher Sie …«
»Sie sind offenbar nicht ganz auf der Höhe der Zeit, Mister!«, fuhr ihm der Einarmige barsch ins Wort. »Das hier ist mal ein öffentlicher Outspan gewesen, aber das war, bevor man drüben am Vaal Diamanten gefunden hat. Jetzt kostet es Geld, wenn Sie mit Ihrem Gespann hier stehen bleiben wollen.«
»Mit welchem Recht …«, begann Daniel erregt, und Molefes Miene zeigte flammende Empörung.
»Machen Sie mir keinen Ärger, Mister!«, herrschte ihn der Einarmige an, der nicht zu den Einheimischen von Hope Town gehörte. »Ich habe den Platz gepachtet, und ich nehme einen verdammt fairen Preis. Wenn Sie hinter Houtman’s Emporium stehen wollen, müssen Sie einen Sixpence mehr zahlen. Aber wenn Ihnen sogar zwei Shilling noch zu viel sind, suchen Sie sich gefälligst draußen vor dem Ort einen Platz. Doch glauben Sie ja nicht, dass Sie dann billiger davonkommen. Die Kaffern, die Sie anheuern müssen, um Ihren Wagen zu entladen und mit neuen Waren zu beladen, kosten Sie eine Menge mehr als zwei Shilling. Also, was ist? Stehlen Sie mir nicht die Zeit, sondern entscheiden Sie sich. Wenn Sie nicht zahlen wollen, verschwinden Sie von meinem Outspan. Ich kriege die Lücke schon gefüllt.«
»Zahl ihm keinen lausigen Penny nicht, Baas!«, stieß Molefe wütend hervor.
»Hast du Stimmen gehört, Kaffer?«, blaffte der Mann ihn an. »Habe jedenfalls nicht gehört, dass dich jemand nach deiner Meinung gefragt hat!«
Daniel war versucht, seinem Zorn Luft zu machen und dem Burschen zu zeigen, dass er so nicht mit sich und Molefe umspringen ließ. Zudem waren zwei Shilling eine glatte Unverschämtheit. Zum Teufel mit dem Outspan! Er würde sich draußen einen Lagerplatz suchen. Dann aber dachte er an das viele Elfenbein, das er von den Mashona, Matabele und den Bamangwato eingetauscht hatte. Molefe und er waren noch nie so weit nordwärts vorgedrungen, und mehr als einmal hatten sie auf diesem Treck ihr Leben riskiert. Vielleicht war es unklug, mit einer so wertvollen Fracht außerhalb des Ortes bei den schäbigen Zelten und Wellblechhütten zu kampieren. Mit Sicherheit trieb sich unter den Leuten, die am Vaal ihr Glück machen wollten, auch eine Menge Gesindel herum, das nur darauf wartete, andere auszunehmen. Unter diesen außergewöhnlichen Umständen waren die zwei Shilling möglicherweise gut angelegt.
»Verdammter Wucher!«, grollte Daniel, zog seinen Geldbeutel hervor und zahlte die zwei Shilling.
»Wenn Sie nach Sonnenuntergang noch hier sind …«, begann der Einarmige, während er die Münzen einsteckte.
Daniel machte eine ärgerliche Bewegung. »Ja, ich weiß, dann ist noch ein Shilling fällig.«
»Prächtig, dass Sie es endlich begriffen haben«, höhnte der Mann. »Aber vergessen Sie es auch nicht!«
Daniel ersparte sich eine Erwiderung darauf und sagte mit gedämpfter Stimme zu Molefe: »Ich werde erst einmal zu Ryk van Dyke hinübergehen und einige Erkundigungen einziehen. Du bleibst solange hier und lässt den Wagen nicht aus den Augen.«
Molefe nickte mit grimmig entschlossener Miene und schlug sich mit der Sjambok auf die Brust. »Du kannst dich auf mich verlassen, Baas!«, versicherte er und fügte mit einem zornigen Blick auf den Rücken des Einarmigen hinzu: »Statt der zwei Shilling hättest du ihm deine Fäuste zu schmecken geben sollen!«
Daniel zuckte mit den Schultern. »Glaube nicht, dass uns das viel genutzt hätte. Sieht so aus, als wären wir tatsächlich nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit. Mal hören, was Ryk van Dyke zu berichten hat.«
4
Daniel ging über den Platz und musste gehörig aufpassen, dabei nicht unter die Räder der Fuhrwerke und Pferdekutschen zu kommen. Die Witte Boom Canteen lag auf der anderen Seite gleich neben dem Geschäft von Jan Houtman, bei dem man alles kaufen konnte, was ein gut sortierter Laden in diesem Teil der Welt gewöhnlich an Lebensmitteln, Haushaltswaren, Stoffen, Kurzwaren, Schuhwerk, Waffen, Werkzeugen und anderen Gerätschaften im Angebot hatte, und das war eine ganze Menge. Daniel fiel auf, dass die Veranda von Houtmans Geschäft mit Kisten vollgestellt war. Der Laden selbst und das Lager boten offensichtlich nicht mehr Platz genug für all die Waren, die er in Erwartung guter Geschäfte geordert hatte. Ihm fiel auch auf, dass mehrere Häuser, die bei seinem letzten Aufenthalt den Einheimischen noch als ganz normale Wohnhäuser gedient hatten, nun zu Pensionen, Läden und Schankstuben geworden waren. Über zwei Eingangstüren las er Schilder mit der Aufschrift »Diamantenhändler« in Burisch und Englisch. Jeder schien an dem Diamantenfieber, das diesen abgelegenen Winkel Afrikas erfasst hatte, auf die eine oder andere Art profitieren zu wollen.
Auch die Canteen von Ryk van Dyke kannte er kaum wieder. Nicht dass sich in dem langgestreckten L-förmigen Raum mit dem Billardtisch in der Ecke viel geändert hätte. Die einfache und zweckmäßige Einrichtung aus schweren Holztischen und derben Stühlen mit ledergeflochtener Sitzfläche und dem mächtigen Tresen aus Gelbholz war dieselbe geblieben. Doch wo sich früher kaum mehr als ein Dutzend Zecher gleichzeitig auf ein Bier oder ein Glas Branntwein eingefunden hatte, da drängte sich nun, zur frühen Nachmittagsstunde, eine bunte und lärmende Menschenmenge. Die Luft war zum Schneiden. Tabakrauch von Zigarren und Pfeifen hing als dichter, blau wabernder Dunst unter der Balkendecke. Das einzig Positive an dem stinkenden Rauch, der einigen Pfeifen und billigen Zigarren entströmte, war, dass er den noch übleren Geruch mancher Körperausdünstungen gnädig überdeckte.
Daniel hatte im ersten Moment das beklemmende Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Dann schob er sich durch die Menge zur Theke und schnappte dabei links und rechts aus dem Zusammenhang gerissene Gesprächsfetzen auf.
»… mit dem Dampfer Celtic … eine Odyssee von achtunddreißig Tagen … hätte einem blinden Passagier nicht schlimmer ergehen können als mir …«
»Es heißt, man braucht die Glitzersteinchen bloß aus dem Sand zu sieben …«
»Eigentlich wollte ich ja heiraten, aber als ich am Morgen der Trauung den Bericht über den Star of South Africa las, habe ich die nächste Passage nach Kapstadt gebucht …«
»…was heißt hier Kartenhai? Wenn die Digger den ganzen Tag im Dreck nach Diamanten gewühlt haben, steht ihnen abends der Sinn bestimmt nach’n bisschen Ablenkung – und die werde ich ihnen bieten …«
»… wollte bloß ’n paar Felsbrocken für ’ne Feuerstelle zusammentragen, und da fand er direkt unter dem ersten Stein ’nen Diamanten so groß wie’n verdammtes Hühnerei. Von Stund an war er ’n gemachter Mann …«
»Die armen Schweine, die jetzt in Kapstadt festsitzen und nicht wissen, wie sie zum Vaal kommen sollen. Bei der Inland Transport Company sind alle Plätze schon auf Wochen im Voraus ausgebucht – und dabei nehmen die Kerle noch zwölf Pfund für die Tortur, die man zehn Tage lang auf diesen Karren erdulden muss …«
»Manch einer soll die Höllenfahrt nicht überstanden haben. Habe von einem gehört, dem die Füße so angeschwollen sind, dass er sich, wahnsinnig vor Schmerz, das Messer ins Fleisch gerammt hat. Ob er ’s überlebt hat …«
»… dreißig Fuß im Quadrat pro Claim, mehr darf man sich nicht abstecken …«
»Magtig, nein! Wo kämen wir denn auch hin, wenn sich ein Kaffer einen eigenen Claim abstecken dürfte. Ihn an der Ausbeute zu beteiligen, ist ja wohl großzügig genug!«
Die erregten Stimmen, die aus allen Richtungen auf Daniel eindrangen, machten ihn ganz wirr im Kopf. Der Lärm war wie ein tosender Wasserfall. Nach den Monaten, die er mit Molefe im Mashona- und Bechuanaland verbracht hatte, war er diese Seite der Zivilisation nicht mehr gewöhnt.
Mittlerweile hatte er sich bis in die zweite Reihe hinter dem Tresen durchgekämpft, und sein Blick suchte Ryk van Dyke. Er sah zuerst nur zwei junge Burschen und einen schnauzbärtigen Glatzkopf, die hinter der Theke alle Hände voll zu tun hatten, Branntwein, Bier und Rum auszuschenken. Dann entdeckte er Ryk van Dyke. Er steckte gerade den Kopf durch den Vorhang aus bunten Perlenschnüren, der im Durchgang zu einem privaten Hinterzimmer hing.
»Ryk!«, rief Daniel. Er versuchte das Stimmengewirr zu übertönen und winkte mit seinem breitkrempigen Lederhut in der Hand. Letzteres lenkte die Aufmerksamkeit des Schankwirts auf sich, zumal Daniel Lundquist die meisten Umstehenden um einen Kopf überragte.
Ryk van Dyke, der mit seiner gedrungenen, korpulenten Gestalt in der Menge untergegangen wäre wie ein Ochse in einer Herde Giraffen, lachte über das runde Gesicht, das von einem struppigen dunklen Vollbart eingefasst wurde.
»Alle wereld, Daniel der Schwede ist zurück!«, schrie Ryk erfreut und winkte ihn zu sich.
Daniel begab sich zu ihm hinter die Theke, und sie tauschten einen ebenso kräftigen wie herzlichen Händedruck. »Schön, dich wiederzusehen, Ryk. Aus der Witte Boom Canteen ist ja der reinste Hexenkessel geworden. Aber ich nehme an, du hast keinen Grund, dich darüber zu beklagen, oder?«
Ryk lachte. »Hast du bei Pniel oder Klip Drift über den Vaal gesetzt?«
»Nein, wir sind diesmal direkt von Westen und nur über den Orange River gekommen«, antwortete Daniel. »Wir waren bei den Mashona und im Matabeleland und haben auf dem Rückweg einen größeren Abstecher zu den Stämmen im Bechuanaland am Rand der Kalahariwüste gemacht. Erst ein gutes Stück westlich der Korana Mountains haben wir einen Haken nach Südosten und zurück nach Hope Town geschlagen.«
»Na, wenn du noch nicht am Vaal gewesen bist, dann weißt du auch nicht, was ein Hexenkessel ist.«
Daniel machte eine etwas hilflose Geste. »Ryk, um ehrlich zu sein, ich bin völlig erschlagen. Ich habe in den letzten Wochen Gerüchte gehört, aber auf das hier … also, darauf bin ich wirklich nicht vorbereitet gewesen. Ich habe im ersten Moment geglaubt, mich in die falsche Stadt verirrt zu haben. Hope Town ist nicht mehr die Siedlung, wie ich sie einmal gekannt habe.«
»Wenn ich Zeit hätte, mal in Ruhe darüber nachzudenken, würde ich bestimmt zum selben Ergebnis kommen. Aber wir sind hier viel zu sehr damit beschäftigt, über Nacht ein Vermögen zu machen, Daniel, um über vergangene Zeiten nachzugrübeln«, sagte Ryk scherzend und ernsthaft zugleich.
Daniel verzog das Gesicht. »Ja, indem man beispielsweise zwei Shilling für einen Platz auf dem Outspan verlangt!«
»Das sind doch nur Brosamen, Daniel.« Ryk schlug ihm auf die Schulter. »Du bist diesmal eine Ewigkeit weg gewesen. Ich habe dich beinahe schon für tot gehalten, irgendwo verscharrt jenseits des Limpopo. Schön, dass dem nicht so ist und du noch nicht zu spät dran bist, um dir deinen Anteil an diesem gewinnträchtigen Spektakel zu sichern.«
»Was ist denn überhaupt geschehen, Ryk? Wie ist es bloß zu diesen kolossalen Veränderungen gekommen?«
»Du hast eine Menge verpasst. Ich werde dir erzählen, was sich hier ereignet hat, aber lass uns nach hinten gehen, da haben wir mehr Ruhe«, sagte Ryk und schob ihn durch den Perlenvorhang in das kleine Hinterzimmer, das so einfach möbliert war wie der Schankraum der Canteen. Es gab einen runden Holztisch mit vier Stühlen, einen schmalen Eckschrank sowie ein Schreibpult, an dem Ryk van Dyke gewöhnlich Aufträge zusammenstellte und seine Buchhaltung machte.
Daniel setzte sich an den Tisch, während Ryk zwei Gläser und eine Flasche von seinem besten Brandy holte. Er goss ein, und nachdem sie angestoßen und einen Schluck genommen hatten, begann Ryk seinen Bericht.
»Wenn wir einem dankbar sein müssen, dann ist es Schalk van Niekerk. Wäre er nicht so verrückt gewesen, sich ausgerechnet die Mineralogie als Steckenpferd zu wählen, dann gäbe es keine Diggercamps an den Ufern des Vaal, und dann wäre Hope Town noch immer ein verschlafenes Nest. Und die Jacobs von De Kalk hätten auch nie erfahren, dass ihr Sohn mit Kieseln gespielt hat, die tausend Pfund und mehr wert sind.«
Daniel stutzte. »Die Jacobs?«
Ryk nickte. »Es war im Dezember 1866, als Schalk van Niekerk seinen Nachbarn einen Besuch abgestattet und diesen besonderen Stein bei dem jungen Erasmus bemerkt hat.«
»Magtig, ich erinnere mich daran!«, rief Daniel. »Er wollte ihn Mevrouw Jacobs abkaufen, und sie hat ihn fast für einen Narren gehalten und ihm den Stein geschenkt.«
»Richtig, und viele andere haben ihn ebenfalls für einen Narren gehalten, als er davon sprach, dass es sich bei dem Stein um einen Diamanten handeln könnte. Ich weiß gar nicht, durch wie viele Hände und unter wie viele skeptische Augen er gekommen ist. Er gelangte schließlich nach Colesberg zu Lorenzo Boyes, einem hohen Verwaltungsbeamten. Das war schon Mitte 1867. Dieser zog einen Chemiker zu Rate. Aber auch der war sich seiner Sache nicht ganz sicher. So kam der Stein nach Grahamstown und schließlich nach Kapstadt, wo der französische Konsul und ein Diamantenexperte, ein gewisser Louis Hond, den Stein zweifelsfrei als einen Diamanten von 211/4 Karat bestimmten, mit einem Wert von mindestens fünfhundert Pfund. Wie es heißt, hat Schalk van Niekerk ihn aus Trägheit und Desinteresse am Feilschen weit unter Preis verkauft, denn er hat nur dreihundertfünfzig Pfund dafür bekommen.«
»Nur?« Daniel schüttelte wie benommen den Kopf. »Dreihundertfünfzig sind doch ein Vermögen!« Er glaubte nicht, dass er für all sein Elfenbein, das er auf seiner Reise eingetauscht hatte, auch nur zweihundertfünfzig Pfund erhalten würde.
»Ja, für dreihundertfünfzig Pfund muss ein gewöhnlicher Arbeiter schon ein paar Jahre schuften«, gab Ryk schmunzelnd zu. »Habe im letzten Advertiser gelesen, dass ein Knecht in England sich glücklich schätzen kann, wenn er im Jahr vierzehn Pfund Lohn erhält, und ein gewöhnlicher Buchhalter kommt selten über vierzig Pfund, und in anderen Ländern sieht es nicht viel besser aus. Kein Wunder, dass Tausende von überall her zu uns an den Vaal strömen, um hier ihr Glück zu machen. Doch zurück zu Schalk van Niekerk. Fair, wie er ist, hat er den Jacobs von den dreihundertfünfzig Pfund die Hälfte abgegeben. Aber dieser erste Stein, dem sie später den Namen Heureka verliehen haben, hat noch nicht viel Staub aufgewirbelt. Die Leute haben einfach nicht daran geglaubt, dass das mehr als nur ein Zufall sein sollte. Und der Bursche aus London hat alle Skeptiker mit seiner Strauß-Wander-Diamanten-Theorie bestätigt.«
»Welcher Bursche aus London?«
Ryk warf ihm ein belustigtes Lächeln zu. »Dieser James R. Gregory, ein erfahrener Mineraloge mit all den Diplomen und so, hat sich eingehend am Vaal und Orange River umgesehen und dann kategorisch ausgeschlossen, dass die Erde dieser Region diamantenhaltig ist. Aber er musste ja den Fund des Heureka und einiger anderer kleiner Diamanten erklären, die danach noch aufgetaucht sind. Tja, und da ist er auf eine wirklich originelle Theorie verfallen. Er hat nämlich öffentlich und wiederholt erklärt, dass diese Steine von Straußen aus ganz anderen Gegenden an diesen Ort gebracht worden sind.«
Daniel furchte die Stirn. »Wie bitte?«
»Ja, das hat er wirklich behauptet!«
»Und wie soll das so ein Strauß anstellen?«
Ryk grinste breit. »Na ja, so ein Strauß pickt doch schon mal einen Stein mit auf. Oder so ein Oberflächendiamant kann sich im Gefieder festsetzen, wenn sich die Vögel im Sand niederlassen oder ihre Eier ausbrüten. Wie auch immer, dieser feine Londoner Experte hat das ernsthaft behauptet und seine Theorie sogar richtig wissenschaftlich ausgeführt. Tja, und die meisten Leute haben ihm auch geglaubt. Nur ein paar clevere Burschen wie Lorenzo Boyes und Louis Hond haben sich davon nicht täuschen lassen. Lorenzo Boyes hat mit einigen Kompagnons schon Ende letzten Jahres in Colesberg die Diamond Metal and Mineral Association gegründet und mit Nicolaas Waterboer, dem Häuptling der Griquas, Verhandlungen über eine alleinige Konzession für alle Schürfrechte auf dem Griquaterritorium aufgenommen. Die sind sich dann auch gleich mit den Lilienfeld-Brüdern in die Haare geraten.«
»Die beiden Händler hier aus Hope Town?«, fragte Daniel überrascht nach.
Ryk nickte. »Ja, Leopold und Martin Lilienfeld. Sie sind ja schon immer clevere Burschen gewesen und haben ein lukratives Geschäft bereits meilenweit gerochen, wenn andere noch im geschäftlichen Tiefschlaf gelegen haben. Und mit dem Star of South Africa, den sie geschickt an sich gebracht haben, ist ihnen ein ganz großer Coup gelungen, aber gleichzeitig haben sie sich die Clique um Lorenzo Boyes von der Diamond M. & M. Association zu Erzfeinden gemacht. Denn sie pochen auf ihr Abkommen mit Nicolaas Waterboer und behaupten, dass Schalk van Niekerk diesen Stein nie an die Lilienfeld-Brüder hätte verkaufen dürfen, ja dass der Kaffer, von dem van Niekerk den Diamanten hatte, kein Recht besaß, diesen an ihn zu veräußern. Sie sind mittlerweile vor Gericht gezogen. Der Streitwert lohnt sich ja auch, denn der Diamant hat 83½ Karat auf die Waage gebracht, war lupenrein und hat Schalk van Niekerk mit einem Schlag um elftausenddreihundert Pfund reicher gemacht. Die Leute um Lorenzo Boyes schätzen den wahren Wert jedoch eher auf gut und gern dreißigtausend Pfund, wenn er erst einmal geschliffen ist. Und weißt du, wofür Schalk van Niekerk ihn eingetauscht hat? Er hat diesem Griquahirten namens Swartboy fünfhundert Schafe, zehn Rinder und ein Pferd für den Stein gegeben – und der war damit so glücklich wie van Niekerk vermutlich mit seinen elftausenddreihundert Pfund.«
Der Bericht seines Freundes barg für Daniel eine unglaubliche Überraschung nach der anderen. Er dachte an den Stein, den ihm der schwarze Hirte auf Dutoitspan für den Tabak gegeben hatte. In den letzten Wochen hatte er schon mehrfach überlegt, ob der Stein nicht vielleicht doch einen gewissen Wert besaß. Nun ergriff ihn eine eigenartige Erregung, die fast an die Gewissheit grenzte, seit beinahe zwei Jahren einen Diamanten mit sich herumzutragen.
»Als das mit dem Star of South Africa durch alle Zeitungen ging, in den Burenstaaten, in der Kapkolonie und auch in Übersee, da begann das große Diamantenfieber – und der Wettlauf zum Vaal«, fuhr Ryk van Dyke fort. »Du glaubst gar nicht, wie viele Digger zum Vaal strömen. Die Leute zahlen zwölf Pfund und mehr, um auf einem der besseren Karren der Inland Transport Company, die so etwas wie einen regelmäßigen Zubringerdienst zwischen Kapstadt und dem Vaal unterhält, einen Sitzplatz zu ergattern. Die Fahrt auf diesen offenen Kastenwagen, die von acht Pferden gezogen werden, dauert volle zehn Tage, und ich habe von mehr als nur einem gehört, dass es eine unglaubliche Tortur ist. Und wer heute in Kapstadt ankommt und sich eines dieser pinkfarbenen Tickets kauft, muss sich in Wartelisten eintragen und sich mehrere Wochen gedulden, bis er endlich an der Reihe ist. Wer nicht genug Geld hat, der muss sich damit begnügen, für ein paar Pfund mit einem burischen Ochsengespann zu reisen, und du weißt ja, wie lange so ein Treck von Kapstadt zu uns dauert.«
»Bei besten Bedingungen mindestens vierzig Tage, zwei Monate sind die Regel und zehn Wochen keine Seltenheit«, sagte Daniel und nahm einen Schluck Brandy. Immer wieder gingen seine Gedanken zu dem Stein, den er in seinem ledernen Geldbeutel mit sich trug. Wenn es denn wirklich ein Diamant war, wie viel Karat mochte er dann haben?
Ryk griff zur Flasche und füllte ihre Gläser auf, ohne etwas um Daniels abwehrende Geste zu geben. »Ich sage dir, die Leute lassen sich die verrücktesten Dinge einfallen, um zu den Diamantenfeldern am Vaal zu kommen, und nicht wenige verlieren dabei ihr Leben, noch bevor sie die Große Karroo durchquert haben. Die ganz armen Schlucker, die ihr letztes Hemd für die Schiffspassage hergegeben haben, machen sich tatsächlich zu Fuß auf den Weg. Keiner weiß, wie viele von diesen Männern und Frauen elendig verhungern und verdursten, sich in den Bergen die Knochen brechen oder von wilden Tieren im veld gerissen werden. In jeder Canteen zwischen Klip Drift und Kapstadt hört man derartige Horrorgeschichten, und die Skelette, auf die man entlang des Weges immer wieder stößt, sprechen eine sehr beredte Sprache. Aber das Diamantenfieber ist fast immer stärker als die Stimme der Vernunft.«
»Sag mal, warum bist du denn noch immer hier, statt auch am Vaal nach Diamanten zu graben?«, wollte Daniel plötzlich wissen.
Ein spöttisches Lächeln huschte über das runde Gesicht des Schankwirts. »Dass man sich nach den Diamanten nur zu bücken braucht, ist eine von vielen Legenden, die zwischen hier und Feuerland kursieren. Natürlich passiert es schon mal, dass man einen Diamanten beim Sammeln von Feuerholz einfach so vor seinen Augen liegen sieht. Aber das sind die Ausnahmen. Wenn du Diamanten finden willst, musst du dir am Ufer einen Claim abstecken, eine Fläche von maximal dreißig Fuß im Quadrat ist erlaubt, und nach den Steinen schürfen. Und das ist verflucht harte Arbeit, die nicht immer von Erfolg gekrönt ist. Ich habe es ein paar Wochen versucht, ohne auch nur einen lausigen Diamantsplitter gefunden zu haben, und dabei habe ich die Erde so sorgfältig gesiebt und die Steine sortiert wie der Digger, der aus dem Claim neben mir in derselben Zeit fünf hübsche Steine mit insgesamt 84 Karat geholt hat. Und das hat mich dann daran erinnert, dass immer Tausende nachzumachen versuchen, was doch nur wenigen gelingt, nämlich durch pures Glück auf diamanthaltiges Gestein zu stoßen.«
»Und du meinst, du hast die Flinte nicht zu früh ins Korn geworfen?«
Ryk schüttelte den Kopf. »Mir ist eingefallen, dass ich nur Zeit vergeude, indem ich nach Diamanten grabe, während ich mich doch schon im Besitz einer Goldgrube befinde, die mit hundertprozentiger Sicherheit satte Gewinne abwirft, solange dieser Diamantenrausch anhält.«
»Du meinst damit deine Canteen hier, nicht wahr?«, fragte Daniel.
Ryks Antwort überraschte ihn. »Falsch. Die Witte Boom Canteen habe ich an den Glatzkopf und seine beiden Neffen verpachtet. Du hast Glück, dass du mich heute hier angetroffen hast. Ich hatte noch ein paar persönliche Sachen abzuholen.« Er deutete mit dem Kopf auf zwei Kisten, die in der Ecke standen. »Ich habe eine Canteen im Camp der Digger auf dem Südufer des Vaal eröffnet und sie The Midnight Cradle genannt. Eigentlich ist es nicht mehr als ein großes Zelt mit einem Tresen, aber für feste Gebäude hat in den Camps auch keiner Zeit. Ich sage dir, die Geschäfte laufen phantastisch!«
»Midnight Cradle? Wie kommst du nach Witte Boom Canteen ausgerechnet auf so einen Namen?«
Ryk lachte entwaffnend. »Die Diamantenfelder sind fest in der Hand der Uitlanders, Daniel. Wir Buren sind in der Minderheit. Engländer, Australier und Amerikaner machen mehr als zwei Drittel der Digger aus, und als Geschäftsmann hat man sich den veränderten Bedingungen anzupassen, wenn man Erfolg haben will. Eine cradle ist übrigens ein Kasten mit zwei oder auch drei untereinander angebrachten Sieben mit verschiedener Maschenstärke. Das oberste ist das gröbste und das unterste ist das feinste Sieb. Mit so einer Cradle siebt man die steinige Erde. Aber das wirst du ja bald mit eigenen Augen sehen.«
Daniel nippte an seinem Glas, denn er hatte allen Grund, einen klaren Kopf zu behalten, und blickte ihn fragend an.
Ryk zwinkerte ihm zu. »Ich sehe doch, wie gebannt du an meinen Lippen hängst, Daniel.«
»Magtig, das sind einfach faszinierende Geschichten, die du da erzählt hast.«
»Ach was, dir steht das Diamantenfieber ja schon auf dem Gesicht geschrieben! Dich hat es gepackt wie all die anderen, gib es nur zu.«
Daniel fühlte sich wie ertappt. »Übertreib mal nicht. Ich war mit dem, was ich bisher hatte, recht zufrieden.«
»Ja, weil dir bisher nichts Besseres in den Sinn gekommen ist, als wie dein Vater als Smouse übers Land zu ziehen«, erwiderte Ryk.
»Ich hätte Farmer werden können«, hielt Daniel ihm vor und wusste selbst, wie wenig überzeugt das klang.
»Die Scholle zu beackern, liegt dir nicht im Blut.«
»Aber das Leben eines Diamantendiggers, ja?«
»Dieses Fieber kann jeden packen, und ich spreche aus Erfahrung. Ich gebe dir jedoch einen guten Rat, Daniel.«
»Ich bin ganz Ohr.«
»Lass die Finger von den Diamanten, und vergiss es, dir einen Claim abzustecken und wie die anderen Digger von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang mit Spitzhacke und Schaufel in der Erde zu wühlen.« Er machte eine Pause. »Besinn dich auf das, was du den meisten anderen voraus hast.«
»Und das wäre?«
»Dein Wagen und deine Ochsen. Mit ihnen wirst du zwar nicht über Nacht zu einem reichen Mann, aber du kannst doch sicher sein, dass du beständig eine Menge Geld verdienst. Weißt du, was inzwischen für hundert Pfund Fracht, egal welcher Art, von Kapstadt nach Pniel gezahlt wird? Sage und schreibe vierzig Shilling!«
Daniel sah ihn ungläubig an. »Magtig, das ist ja mehr als viermal so hoch wie vor zwei Jahren.«
»Und die Frachtraten werden noch weiter steigen. Die Händler kommen mit dem Nachschub von Zelten, Werkzeugen und tausend anderen Dingen, die in den Camps gebraucht werden, gar nicht nach. Und die Preise sind für alles und jedes astronomisch in die Höhe geschnellt. In einem primitiven Diggercamp am Vaal zu leben ist bestimmt teurer als in einem netten Hotel in Paris oder London. Wie viel Tonnen Fracht kannst du mit deinem Gespann transportieren?« – »Zehn Tonnen.«
»Dann kannst du pro Fuhre satte zweihundert Pfund einstecken?«
Daniel machte große Augen. Für einen Gewinn von zweihundert Pfund hatte er bisher mindestens zwei Jahre durchs Land kutschieren und sich auf manche Gefahren einlassen müssen.
»In diesen Größenordnungen musst du jetzt denken, Daniel! Und lass dich nicht von den verdammten Steinen locken. Dein sicherster Claim ist dein Wagen«, riet Ryk ihm nachdrücklich. »Leute wie wir, die Händler, sind hier die sicheren Gewinner. Es hat schon seinen guten Grund, warum Männer wie Lorenzo Boyes und die Lilienfeld-Brüder nicht selbst hinaus auf die Diamantenfelder gezogen sind, sondern Handelsgesellschaften gegründet haben und von den Diggern leben, ob sie nun fündig werden oder nicht. Die Lilienfelds haben sich mit Louis Hond und einigen anderen cleveren Geschäftsleuten zusammengeschlossen. Die Gruppe ist unter den Diggern allgemein als die Hope Town Company bekannt. Sie haben übrigens Bultfontein aufgekauft.«
»Die Farm vom alten Querkopf Cornelis du Plooy?«, stieß Daniel hervor. »Sag bloß, da hat man auch Diamanten gefunden?«
»Nicht nur da, auch auf Dutoitspan«, teilte Ryk ihm mit. »Aber diese dry diggings, wie die Schürforte fern vom Fluss genannt werden, sind nicht halb so ergiebige wie die entlang des Vaal und unheimlich mühsam, weil einfach das Wasser zum Waschen der Erde fehlt. Außerdem gibt es auf den Farmen ständig Ärger. Adriaan van Wyk erlaubt auf seiner Farm nur Buren, gegen eine monatliche Gebühr von sieben Shilling und Sixpence nach Diamanten zu schürfen. Es sollen auch nur zweihundert Digger sein, die sich da abrackern, und das Wasser, das sie zum Leben herankarren müssen, kostet wohl mehr, als sie an Diamanten aus dem Boden holen. Und die Hope Town Company vergibt überhaupt keine Schürfrechte, sondern lässt Dutoitspan unter der Aufsicht von Cornelis du Plooy von Kaffern bearbeiten. Am besten vergisst du die Diamantenfarmen gleich wieder; denn da gibt es für einen aufgeweckten Burschen wie dich nichts zu holen. Bleib bei deinem Leisten, und du hältst alle Trümpfe in der Hand.«
»Ich werde darüber nachdenken.«
»Tu das.« Ryk leerte sein Glas und erhob sich. »Nimm es mir nicht krumm, aber ich muss jetzt los. Wir sehen uns ja bestimmt am Vaal River.«
»Worauf du dich verlassen kannst.«
Ryk beschrieb ihm, an welcher Stelle des Flusses er ihn und seine Canteen The Midnight Cradle finden konnte, und nach einem Händedruck und gegenseitigen guten Wünschen gingen sie getrennt ihrer Wege.
5
Daniel schwirrte der Kopf von all den unglaublichen Neuigkeiten, die er von Ryk erfahren hatte, und er konnte es schon jetzt nicht erwarten, zum Vaal zu kommen und selbst zu sehen, was dort vor sich ging. Ryks Worten nach mussten Tausende von Diggern die Flussufer bevölkern und Diamanten aus der Erde holen, zumindest einige von ihnen. Er versuchte sich das bildlich vorzustellen, doch es wollte ihm nicht so recht gelingen. Er zwang sich, zuerst einmal die Dinge in Angriff zu nehmen, die getan werden mussten, bevor er überhaupt darüber nachdenken konnte, ob er später in Richtung Vaal aufbrechen sollte. Deshalb begab er sich zu Jan Houtman, mit dem er seit Jahren Geschäfte machte und von dem er wusste, dass er ihm das Elfenbein der Matabele und Bamangwato abkaufen würde.
Jan Houtman, ein Klotz von einem Mann mit einem geradezu biblischen Bart, hatte in seinem Geschäft alle Hände voll zu tun, und als Daniel mitbekam, was derzeit für einen Sack Mehl oder für eine einfache Schaufel zu zahlen war, glaubte er erst, sich verhört zu haben. Ryk hatte nicht übertrieben, die Preise waren tatsächlich in atemberaubende Höhen gestiegen.
Endlich hatte Jan Houtman Zeit für ihn. »Ah, der Schwede lässt sich auch mal wieder bei uns blicken!«, begrüßte er ihn mit der ihm eigenen Leutseligkeit. »Was soll’s denn sein – Picke, Schaufel und Cradle?«
»Vielleicht später, zuerst einmal habe ich Ihnen etwas anzubieten«, antwortete Daniel. »Ich habe den Wagen voller Elfenbein.«
Jan Houtman konnte nicht glauben, dass Daniel Lundquist von dem Tumult der vergangenen Monate nichts mitbekommen hatte und gerade erst völlig unvorbereitet von seiner letzten großen Handelsreise nach Hope Town zurückgekehrt war.
»Ein Wagen voll Elfenbein ist auch kein schlechter Start, um es hier zu was zu bringen, Schwede. Gehen wir und sehen wir uns die Stoßzähne mal an«, schlug er vor und begab sich mit ihm hinüber zum Outspan, wo er mit Daniel in den Wagen kletterte und das Elfenbein begutachtete.
»Nun ja, mit Diamanten ist im Moment ein besseres Geschäft zu machen, aber Elfenbein hat auch seinen guten Preis, besonders wenn es von so prächtiger Qualität ist wie das hier. Ich denke, wir werden uns auch diesmal handelseinig werden.«
Das wurden sie auch, und noch vor zwei Jahren wäre Daniel der Erlös wie ein kleines Vermögen vorgekommen. Doch er musste seine Vorräte auffüllen und wollte auch eine Schürfausrüstung erstehen, und nachdem Daniel seine Einkäufe getätigt und sie miteinander abgerechnet hatten, blieben ihm gerade noch siebzig Pfund.
»Die Zeiten haben sich geändert, Schwede«, bedauerte Jan Houtman, als er Daniels betretenes Gesicht bei der Aufstellung seiner Rechnung sah. »Aber was halten Sie davon, wenn Sie für mich Waren aus Kapstadt holen? Ich zahle Ihnen pro hundert Pfund Fracht einen Aufschlag von fünf Shilling auf die zurzeit übliche Frachtrate. Im Augenblick würde Ihnen das mit meinem Bonus einundzwanzig Pfund pro Tonne Fracht bringen, und das sicherlich nicht nur für eine Fuhre. Ich brauche ganze Wagenladungen Zelte, Bohlen, Wellbleche und Gerätschaften aller Art. Was halten Sie davon?«
»Danke, Mijnheer Houtman, ich werde mir Ihr Angebot durch den Kopf gehen lassen.«
Jan Houtman nickte mit einem wissenden Blick in den Augen, die unter buschigen Brauen lagen. »Ach was, Sie werden wie all die anderen zum Vaal ziehen und nach mooi klippe graben«, sagte er seufzend.
Daniel machte eine vage Geste, wünschte ihm einen guten Tag und verließ Jan Houtmans Emporium. Er hatte seiner Ungeduld jetzt seit fast zwei Stunden die Zügel angelegt. Nun drängte es ihn mit aller Macht, in den Laden des nächsten Diamantenhändlers zu kommen und herauszufinden, ob der Stein des Griquahirten etwas wert war und wenn ja, wie viel.
Ein entsprechendes Geschäft zu finden, war nicht schwer. Die einzige Schwierigkeit, der Daniel sich ausgesetzt sah, war zu entscheiden, welches er aufsuchen sollte. Allein in seiner unmittelbaren Nähe machte sich ein halbes Dutzend Aufkäufer auf beiden Seiten der Straße gegenseitig Konkurrenz.
Er begab sich nach kurzem Zögern in den Laden von Cornelius Dewitt. Das Schild Diamant Kooper – Diamond Merchant über der Tür hob sich mit seinen sorgfältig ausgemalten und kunstvoll abgesetzten Buchstaben sowie seinen liebevollen Randverzierungen deutlich von den sichtlich hastig angefertigten Ladenschildern der anderen Diamantenhändler ab.
Das Geschäft bestand nur aus einem kleinen Raum mit einer Schlafpritsche in der hinteren Ecke und einem Tisch am Fenster, hinter dem Cornelius Dewitt saß.
Daniel war überrascht, einen Mann vor sich zu sehen, der kaum älter sein konnte als er selbst. Er hatte mit einem erfahrenen Kaufmann in mittleren Jahren gerechnet und wäre am liebsten wieder gegangen.
»Gott zum Gruße, Mijnheer. Womit kann ich Ihnen zu Diensten sein?«
»Ich möchte wissen, was der hier wert ist«, sagte Daniel und suchte unter all den Münzen in seinem Geldbeutel nach dem Stein. Er fand ihn und reichte ihn Cornelius Dewitt.
Dieser klemmte sich eine kleine Lupe ins rechte Auge, nahm den Stein zwischen Zeigefinger und Daumen und hielt ihn ins Licht. Mit klopfendem Herzen stand Daniel vor dem Tisch. Sein Mund war vor Aufregung ganz trocken. Hatte er all die Zeit einen Diamanten als Talisman bei sich getragen? Warum, um alles in der Welt, ließ sich der Bursche bloß so lange Zeit? Wie töricht von ihm, sich von einem hübsch gemalten Schild beeinflussen zu lassen. Er hätte das Geschäft der Gebrüder Lilienfeld aufsuchen sollen. Da konnte er sicher sein, dass sie was von Diamanten verstanden.
Cornelius Dewitt gab schließlich ein Schnalzen von sich, das alles bedeuten konnte – Anerkennung wie auch Geringschätzung darüber, dass jemand ihm einen wertlosen Glaskiesel zur Begutachtung brachte.