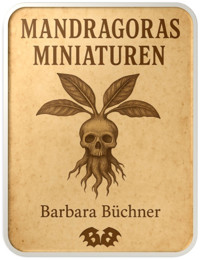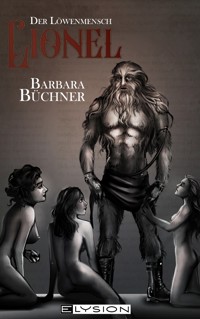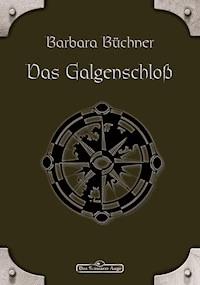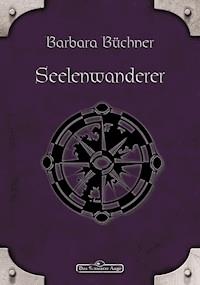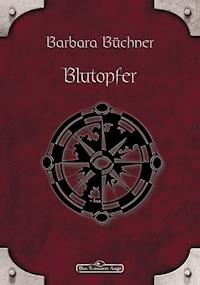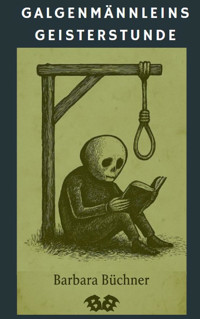
2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Seit sechzig Jahren schreibt Barbara Büchner über Gespenster, Alpträume und andere nächtliche Erscheinungen – nun öffnet sie ihr Archiv der seltsamen Begebenheiten. In diesen Erzählungen begegnet man Karussells, die geometrisch unmöglich sind, Läden, die ihre Kunden verschlingen, spukenden Villen und törichten Kindern, die in verfluchten Häusern ihr Schicksal finden. Zwischen makabrem Humor und kalter Gänsehaut entfaltet sich eine Welt, in der das Übernatürliche so selbstverständlich ist wie der Schlaf – und das Erwachen manchmal der wahre Albtraum. Wer sich furchtlos in die Schatten wagt, wird reich belohnt: mit Geschichten voller Stil, Verstand und böser Eleganz – typisch Barbara Büchner.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Barbara Büchner
Galgenmännleins Geisterstunde
Unheimliche Erzählungen
Galgenmännleins Geisterstunde
Eine Sammlung von Barbara Büchner
Aus der Reihe „Portiunculas Bibliothek“ (Band 2)
Copyright © 2025 Barbara Büchner
Alle Rechte vorbehalten
Cover und Illustrationen: Barbara Büchner und „Thekla“ (GPT-5)
Erstveröffentlichung in der Portiuncula Reihe
Veröffentlicht über Tolino Media Gmbh & Co .Kg
ISBN
Eine Warnung an die verwegenen Leser
Diese Geschichten entstanden über einen langen Zeitraum hinweg – immerhin bin ich jetzt seit rund 60 Jahren Schriftstellerin (wenn man mein erstes Buch nicht mitrechnet, das ich als Achtjährige in Blockschrift in ein Schulheft geschrieben habe: „Ekspdesion ins Unbegane.“) Es war sechs Heftseiten lang. Das nächste schrieb ich mit zwölf Jahren, bereits auf einer Reiseschreibmaschine – ein heroisches Epos um die Ritter Hanke und Silvio, dessen Handlung hauptsächlich dazu diente, meine verhassten Professoren im Gymnasium und sonstige Erzfeinde splatternäßig abzuschlachten. Sein literarisches Gewicht kann ich nicht bestimmen, aber das Manuskript wog ungefähr ein halbes Kilo.
Von da ab verliere ich die Übersicht, denn meine Arbeiten wurden immer zahlreicher. Anfangs wurden meine Geschichten mit Stolz der Verwandtschaft präsentiert. Später nicht mehr. Mit 16 war ich ein garstiges kleines Konglomerat aus Lovecraft, Poe und einer bösartigen viktorianischen Pfarrersfrau geworden, getrieben von morbiden Lüsten, unterschwelligem Sadismus und einem entschiedenen Vernichtungswillen gegen alle Schurken in meinen Büchern. Wenn schon mal eine Liebesgeschichte vorkam, entpuppte sich der Geliebte garantiert als Werwolf. Und wurde prompt auf dem Abrichtungsplatz angemeldet.
Sind Sie furchtlos genug, meine makabere Welt zu betreten? Dann herzlich willkommen.
Sternenfahrt
Sie hatten fast ihr ganzes Geld ausgegeben, aber als sie die Maschine sahen, wollten sie auch damit fahren.
Della zögerte. Sie war müde, und sie hatte langsam genug von den kreischenden Lautsprecherstimmen und dem fahlen Flimmern der Automaten und dem irren Gelächter, das aus dem Spukschloss in die Nacht hinausgellte, aber sie wusste auch, dass Ella und Mandy keine Ruhe geben würden, bis sie nicht den letzten Cent in irgendeinen Einwurfschlitz gesteckt hatten, und im Grunde war es gleichgültig, ob sie hier oder anderswo fuhren. Außerdem war die Maschine klein und sah nicht so aus, als ob einem darauf übel würde.
Sie hieß „Stemenfahrt". Der Name stand in gelben, glitzernden Flittersternen auf der schwarzen Plattform geschrieben, auf der sie sich drehte wie ein Kreisel auf einer flachen Hand, eine seltsam deformierte Pyramide, auf deren dunklen Seitenflächen silberne und kupferfarbene Monde und Planeten aufgemalt waren und ein fetter Saturn mit einem hypnotisch funkelnden Ring um die Mitte und viele kleine, wie Leuchtfeuer blinkende Sterne.
Della fuhr sich mit dem Handrücken über die Stirn. „Komisches Ding", dachte sie. Sie hatte an diesem Abend so viele Maschinen gesehen. Große flammende Feuerräder, auf denen Ella und Mandy nicht fahren durften, weil sie erst sechs und acht Jahre alt waren. Riesige weiß illuminierte Spinnen, die ihre Passagiere in der Luft herumwirbelten und in den schwarzen Nachthimmel schleuderten. Zylindrische Gondeln, die rasend schnell an hydraulischen Armen rotierten, und haushohe Stahlkonstruktionen, auf denen die Schlitten jaulend in eine halsbrecherische Tiefe rasten. Maschinen, neben denen sich die „Sternenfahrt" klein und schäbig und ein wenig lächerlich ausnahm, wie ein zu groß geratener Zauberhut, den jemand auf das nächtliche Rondeau gestülpt hatte.
„Aber das ist jetzt endgültig das letzte Mal", sagte sie und suchte im bunten Zwielicht neben sich nach Ellas Hand, „das letzte Mal, hörst du?" Es dauerte ein paar Sekunden, bis sie merkte, dass sie im Leeren herumgriff und Ella und Mandy längst nicht mehr da waren, sondern Hand in Hand vor der „Stemenfahrt" standen und gebannt zusahen, wie sich die Monde und Planeten und Sterne an ihnen vorbeidrehten. Sie standen ganz still und eng nebeneinander, die kleinen Fäuste fest um die Münzen geballt, wie zwei weiße Zuckergussfigürchen auf einem schwarzen Kuchen, der sich drehte und drehte und glitzerte und sich drehte, und die beiden weißen Figürchen drehten sich mit.
Della schloss irritiert die Augen. Eine Sekunde hatte sie das Bedürfnis gehabt, in dieses Drehen hinein zu sinken, sich dem Sog hinzugeben, der sie in einem langsamen Strudel auf die Maschine zu spülte, einem gemächlichen, weitausholenden Strudel.. .
Sie blinzelte und rieb mit den Fingerknöcheln die Schläfe. „Komisch", dachte sie. Irgendetwas an der Maschine war komisch. Sie wusste nicht, was es war, aber irgendetwas war nicht so, wie es sein sollte. Irgendetwas war anders.
Sie starrte die Pyramide an. Es war keine richtige Pyramide. Es war etwas, das sie noch nie gesehen hatte. Jetzt erst sah sie, dass die schwache Kurve dieser gekrümmten Seitenwände anders war, eine abnorme Linie - eine Linie, die es nicht geben sollte . .. Und die Rundung der Plattform, der spitze Kegel am oberen Ende, die Monde und Planeten, alles das waren keine Rundungen, keine Kegel, keine Monde, es waren sonderbare Verzerrungen von Rundungen und Kegeln und Monden. Sie waren falsch. Alles an der Maschine war falsch - und mehr noch, es war unmöglich: Keine Geometrie kannte diese widersinnig geschwungenen Kurven, diese Linien, diese Formen ...
„Mama!" rief Ellas dünne brüchige Stimme. „Wir kommen dran!"
Della winkte automatisch, winkte mit einer schlaffen Handbewegung, während sie die fahl flimmernden Sterne betrachtete. Sie schienen zu Sternbildern angeordnet, aber welche Sternbilder waren das - diese kaltfunkelnden Rhomben und Sicheln und Oktaeder? Welche ständig wechselnden Konstellationen, die in sich zusammenfielen und sich ausdehnten wie die Sternchen in einem Kaleidoskop? Und die Monde, diese kalten, erlöschenden Monde, die in trägem Schwung durch das Dunkel rotierten - da ein Doppelmond - dort drei pyramidenförmig übereinander angeordnete Sicheln - Monde, von denen dunkle Feuerstrahlen ausgingen, Monde mit sichelförmigen Hörnern ... Und die Bahnen, in denen sie kreisten! Diese schwankenden, elliptischen Bahnen!
„Huh!" rief Mandy. „Es fährt! Mama! Schau her!"
„Nein", dachte Della, „nein, es darf nicht fahren. Was ist das überhaupt? Was ist das?“
Der Zauberhut schwankte auf seiner Plattform, wackelte täppisch und begann sich zu drehen, und gleichzeitig begann der Musikautomat im Inneren der Maschine zu spielen, eine leise, heitere Melodie, zu der sich der Hut nach beiden Seiten verneigte und den Stern an seiner Spitze aufleuchten ließ.
Della hörte Mandy im Inneren der Maschine quietschen, ein amüsiertes Quietschen, das zu der amüsierten Musik passte - sie lachten beide, Mandy und der asthmatische Apparat, aus dem es trillerte und klimperte und aus hohlen Lungen pfiff, und dann lachte nur noch der Apparat, lachte sein blechernes Lachen, während der Hut seinen wackligen Tanz tanzte - dieser Hut, den man über Ella und Mandy gestülpt hatte, dieser große schwarzfunkelnde Hexenhut ...
„Nein", dachte Della, „nein, mein Gott, ich bin einfach müde, es ist ja auch keine Kleinigkeit, den ganzen Abend auf diesen idiotischen Maschinerien im Kreis zu fahren . . . wie lange fährt das Ding wohl? Zwei, drei Minuten? Sie fahren nie lange. Und dann ist es aus - das war jetzt endgültig das Letzte .. ."
Sie schloss einen kurzen Moment lang die Augen, überließ sich ganz dem hysterischen Lärm, der um sie flackerte wie das Licht eines Lichtzerhackers, diesem weißen, gleißenden Lärm, der das eintönig heitere Trillern der kleinen Maschine verschlang . . . dem Heulen der Achterbahnen, dem Rollen und Klicken der Flipper, dem Wahnsinnsgelächter aus dem Spukschloss, das in regelmäßigen Abständen losplärrte wie eine steckengebliebene Schallplatte. Alles war, wie es den ganzen Abend gewesen war. Aus der Automatenhalle kam das Sirenengeheul der Abschussjäger, das trockene Bellen der Elektronengewehre, das Klirren der Pennyfalls. Auf der gipsernen Zinne des Spukschlosses drehte ein in schmutzige Leichentücher gehülltes Skelett seine Runden, glotzte eine verstaubte Riesenspinne aus bleichen Neonaugen. Aus dem „Haus der Illusionen" kam das schrille Lachen der Gefoppten. Alles war, wie es sein sollte. Nur die Maschine war nicht ganz richtig.
Sie drehte sich schneller, und die Musik dudelte heller und fröhlicher, während der Hut auf der Plattform hopste wie auf einem schwachsinnig wackelnden Kopf. Die seltsamen Monde und Sternbilder zogen in dunkelglühenden Streifen über die Seitenwände.
„So schnell", dachte Della, „so schnell!" Die fahlen Lichtfünkchen flogen jetzt wirbelnd an ihr vorbei, flimmerten über die Wände wie Schneegestöber. „Nein, wie idiotisch!" dachte sie - und dazu kippte der Hut jetzt noch, rotierte schräg auf der Plattform - so schnell - „Mandy wird totenübel sein . . . wie kann man das Ding nur so idiotisch schnell fahren lassen ..."
„Es ist zu schnell", dachte sie, „viel zu schnell.. . das kann nicht in Ordnung sein, da ist irgendwas falsch..."
Aber die Musik spielte weiter, trillerte schrill und unbekümmert in der warmen Nacht, und plötzlich senkte sich der Hut wieder, drehte sich aufrecht und wurde langsamer. Della konnte die Monde und Planeten wieder sehen, die kreisenden Sternbilder wurden größer und klarer, der Hut hopste noch ein paarmal, verbeugte sich und blieb stehen. Die Lichtpünktchen auf seinen Seitenflächen zuckten klein und glitzernd.
Della strich sich das Haar von den Schläfen zurück. Sonderbar - nun sah die Maschine wiederum klein und schäbig aus, auch wenn sie immer noch nicht ganz richtig war. Die Monde - und diese seltsamen Sternbilder.
Und warum kam niemand, um die Türen zu öffnen? Warum stand die Maschine nur da, während die Musik spielte? Und warum … war das Innere leer?
***
Zwischenfall im „Magic Land“
Was mit Darby geschah, begann an einem Samstagnachmittag in der Portobello Road, einem dunklen Nachmittag, an dem nur wenige Läden geöffnet waren, denn die Touristensaison hatte noch nicht begonnen. Es geschah im „Magic Land", einem kleinen Laden am oberen Ende der Straße (gegen Notting Hill zu), wo sich die Magazine der Straßenhändler und die leeren Buden zugrunde gegangener Trödler befanden. Das „Magic Land" war eine rühmliche Ausnahme in dieser verfallenen Umgebung: Es hatte eine schöne schwarzlackierte Fassade und zwei ovale Schaufenster, die wie altmodische Brillengläser aussahen. Sie waren dunkel getönt, so dass es drinnen stockfinster gewesen wäre, hätte nicht hoch oben an der Decke eine Lampe gebrannt – und vielleicht lag es an dieser trüben und trügerischen Beleuchtung, dass Darby den Eindruck gewann, das „Magic Land" sei innen viel größer, sehr viel größer, als seine schmächtige Außenfront ahnen ließ. Jedenfalls war er gut eine Stunde drinnen herumgegangen, ehe er sich wieder in der Nähe der Türe befand ...
Aber fangen wir einmal beim Anfang an, bei Darby nämlich. Er war ein kleiner Mann, von durchschnittlichem Äußeren, und trug einen gelben Schnurrbart. Auch sein Charakter war eher durchschnittlich, wenn man von einer Eigenschaft absah, die sich bei ihm in ungewöhnlichem Ausmaß herausgeprägt hatte, ja fast zur Besessenheit geworden war, sodass er keinen Schritt mehr tun konnte, ohne dass sie zum Vorschein kam: Darby hatte ein Talent zur Kritik – ein ganz besonderes Talent.
Wo er ging und stand, wurden die Bücher zu Groschenromanen, das Silber zu Blech, die Musik zu Gassenhauern. Nicht, dass dabei irgendwelche okkulten Kräfte im Spiel gewesen wären – es lag einfach an der Art, wie Darby die Dinge betrachtete, wie er sie in die Hand nahm und in seinen feuchten Handflächen drehte und wendete, ehe er sie mit einer unnachahmlich gelangweilten Geste – der Geste eines Weisen, der einen plumpen Trick durchschaut hat – an ihren Platz zurückfallen ließ.
Er konnte ein Buch ruinieren, indem er nichts weiter tat, als seinen Titel laut und näselnd vorzulesen, oder ein Musikstück, indem er seine Harmonien gassenhauemd mitsang, oder ein Bild, indem er lässig auf einen unbedeutenden Fehler darin aufmerksam machte. Eine kleine Handbewegung, ein Blick genügte, um die Dinge wie in einem Zerrspiegel sichtbar werden zu lassen, lächerliche und bedauernswerte Monstren, die ein paar Sekunden lang am Pranger seiner Kritik standen und dann eilig ins Dunkel zurücksanken.
So war Darby, und es gab nicht wenige Leute, die ihm das übelnahmen, aber sie sagten wohlweislich nichts darüber . Sonst wäre es ihnen ergangen wie dem unglücklichen Besitzer des „Magic Land", der es einmal, ein einziges Mal gewagt hatte, einen schwachen Protest einzulegen. Das war, als Darby sich über den Ladentisch beugte und mit dem Griff eines geübten Henkers einen kleinen Gedichtband am Schlafittchen nahm, der bisher unbehelligt zwischen Silberschmuck und Platten vor sich hingedöst hatte.
Der Besitzer des Ladens – ein blasser junger Mensch, von dem im Halbdunkel nie viel mehr zu sehen war als ein paar grünliche, äußerst unangenehme Augen – blickte auf, als er Darby hinter sich deklamieren hörte, halblaut und mit dem ganzen entnervenden Pathos eines Schmierenschauspielers:
„Die Wäuse von Lübe und Tod des Korrnetts Krüstof Marüa Rülke –"
Dann fiel das Buch mit einem leisen Aufschlag an seinen Platz zurück.
„Warum tun Sie das?" fragte der Besitzer des „Magic Land".
„Was?" fragte Darby.
Der Besitzer drehte sich um, und seine hellen Augen leuchteten im Dunkel wie Feenaugen. „Wenn Ihnen das Buch nicht zusagt, lassen Sie es liegen, aber verhöhnen Sie es nicht. Ich liebe meine Bücher."
Darby zuckte die Achseln. „Ich habe ja auch nichts dagegen", widersprach er pikiert. „Deswegen brauchen Sie mich nicht gleich so anzufahren, lieber Mann, weil ich mir eine kritische Bemerkung erlaube! Es ist ja schließlich keine heilige Reliquie, oder? Man wird doch noch ein Wort sagen dürfen!"
„Nicht über meine Bücher", antwortete der Besitzer des „Magic Land".
Darby stieß entrüstet die Luft durch die Nasenlöcher. „Du meine Güte! Jetzt machen Sie aber einen Punkt, mein lieber Mann! Ist es vielleicht Das Große Werk Des Jahrhunderts? Größer als die Ilias? Die Odyssee? Darf man sich ihm nur auf den Knien rutschend nahem? Ist es Häresie, ein kritisches Wort darüber zu sagen? Man muss diese Dinge doch mit einer gewissen kritischen Distanz betrachten können, meinen Sie nicht?"
Der Besitzer des „Magic Land" gab keine Antwort, und als Darby genauer hinsah (es war wirklich sehr dunkel), war er gar nicht mehr dort, wo er gewesen war, sondern stand am anderen Ende des Ladens neben der Tür. Seine hellen Augen glitzerten, als Darby (schneller, als er vorgehabt hatte) den seltsamen Laden verließ.
*
Am nächsten Samstag jedoch, als Darby wiederkam, schien er den Wortwechsel bereits vergessen zu haben. Jedenfalls machte er keine Bemerkung darüber. Es war Darby selbst, der auf die Sache zurückkam.
Er hatte auf einem Regal, das er noch nicht untersucht hatte (es war erstaunlich, wie viele Regale es in diesem kleinen Laden gab!) Poes Gesammelte Werke entdeckt, leicht beschädigt und zum Vorzugspreis von ein Pfund fünfzig. Die Bände waren altertümlich ausgestattet, der geprägte Ledereinband knirschte, als Darby ihn in den Händen bog.
„Mögen Sie Poe?" fragte die Stimme des Besitzers, und zwar – was Darby nicht wenig irritierte – hinter seiner linken Schulter. Er hätte schwören können, dass noch vor einer Minute hinter ihm in der Mauerecke eine Glasvitrine voll Silber gewesen war, aber jetzt war nur die leere Mauer mit ihrer hässlichen Tapete da, und daran lehnte der Besitzer des „Magic Land". Er lächelte, und einen Augenblick lang durchfuhr es Darby, dass er dieses Lächeln schon einmal gesehen hatte, in einem Zusammenhang, der ihm jetzt nicht mehr einfiel.
„Nun ja", sagte er. „Bisschen altmodisch, nicht wahr? Und neurotisch. Sehr neurotisch. Wenn man alle diese billigen viktorianischen Gruseleffekte wegstreicht –"
„Ich mag Poe", sagte der Besitzer, und in seiner Stimme war ein merkwürdiger Ton, fast wie ein leises Prasseln.
Darby zuckte die Achseln. „Ich will nichts gesagt haben; ich sehe schon, Sie sind da etwas empfindlich. Aber wenn man Poe wirklich hinterfragt – psychologisch seziert, meine ich –"
„Davon verstehe ich nichts", flüsterte der andere mit sanfter Stimme. „Aber ich sehe schon, worum es Ihnen geht. Schön, Sie sollen es haben."
Und genau da zerfiel das Buch, das Darby immer noch in der Hand hielt (es war „Die denkwürdigen Erlebnisse des Arthur Gordon Pym"), zerfiel zu einem Haufen grauer Blätter, die raschelnd zu Boden wirbelten. Ein dünner, aber sehr unangenehmer Geruch stieg aus dem Papierhaufen auf, der Geruch von vermodertem Papier.
„Diese Bücher sind alt und schlecht gebunden, mein Herr", sagte der Besitzer des „Magic Land" und schlenderte achselzuckend in seinen Winkel neben den dunklen Fensterscheiben zurück.
Darby starrte benommen die Seiten an, die rund um ihn auf dem Fußboden lagen. Das Buch hatte einen recht soliden Eindruck gemacht, als er es aus dem Regal genommen hatte, und doch . . . Als er sich bückte und eines der Blätter aufhob, krümmte es sich in seiner Hand, knisterte wie von unsichtbaren Flammen erfasst und zerfiel in zwei Teile.
„Merkwürdig!" dachte Darby. Aber natürlich war es nicht unerklärlich – das Buch mochte auf schlechtem Papier gedruckt worden sein, vielleicht während des Krieges, und er hatte es wohl doch zu grob angefasst.. .
„Tut mir leid", sagte er, aber der Ladenbesitzer war nirgends zu sehen. Auf die Art blieb es Darby erspart, gleich doppelt um Entschuldigung bitten zu müssen: Als er sich nämlich vorbeugte, hatte er eine kleine Puppe gestreift (offenbar war er ein wenig tollpatschig in seinem Schrecken über das verdorbene Buch) und hatte sie umgestoßen, wobei ihr Arme und Beine abfielen, sodass sie wie der Leichnam eines Gevierteilten auf der schwarzen Kommode lag.
Darby versuchte zwar, sie notdürftig wieder zusammenzusetzen, aber als er sie anfasste, rollte auch noch der Kopf davon, und so ließ er es lieber bleiben. In der allgemeinen Dunkelheit war es ohnehin unwahrscheinlich, dass das Unheil bald entdeckt würde, und außerdem konnte es auch jemand anders getan haben.
Er schlüpfte möglichst unauffällig aus dem Winkel heraus und begab sich zu einem Tisch in der Nähe des Hinterzimmers, auf dem ein wüstes Durcheinander von Büchern, Platten, porzellanenen Nippes und billigem Schmuck ausgebreitet lag. Im Moment fühlte er sich, nachdem er soviel Schaden angerichtet hatte, zumindest moralisch verpflichtet, irgendetwas zu kaufen – wenigstens eine nicht allzu teure Kleinigkeit, bevor der Besitzer auf den Gedanken kam, Schadenersatz zu verlangen. Immerhin war es gut möglich, dass dieser schlüpfrige Bursche von irgendwoher – vielleicht von der eisernen Wendeltreppe zum Oberstock aus – beobachtet hatte, wie er die Puppe ruinierte, und es war vielleicht besser, ihn günstig zu stimmen.
Er hatte allerdings wenig Glück. In dem matten Licht sah alles viel besser aus, als es dann tatsächlich war, und so bekam er der Reihe nach eine Unmenge Ramsch in die Hand. Ein silbernes Armband, das zuerst in recht gutem Zustand zu sein schien, entpuppte sich als so geschwärzt, als sei es in einem Feuer gelegen; ein kleiner blecherner Reiter zerbrach in der Mitte, als er ihn aufhob; bei einer mit gelben Rosen und blassen indischen Göttern bemalten Blechbüchse wiederum zeigte sich, dass die Farbe auf der Rückseite in dunklen Schuppen herunterfiel, und einem kristallgläsernen Flakon – dem Etikett nach mit Parfum gefüllt – entströmte beim Öffnen ein infernalischer Geruch nach Buttersäure.
„Ramschladen!“ dachte Darby wütend und war nahe daran, einfach zu gehen, als er schließlich doch noch etwas halbwegs Brauchbares fand: Einen gläsernen Briefbeschwerer, in den ein Stück Rosenquarz eingelassen war. Nichts Besonderes, aber der Preis war billig, und man konnte ihn immerhin irgendwo als Dekoration hinstellen.
Der Besitzer des „Magic Land" kam hinter dem Ladentisch hervor, kaum dass der Kunde ihn gerufen hatte. Sein maskenhaftes Lächeln war Darby unter den Umständen doppelt unangenehm — es war eigentlich gar kein richtiges Lächeln, dachte er, sondern ein breites gefräßiges Grinsen, und dabei merkwürdig starr, als gehörte es gar nicht zu einem menschlichen Gesicht. Auch die grünen Augen, die über diesem Grinsen aus dem Halbdunkel glühten, waren keine ganz menschlichen Augen.
„Nun, haben Sie doch noch etwas gefunden, das Ihnen gefällt?" fragte er, als Darby die Glaskugel auf den Ladentisch legte. „Ein hübsches Ding, mein Herr, ein sehr hübsches kleines Ding. Vierzig Pence, weil Sie's sind."
Darby gab keine Antwort. Er starrte mit immer größer werdenden Augen an, was da vor ihm auf der Ladentheke lag – ein formloser Klumpen Glas, in dem ein ausgebleichtes Stück Kiesel steckte.
„Nein!" wisperte er betäubt.
Der Besitzer des „Magic Land" legte den Kopf schief und grinste wie ein Gehenkter.
„Nicht?" fragte er sanft. „Wollen Sie's nicht haben? Vielleicht etwas anderes?"
Darby hörte ihn gar nicht. Er streckte einen zitternden Finger aus und tippte das Ding an, das wie eine abscheuliche Missgeburt auf dem Ladentisch lag – und es zerfiel, als hätte man es in Säure getaucht, zerfiel zu einer winzigen Menge von übelriechendem Staub. Und noch während er hinstarrte, ging eine schwache Bewegung über die Theke, als fegte ein unsichtbares Verderben darüber hin. Der Band mit den Rilke–Gedichten blähte sich in der Mitte auf und fiel knisternd in sich zusammen. Eine schwärzliche Verfärbung zog über den Silberschmuck. Die Platten warfen sich. Das ganze Sammelsurium auf dem Tisch tobte ein paar Sekunden lang wie in einem stummen Kampf und schrumpfte dann zu einer dunklen, rasch zerfallenden Masse zusammen.
„Kann ich Ihnen sonst noch etwas zeigen?" fragte der Besitzer des „Magic Land". Aber Darby hatte gerade noch so viel Kraft, „Auf Wiedersehen!" zu stammeln, dann schoss er quer durch den halbdunklen Raum davon – und keine Sekunde zu früh: Hinter ihm krachte und knisterte es wie ein Feuerwerk, und auf den Regalen begann ein Gerumpel, als hätte sich der gesamte Trödelkram auf die Beine gemacht, an ihm Rache zu nehmen (wozu das „Magic Land", wie wir gesehen haben, Grund genug hatte). Darby schaffte es gerade noch, die Tür zu erreichen, als es ihm schon um die Ohren flog; Bücher, Nippsachen, Platten, Bilder, und gerade, als er die Türe aufriss –deren Klinke sich schrecklich heiß anfühlte –, fiel von oben etwas Schweres herunter und zersprang hinter ihm auf dem Boden, wobei es ihn von oben bis unten mit feuriger Asche besprühte.
Das Letzte, was er vom Besitzer des „Magic Land" sah, war sein Grinsen, das unbeweglich am anderen Ende des Ladens hing, und in dem Moment fiel ihm auch ein, wo er es schon einmal gesehen hatte: Es war das Grinsen der Cheshire–Katze aus „Alice in Wonderland".
***
Das kalte Zimmer
„Du hast uns verlassen,
wir aber werden dich niemals verlassen.“
Ich mag diese Villa nicht, dachte Cathy Mallory. Schlimmer noch. Ich hasse sie und mir graut vor ihr!
Aber wie sollte sie ihrem Ehemann Angus beibringen, was sie empfand?
Äußerlich war an der Villa Wertham – einem hübschen Stück viktorianischer Zuckerbäcker-Architektur in hellblau, rosa und weiß – nichts auszusetzen. Das Quartier war sauber und preiswert. Es wurde von Misses und Miss Wellbutton besorgt, Mutter und Tochter, Schottinnen aus Edinburgh, was dem Ganzen einen angenehm heimatlichen Touch gab. Die Einrichtung war etwas antiquiert, aber gemütlich. Gut, die Bilder waren nicht nach dem Geschmack der Mallorys, sie hätten lieber hübsche Aquarelle gehabt als diese Unzahl von Ölgemälden und Fotografien ausländischer Berge, die alle sehr frostig, grimmig und sturmumweht aussahen, aber natürlich hatten leidenschaftliche Bergsteiger wie die beiden längst verstorbenen Lords Wertham ihnen zusagende Sujets gewählt.
Angus´ Chef in Glasgow hatte das Quartier empfohlen, er kannte die Besitzer und meinte, es sei billiger und zugleich für einen frischgebackenen Prokuristen auf Hochzeitsreise passender, ein Privatquartier zu nützen, als sich mit tausend plebejischen Sommertouristen in ein Hotel zu quetschen.
Cathy sah das nicht so. Die junge Schottin war nicht umsonst im Schatten des Ben MacDhui, des von Spukerscheinungen heimgesuchten Berges in den Cairngorms, geboren worden. Sie erkannte einen Geist, wenn sie einen spürte, und kein Zweifel: In der Villa Wertheim gab es einen Geist, sogar einen extrem widerwärtigen.
Auf dem ganzen Ort lastete eine Atmosphäre von Beklemmung und Bangigkeit, wie sie für ein so unschuldig aussehendes Gebäude ungewöhnlich war. Und die Quelle allen Unbehagens befand sich in einem Erkerzimmer im Oberstock, das sehr deutlich als PRIVAT gekennzeichnet, aber sichtlich unbenutzt war. Mehr noch: Es war unbenutzbar gemacht worden. Mit Absicht. Das Schloss war, wie Cathys flinke Augen im Vorbeigehen mit einem Seitenblick festgestellt hatten, mit Modelliermasse verstopft worden.
Angus sah daran nichts Besonderes. Wenn das Zimmer stets verschlossen bleiben musste, was war daran verdächtig? Schließlich waren die Mallorys fremde Gäste, denen man mit Fug und Recht verwehren durfte, in Privatsachen herumzustöbern.
Cathy widersprach. „Das ist nicht alles. Das sind die Gebetstücher.“ Quer über die Türe war nämlich eine dünne Seidenschnur gespannt, an der bunte, in fremdartigen Lettern beschriebene Fähnchen hingen – Gebetstücher, wie man sie in Fernsehberichten aus dem Himalaya auf den schneebedeckten Hängen im Wind flattern sah. Die beiden Lords Wertham hatten allerlei solch exotisches Zeug von ihren Expeditionen mitgebracht, aber Cathy wurde den Eindruck nicht los, dass die Flaggen hier nicht als Zierde, sondern als Sperre dienten – als asiatisches Äquivalent zu einem Knoblauchkranz. Angus sah das nicht ein. Er war natürlich auch der Meinung, sie hätte sich nur eingebildet, dass die leichten Tücher in einem aus den Türritzen dringenden Wind flatterten. Die azurblauen Sturmläden des Erkerzimmers waren immer geschlossen. Woher sollte in einem hermetisch verschlossenen Raum Wind kommen?
Also erzählte Cathy ihm nichts davon, was ihr passiert war, als sie auf dem nächtlichen Weg zur Toilette an dem Erkerzimmer vorbeigemusst hatte. Gut, um ehrlich zu sein, sie hatte nicht wirklich gemusst. Das kalte Zimmer lag einen Stock höher als ihr Quartier. Aber sie hatte einfach nicht widerstehen können, hinauf zu huschen und an der Türe zu lauschen. Und da hatte sich in einer einzigen Sekunde ein scheußliches Bild in ihre Gedanken geprägt. Ein riesiges Gesicht ohne Körper hatte sie angestarrt, blaugrau wie eine in Schnee und Eis mumifizierte Leiche, mit borstig gesträubten Haaren – und aus dem weit aufgerissenen Mund mit den morschen Zahnstummeln war ein unverständlicher Schrei gedrungen, so dünn wie das Winseln des Windes auf fernen Bergeshöhen.
Es war natürlich nur eine Phantasmagorie gewesen, ganz gewiss, denn die Türe war und blieb verschlossen, aber die Seidenfähnchen wirbelten in einem jähen Windstoß. Cathy war der Atem in der Kehle stecken geblieben vor Angst. Sie konnte von Glück sagen, dass sie auf den unregelmäßigen Stufen nicht gestolpert und die Treppe hinuntergefallen war, so eilig hatte sie es wegzukommen.
Das war in der ersten Nacht gewesen, die eigentlich ihre feierliche Hochzeitsnacht hätte werden sollen – aber nach der langen Reise, dem Um– und Einräumen, dem viel zu späten Abendessen in einem billigen Lokal waren sie beide nicht in der Stimmung für Zärtlichkeiten gewesen. Angus fiel in den Schlaf wie ein Stein ins Wasser, und Cathy Mallory kämpfte sich zur Strafe für ihre Neugier durch einen schrecklichen Traum.
Sie befand sich irgendwo in einem Tal zwischen völlig fremdartigen, nicht-europäischen Bergmassiven, vor denen sie sich fürchtete, aber etwas zog mit unwiderstehlicher Gewalt an ihr und saugte sie immer höher und höher hinan, vorbei an gigantischen Schluchten, in deren Finsternis Wasserströme rauschten. Über ihr, immer weiter hinauf bis in den schmutzig gelblichen Himmel, stapelten sich einer über dem anderen monumentale Felstürme. Und diese fremdartigen Orte, fühlte Cathy, waren bewohnt: Von bösen lemurenhaften Geschöpfen bewohnt, die jedes für sich seinen Weg gingen und ihre schweren schwarzen Schatten hinter sich herschleppten. Sie hatte es kaum gedacht, als der furchtbare Schrei von neuem ertönte, aus weiter Ferne und doch so durchdringend, dass es ihr wie eine Nadel ins Herz stach. Es musste ein Schrei in einer ihr völlig fremden Sprache gewesen sein, denn auf Englisch hätten die klagenden, stöhnenden Laute nur den ziemlich absurden Satz ergeben: „Ganz–schön–eng–da!“
So real erschien ihr der Traum, dass sie es kaum glauben konnte, als sie im Morgengrauen in einem gemütlichen Bett neben ihrem frisch angetrauten Gatten erwachte und der herrliche Duft des Frühstücks, das Misses Wellbutton unten in der Küche zusammenbrutzelte, ihr in die Nase stieg.
Bei der Erinnerung an diesen Traum durchschüttelte sie von neuem die Verzweiflung darüber, dass Angus so gar nichts von dem Grauen im Haus mitbekam, und sie beschloss nicht länger um den heißen Brei herumzureden. Sie schob das Kinn vor und wölbte die Schultern. Ihr hübsches sommersprossiges Gesicht verzog sich zu der Grimasse, die besagt: Wage es nicht, mir zu widersprechen! „Ich bin überzeugt“, sagte sie, jedes Wort betonend, „dass in diesem so sorgfältig verschlossenen Zimmer ein Gespenst wohnt.“
Angus wusste darauf keine Antwort, also schnauzte er sie hochmütig an: „Und wenn schon? Dann lass es in Ruhe in seinem Zimmer wohnen, solange es nicht herauskommt.“
„Ihr Mann hat Recht, Misses Mallory.“ Die Stimme gehörte Misses Wellbutton, die unversehens in der Türe des Frühstückszimmers erschienen war. Die jungen Gäste hatten nicht gehört, dass sie von ihrem Einkauf zurückgekehrt war, und jetzt waren sie beide peinlich berührt. Die Haushälterin sah von Cathy zu Angus und wieder zurück. „Sie haben es also bemerkt, hm? Dann kann ich Ihnen nur sagen: Lassen Sie die Dinge, wie sie sind. Fürchten Sie nichts, seien Sie aber auch nicht neugierig. Vor allem seien Sie nicht neugierig! Dann werden Sie hier eine gute Zeit haben. Andernfalls…“ Sie ließ den Satz drohend in der Luft hängen und verschwand in der Küche.
„Buh!“, machte Angus. „Jetzt hast du´s. Der verfluchte Ahnherr der Familie rasselt mit seinen Ketten im Erkerzimmer herum. – Und können wir jetzt bitte überlegen, welchen Londoner Sehenswürdigkeiten außer kalten Gespenstern wir unsere Aufmerksamkeit zuwenden wollen?“
Cathy schwieg. Sie wollte weder mit ihrem frisch angetrauten Ehemann streiten noch das Misstrauen der Haushälterin auf sich ziehen, aber Blaubarts Frau war in ihr erwacht, und sie konnte an nichts anderes denken als an das goldene Schlüsselchen. Misses Wellbutton hatte ihr ja wortwörtlich bestätigt, was sie bereits geahnt hatte: In dem so beklemmend kalten Erkerzimmer hauste ein Geist.
Drei Tage hielt Cathy Mallory sich an die stillschweigende Abmachung, das Erkerzimmer nicht zu erwähnen. Es fiel ihr nicht allzu schwer, denn die beiden jungen Leute amüsierten sich prächtig und waren abends so müde, dass sie wie Bleiklötze ins Bett fielen. Dann holte Cathy, die typische Keltin, weißhäutig und rothaarig, sich bei einer Bootsfahrt auf der Themse einen überaus heftigen Sonnenbrand, und es empfahl sich dringend, einige Tage im Schatten des Hauses zu verbringen. Angus erklärte sich zwar sofort bereit, bei ihr zu bleiben, aber er war doch sehr erleichtert, als sie protestierte: „Sei nicht albern! Ich bin nicht todkrank. Mach deinen Männerkram, während ich mich auskuriere, dann können wir uns nachher den Dingen zuwenden, die mich auch interessieren.“
Angus fuhr also in die Stadt, und Cathy blieb zurück.
Es dauerte nicht lange, bis sie sich langweilte. Es gab zwar einen Fernseher im Haus, aber am Vormittag liefen nur Seifenopern, also stöberte sie in der kleinen Bibliothek herum. Zu ihrem Missvergnügen stellte sie fest, dass die beiden Lords Wertham literarisch dieselben Sujets bevorzugt hatten wie in der Malerei. Außer Alpinismus gab es kein Thema. Selbst ein Buch mit dem verheißungsvollen Titel „Der böseste Mensch auf Erden“ erwies sich als Biographie eines Bergsteigers. Offenbar hatten ihn die Brüder Wertham gut gekannt, denn das Buch trug eine überschwängliche persönliche Widmung für einen Lord Roger Wertham, unterzeichnet mit „Ho Mega Therion Laird of Boleskine.“