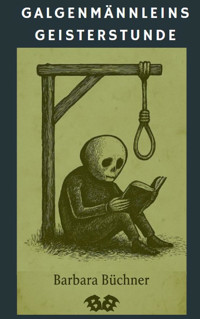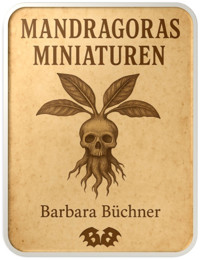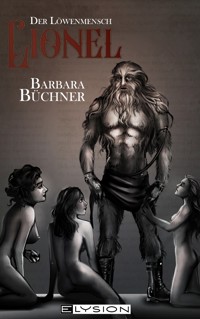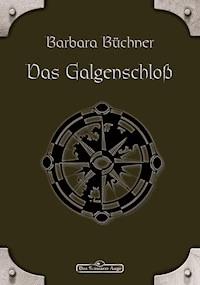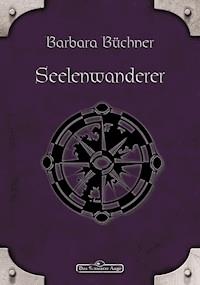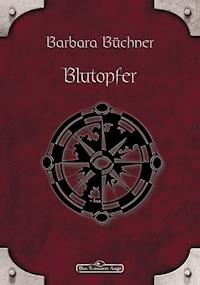1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In Portiunculas Bibliothek riecht es nach Staub, altem Leder und üblen Geheimnissen. Wer hier ein Buch aufschlägt, öffnet mehr als nur eine Geschichte – er löst ein Echo aus. Diesmal sind es makabre, dunkle, mitunter abgründig komische Stimmen, die der närrische Schrebervogel erzählt. Ihre Protagonistin: Ein Psychiater, der in seinem nervösen Patienten die Symptome der Todesangst provoziert. Ein reicher alter Gauner, der seine Schätze mit Aliens teilt. Ein Taschendieb, der an den tödlich falschen Koffer gerät. Und natürlich der schwarze Magie praktizierende Graf vom Latisberg, unsterblicher Schrecken von Wien. Und immer wieder Schatten, die mehr wissen, als sie sollten. Grotesk, schwarz wie Lakritz und mit einem Schuss Wahnsinn – die Erzählungen dieses Bandes sind nichts für Leser, die sich an Normalität gewöhnt haben. Sie führen dorthin, wo das Alltägliche kippt, wo eine kleine Geste zur Beschwörung wird, und eine Zufallsbegegnung vielleicht schon der Anfang vom Ende ist. "Schrebervogels närrische Schreibe", Portiunculas Bibliothek, Band IV – für alle, die beim Lesen ein leises Kichern aus der Dunkelheit nicht fürchten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Schrebervogels schräge Schreibe –
Verquere Geschichten
Eine Sammlung von Barbara Büchner
Aus der Reihe „Portiunculas Bibliothek“ (Band 4)
Copyright © 2025 Barbara Büchner
Alle Rechte vorbehalten
Cover und Illustrationen: Barbara Büchner und „Thekla“ (GPT-5)
Erstveröffentlichung in der Portiuncula Reihe
Veröffentlicht über Tolino Media Gmbh & Co .Kg
ISBN
Der Teufelsgraf vom Latisberg
Gespräch am Rande eines Psychiatriekongresses
Nun, habe ich zu viel versprochen, werte Frau Kollegin? Ist das nicht ein wunderbarer Anblick, wie die Stadt uns da im Abendrot zu Füßen liegt, eingerahmt von Weinbergen, Wiesen und dem dunklen Saum des Wienerwaldes? Der Panoramablick von der Meierei auf dem Cobenzl hat schon Staatsoberhäupter bezaubert, die dort zum Essen geladen waren. Und während wir nach dem üppigen Abendessen einen gemächlichen kleinen Verdauungsspaziergang auf breitem, bequemem Wege machen, erzähle ich Ihnen von dem interessanten Fall, den ich heute Vormittag im Plenum kurz erwähnt habe.
So, hier entlang! Ja, es ist ein wenig kühl geworden unter den Bäumen, aber Sie haben ja Ihren entzückenden Poncho mit, der wird Sie wärmen, und wir gehen nicht weit, wir wollen uns doch nicht die Schuhe ruinieren. Sehen Sie nur, ist das nicht rührend – da unten auf dem Abhang die Pferde des Gutshofs, die in ihre Ställe zurückkehren? Warum man sie nachts nicht auf der Weide draußen lässt, fragen Sie? Nun ja, das hat seinen Grund. Auf dem Parkplatz auf dem Cobenzl, vor der Meierei ist alles in Ordnung – so ziemlich in Ordnung jedenfalls – aber der Gutshof liegt ja doch schon etwas näher am Latisberg, halb und halb in der grünen Wildnis, und da übt man eine gewisse Vorsicht. Jedenfalls werden die Pferde und Esel und Gänse und alles Kleinvieh nachts eingesperrt. Sicher ist sicher. Und der Grund dafür hängt mit der Fallgeschichte zusammen, die ich Ihnen erzählen will.
Als Wiener bin ich meiner Stadt gegenüber loyal, aber um der Wahrheit willen darf ich Ihnen nicht vorenthalten, dass der Wienerwald keineswegs so harmlos ist, wie man das an einem schönen Sommertag meinen möchte. Sicher, er ist jetzt ein zivilisierter Wald mit breiten, bequemen Wegen und genügend Gasthäusern, dass auch der faulste Spaziergänger noch rechtzeitig eines erreicht, bevor ihm die Knie weich werden. Kreuz und quer durchziehen ihn Wanderwege, sodass er viel mehr einem Park ähnelt als einem Forst, und teilweise geht er tatsächlich unmerklich in gepflegte Parks über. Und dennoch hat er etwas an sich ...
Denken Sie nur einmal darüber nach, wie lange der Wald schon die sanften Hügel bedeckt, die sich im Westen wie ein schützender Wall um die Stadt schmiegen. Als die Römer ihr befestigtes Lager Vindobona anlegten (dessen Fundamente Sie heute noch auf dem Hohen Markt in der Innenstadt besichtigen können) holten sie ihr Bauholz aus eben diesem Wald, der damals schon von ehrwürdigem Alter war. Man findet römische Münzen darin, Bronzegeräte und altertümliche Tonscherben, ja sogar grob zugehauene Steinspitzen. Manchmal entdeckt man einen Erdwall, den letzten Überrest einer steinzeitlichen Befestigung, oder stößt auf einen Weg, auf dem schon die römischen Legionäre dahinritten. Der scheinbar so unschuldige, handzahme Wald ist gespickt voll mit den Ruinen zerstörter Burgen und verfallener Klöster, mit uralten Höhlen, geheimnisvollen Steingebilden und vorzeitlichen Grabstätten. Marterln kennzeichnen die Stellen, wo die Bevölkerung ganzer Dörfer aufs Entsetzlichste von den Türken massakriert wurde oder einsame Wanderer von Wegelagerern überfallen und mit aufgeschlitzter Kehle liegen gelassen wurden. Wenn man weiß, wo man zu suchen hat, findet man einige sehr sonderbare und mystische Plätzchen darin.
Natürlich findet man auch gelegentlich Leichen. Ich wette, irgendwo im Sicherheitsbüro haben sie einen riesigen Plan von Wien und Umgebung hängen, auf dem alle Leichenfundorte mit orangen Fähnchen markiert sind, und da sind garantiert ein paar Dutzend Fähnchen allein für den Wienerwald dabei. Es gab eine ganze Reihe mehr oder minder prominenter Unholde, die ihre Opfer abseits der Wanderwege entsorgten. Aber das ist nichts weiter Besonderes; alle dicht bewaldeten Stadtrandgebiete eignen sich zum Deponieren von Leichen, egal, ob es der Central Park in New York oder der Bois de Boulogne in Paris ist. Nein, keine Angst, ich bin bei Ihnen, und wir gehen auch nicht weiter in den Wald hinein – da vorne, sehen Sie, da ist schon die steinerne Terrasse mit der Balustrade. Dort setzen wir uns auf eine Parkbank und ich erzähle Ihnen die Fallgeschichte.
Nein, das wirklich Unbehagliche im Wienerwald sind die mystischen Orte. Auf Schritt und Tritt stößt man auf historische, ja auf prähistorische Stätten. Man weiß nie, ob man auf dem Weg zu Schokoladentorte mit Schlag in einer schmucken Ausflugsgaststätte nicht an einem Platz vorbeikommt, wo Menschen geopfert oder unaussprechliche Riten vollzogen wurden. Und man weiß nie, ob an diesen Orten nicht noch etwas lebendig ist - ob nicht irgendwelche alten und unsympathischen Götter unsichtbar zwischen den Bäumen herumlungern, unter denen sie einst verehrt wurden. Auf dem Leopoldsberg jedenfalls wohnten Kelten, die ihren Göttern Opfer darbrachten, und zwar nach keltischem Brauch auch gelegentliche Menschenopfer, wobei man die Leichen gefangener Feinde zerstückelte oder sie an die hölzernen Zäune der Heiligtümer nagelte. Vielleicht lebten damals auf dem Leopoldsberg sogar Kannibalen, denn zumindest einige Opferriten der Kelten schlossen den Verzehr von Menschenfleisch mit ein. Nach alledem wird es Sie kaum mehr verblüffen, wenn ich Ihnen sage, dass es an einem Ort mit einer so üblen Geschichte spukt!
Seien wir ehrlich: Der gesamte Wald ist nicht geheuer, auch wenn das Forstamt der Stadt Wien davon nichts wissen will (die Leute haben Angst um die Touristen, daher leugnen sie natürlich alles, was dem Ausflugsgeschäft schaden könnte). Manchmal habe ich es selber ja ganz deutlich gespürt, dass in den schattenhaften Kathedralgewölben des Waldes eine unbehagliche Macht am Werk ist. Da geht man beispielsweise am "Häuserl am Roa“ vorbei, einem hübschen Gasthaus mit einem Garten voll eingetopfter Yuccapalmen und gelben Sonnenschirmen, und schlägt den Waldweg zum Roten Kreuz und zur Sophienalpe ein ... und plötzlich fühlt man, wie sich die Atmosphäre verändert. Kaum merklich wird es kälter und dunkler, als habe sich eine Wolkenbank vor die Sonne geschoben, und diese schwarze Wolke bleibt beharrlich an ihrem Ort. Ein dumpfes Unbehagen erfüllt den Wald. Man passiert einen schlammigen Teich, auf dessen schwarzem Wasser gelber Schaum schwimmt, und wandert weiter mit dem Gefühl, von unsichtbaren Augen beobachtet zu werden. Später sieht man auf der Landkarte nach und stellt fest, dass der Ort "Zwei Gehängte" heißt.
Nicht weit davon schimmert ein bleicher Rundbau zwischen den Stämmen hervor, ein Heldendenkmal, und auch dieses strömt eine seltsam bösartige Aura aus, als wäre es nicht ein Denkmal wackerer Patrioten, sondern ein Tempel zu Ehren der Hekate und des Pluto.
Oder nehmen wir an, Sie spazieren von der Endstation des 39A in Sievering den Weg von der Agnesgasse zum Dreimarkstein hinauf, einen wunderschönen, romantischen Aufstieg durch sonnige Weinberge und lichten, grün und golden gefleckten Wald. Dabei kommen Sie an einem einfachen Holzkreuz vorbei, das als »Cholerakreuz« bekannt ist und an die schreckliche Seuche erinnert, die vor vielen Jahren auch in den Dörfern des heutigen 19. Bezirkes wütete. Die kleinen Friedhöfe fassten die Toten nicht mehr, und so begrub man sie in einem Massengrab, an dessen Stelle heute das Cholerakreuz steht. In der Geisterstunde, so berichtet man, tanzte über diesem Grab stets ein Lichtlein, vielleicht die Seele eines Verstorbenen, der schwere Schuld auf sich geladen hatte und deshalb im Grabe keine Ruhe fand. Niemand wagte es, in der Nacht an dem Kreuz vorbeizugehen. Davon (so erzählt man sich) hörte ein übermütiger junger Jägersmann, als er mit seinen Freunden im Wirtshaus saß. "Ich werde der armen Seele schon Ruhe verschaffen«, sagte er, packte um Mitternacht sein Gewehr und verließ das Wirtshaus. Plötzlich hörten die Zurückgebliebenen einen Schuss. Sie warteten nun auf den Jä¬ger; als er nicht kam, schlichen sie beklommen heim. Am nächsten Morgen fand man den Jäger tot beim Cholerakreuz, eine Kugel aus seinem eigenen Gewehr in der Brust. Das Lichtlein wurde danach nicht mehr gesehen. Es war – aber da sind wir ja schon!
Bitte, hier ist ein bequemes Bankerl. Sie erlauben, dass ich rauche? Danke. Wenigstens im Wald ist es ja noch erlaubt. Aber jetzt zu meiner Geschichte!
Aussage eines an multipler Intoxikation leidenden Jugendlichen
Na gut, Herr Doktor, wir waren besoffen. Alle Vier. Und ja, ein bisschen was eingeworfen hatten wir auch. Wenn die Blutprobe das sagt, wird sie wohl recht haben. Aber das ist alles noch lange kein Grund solche Sachen zu erleben, wie sie uns zugestoßen sind, und wenn Sie so etwas erlebt hätten, wären Sie auch reif für die Psychiatrie.
Also von Anfang an. Wir hatten eine super Party gefeiert im Restaurant auf dem Kahlenberg, und als wir um halb zwei Uhr nachts gingen – gehen mussten, weil der Wirt uns rausschmiss – hatten wir Vier (Loisi, Motzl, Pippi und ich) alle einen Schädel wie ein Wasserschaff, und wir sahen es kommen, dass wir unterwegs ein paar Mal würden kotzen und pinkeln müssen, also nahmen wir uns vorsichtshalber kein Taxi (Reinigungsgebühr!), sondern beschlossen, den Waldweg vom Kahlenberg bis zum Parkplatz am Cobenzl zu Fuß zu gehen. Bis wir die Autobusstation dort erreichten, würden wir nüchtern genug sein, um einen öffentlichen Autobus zu benützen. Außerdem – so dachten Motzl und ich – würden sich die beiden Mädels vielleicht durch die laue Sommernacht und Waldesluft und weiche Wiesen überreden lassen... Sie wissen schon.
Anfangs ging alles recht gut. Der Vollmond stand am Himmel, und da der Weg längs der Höhenstraße verlief, auf der sogar hin und wieder ein Auto vorbeifuhr, konnten wir uns auch nicht verlaufen. Jedenfalls nicht, bis wir zur Schönstatt kamen. Das ist so ein katholisches Irgendwas-Haus mit Kapelle und einem Marienbild im Wald, zu dem die alten Weiber wallfahrten gehen. Dort kam Motzl auf die Idee, wir sollten nicht weiter an der Straße entlang tappeln, sondern ganz romantisch bei Mondschein durch den Wald wandern. Das war nur ein kleines Stück länger als auf der Straße. Wenn man rechtzeitig abbog, kam man zur Kreuzeiche (noch so ein Wallfahrtsbild) und von dort in fünf Minuten über den Latisberg zum Cobenzl.
Schön, wir machten das, und es war wirklich sehr nett. Anfangs jedenfalls. Loisi hing an meinem Arm wie eine gestrandete Meerjungfrau und murmelte mir blödes, aber verheißungsvolles Zeug ins Ohr, und während wir dem Weg unter den schwarzen Baumkronen folgten, dachte ich an das Päckchen Pariser in meiner Hosentasche und ob ich es in der Nacht noch benützen würde. Der Wald stand schwarz und schweiget, die Sterne blinkten, der Mond tauchte alles in ein graublaues Licht, und es war so wunderbar windstill, dass die Blätter und Zweige aussahen wie aus schwarzem Papier geschnitten. Richtige Sommernacht eben. Ur-romantisch. Die Mädels waren ganz hin und weg, die labberten nur noch seelenvoll vor sich hin wie Hunde, wenn sie den Mond anheulen, und wenn ich Motzl ansah, wusste ich, dass er dasselbe dachte wie ich: Wo ist die nächste Wiese ohne Ameisen?
Aber dann kamen wir zur Kreuzeiche, und ich weiß nicht warum, aber mir war plötzlich nicht mehr so geil und romantisch zumute wie eben noch. Ist ja Blödsinn, denn kein kleines Kind glaubt heute noch an den Teufel und schon gar nicht an die Geschichte vom Krapfenwaldl, wo er umgehen soll – aber als wir über die Lichtung bei der Kreuzeiche gingen, einen richtigen Kreuzweg, wo sich fünf oder mehr Wege treffen, da gefiel mir der Weg ins Krapfenwaldl hinunter überhaupt nicht. Er ist viel schmäler als die anderen Wege und wird bald sehr steil, deshalb ist man auch schnell unten bei der Autobuslinie, und ich hatte auf einmal das komische Gefühl, dass irgendetwas diesen Weg heraufkam. Irgendetwas, Herr Doktor, denn ich kam vom ersten Augenblick an gar nicht auf den Gedanken, dass es Menschen sein könnten. Es ging nicht auf Füßen, sondern hörte sich eher an wie etwas Massiges und zugleich Schwereloses, das den nächtlichen Waldweg herauf schwamm – richtig in der Luft schwamm und nur hin und wieder den Boden streifte. Es rauschte in den Büschen und schleifte auf dem Weg und stieß kleine Steinchen an, die bergab rollten, und es brachte etwas mit sich wie... ja, als käme eine dicke schwarze Wolke den Weg herauf, eine eiskalte Wolke, in der grüne Lichter blitzten und flimmerten!
Motzl konnte ich davon nichts sagen, der hätte natürlich gedacht, dass ich heimlich noch ein paar extra eingeworfen hätte, ohne ihm was abzugeben, also wisperte ich ihm ins Ohr: „Bei der Terrasse am Latisberg ist eine wunderschöne weiche Wiese.“ Wie erwartet, legte er einen Gang zu, und die Wolke blieb ein wenig hinter uns zurück. Ich hoffte schon, wir hätten sie abgehängt, aber da hatte ich mich getäuscht. Sie kroch uns nach und schien, ganz im Gegenteil, immer dicker zu werden, als wir endlich die Terrasse erreichten.
Irgendwie komisch, eine riesengroße steinerne Terrasse mit einer schönen Balustrade mitten im Wald, wo sie kein Mensch braucht. Aber da war sie nun einmal, mit einer Reihe Parkbänken darauf, damit man sich hinsetzen und den Blick über die Stadt genießen kann. Die sah ja auch jetzt im Dunkeln gar nicht schlecht aus – als wäre eine ganze Galaxie mit roten und goldenen und weißen Sternen auf die Erde geplumpst und liegen geblieben. Aber ich hatte überhaupt kein Interesse mehr, weder an der schönen Aussicht noch an der weichen Wiese, die es dort wirklich gibt. Ich hoffte sehr, Motzl würde nicht auf die Idee kommen mit Rumschmusen anzufangen, denn dann hätte ich allein den restlichen Weg zum Parkplatz gehen müssen, und wenn es auch nur ein paar Minuten waren, hatte ich echt keinen Bock darauf da allein durch den finsteren Wald zu schleichen, während das Irgendwas vom Krapfenwaldl herauf hinter mir herschwebte.
Loisi quakte plötzlich: „Habt ihr gewusst dass hier mal ein Schloss war?“ Dabei wachelte sie mit einer schlaffen Hand in der Luft herum und deutete auf den Haufen bewaldeter Erde hinter der Terrasse, der den Latisberg ausmacht. „Und es hat´m Typen gehört, der nachts in´n schwarzen Mantel vermummt auf den Grinzinger Friedhof schlich und Leichen ausgrub, die er in seinem Schloss versteckte, in spesch... speschi.... speschiell ausgegrabenen Stollen...“
Das Mädel war blunznfett, aber sie brachte die ganze Geschichte zusammen: Wie ein Baron von Reichenbach sein Schloss auf dem Latisberg erbaut hatte und bald weit und breit gefürchtet war, weil er sich der schwarzen Magie widmete und eben nachts den Grinzinger Friedhof plünderte, um mit den Leichen irgendwas anzustellen – was genau, wusste Loisi nicht mehr, aber jedenfalls sah man dann ein violettes Licht in den Fenstern des Schlosses zum Zeichen, dass der Teufel und der Baron von Reichenbach wieder gemeinsam am Werk waren. Und als der Baron dann zur großen Erleichterung der Grinzinger starb oder wegzog oder vom Teufel geholt wurde, verfiel das Schloss, weil niemand darin wohnen wollte, mit alle den versteckten Stollen rundherum, in denen die Leichen immer noch lagen. Aber bis ins Jahr 1965, als es dann endlich abgerissen wurde, sah man in gewissen Nächten dieses Licht rund um die Ruine schimmern und hörte ein Kratzen und Graben in der Erde. Dann kam nämlich der Teufel von seinem Lieblingsplatz im Krapfenwaldl herauf und half dem untoten Baron bei seinen Experimenten. Und die geheimen Gänge mit den Leichen hat nie jemand gefunden.
Motzl lachte, und ich hätte auch gerne gelacht, aber gerade da blies es mir aus der Finsternis heraus eiskalt in den Nacken, und ich spürte, wie die schwarze Wolke sich den Waldweg herabwälzte. Im nächsten Augenblick machte etwas ganz leise „Knirsch“, als würde vorsichtig eine Türe mit rostigen Angeln geöffnet, und keine zehn Meter von uns entfernt ging zwischen den Bäumen am Abhang eine Tür auf. Ein kaltes, violett schillerndes Licht drang heraus, ein so abgefahrenes Licht, wie ich es in keiner Diskothek je gesehen habe. Es machte einen frösteln, wenn man es nur ansah. Dann guckte Einer hinter der Türe hervor, als erwartete er jemand, den der möglichst unauffällig einlassen wollte. Ich könnte nicht sagen, wie er aussah, weil das Licht hinter ihm war und ich nur eine pechschwarze Silhouette erkennen konnte. Aber ich war auch gar nicht neugierig darauf, mehr von ihm zu sehen. Er strömte etwas aus, das einen eindringlich warnte, sich ihm zu nähern oder, was das angeht, von ihm bemerkt zu werden.
Komisch: Obwohl wir alle so besoffen waren, reagierten wir blitzschnell. Kommt wohl vom Computerspielen, die schnelle Reaktionsfähigkeit. Flatsch!, lagen wir auf dem Bauch, und eine Sekunde später waren wir alle Viere den Abhang hinunter gerutscht und hatten uns unter der Stützmauer der Terrasse versteckt. Wir zogen uns gerade weit genug hoch, dass wir den unheimlichen Eingang im Auge behalten konnten.
Zuerst aber gab es auf dem Waldweg etwas zu sehen. Pippi fiepte plötzlich wie eine Maus und deutete dorthin, wo sich der schwarze Tunnel der Bäume auf die Lichtung öffnete, und wir sahen alle, wie dort etwas herauskam... etwas, dass erst wie ein langer, verschlungener Rauchfaden aussah und dann rasch immer länger und dicker wurde, eine Art Schlauch – nein, ein Rüssel – ein unnatürlich langer Schweinerüssel war es, mit zwei Löchern vorne drin, der sich runzelte und zurückzog und vorwärts schob und immer noch länger wurde wie die Schnauze eines Hundes, der eine Spur wittert. Und hinter dem Rüssel wuchs aus dem Rauch und der Finsternis ein Gesicht, das von einem Schimmer wie Phosphor umgeben war und den gesamten sechs oder sieben Meter hohen Baumtunnel ausfüllte. Richtig durchquetschen musste es sich, bis plötzlich der gesamte Schädel da war. Ein grüner Schweineschädel war es, so grün und schwammig, als wäre er eine ganze Weile im Mülleimer eines Fleischers in der Sonne gelegen, aber mit kleinen, wie Laserpointer leuchtenden Äuglein darin, in denen alle Bosheit der Welt glühte.
Das war so ziemlich das Letzte, was wir sahen, ehe wir alle Vier die steile Böschung hinunterkugelten. Ich glaube ja, dass wir nur deshalb mit dem Leben davonkamen, weil wir nichts weiter tun mussten als rollen, und an den Stellen, wo die Höhenstraße in Schlangenlinien den Berg hinaufkurvt, auf alle Vieren krabbeln und weiter rollen. Rennen hätten wir jedenfalls nicht können, und wir hätten auch den Weg nicht gefunden. Keiner von uns konnte an irgendetwas anderes denken als an dieses grüne, faulende Schweinegesicht, das sich der geöffneten Türe im Waldabhang näherte, und den Gucker dahinter, der seinen höllischen Freund und Genossen erwartete.
Ich weiß auch nicht mehr – und ich wette, die Anderen wissen es ebenso wenig – wie es letztendlich dazu kam, dass wir alle Vier in der ersten Morgendämmerung kreischend und schluchzend die Grinzinger Hauptstraße hinunter stolperten und einen Trupp Straßenkehrer zu Tode erschreckten. Die müssen ja gedacht haben, sie sehen irgendwelche Waldschratln vor sich, so zerkratzt, zerschrammt und völlig verdreckt waren wir, mit Gras und Blättern im Haar und den Kleidern. Sie hatten ja vielleicht nichts dagegen, dass die Mädeln sich ihnen heulend und winselnd an den Hals warfen und an ihnen festsaugten wie Zecken an einem fetten Hund, aber Motzl und mich schubsten sie ziemlich grob fort. Ich kann´s ihnen auch nicht verdenken, dass sie uns erst ordentlich durchbeutelten und dann die Polizei und die Rettung verständigten. Im Wald kehrt und putzt ja keiner, und deshalb wird der durchschnittliche 48er auch nie die Türe mit dem violetten Licht dahinter und das Ungeheuer aus dem Krapfenwaldl sehen. Es sei denn, er feiert im Restaurant auf dem Kahlenberg, wird mitten in der Nacht hinausgeworfen und beschließt, zur Ausnüchterung einen Spaziergang zum Parkplatz Cobenzl zu machen.
Ich sage ja nichts mehr. Ich bin einverstanden; ich bleibe brav da bis zur völligen Entgiftung und spreche nachher mit einem Psychologen über Komasaufen und Ecstasy. Was immer Sie wollen, Herr Doktor. Aber nie im Leben werde ich mehr einen Spaziergang durch den Wienerwald beim Latisberg machen, nicht einmal beim hellsten Sommersonnenschein, und wenn ich hundert Jahre alt werde. Motzl, Pippi und Loisi sind da garantiert ganz meiner Meinung. Und wenn ich der Bürgermeister von Wien wäre, würde ich den ganzen Latisberg mit einem zwei Meter hohen Gitter einzäunen und überall Schilder mit „Betreten verboten! Lebensgefahr!“ anbringen lassen.
Schon gut! Weg mit der Spritze! Ich beruhige mich ja schon!
Dienstgespräch im geheimen Allerheiligsten der Wiener Städtischen Bestattung
„Naa! Net schon wieder! Machen´S mich net wahnsinnig! Das ist doch nicht die Möglichkeit wenn der gesamte Grinzinger Friedhof Tag und Nacht scharf bewacht – was soll das heißen, für die paar Netsch setzen Sie sich nicht Tag und Nacht auf aan Grabstein hin? Das war ein dienstlicher Auftrag, und wenn Sie den verweigern, ich meine, nachdem Sie den bereits verweigert haben, werden Sie sich wundern was ich Ihnen anschaun lass – und net frech werden, bittschön, und mit der Kronenzeitung drohen! Dass die das Dreifache zahlen würden für ein paar Gschichterln hinsichtlich der verschwundenen schönen Leichen von Grinzing! Nix ist´s mit einer Erpressung! Das bleibt schön unter uns, da sitzen Sie nämlich genauso drinnen wie wir, alle im selben Boot, lieber Herr.
Wer war´s denn diesmal, übrigens, nur for the record? Waclaweczs Susanne, aha, und Johanna Riebenfeld. Neunzehn Jahre die eine, achtzehn die andere. Todesursache – na, wie erwartet. Haben ausg´schaut wie wenns schlafeten. Zerdepschte Unfallleichen schleppt der Herr Baron keine weg. Das ist ein Feinspitz. Schöne Madln, unbeschädigt, frisch. Kann ich verstehn, ich machets genauso, wenn ich Frauenleichen.... fixnocheinmal, ich mein doch nicht, dass ich wirklich – das war nur ein rhetorischer Gedanke, wenn´S mich verstehn, aber für einen gewöhnlichen Totengräber ist das sowieso zu hoch. Gebn´S a Ruah und buddeln´S weiter. Ich mein, schaufeln´S gschwind alles schön zu, ein paar Blumerln drauf, dass´s was gleich schaut; wenn die Verwandtschaft blöd fragt sagn´S was von „technischen Gründen“. Sonst gar nix. Die geheime Meldung an die Erzdiözese wegen dem Exorzisten mach ich selber, das ist eine heikle Gschicht. Ja, einem alten Sozi wie mir passt die Packelei mit den Pfaffen auch nicht, aber unsere Ressourcen sind erschöpft, ich kann net höchstpersönlich den Friedhof bewachen, und irgendwie muss der Hund von Reichenbach doch zum Packen sein.
***
Der Body-Hopper
Die beiden Krankenschwestern in der geschlossenen geriatrischen Abteilung der Nervenklinik saßen dicht nebeneinander in der Teeküche, in ein vertrauliches Gespräch vertieft.
„Pass du mal bloß auf mit dem Neuen, dem Professor auf Nummer Drei“, sagte die Oberschwester. „Lass den nie aus den Augen! Das ist einer von den ganz fiesen.“
„Aber der Alte ist doch total dement.“
„Das stimmt … mit seinem Geschwätz, dass ihm Außerirdische den Körper oder die Seele gestohlen hätten und er sein Zeug zurück haben wollte. Trotzdem, glaub meiner Erfahrung: Der ist gefährlich. Ich hab ein Gefühl für so was. Der hat die Augen eines Mörders. Wird uns noch jede Menge Ärger machen.“
Ein paar Minuten herrschte Schweigen, während sie ihren Tee tranken. Dann schlug die Untergebene in vorsichtig gedämpftem Ton vor: „Dann sollten wir ihm vielleicht gleich die kalte Kur verpassen… ich meine, bevor er noch einer von uns was antut.“
Die Oberschwester nickte bedächtig Zustimmung.
*
Der bemerkenswert gutaussehende junge Mann begann mit seinem Bericht, sobald die vernehmenden Polizisten die Videokamera eingestellt und sich zurechtgesetzt hatten.
„Ich möchte vorausschicken, dass ich vollkommen unschuldig bin“, sagte er.
Chefinspektor Homer Wallitt – ein feister Glatzkopf, der immer müde und verdrossen aussah – gähnte demonstrativ. „Komm, Junge, lass das bleiben. Wir haben dich nicht nur mit heruntergelassenen Hosen erwischt, sondern auch mit blutigen Händen. Also? Warum legst du nicht ein schönes Geständnis ab? Dann kommen wir heute noch alle rechtzeitig ins Bett.“
„Weil ich mit der Sache nichts zu tun habe, deshalb!“, erklärte der Jüngling gereizt. Sogar im kahlen Verhörraum der Polizei machte er eine gute Figur. Wer ihn sah, hätte glauben können, dass er als der Rechtsvertreter irgendeines armen Sünders hier saß, ein geschniegelter, geleckter Yuppie. Kaum vorstellbar, dass ihn vor zwei Stunden eine Streife wegen eines unbedeutenden Fahrfehlers angehalten und bei der obligatorischen Kontrolle in seinem Kofferraum eine übel aussehende und noch sehr frische Frauenleiche entdeckt hatte.
Der zweite Polizist, Bert Mosley, grinste spöttisch. „Ach! Da wollte dir wohl einer einen Streich spielen und hat dir das Mädel in den Kofferraum gelegt? Oder welche Geschichten willst du uns hier auftischen? Gib auf! Du bist dran, Junge. Du sitzt schon so gut wie auf´m elektrischen Stuhl.“ Er ahmte ein brutzelndes Geräusch nach. „Aber bitte sehr, erzähle! Der Wagen gehört gar nicht dir, obwohl er auf deinen Namen zugelassen ist und uns deine Visage vom Führerschein anlächelt, und jemand hat…“
Der Gefangene unterbrach ihn mit einer autoritären Handbewegung, bei der seine Handschellen klirrten. „Unsinn. Wer wollte so was behaupten?“ Sichtlich verärgert über das Unvermögen der Polizisten, ihn zu verstehen, setzte er in geduldigem Ton hinzu: „Ich bin unschuldig, weil ich gar nicht der Mann bin, der diese Frau ermordet hat.“
„Siehst ihm aber verdammt ähnlich“, knurrte Bert Mosley, der subalterne Beamte.
„Ja, jetzt! Weil ich ihn übernommen habe. Ich konnte doch nicht wissen… Aber fangen wir von Anfang an! Meinen richtigen Namen brauche ich Ihnen erst gar nicht zu nennen, weil Sie ihn sowieso nicht aussprechen könnten. Meinen Geburtsort auch nicht, weil Sie keine Sternenkarte hier haben. Ich bin ein Außerirdischer.“
Natürlich starrten die beiden Beamten ihn an, unsicher, ob sie lachen oder ihn mit einer diskret verabreichten Tracht Prügel zur Vernunft bringen sollten. Er sprach daher schnell weiter, ehe sie sich für letztere Handlungsweise entscheiden konnten. „Sie werden ja schon gehört haben, dass es immer wieder außerirdische Rassen gibt, die auf ihren ursprünglichen Wohnorten nicht länger existieren können und sich daher nach einer neuen Bleibe umsehen müssen. Einer dieser Rassen gehöre ich an. Da ich immer schon ein unternehmungslustiger Typ war, habe ich mich für ein Auswandererprogramm registrieren lassen und bin hier gelandet, was ich übrigens nie bereut habe. Sobald ich mich an den komischen Körper mit allen seinen herumwedelnden Extensionen gewöhnt hatte, fühlte ich mich pudelwohl hier. Ich bin schon lange auf Ihrer Welt – fünfzehn, sechzehn Jahrhunderte, würde ich sagen. Hab mich ganz gut eingelebt hier.“
„Kompliment, für´n sechzehnhundert Jährchen alten Typen sehen Sie ziemlich frisch aus“, höhnte der Chefinspektor. „Was essen Sie denn Gesundes zum Frühstück?“
„Das hat mit meinem Frühstück nichts zu tun. Ich bin ein Body-Hopper. Wenn es mit einem irdischen Körper zu Ende geht, mache ich einen Hüpfer in den nächsten. Ich hüpfte in der ganzen Welt herum, wobei ich natürlich immer darauf achtete, möglichst attraktive, gesunde und vor allem wohlhabende Exemplare zu übernehmen. Meine letzte Wohnung war ein Professor, der sich mit seinen Büchern ein ganz ordentliches Taschengeld verdient hatte. Aber dann kam plötzlich der Schlaganfall, und mir wurde klar, dass es an der Zeit war, mir einen neuen Körper zu suchen. Ich kann so leicht wechseln, wie man von einem Autobus in den anderen umsteigt. In dem neuen Körper muss ich dann allerdings bleiben, bis er seinerseits sein vorherbestimmtes Ende erreicht hat oder ihm jedenfalls schon sehr nahe gekommen ist. Nach Belieben die Wohnung tauschen geht nicht. Fragen Sie mich nicht, warum. Ist einfach so.“
„Na, in dem Körper hier brauchen Sie nicht mehr lange bleiben“, bemerkte Bert Mosley. „Wenn Sie auf alle juristischen Einwände und Gnadengesuche verzichten, sind Sie in´m halben Jahr dran.“
„Das freut mich zu hören“, antwortete sein Gegenüber. „Ich fühle mich nämlich verdammt unwohl in dieser Haut, obwohl sie erst so verlockend aussah. Jung. Gesund. Hübsch. Feiner Anzug und Maßschuhe. Ich dachte, in dem halte ich es schon eine Weile aus. Wie man sich täuschen kann!“ Er nippte mit einer eleganten Bewegung an dem Pappbecher mit kaltem Kaffee. „Aber ich muss zu meiner Entschuldigung hinzufügen, dass wir nicht in die Zielpersonen hineinsehen können. Wir sehen von ihnen nicht mehr als Sie auch – das Äußere. Und Sie müssen zugeben, dass ich einen angenehmen und sympathischen Eindruck mache.“ Er lächelte strahlend.
„Das stimmt“, bestätigte der Chefinspektor. „Auf jeden Fall so lange, bis man Ihren Kofferraum aufmacht.“
„Sehen Sie?“, rief der Gefangene, sichtlich zufrieden mit der Zustimmung, die er geerntet hatte. „Genauso ging es mir. Ich hatte den Burschen zwar schon eine Weile beobachtet, aber auch nur ein attraktives, lächelndes Gesicht, ein höfliches Wesen und eine gepflegte Sprache registriert. Ich muss überhaupt hinzufügen, dass wir nicht völlig frei in unserer Wahl sind. Ich kann zum Beispiel nicht in den Präsidenten der Vereinigten Staaten hineinhüpfen. Das heißt, ich könnte es wohl, aber nur wenn es möglich wäre mich ihm auf mindestens eineinhalb Meter zu nähern – und das genau zu einem Zeitpunkt, wo ich die Erlaubnis bekommen habe, meine gegenwärtige Wohnung zu verlassen. Wenn das nicht klappt und man ins Leere hüpft – also, das ist echt unangenehm. Dann nimmt man nämlich seine ursprüngliche Gestalt wieder an, und die ist, nach Ihren Maßstäben und Begriffen, doch ziemlich auffällig. Ich suchte mir meinen derzeitigen Körper aus, weil der Vorbesitzer ein Student meines Professors war und recht häufig in seine Wohnung kam; ich brauchte also nur den richtigen Augenblick abzupassen.“
„Warum erzählen Sie uns eigentlich den ganzen Quark?“, fragte der verdrossene Chefinspektor. „Wenn Sie auf verrückt plädieren wollen, erzählen Sie´s Ihrem Verteidiger.“
„Ich bin nicht verrückt und will nicht vorgeben, es zu sein“, kam die rasche Antwort. „Ich will Ihnen das Ganze nur erklären, weil ich… Sagen wir: Es ist eine Frage des Anstands. Sie brauchen nicht glauben, dass man davon nichts wüsste, nur weil man von einem anderen Stern kommt! Ich hatte dort einen ausgezeichneten Ruf, und in meinem gesamten irdischen Leben habe ich mich immer bemüht, mich den hiesigen Sitten und Gebräuchen anzupassen. Wir wollen schließlich nicht auffallen. Aber abgesehen davon… Sehen Sie, ich muss Ihnen den technischen Prozess des Body-Hopping kurz erklären.“
„Wollt ich immer schon wissen“, murrte Chefinspektor Homer Wallitt. „Hören Sie, wir machen einen Deal: Ich höre mir Ihren dämlichen Quatsch noch eine Stunde lang an, dafür unterschreiben Sie dann schön brav ein Geständnis, dass Sie das arme Mädchen umgebracht haben, ja?“
Der Gefangene nickte. „Mach ich!“, stimmte er mit bemerkenswerter Gelassenheit zu. „Und jetzt zum Thema. Wie gesagt, wenn man einmal gehüpft ist, gibt es kein Zurück mehr. Dann steckt man in dem Kerl fest, den man sich ausgesucht hat.“
„Was für´n Pech!“ Bert Mosley grinste. „Und Sie suchen sich ausgerechnet einen aus, der gerade seine Freundin abgemurkst hat!“
„Ja, wenn´s nur das wäre!“, antwortete der Gefangene. „Ich hatte noch viel mehr Pech, wie Sie gleich hören werden. Sie müssen sich den Hüpfprozess so vorstellen, als würden Sie in eine komplett möblierte Wohnung mit allem Drum und Dran einziehen. Wenn Ihr Vorgänger eine Vorliebe für violett lackierte Wände, schmutzige Bettwäsche und grün gefärbte Haare hatte, müssen Sie damit leben lernen, so lange jedenfalls, bis Sie es unauffällig geändert haben. Ich muss mich anfangs ziemlich klein machen – als blinder Passagier in seiner Persönlichkeit, sozusagen. Später dehnt man sich natürlich aus, verdrängt immer mehr von dem Müll, den der ursprüngliche Bewohner des Körpers zurückgelassen hat, aber das dauert seine Zeit und darf nicht überhastet vorgenommen werden. Wie gesagt, wir wollen nicht auffallen, und deshalb hat die Auswanderungsbehörde uns dringend davon abgeraten, innerhalb von wenigen Tagen nach der Übernahme die Wohnung komplett neu zu möblieren, sich von der Frau scheiden zu lassen oder auch nur die Frisur zu wechseln. Denn das würde natürlich Gerede hervorrufen, und manche von diesen fanatischen Alien-Jägern sind uns verdammt knapp auf den Fersen. Ich hasse Haustiere, aber ich habe zehn Jahre zugewartet, ehe ich das Dutzend Katzen im Haus des Professors endgültig fortgeschafft hatte – der Mann war weithin bekannt als Katzennarr. Also war ich auch jetzt bereit es mir in meiner neuen Wohnung ganz unauffällig gemütlich zu machen, als ich… Hol´s der Teufel! Können Sie sich vorstellen, wie das ist, wenn Sie glauben einen Mietvertrag für eine Luxussuite mit Panoramablick abgeschlossen zu haben und Sie landen statt dessen in einem Mülleimer?“
Der Chefinspektor beantwortete die Frage nicht, sondern deutete auf die Uhr. „Fünfunddreißig Minuten dürfen Sie noch jeden Blödsinn quatschen, den Sie wollen. Also, es gefiel Ihnen nicht in der neuen Wohnung? Warum eigentlich? Sie sehen gut aus und leben in angenehmen Verhältnissen. Sohn reicher Eltern, Studium fast abgeschlossen, elegante Wohnung, von Papa und Mama finanziertes Auto…“
„Das stimmt, aber da hat es noch einen Haken. Sie kennen ja das physikalische Prinzip: Wo eines ist, kann nicht gleichzeitig ein anderes sein. Um also überhaupt hineinzupassen in den Kerl, musste ich eine bestimmte Methode anwenden. Ich hüpfte in ihn hinein, packte ihn am Kragen und schmiss ihn raus – stopfte ihn in den Körper des alten Professors. Aber das ist so, als würden Sie in eine Wohnung einbrechen, den Besitzer rauswerfen und sich drinnen breit machen. Der Besitzer ist zwar fort, aber es ist immer noch seine Wohnung. Seine Gedanken, Erinnerungen, Emotionen, sein ganzes Flair ist noch da. Und kaum war ich drinnen, merkte ich, dass ich einen Fehler gemacht hatte. Einen kapitalen Fehler. Ich war in einer Persönlichkeit gelandet, die eine einzige Kloake war. Oh, nicht äußerlich! Innerlich, meine ich. Ich war in ein Haus gezogen, das nach Blut und Schimmel und Moder stank und angefüllt war mit allen Furien des Mordes.“
„Würde mich auch nicht wundern, nachdem er gerade eine Frau umgebracht hatte“, warf der jüngere Beamte ein.
„Was heißt hier eine!“, rief der Außerirdische und schlug mit beiden gefesselten Händen auf den Tisch, dass ein Pappbecher umfiel. „Der Kerl war ein Serienmörder!“
Die beiden Polizisten glotzten ihn an. Eine gute Minute herrschte Schweigen, dann hatte sich der Chefinspektor soweit wieder gefasst, dass er wie ein Automat murmelte: „Serienmörder.“