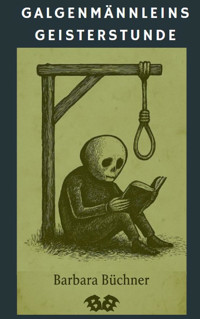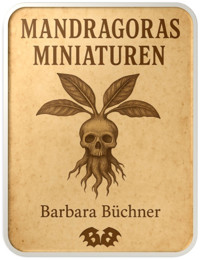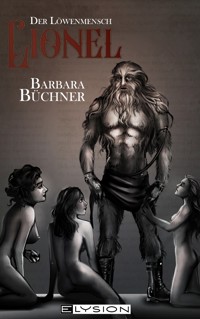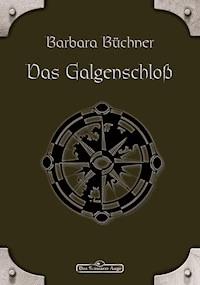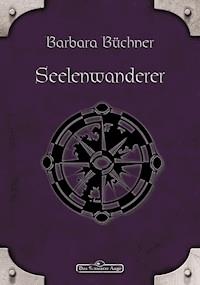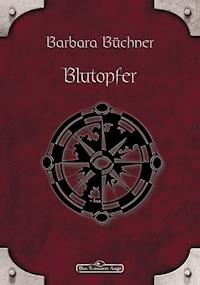1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Windmüller paktiert mit dem Teufel. Ein junger Wanderer entkommt nur knapp der glühenden Umarmung der Mittagsfrau. Ein altes Auto wird von seinem Mitgefühl für einen verunfallten Sportwagen überwältigt. Ein Bauerndorf legt das Glück an die Kette. Ein Fernfahrer wird wider Willen zum Exorzisten – und mancher gleichgültige Mann erhält einen unerwarteten moralischen Schubser. In diesen Geschichten begegnen sich Grauen und Güte, Schuld und Sehnsucht, Bosheit und Mitgefühl. Sie erzählen von Menschen, die stolpern, zaudern, lieben – und manchmal in den Abgrund blicken müssen, um das Licht zu erkennen. Barbara Büchner, Jahrgang 1950, ist eine bekannte Wiener Schriftstellerin. Nach Jahren im Journalismus wandte sie sich ganz der Literatur zu – zunächst mit historischen und Fantasy-Romanen, später mit dunklen Erzählungen, in denen das Grauen leise und oft unerwartet daherkommt. Ihre Bücher vereinen klassische Erzählkunst der schwarzen Romantik mit einem feinen Sinn für das Makabre und für jene warmherzigen Regungen, die selbst in der Finsternis nicht verlöschen. Wer bei ihr liest, darf sich gruseln, lächeln – und manchmal auch lachen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Barbara Büchner
Geschichten aus der Knochenmühle
Dunkle Wunder, bleiche Geister
Geschichten aus der Knochenmühle
Dunkle Wunder, bleiche Geister
Eine Sammlung von Barbara Büchner
Aus der Reihe „Portiunculas Bibliothek“ (Band 5)
Copyright 2025 Barbara Büchner
Alle Rechte vorbehalten
Cover und Illustrationen: Barbara Büchner und „Thekla“ (GPT-5)
Erstveröffentlichung in der Portiuncula-Reihe
Veröffentlicht über Tolino Media GmbH & Co.Kg
ISBN
Die Knochenmühle
Eine rumänische Volkssage
„Hör mir zu, Windmüller“, sagte der Teufel zu Jozef Mazilescu, „ich kenne dich; du bist kein Hasenfuß und weißt, was gutes Geld wert ist; willst du ein Geschäft mit mir abschließen? Du brauchst mich nur in jeder Neumondnacht in deiner Mühle mahlen lassen. Dazu genügt mir der vierte Gang, auf den drei anderen Gängen kannst du allezeit mahlen, was du willst.“
Mit diesen Worten ließ er ein paar klingelnde Goldfüchse über den Tisch rollen.
Das Angebot gefiel dem Müller (der unersättlich habgierig war), und so kamen sie überein. Der Müller mahlte auf drei Gängen das Getreide, das ihm die Bauern brachten, und auf dem vierten Gang mahlte der Teufel Pferdehufe und Totengerippe, die er bei Neumond um Mitternacht in einem Karren mit kopflosen schwarzen Pferden anlieferte. War er mit Mahlen fertig, so füllte er alles in stinkende schwarze Säcke, die er selbst mitgebracht hatte, band sie ordentlich zu, warf sie auf den Karren und fuhr mit Hü und Hott in die Hölle zurück. Der neue Teilhaber zahlte pünktlich, und alles wäre in Ordnung gewesen, hätte nicht ein Zufall den Müller neugierig gemacht. Oder war es vielleicht der Teufel selbst gewesen, der ihm eine Falle stellte? Jedenfalls sah Mazilescu eines Tages ein goldenes Körnchen, so groß wie ein Getreidekorn, unter dem Stutzen liegen, aus dem das Mehl in die Säcke rieselte. Als er nun genauer nachsah, entdeckte er noch eines, und noch eines, und nun wurde ihm klar, dass der Teufel alle diese Totengerippe zu Gold mahlte.
Er sagte aber niemand etwas davon, sondern eines Nachts, als er allein in der Mühle war, schlich er mit einem Häfen Leim und einem dicken Pinsel hinzu und malte im Inneren auf dem schrägen Boden des Abfüllschachts einen handbreiten, klebrigen Streifen. Und von da an blieben immer viele der kostbaren Körner dort kleben. Der Teufel, dachte Jozef Mazilescu, würde es schon nicht bemerken, denn wenn der goldene Strom anschwoll, verdeckte er die Falle und rauschte darüber hinweg. War der Böse mit seinem höllischen Fuhrwerk verschwunden, so kratzte der Müller eifrig die Goldkörner aus dem Stutzen.
So wurde Mazilescu immer reicher, und eines Tages fiel das seinem Weib auf. Sie nahm ihn ins Gebet, und wer kann schon widerstehen, wenn ein solcher Weibsteufel, wie es die Müllerin war, einem Mann sein Geheimnis entreißen will? Nachdem sie ihm recht gründlich das Gesicht zerkratzt hatte, legte Jozef ein Geständnis ab. Die Müllerin zeterte und keifte, sie warf ihm alle Schimpfnamen an den Kopf, die ihr nur einfielen – aber das nicht etwa, weil er mit dem bösen Feind ein Geschäft gemacht hatte, und auch nicht, weil er diesen dabei betrogen hatte, sondern weil er sich mit einem handbreiten Streifen Leim begnügt hatte! „Hättest du Holzkopf den ganzen Schacht innen mit Leim bestrichen, so wäre viel mehr hängengeblieben!“, geiferte sie. „Was ist so ein Mann doch für ein dummes Tier! Geschwind, hol den Leim! Was den Teufel angeht, da trifft es keinen Armen, also lass uns nur mit vollen Händen zugreifen…“
Und der Müller, von zwei Peitschen gleichzeitig angetrieben, nämlich von seiner Habgier und der Angst vor seiner Frau, tat, was sie ihn geheißen hatte.
Der Teufel muss es aber wohl doch gemerkt haben, wie er betrogen wurde, denn beim nächsten Neumond packte er den Müller und sein Weib und riss ihnen beiden das Herz aus der Brust. Die Körper aber hängte er an den Segeln ihrer Windmühle auf. Und da niemand wagte, sie herunterzuholen, blieben sie dort oben hängen, und wenn der Wind wehte, schwebten die beiden Leichen immerzu auf und ab, auf und ab, bis sie schließlich völlig verwittert waren und ihre Knochen zu Boden plumpsten.“
*
„Gewonnen, Meikart! Was habe ich dir gesagt? Die schwarze Mühle ist kein rumänisches Volksmärchen, wie unser schlauer Herr Kollege Schonhoff in seinem albernen Buch behauptet! Sie existiert – da, genau vor unseren Augen – und sie ist auch noch verdammt gut erhalten!“
Das Motorbrummen des Hummer Jeep erstarb, als John Bolton beim ersten Anblick der Mühle anhielt. Es war ein regnerischer Sommertag, der seinem Ende zuging, und das bucklige, in der Ferne von zackigen Bergen begrenzte Plateau in einer der hintersten Ecken Rumäniens machte einen unvorstellbar trübseligen, verlassenen Eindruck. Seit gut zwei Stunden hatten die beiden Parapsychologen keine menschliche Ansiedlung mehr gesehen, und diese letzte hatte aus ein paar moosbewachsenen Grundmauern und halb eingestürzten Kaminen bestanden. Schwere Wolken, anzusehen wie zerlumpte Säcke, hingen über einer ehemals bewirtschafteten, jetzt aber seit langem völlig verwahrlosten Landschaft, die bewachsen war von Krüppelbäumen, borstigem Gras und Dornbüschen. Schon auf der Fahrt war den Männern aufgefallen, dass die Vegetation mit jedem zurückgelegten Kilometer kümmerlicher wurde und selbst die wilden Rosen hier nur kleine, missfarbene und verschrumpfte Blüten trugen, als hätte sie mitten im Juli ein bitterer Frost gestreift. Von einer Straße hatte keine Rede sein können; nicht einmal einen Güterweg gab es mehr, nur den beinahe gespenstischen Schatten einer Karrenspur, die vor endlos langer Zeit zuletzt befahren worden war. Man musste es geradezu ein Wunder nennen, dass sie den Ort überhaupt gefunden hatten, erst das verfallene Dorf und jetzt die sagenumwobene Mühle selbst. Sobald diese in Sicht kam, wurde auch die Straße besser – bemerkenswert besser. Es war allerdings keine moderne Asphaltstraße, sondern ein mit dicken Feldsteinen gepflasterter, einspuriger Weg, der in Bolton Erinnerungen an römische Landstraßen weckte. Damals, dachte er, hatten die Leute wahrhaftig noch für die Ewigkeit gebaut! Auch die Mühle – eine erstaunlich große, wehrhafte Ansammlung von Gebäuden – war kaum vom Zahn der Zeit benagt worden.
Ronnie Meikart, der ein notorischer Pessimist war, brummte in seinen Bart: „Ein bisschen sehr gut erhalten für einen dreihundert Jahre alten ländlichen Zweckbau! Mann, sogar die Fludern sind noch dran! Von dem Dorf da hinten stehen nicht einmal mehr die Grundmauern, aber das Ding sieht aus, als könnte man es jederzeit in Betrieb nehmen! Es könnte…“ Plötzlich blinzelte er und fuhr sich mit der Hand über die Augen. „John, sag mir, ob ich Halluzinationen habe! Drehen sich die Flügel tatsächlich?“
John Bolton grinste. „Tatsächlich! Nun, das liegt ganz einfach an dem lebhaften Wind, der hier oben bläst. Oder meinst du etwa“ – dabei knuffte er seinen Begleiter schelmisch mit dem Ellbogen in die Rippen – „der Teufel ist wieder in der Mühle zugange und mahlt Totengerippe?“
„Unsinn“, knurrte Meikart in dem gereizten Ton, der verriet, dass er sich unbehaglich fühlte. „Natürlich liegt es am Wind. Aber dass die Dinger nicht in Fetzen an den Spieren hängen, Mann, das fasse ich nicht!“
Bolton ging nicht darauf ein. „Apropos lebhafter Wind“, bemerkte er, während er den Motor wieder startete und den Hummer vorsichtig die holprige Fahrbahn entlang steuerte. „Die Wolken da hinten sehen mir nach einem Unwetter erster Klasse aus, und ich möchte nicht, dass mir der Hagel Dellen ins Dach schlägt und die Reifen im Schlamm steckenbleiben. Wir stellen den Wagen in den Wirtschaftsgebäuden unter, und dann sehen wir uns das Spukschloss einmal aus der Nähe an – machen ein paar Fotos und Video-Aufnahmen, damit wir sie diesem Klugscheißer Schonhoff unter die Nase reiben können. Rumänisches Volksmärchen! Dass ich nicht lache!“
Meikart zuckte die Achseln. „Dass die Geschichte einen gewissen historischen Kern hat, gibt ja auch Professor Schonhoff zu. Einen Müller namens Jozef Mazilescu gab es wirklich, und er war ein Geizhals und Betrüger, wie so viele seinesgleichen.“
Bolton lachte laut auf. „Mann, wenn einer sogar den Teufel zu betrügen versucht, wie schlimm wird er es dann erst mit seinen armen Landleuten getrieben haben? Wollen wir nachsehen, ob wir in diesem exzellent erhaltenen Gebäude vielleicht noch Spuren von den berühmten Goldkörnern finden? Eine Handvoll davon, und wir hätten die Kosten dieser Expedition wieder herinnen!“
Sein Gefährte gab keine Antwort. Über der steilen Anhöhe, auf der der Turm mit den Flügeln erbaut war, alle anderen Gebäude überragend, zuckte Wetterleuchten auf, und der Sturm fuhr mit einer Wucht über die Hochebene, dass Sand und Steine gegen die Flanken des Hummer prasselten. Auch Bolton schwieg. Die beiden Männer hatten fürs erste keine anderen Sorgen mehr, als den wertvollen Wagen mit den Geräten und sich selbst unter Dach zu schaffen, ehe das Unwetter losbrach.
Ronnie Meikart war ein Kerl wie ein Holzfäller, groß, muskulös, mit einem wild wuchernden roten Bart, aber er war zugleich ein sehr sensibler Mann, und plötzlich wünschte er, sie hätten die Mühle nicht gefunden. Vielleicht lag es ja nur an der fahlen Beleuchtung und dem drohenden Unwetter – eine richtige Hammer-Film-Kulisse – aber diese so seltsam langlebigen Gebäude mit den ruckartig kreisenden Fludern hatten etwas beklemmend Unnatürliches an sich. Irgendwie passten sie nicht in die Landschaft – oder passten sie einfach nicht in die Zeit? Immer aufdringlicher wurde die optische Täuschung, dass die historische Windmühle nur ein in die düstere Landschaft hineinkopiertes Gemälde war. Alles rundum war dem Verfall geweiht, aber die Mauern der „schwarzen Mühle“ waren stark, ihre kegelförmigen Schindeldächer unbeschädigt, ihre hölzernen Tore und Fensterläden in demselben Zustand, in dem sie sich Ende des siebzehnten Jahrhunderts befunden haben musste. Selbst die empfindlichen Leinwandsegel waren intakt. Stramm und straff wie Schiffssegel blähten sie sich im Wind. Konnte einem das Gespenst eines Gebäudes erscheinen? Aus seiner Erfahrung wusste er, dass es so war. Vielleicht würde die gesamte Anlage vor ihren Augen verschwinden, wenn sie am offen stehenden Tor angelangt waren?
Aber der Hummer mit seinem starken Motor und seinen griffigen Reifen erklomm zügig die die kurze letzte Steigung, und als Meikart das Fenster auf seiner Seite herunterkurbelte und hinaussah, war da ganz eindeutig eine stabile Mauer aus Feldstein, die vor dem Sturz in eine steile Schlucht schützte, und am Ende dieser Mauer das weit offen stehende Hoftor, ebenso unbestreitbar real. Die mächtigen Torflügel schauderten unter dem Anprall des Windes, der immer heftiger wurde. Erste große Tropfen fielen und hinterließen schwarze Löcher im Staub. Einem hellfarbigen Staub, der untermischt war mit Spelzen und den Überresten von Strohhalmen.
Meikart stieß unwillkürlich einen erstickten Schrei aus. Er packte seinen Begleiter so grob am Arm, dass der das Lenkrad verriss und um ein Haar in den Torflügel gekracht wäre. Über Boltons zorniges Aufbrüllen hinweg schrie er: „Verdammt, hast du das gesehen? Hier liegen Spelzen, und der Sand sieht aus wie mit Mehl vermischt! Hier hat jemand gemahlen, und zwar vor ganz kurzer Zeit, sonst wäre bei dem starken Wind alles längst davongeflogen!“
Bolton knurrte Verwünschungen, kurbelte aber das Fenster auf seiner Seite herunter, beugte sich hinaus und betrachtete den Boden. Er musste zugeben, dass Meikart recht hatte. „Versteh ich nicht“, brummte er. “Aber es könnte immerhin sein, dass Bauern klammheimlich die Mühle benützen.“ Und da er das Unbehagen seines Mitarbeiters sehr deutlich erkannte, fügte er zynisch hinzu: „Seien wir froh! Wer immer hier am Werk war, hat wenigstens nur Getreide gemahlen und keine Pferdehufe!“
Ganz geheuer schien es ihm aber doch nicht zu sein, hier so deutliche Spuren menschlicher Tätigkeit zu finden, denn er parkte den Hummer mit der Schnauze zum Ausgang direkt unter dem tunnelartigen Torgewölbe, das ausreichen würde, ihn vor Hagelschloßen und Blitzen zu schützen. Als er ausstieg, steckte er ein handliches kleines Gerät in die Tasche – einen Taser. Gespenstern machten die Stromschläge nichts aus, aber bei unangenehmen Begegnungen menschlicher Art war das bissige kleine Ding sein Geld wert.
*
„Sehen wir uns zuerst die eigentliche Mühle an, die Wirtschaftsgebäude können warten“, schlug Bolton vor. „Wenn wir uns beeilen, haben wir unsere Fotos im Kasten, bevor das Unwetter losbricht. Mir geht es jetzt einmal darum diesem Märchenerzähler Schonhoff zu zeigen, wer recht gehabt hat mit seiner Theorie – nämlich ich.“
Meikart fand, er hätte ruhig wir sagen können, aber Boltons Gedanken kreisten meistens um sich selbst. Also fragte er nur: „Und die technischen Untersuchungen?“ Das war der korrekte Ausdruck für „die Gespensterjagd“.
„Später. Ich will die empfindlichen Geräte nicht herumschleppen, während es jeden Moment wie aus Eimern schütten kann. Fürs erste machen wir ein paar Fotos mit den Handys, nur als Beweismaterial, die können wir ihm dann gleich schicken. Wird ihn ordentlich ärgern.“
Nachdem Bolton immer derjenige war, der anordnete, was zu geschehen hatte (er war auch der Sohn des alten Alfred Bolton, der die Expedition finanziert hatte), fügte Meikart sich, wenn auch sehr widerwillig.
Vom Wind gebeutelt, stiegen sie die Treppen hinauf, die zum Turm der Mühle führten. Es waren sauber und ordentlich in den Stein gehauene Treppen, auf denen kein Moos wuchs. Über ihnen knarrten und ächzten die gewaltigen Flügel, und obwohl Ronnie Meikart wusste, dass sie in sicherem Abstand über seinem Kopf schwangen, zog er jedes Mal den Kopf zwischen die Schultern. Er wurde das Gefühl nicht los, dass an zweien dieser Flügel jeweils am äußersten Ende etwas Langes, Schweres hing, dessen Form sich immer erst im letzten Augenblick in einen dunklen Fleck vor der Hintergrund der tintenschwarzen Wolken auflöste.
Es wunderte ihn nicht mehr, dass das Tor am Ende der kurzen Treppe einladend offen stand. Er konnte in einen schattenverhangenen Flur hineinsehen, sauber getäfelt und gefliest – der Müller war tatsächlich ein reicher Mann gewesen. Aber so reich, dass auf den Fliesen verführerisch glitzernde Goldkörner lagen?
Bolton stieß einen Schrei aus. Also war es keine Täuschung – er hatte das Gold auch gesehen! „Ich werde verrückt! Schau dir das an, Ronnie, schau dir das an! Hol mich der Teufel, das Zeug ist echt!“ Mit einem Satz war er drinnen und häufelte mit beiden Händen die Körner zusammen. Sie schimmerten matt in dem trüben Licht, aber Ronnie musste zugeben, dass es kein Feengold war – als Bolton sie von einer Hand in die andere rieseln ließ, waren sie rundherum substanziell. „Wenn hier schon so viele liegen, wie viele dann erst –„
Ronnie streckte energisch die Hand aus und riss den Gefährten zurück. „Halt! Hörst du das nicht?“ Er wies in das dunkle Gebäude. Aus dem Inneren drang, zuweilen unterdrückt und verwischt vom Lärm des Windes, aber unverkennbar, das Klappern eines Mahlwerks!
„Ja und?“ Bolton hatte nur mehr Augen für das Gold, dessen verführerisch glitzernde Spur sich im Dunkel des Ganges verlor. „Dann läuft das Ding eben, die Fludern drehen sich ja auch.“ Er riss sich die Basketball-Mütze vom Kopf und begann das Gold einzufüllen, während er Schritt für Schritt weiter in die Mühle eindrang. Ronnie schien es, dass er das Geräusch der Mühlsteine immer lauter und deutlicher hörte.
„Bleib da, John!“, schrie er, von jäher Todesangst gepackt. „Geh da nicht hinein!“
Da wurde ihm die Türe vor der Nase zugeschmettert, als hätte sie ein gewaltiger Windstoß gepackt – und Windstöße gab es tatsächlich genug, nur ging die Türe nach innen auf! War der plötzliche Sturm denn aus dem Innern des Turmes gekommen?
Meikart starrte das Tor an, durch das Bolton verschwunden war. Alles in ihm sträubte sich dagegen, dem Kollegen zu folgen. Aber wozu sonst hatte er die mühselige Reise auf sich genommen, wenn ihn jetzt im letzten Augenblick der Mut verließ? Nicht auszudenken, wie der Amerikaner ihn auslachen würde, wenn er wegen eines Rasselns und Klapperns, das irgendeine x-beliebige Ursache haben mochte, die Flucht ergriff! Und wohin sollte er überhaupt flüchten? Sie hatten nur den einen Wagen. Sich kurzerhand in den Besitz des Hummers zu setzen und Bolton seinem Schicksal zu überlassen, dazu war Meikart zu anständig. Aber ohne den Wagen flüchten, hätte einen endlosen Fußmarsch durch diese deprimierende Heide bedeutet, bei Regen und Sturm obendrein… Nein, sie hatten die Sache gemeinsam angefangen, sie mussten sie auch gemeinsam zu Ende bringen.
Der große rotbärtige Mann seufzte, tat aber einen tapferen Schritt auf das Tor zu. Im nächsten Augenblick hörte er ein Geräusch, das sich deutlich vom Jaulen des Windes und dem Klappern der Fludern abhob, das er aber nicht deuten konnte – ein Rasseln und Rascheln, ein schwaches Pfeifen wie vom Fall eines schweren Gegenstandes aus großer Höhe, und dann knallte etwas an seinen Hinterkopf, das ihn zu Boden warf wie ein Totschläger. Er knickte in die Knie und kippte nach vorne um, und ehe ihn die Bewusstlosigkeit überwältigte, sah er aus halb geschlossenen Augenschlitzen, was von seinem Kopf abgeprallt war und vor ihm auf dem Boden lag. Es war ein menschliches Bein, verrottet bis auf die gelben Knochen, dessen Fuß noch in einem mehlbestaubten Schuh steckte.
*
Der kalte Regen weckte Ronnie Meikart schließlich aus seiner Umnachtung. Als er blinzelnd die Augen öffnete, blickte er in ein graues Gemisch aus Wolken, Regenschleiern und nassem Feldstein, das sich nach allen Richtungen zu drehen schien. Ein entsetzlicher Schrecken durchfuhr ihn bei dem Gedanken, etwas hätte ihn an den Fludern aufgehängt, die ihn jetzt immer höher und höher hinauf in das Unwetter trugen, und dieser Schrecken vertrieb die Schleier in seinem Gehirn. Er stieß einen wilden Schrei aus und schlug um sich, wollte sich festklammern, aber seine schwitzenden Hände fassten nur borstiges Unkraut und schlüpfrige Steine. Er lag auf dem Boden, mit mörderisch schmerzendem Schädel und – wie ein vorsichtiges Tasten ergab – einer dicken blutigen Beule im Haar. Über ihm jagten die Sturmwolken. Jagten durch einen leeren Himmel.
Ronnie richtete sich auf Hände und Knie auf und blickte um sich. Von einem Totengebein, das ihn k.o. geschlagen hatte, keine Spur. Auch von der Mühle nicht. Er lag – wie ein Opfer auf einem monströsen Altar – auf einem mächtigen, felsigen Kegelstumpf, auf dem sich da und dort die kniehohen Überreste von Mauern erhoben. Zu seiner Rechten führte eine zerbröckelnde Treppe in einen Hof hinunter, den weitere kaum noch erkennbare Ruinen umstanden. Nur das mächtige Torgewölbe war noch erhalten, und darunter leuchtete das gelbe Hinterteil des Hummer hervor.
Der Anblick des vertrauten Wagens belebte Ronnie Meikart so weit, dass er sich kriechend und rutschend über die gefährliche Treppe hinab manövrierte und in den Hof gelangte. Halb blind vom peitschenden Regen blickte er um sich – und sah Bolton dort auf den Steinen liegen.
Es musste Bolton sein, denn seine Trekkingschuhe und die bunten Socken waren ganz deutlich erkennbar. Erst von den Knien aufwärts wandelte sich die Gestalt in etwas Halbmenschliches, Raues, Ruppiges und schwarz Verschmortes, dessen ausgestreckte rechte Hand mit den Überresten des Tasers zu einer brandigen Klaue verschmolzen war.
*
Brief von Alfred Bolton an Ronnie Meikart.
Lieber Meikart,
ich hoffe, Sie haben sich inzwischen so weit von den schrecklichen Ereignissen erholt, dass ich es wagen kann, Ihnen diese mit meinem Brief neuerlich ins Gedächtnis zu rufen. Ich wollte Ihnen auf jeden Fall danken dafür, dass Sie das Opfer gebracht haben, trotz Ihres eigenen jämmerlichen Zustandes den Leichnam meines Sohnes zu bergen und den Behörden zu übergeben. Beiliegend finden Sie das Gutachten des Gerichtsmediziners aus Bukarest, der die Leiche obduziert hat. Todesursache war eindeutig ein Blitzschlag. Offenbar stand John während des Unwetters – was unverständlich leichtsinnig von ihm war – auf dem höchsten Punkt des Mühlengeländes, dort, wo sich einst der Turm mit den Flügeln befand, und wurde von einem Blitz in den Hof hinabgeschleudert. Warum er den Taser gezückt hat, wird niemand mehr herausfinden. Aber eben das war die Ursache des Unfalls – dass er inmitten all der gewaltigen Entladungen rundum ein elektrisches Gerät in Betrieb nahm. Ich schreibe Ihnen das nur, damit Sie sich keinerlei Vorwürfe machen. Unwetter sind eben tödlich gefährlich und John war sehr leichtsinnig. Ich möchte wirklich wissen, was er sich dabei gedacht hat.
Ich wünsche Ihnen rasche Genesung – wie ich höre, werden Sie das Sanatorium bald verlassen können – und übermittle Ihnen auch von Professor Schonhoff seine besten Wünsche. Leider sind die Handy-Fotos, die John ihm noch aus der Mühle geschickt hat, zu nichts zu gebrauchen. Die Dateien, sagt er, sind völlig vermurkst. Aber ich nehme an, das kümmert Sie jetzt nicht mehr, denn wie ich höre, wollen Sie ja in Zukunft keine parapsychologischen Untersuchungen mehr durchführen. Schade, Sie waren ein sehr tüchtiger Forscher, aber ich verstehe natürlich, dass der Schock Sie tief getroffen hat.
Mit freundlichen Grüßen, Alfred Bolton.
***
Ein Unfall auf der Landstraße
Das Land ist sehr alt, und man sagt, dass es nichts vergisst, weder Gutes noch Böses, vor allem aber das Böse nicht.
Die vier Männer in der Gendarmeriestation von Ballydehob saßen reglos auf ihren hölzernen Stühlen. Drei davon hoben sich von der dunklen, mit vielen Fotos und Anschlagzetteln bestückten Mauer hinter der Schreibtischlampe ab wie die beleuchteten Figuren in einem Schießstand. Sie hätten den vierten - Jake Caims - an Becketts Gestalten erinnert, hätte er jemals Beckett gelesen, aber Caims las nichts anderes als die Zeitung. Außerdem war er nur hergekommen, um über einen Unfall auf der Landstraße zu berichten, und die drei Polizisten interessierten ihn nicht.
„Also!" sagte einer der drei dunklen Männer hinter der Lampe. Sie schienen viel Zeit zu haben, denn als er seinen Bericht begann, hatten sie den Wasserkessel auf den Rechaud gestellt und ihre zerdrückten Zigarettenpackungen einladend auf den Tisch gelegt, und sie machten keine Anstalten, seine Aussage niederzuschreiben. Sie hatten seine Personalien notiert, und nun saßen sie reglos und gelangweilt da und ließen sich alles sehr gründlich erzählen.
Der Fernfahrer Cairns sah den Unfall noch einmal vor sich abrollen wie einen winzigen Film auf einer riesigen schwarzen Leinwand. Die Lampen des Motorrads, die über den nächtlichen Hügel fegten und plötzlich in einem weiten Looping durch den sternlosen Himmel flogen; die beiden anderen Lampen, die von rechts kamen, einen Augenblick lang aufflammten und in die Nacht stierten, fahl wie erblindete Augen, und dann hinter dem Hügel verschwanden. Es war ein stummer Film, begleitet von dem satten Dröhnen, das Caims eigener Femlaster von sich gab, das Bild gedämpft durch eine staubdunkle Windschutzscheibe, aber Caims hätte jeden Eid geschworen, dass der Wagen mit den fahlen Lampen ohne anzuhalten weitergerast war, nachdem das Motorrad seinen schrecklichen Lichtbogen in den Himmel gezeichnet hatte: Die beiden Lichter flohen den nächstgelegenen Hügel hinauf, und dort verschwanden sie in der Regennacht.
Cairns biss auf seine Zigarette, während er den schweren Laster vorsichtig über den Asphalt steuerte. Es regnete stark, und die Doppelräder wirbelten braune Wasserfontänen auf, die hinter ihm auf der Straße zusammenschlugen. Das Asphaltband führte steil hügelabwärts nach Ballydehob, von dessen Straßenlampen ein dünner Lichtnebel über dem wüsten Land aufstieg. Caims spuckte den Zigarettenrest aus, als der Laster die Unfallstelle erreichte, aus derselben instinktiven Pietät heraus, die andere Leute sich bekreuzigen lässt, wenn ein Leichenwagen vorbeifährt.
Der Laster blieb bebend und schnarchend vor den Trümmern des Motorrads stehen, die starken Lampen auf das Wrack gerichtet wie ein Tier, das den Kadaver eines Artgenossen anstiert. Von dem Motorrad war nicht mehr übriggeblieben als ein zerknittertes schwarzglänzendes Etwas mit einer leeren Scheinwerferfassung, und von dem Fahrer nicht mehr als ein schlaffes schwarzglänzendes Etwas in einer zerschundenen Ledermontur. Das Licht spiegelte sich in seinem geschlossenen Helmvisier. Caims sah einen Moment lang auf ein wachsgelbes Stück Bein herunter, das aus den ledernen Falten hervorragte, und da er keine Kappe trug, die er hätte abnehmen können, fuhr er sich mit einer Hand durch das Haar. Dann kletterte er in den Wagen zurück, schrieb in sein Notizbuch, was auf der verbogenen Nummerntafel gestanden war, gab Gas und fuhr hinunter nach Ballydehob.
Die drei Polizisten blickten nachdenklich auf die Ziffern und Buchstaben, die er auf einen gelben Notizblock hingeschmiert hatte: GS 98-417. Dann nickten sie.
„Tja", sagte einer von ihnen. „Das wärs. Danke, Mr. Caims. Zigarette?" Seine kleinen hellen Augen schillerten im Lampenlicht, als er sich vorbeugte. „Grauenhafte Nacht, was?"
„Ja", sagte Caims. „Der Fahrer von dem Motorrad -"
„Grauenhafte Nacht, was?" wiederholte der Beamte mit seltsamem Nachdruck.
Cairns sah ihn an und fuhr sich nachdenklich mit den Fingerknöcheln über die Nase.
Der Polizist hatte kein einziges Wort von seinem Bericht mitgeschrieben.
Er warf einen zweifelnden Blick auf die drei Männer. Der eine, der ihm die Zigarette angeboten hatte, hatte sich zurückgelehnt und säuberte sich mit einem Falzbein den Daumennagel. Der zweite zerknitterte eine leere Zigarettenpackung und strich sie dann immer wieder glatt. Der dritte las in einem mit Gummibändern zusammengeschnürten Akt.
„Tja", sagte er, „ich dachte nur, ich muss unterschreiben."
Der dicke Polizist hob den Kopf und sah ihn aus seinen kleinen schillernden Augen an, als hätte er etwas Unangenehmes gesagt, dann meinte er nur: „Wenn Sie unbedingt wollen."
„Wollen -?" echote Caims.
„Es lohnt sich nicht", sagte der Polizist, leise, wie zu sich selbst. „Es lohnt sich nicht." Dann zog er mit einer trägen Bewegung die Schreibmaschine an sich heran und begann zu tippen. Offenbar hatte er sich die ganze lange Geschichte von Anfang bis Ende gemerkt, denn er schrieb sehr schnell, ohne einmal nachzudenken oder nachzufragen, und doch hatte er sich bei keinem einzigen Detail geirrt, nur den Namen hatte er „Jack Caims" anstatt „Jake Caims" geschrieben.
„Alles in Ordnung jetzt?" fragte er, sobald der Femfahrer seine Unterschrift daruntergesetzt hatte, und seine Stimme klang müde und ungeduldig. Als er sich bewegte, fiel das Licht voll auf sein grobes weißes Gesicht. Die Augen darin sahen klein und alt aus, beinahe wie Löcher in einer weißen Wand. Vielleicht war es dieser Ausdruck von Leere, der Cairns so aufbrachte, dass er sagte: „Ich habe meine Pflicht getan. Macht, was ihr wollt."
„Sie missverstehen uns", sagte der dicke Polizist leise. Und während er weitersprach, hob sich seine Stimme, bis sie den halbdunklen Raum füllte: „Sie haben Ihre Pflicht getan. Wir tun unsere. Sie sagen. Sie hätten einen Unfall gesehen. Wissen Sie denn, was Sie gesehen haben. Sie bürokratischer Dummkopf?"
Nach dieser sonderbaren Einleitung griff er nach einem Aktenordner, schlug ihn auf und reichte ihn Cairns, der in stummer Verwunderung zugehört hatte.
„Lesen Sie!" befahl er.
Cairns starrte die verblichenen Seiten an. Er begann zu lesen, blätterte weiter, las wieder, und dann ließ er die alten Formulare unter dem Daumen durchlaufen wie die Blätter einer Trickzeichnung. Auf dem ersten Formular stand: „Unfallmeldung/Fahrerflucht" und darunter die Nummer der Maschine, GS 98-417, und ein Datum aus dem Jahr 1954. Und dasselbe stand auch auf jedem anderen Blatt, nur das Datum war jedes Mal anders.
„Der ganze Ordner ist voll davon", sagte der Polizist, als Caims aufsah.
„Sie meinen . .." murmelte der Fernfahrer.
Der Polizist hob die Schultern. „Ich meine gar nichts. Ich weiß es nicht. Wir haben uns daran gewöhnt. Vielleicht hört es einmal von selbst auf. Nehmen Sie noch eine Zigarette. Und ein Schnäpschen auf den Schrecken.“
Die Mittagsfrau
„Oh, Sie sind ein guter Junge!“ Die alte Bäuerin seufzte dankbar, als Wladek ihren voll beladenen Einkaufskorb –
den er die letzten zwei Kilometer zusätzlich zu seinem Tramper-Rucksack getragen hatte – vor der Tür des krummen Häuschens absetzte. „Wollen Sie hereinkommen und einen Schluck Apfelsaft trinken?“
„Nein, danke. Ich möchte heute noch ein ordentliches Stück Weg zurücklegen, das Wetter ist so herrlich.“ Er wies mit einer breit ausladenden Geste beider Hände auf die goldenen Stoppelfelder rundum, den strahlend blauen Himmel, die sanft gewellten Hügelrücken, über denen die Hitze flimmerte.
„Herrlich und gefährlich“, sagte die Alte. Ihr braunes Bratapfel-Gesicht nahm einen besorgten Zug an. „Es ist schon elf, da haben Sie nicht mehr viel Zeit.“
Er fragte erstaunt, was sie meinte, bekam aber keine klare Antwort, nur eine Anweisung, aus der er nicht klug wurde. „Gehen Sie den Pfad da hinunter“, befahl sie. „Sehen Sie die Reihe Pappeln und Erlen? Dort fließt ein Bach. Der Weg führt auf einer Brücke darüber, aber nach zwölf Uhr dürfen Sie auf keinen Fall weitergehen. Bleiben Sie am Bach sitzen, im Schatten, stecken Sie die Füße ins Wasser, machen Sie ein Schläfchen. Aber gehen Sie nicht in die Sonne, ehe es ein Uhr ist, sonst begegnen Sie der Poludnica.“
„Wem?“, fragte Wladek erstaunt.
„Der Mittagsfrau. Sie würde Sie töten.“
„Warum sollte mich jemand töten?“
Doch wiederum bekam er keine befriedigende Antwort. „Gehen Sie, gehen Sie“, drängte die Alte, „und ich will für Sie beten, weil Sie meinen schweren Korb getragen haben. Auf Wiedersehen!“ Damit verschwand sie hinter der wurmstichigen Türe ihres Häuschens wie eine Maus in ihrem Loch.
Wladek zuckte die Achseln. Er hatte keine Ahnung, was sie mit ihrer Warnung und der Mittagsfrau meinte, aber der Weg, den sie ihm gezeigt hatte, gefiel ihm, also zog er die Riemen seines Rucksacks straff und stieg den sanften Abhang hinunter. Es war ein abgeerntetes Feld, durch das der Pfad führte, und rundum lagen viele solcher Felder – riesige Flecken von purem Gold in der Vormittagssonne. Die Hitze schwebte in gewaltigen, flimmernden Wolken darüber. Jenseits des Baches stieg das Gelände in einer steilen Welle an, wiederum von einem Stoppelfeld bedeckt. Direkt auf dem Hügelkamm saß ein behäbiges Gebäude, offensichtlich ein Wirtshaus. Dort, beschloss er, würde er zu Mittag essen. Die Schlepperei in der prallen Sonne hatte ihn hungrig gemacht.
Er schritt kräftig aus, wie es sich für einen gerade zwanzigjährigen Studenten auf Tramp-Tour gehörte, aber der Weg dauerte weitaus länger, als er gerechnet hatte. Für jemand, der an die Großstadt-Straßen von Warschau gewöhnt war, hatten die großzügigen Proportionen des weiten, schwach besiedelten ländlichen Polen etwas Verwirrendes an sich. Er hatte gedacht, in zehn Minuten müsste er den Bach erreicht haben; tatsächlich jedoch hörte er bereits die Mittagsglocke aus dem Dörfchen, in dem die alte Frau wohnte, als er die Brücke vor sich sah. Im Schatten der Pappeln und Erlen angekommen, blieb er zögernd stehen. Der Weg, der vor ihm lag, war nicht mehr weit – vielleicht zehn Minuten steil bergauf über das Stoppelfeld. Danach konnte er die Beine unter einen Wirtshaustisch strecken, in Ruhe essen und trinken, ein Schwätzchen mit den Wirtsleuten halten. Er sah auf die Uhr. Es war gerade die richtige Zeit für eine ausgiebige Mahlzeit: Fünf nach zwölf.
Nach zwölf Uhr dürfen Sie auf keinen Fall weitergehen.
Und warum? Sonst begegnet Ihnen die Mittagsfrau. Er hatte keine Ahnung, was sie damit gemeint hatte; als Student der Betriebswirtschaft lernte man nicht viel über den bäurischen Aberglauben, um den es sich hier zweifellos handelte. Er hatte auch nie den Eindruck gehabt, dass es wichtig war, solche Dinge zu wissen – nicht, wenn man ein vernünftiger Mensch war, der mit Fernsehen und Internet lebte. Die Leute auf dem Land, das hatte er während seiner Tour gemerkt, waren oft unglaublich rückständig. Glaubten an alles und jedes, hielten jedes Hemd an der Wäscheleine für ein Gespenst und jede nächtlich streunende Katze für den Teufel mit glühenden Augen. Zweifellos hatte die Alte es gut gemeint, aber er dachte gar nicht daran, wegen ihres kindischen Aberglaubens auf sein Mittagessen zu verzichten!
Entschlossen machte er sich daran, die Brücke zu überqueren, obwohl etwas in ihm drängend wisperte: „Tu´s nicht! Tu´s nicht!“ Seine Füße waren plötzlich wie Blei, als er sie auf die weiß gestrichenen Bohlen setzte, sein Kopf brummte wie nach einer Sauftour. Ein unbestimmtes Gefühl nahender Gefahr schnürte ihm die Kehle ab. Er raffte sich zu einem zweiten Schritt auf, aber ihm war zumute, als müsste er sich durch Treibsand kämpfen. Die so eindringlich gesprochene Warnung der dankbaren Alten ließ ihn nicht los. Außerdem lockte der fröhlich dahin pritschelnde Bach in seinem üppigen grünen Saum aus Schilf und Moos, Erlen und Pappeln. Warum sollte er sich nicht ein wenig niedersetzen, sich im kalten Wasser erfrischen und nachher erst weitergehen? Seine Füße schrien danach, aus den plumpen Wanderschuhen befreit zu werden!
Er wandte sich halb um, und augenblicklich wich die unsichtbare Last von ihm
Eine wohlige Schläfrigkeit überkam ihn. Mit dem Gefühl, dass er es ohnehin keinen Schritt weiter geschafft hätte, ließ er sich an einer sandige Uferstelle zu Boden sinken, lehnte den Rücken an einen Baum und zog die Schuhe aus. Es war herrlich, die rot geschwollenen und mit Blasen bedeckten Gehwerkzeuge in das klare, eisige Wasser zu tauchen. Sofort ließ der Schmerz nach, sie schrumpften wieder auf ihre natürliche Größe zusammen, und die Blasen hörten auf wie Säurespritzer zu brennen.
Während seine eben noch wie kochende Wäsche dampfenden Füße sich beruhigten, kramte er aus dem Rucksack einen kleinen Imbiss – Brot, Knoblauch, einen Apfel, ein paar Dörrfrüchte. Er aß nicht gerne reichlich, solange er unterwegs war; man wurde so müde davon. Schlemmen konnte er nachher im Gasthaus, wenn er nur ein paar Schritte gehen musste und ins Bett fallen konnte.
Er füllte seine Trinkflasche mit dem eisigen Wasser, das erstaunlich delikat schmeckte – vielleicht, weil so viel wilde Kräuter am Ufer wuchsen – trank, bis er zu platzen meinte, und widmete sich dann wieder seinem übrigen Körper. Das Wasser war so klar und frisch, dass man es trinken konnte, und wenn es den Füßen so gut tat, warum nicht auch dem ganzen Körper?
Um diese Mittagszeit war weit und breit niemand zu sehen, also zog er unbefangen seine Kleider aus, hängte sie über ein Stück Treibholz und tappte vorsichtig in den Bach. Das Wasser reichte ihm nur bis zu den Knien, aber da war eine kleine Stufe mit einem Miniatur-Wasserfall, und als er sich dort zusammenkauerte, ging es ihm bis über die Oberlippe. Wundervoll! Er pritschelte herum wie ein kleines Kind, und erst als er sich rundum frisch, sauber und herrlich abgekühlt fühlte, stieg er wieder ans Ufer.
Er wollte sich anziehen, aber seine Kleider rochen so gräulich verschwitzt, dass er auf den Gedanken kam sie ebenfalls zu waschen. Natürlich hatte er weder Seife noch Waschpulver, aber nachdem er sie mit kopfgroßen Steinen auf dem sandigen Boden fixiert hatte, spülte das heftig vorüber strudelnde Wasser allen Schweißgeruch aus ihnen heraus. Schließlich waren Hemd und Hose, Unterleibchen und Socken ebenso nass wie sauber. Nur die Unterhose hatte er anbehalten. Man wusste ja doch nicht, ob die Leute hier nicht vielleicht sehr prüde waren. Aber wenn er die Hose, die ohnehin kaum mehr als ein Tanga war, auszog, ausschwemmte und rubbelte, dann auswrang und auf einen in der Sonne stehenden Busch hängte, war sie garantiert in kürzester Zeit wieder trocken. Was nützten ihm die sauberen Kleider, wenn er sie über einen ekelhaft schmierigen Slip anziehen musste?
Es wuchs da sogar ein sehr geeigneter Baum, ein niedriges Krüppelgewächs mit waagrecht ausladenden Zweigen wie ein natürlicher Wäschetrockner. Allerdings stand es am jenseitigen Ende der weißen Brücke, aber das war eine Distanz von nicht einmal drei Meter. Er sprang mit einem flotten Satz auf die im Sonnenschein glühenden Bohlen, zwirbelte die Hose zwischen zwei Fingern und hängte sie eben auf einen Ast, als auf der steilen Wiese etwas in Bewegung geriet.
Nun hatte Wladek schon oft solche winzigen Staubteufel gesehen, die im Hochsommer von staubigen Wegen und oft auch ausgedörrten, abgeernteten Feldern hochfuhren, aber dieses Ding war nur eine Sekunde lang winzig. In der nächsten war es so groß wie ein siebenjähriges Kind, und obwohl sich ringsum in der bleiernen Hitze kein Blättchen regte, wirbelte es mit erstaunlicher – und beängstigender – Geschwindigkeit den Hang herunter, genau auf den jungen Mann zu. Wladek war mehr verblüfft als wirklich erschrocken, aber er war doch froh, dass seine langen kräftigen Beine ihn über die Brücke und an die feucht-grüne Uferböschung trugen, ehe ihn der Wirbel erreichte. Gleichzeitig legte sich der Wind, oder sonst irgendetwas in der Atmosphäre änderte sich, denn der Staubteufel fiel in sich zusammen, als hätte er nie existiert.
Der Jüngling rutschte die Böschung hinunter, umschmeichelt von fettem Gras, weichen Schösslingen und feuchtem Unkraut, und kaum hatte er seine sandige Bucht mit dem zweifingertiefen Wasser erreicht, als alle Nervosität von ihm abglitt und er sich wieder herrlich entspannt fühlte. Auf dem Rücken ausgestreckt, die Füße im kalten Wasser, eine Landkarte züchtig über die möglicherweise anstößigen Körperteile gebreitet, lag er da und döste. Aber dass er keine Furcht mehr empfand, hieß noch lange nicht, dass er kein Misstrauen empfand. Immer wieder wanderte sein Blick den steilen, kurzgeschorenen Abhang hinauf, auf den die Sonne jetzt mit buchstäblich brandgefährlicher Wut herabprasselte. Staubteufel waren keine mehr zu sehen, aber ein eigentümlicher Lichtschimmer, als wanderte jemand mit einer Laterne in der Hand im grellen Licht herum und überstrahlte es noch. Denn zweifellos war es die Person selbst, die strahlte, nicht das Gerät, das sie in der Hand trug – eine Laterne in der einen und eine Sichel in der anderen. Die Sichel war völlig verrostet, sah aber merkwürdigerweise dennoch so aus, als könnte man jemand damit ohne Mühe in Stücke hauen.