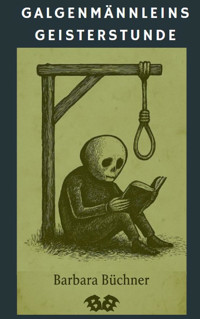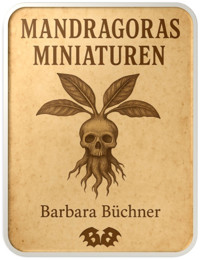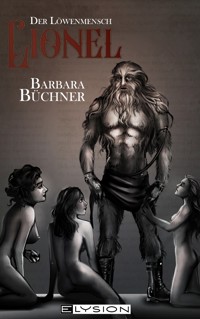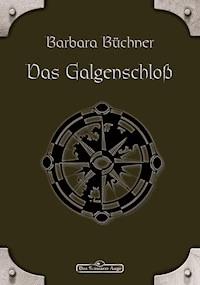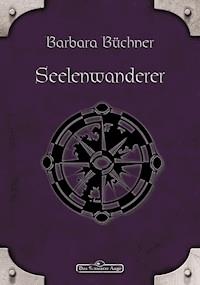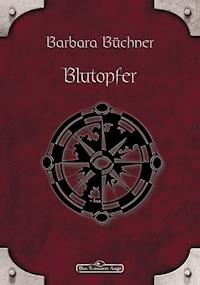2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
"Rettet mich! Hört mich denn niemand?" Verloren in der Nebelzone zwischen Tod und Leben, rufen Verirrte um Hilfe - manchmal lautlos. Ihr Dasein steht auf der Kippe. Ihre einzige Hoffnung - an die sie oft selbst nicht mehr glauben - ist, dass ein Mitmensch ihre stummen Schreie wahrnimmt und ihnen die Hand entgegenstreckt, ehe sie der eisige Nebel verschlingt. Wenn das geschieht, ereignet sich oft Skurriles: Ein krankes Hündchen wehrt Dämonen ab, ein toter Mann findet den zu ihm passenden Hund, Blumen werden zu grausamen Rächern, drei jugendliche Selbstmörder landen in einem ganz unerwarteten Jenseits, eine prähistorische Mumie erfüllt sich den Wunsch nach exklusiven Tätowierungen. Und einige kehren zurück, um noch eine Weile zu leben. Düster, makaber und doch hoffnungsvoll - typisch in der charakteristischen Handschrift von Barbara Büchner.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Barbara Büchner
Geschichten aus der Nebelzone
Erlebnisse zwischen hüben und drüben
Geschichten aus der Nebelzone
Erlebnisse zwischen hüben und drüben
Prolog: Charon hat kein Wechselgeld?
In der griechischen Mythologie steigen die abgeschiedenen Seelen in das Boot des düsteren Fährmanns Charon, der sie über die Flüsse Lethe, Styx und Acheron an ihren Bestimmungsort in der Unterwelt bringt. Allerdings ist auch der Tod nicht umsonst: Charon kassiert Fährgeld. Diese Münze, der Obolus, wird den Verstorbenen bei den Bestattungsriten unter die Zunge gelegt.
Aber was, wenn eine arme Seele ohne Obolus am Ufer steht? Weil es schon im Leben hinten und vorne nicht gereicht hat? Oder im Getümmel eines Krieges keine Zeit für eine vorschriftsmäßige Bestattung war? Gibt es für solche Sozialfälle einen Fond, aus dem sie einen Obolus erhalten?
Nein, Charon ist konsequent. Kein Geld, keine Überfahrt. Das Boot legt ohne sie ab, und die Unglücklichen bleiben am schattenverhangenen Ufer zurück, wo sie weinend und wehklagend herumirren, bis der Fährmann irgendwann vielleicht doch – bei schlechtem Geschäftsgang – ein Plätzchen für sie frei macht.
Aber manchmal liegt es gar nicht an Charons knallharter Geschäftsführung. Manchmal hätte er Passagieren auch mit Obolus die Überfahrt verweigert. Weil ihre Nummer noch nicht aufgerufen wurde. Weil sie schon fast tot waren, aber noch nicht ganz. Weil etwas dazwischenkam. Vielleicht ein alter Mann, dem Katzen mehr am Herzen liegen als Menschen. Oder weil eine irische Landstraße sich plötzlich in ein Labyrinth verwandelt. Oder ein jämmerlicher kleiner Straßenköter zum Beschützer vor einer Herde dämonischer Hunde wird. Oder weil am Ufer schon jemand anderer wartet, der die armen Seelen in Empfang nimmt.
Lesen Sie selbst, was so alles passieren kann, wenn Charon kein Wechselgeld hat und auch nichts geschenkt gibt!
Die Traumkatze
Lew Elliott war ein Sonderling. Schon sein Äußeres ließ darauf schließen: Er sah ein wenig aus wie ein Killer in einem Groschenroman - ein großer hagerer Mann mit einem ordinären Mund, das lange Haar mit einem unordentlichen Scheitel gekämmt, immer in denselben wasserfleckigen Trenchcoat gekleidet. Überdies war er den Menschen gegenüber gleichgültig und liebte Katzen.
Er liebte sie abgöttisch.
Deshalb hatte ihn dieser hässliche Traum auch so entsetzlich aufgeregt.
In diesem Traum ging er spätnachts die schmale Passage von der Richmond High Street zur Themse hinunter, eine sehr schmale, winkelige Gasse mit vielen Trödelläden, in denen schwaches blaues Licht brannte wie die Lämpchen in einem Krankenzimmer. Als er aus der Passage heraustrat, sah er die Lampen der Twickenham-Brücke wie fette Monde über dem schwarzen Fluss stehen.
Er stieg die breiten steinernen Stufen der Brücke hinauf und ging langsam in Richtung Twickenham.
Die beiden Städte lagen im Dunkel, und als er die Mitte des gewaltigen steinernen Bogens erreichte und in das träge Wasser hinunterblickte, hatte er den seltsamen Eindruck, dass er von Nirgendwo nach Nirgendwo ging, als hätte sich die Brücke aus ihren Verankerungen gelöst und sei in der Leere zwischen Zeit und Raum stehengeblieben. Er glaubte, auf einer weißen Bastion zu stehen, der letzte Verteidiger einer fast verlorenen Stadt, während die Finsternis um ihn her sich zum Angriff sammelte.
Dann sah er die Katze.
Sie saß auf der Wölbung des Brückengeländers und starrte in den öligen Fluss hinunter, der wirbelnd um die drei gewaltigen Bögen der Brücke strömte - eine schmale dunkle Katze, so dunkel, dass sie sich von den plumpen Schnörkeln der Steine abhob wie eine kleine, schwarzmarmorne Götzenfigur. Ihre Augen schimmerten kalt und flach und silbergolden im Abglanz der Lampen. In seinem Traum ging er langsam näher und streckte die Hand aus.
Die Katze blickte ihn an.
„Komm!" lockte er leise. „Komm her!"
Die Katze erhob sich und machte einen unsicheren Schritt auf ihn zu, taumelnd vor Schwäche, und dann verlor sie das Gleichgewicht und fiel, fiel wie ein Stein in die Tiefe, ein schwarzer Schatten, der in den schwärzeren Schatten des Wassers verschwand.
Es war nur ein Traum gewesen, aber Lew Elliott war ganz elend, als er erwachte. Er lag lange wach, niedergedrückt von einem sinnlosen, aber grässlichen Schuldgefühl.
Als der Traum zwei Tage später wiederkam, fühlte er sich beinahe krank.
Dann träumte er ihn zum dritten Mal, und diesmal stand er auf, obwohl es lange nach Mitternacht war, schlüpfte in seine Kleider und trat in die Nacht hinaus.
Richmond war dunkel, und selbst die Pubs hatten seit langem geschlossen. Die Lampen der Twickenham-Brücke waren die einzigen Lichter außer den kalten Straßenlampen, und als er um die Ecke bog und das Labyrinth winziger Gässchen betrat, verschwanden auch sie, und er tauchte in blasse Finsternis. Er blieb stehen und sah zu dem schwachen Widerschein der Lampen über den dunklen Häusern auf, und auf einmal fühlte er sich sehr allein.
Es war kalt; eine schleichende, lähmende Kälte, die von der schwachen Dämmerung jenseits der Brücke ausging. Er war niemand begegnet, und selbst die sonst so allgegenwärtigen Autos schienen ausgestorben zu sein. Der weiße steinerne Bogen der Brücke erhob sich vor ihm wie ein heidnisches Bauwerk, leer und verlassen im Licht der Kugellampen, ein Bauwerk, das seine Zeit überlebt hatte. Elliott fror. Er suchte mit vor Kälte unbeholfenen Fingern nach seinen Zigaretten, zündete eine an und starrte, von der kleinen Flamme geblendet, blinzelnd über die Brücke.
Soweit er sich erinnerte, war die Katze am höchsten Punkt des Bogens auf der steinernen Balustrade gesessen, gerade zwischen zwei Lampen. Man konnte den Platz aus der Entfernung nicht sehen, denn an der Stelle sprang das Steingeländer in einer Art Balkon vor, und die Sockel der Lampen verdeckten die Sicht.
Er betrat die Brücke und ging langsam in Richtung Twickenham. Die Kälte zog sich in seinen Mantel, und er blinzelte unbehaglich in dem gelblich irisierenden Licht, das aus den Kugellampen strömte, ein kaltes, unfreundliches Licht, wie es verödeten nächtlichen Bauwerken eigen ist. Es schien die Kälte der Nacht anzuziehen wie ein Magnet. Vielleicht, dachte Lew Elliott, dem gelegentlich seltsame Dinge einfielen, war dieses Licht nur dazu da, die zu verspotten, die keine Zuflucht hatten und sich in seinem Bannkreis aufhalten mussten.
Die Nische, in der die Katze gesessen hatte, war leer.
Einen Augenblick wusste er nicht, ob er sich darüber ärgern sollte, oder ob es ihn beruhigte. Dann (denn Lew Elliott war ein methodischer Mann, der, was er anfing, auch zu Ende brachte) holte er ein sorgfältig eingewickeltes Paket aus der Manteltasche und begann in Abständen kleine Stücke Fisch auszulegen. Falls es eine hungrige Katze gab, würde sie sie jedenfalls finden. Mehr konnte er im Augenblick nicht für sie tun.
Es dauerte eine ganze Weile, bis er das letzte Endchen Fisch hingelegt hatte, und als er zu der Nische zurückkam, bemerkte er mit einem gewissen Ärger, dass er die längste Zeit nicht allein gewesen war: Wo (in seinem Traum) die Katze gesessen war. lehnte jetzt eine dunkle menschliche Gestalt an der Steinbalustrade, vielleicht ein verspäteter Nachtschwärmer, der in alkoholischer Sentimentalität die Dämmerung und das öde schwarze Wasser anstierte.
Lew Elliott war nicht weiter zimperlich, was die Meinung anderer Leute über ihn anging, aber ein wenig peinlich war ihm die Sache doch — immerhin war er in der letzten halben Stunde einer sehr sonderbaren Beschäftigung nachgegangen, spätnachts mit einer Handvoll Fisch auf der verlassenen Brücke hin und her tappend . . .
Aber der Mann hatte ihn nicht beobachtet. Er hörte ihn nicht einmal, als er dicht hinter ihm vorbeiging. Er stand nur da, die Arme auf das Brückengeländer gestützt, den Kopf beinahe bis auf die Hände gebeugt, ganz versunken in den Anblick der Tiefe und des träge strudelnden Wassers. Ein feiner Mann war er nicht, das konnte man schon an seiner Rückseite ablesen -seine Schuhe waren schiefgetreten, die schwarzen Hosen so kurz, dass die missfarbenen Socken darunter hervorsahen, das Sakko verbeult, und unter dem Kragen guckte ein Endchen einer zyklam-rosa Krawatte hervor.
Lew Elliott blieb stehen und betrachtete ihn durch den Rauch seiner Zigarette hindurch, und je länger er ihn betrachtete, desto mehr missfiel ihm die Reglosigkeit dieses kummervoll gebeugten Rückens.
„Du wirst doch nicht - ?!" dachte er.
Und plötzlich ergriff ihn ein seltsamer Zorn; er richtete sich auf und warf den Kopf in den Nacken, als hätte er in diesem Augenblick in der Brücke und der Dämmerung und den feisten mitleidlosen Lampen die Abgesandten des Bösen erkannt. Er ging auf den reglosen Fremden zu in dem unbestimmten Bewusstsein, dass irgendjemand auf das vertraute, was er jetzt tun würde.
„He - Sie da!" sagte er und warf den glühenden Zigarettenstummel an dem Mann vorbei in die Tiefe. „Kann ich Ihnen irgendwie helfen?"
„Wie kämen Sie dazu?" antwortete der Mann, ohne aufzusehen.
Lew Elliott gab keine Antwort, aber er streckte mit einer sonderbar feierlichen Geste die Hand aus und legte sie dem Mann auf die Schulter. Der Fremde schauerte unter der kleinen Berührung und hob langsam den Kopf.
Seine Augen schimmerten kalt und flach und silbergolden im Abglanz der Lampen - wie Katzenaugen.
„Gehen wir", sagte Lew Elliott sanft. „Gehen wir weg von hier — und sagen Sie mir, wie ich Ihnen helfen kann."
Die Straße nach Aughadown
Die Straße zwischen Skibbereen und Aughadown ist nicht sehr lang, nur etwa neun Meilen, aber es ist eine sonderbare Straße, und man sagt, dass sonderbare Dinge darauf geschehen. Sie führt über öde, wellenförmig aufsteigende und abfallende dunkle Hügel, in kleine dunkle Senken hinunter, in denen die West Cork Brigade im Hinterhalt lag, und auf steinige Hügelrücken hinauf, von denen man nachts das Leuchtfeuer an der Südspitze Irlands, in der Nähe von Skibbereen, sehen kann.
„Ich weiß nicht, was dort umgeht", hatte der Mann im „Golden Harp" in Skibbereen zu Aubrey gesagt, „aber irgendwas ist dort nicht ganz in Ordnung, und wenn ich Sie wäre, junger Mann, würde ich nicht um viel Geld nachts dort anhalten."
Aubrey zuckte die Achseln, als er daran dachte. In gewissem Sinn hatte der Mann recht gehabt: Es war eine miserable Straße. Es gab keine Tankstellen, keine Cafés, keine Straßenbeleuchtung, keine Notrufsäulen, aber es gab jede Menge Schlaglöcher. Das nächste Telefon befand sich in einem finsteren Laden in Aughadown, in dem man Petroleum, Heiligenbilder und Regenmäntel zu kaufen bekam, und der nächste Gendarmerieposten in Ballydehob, drei Meilen hinter Aughadown. Er fröstelte, als er an die Möglichkeit einer Panne dachte. In dem ganzen regendunklen Land rundum war kein einziges Licht zu sehen, die letzte Tankstelle hatte er in Skibbereen hinter sich gelassen, und Autos schienen hier nur bei Tag zu fahren - wenn überhaupt.
Er ging vom Gas weg, als die letzten Lichter verschwanden und die Straße hinabsank in die gleichförmige Dunkelheit endloser, steinübersäter Hügel und Senken. Eine Panne war das Schlimmste, was ihm passieren konnte: Es wäre schon leidig genug gewesen, bei Nacht und Nebel nach Skibbereen zurückmarschieren zu müssen, aber da war noch etwas, worum er sich Sorgen machte - sein Musterkoffer mit der Schmuckkollektion.
Aubrey reiste für eine Firma, die japanische Perlen herstellte, und so stimmte er dem Mann in Skibbereen in einem Punkt zu: Nicht für viel Geld würde er nachts auf der einsamen Straße anhalten, ob es nun dort „umging" oder nicht. Sein Haar knisterte, als er sich vorstellte, ausgeplündert nach London zurückkehren zu müssen.
„Du meine Güte!" sagte er leise und rieb sich unbehaglich die Wange.
Eine Windbö schlug gegen den Wagen, als er die Höhe erreichte. Es regnete dünn und kalt. In dem diffusen Licht vor sich konnte er gerade noch die Straße sehen, wie sie wieder hügelab führte, dann verschwamm alles zu einem Chaos von Dunkelheit. Nur gegen Süden zu hing ein blasser Lichtnebel, wo Skibbereen lag, und ein Stückchen davon entfernt schlug in regelmäßigen Abständen fahler Widerschein gegen den Himmel, wo das Leuchtfeuer stand, ansonsten aber war die Straße sein einziger Wegweiser. Er fühlte sich unbehaglich, als er daran dachte. Warum, wusste er nicht recht, aber es störte ihn, dass ihm nichts übrigblieb als dieses blinde Vertrauen.
„Hier könntest du lange schreien", dachte er, als er das Seitenfenster blankwischte und in die öde Landschaft hinaussah. „Lieber Himmel, hier könntest du lange schreien .. ."
Sofern der Mann im „Golden Harp" das gemeint hatte, hatte er recht gehabt. Was alles andere betraf...
Aubrey räkelte wohlig schaudernd die Schultern und such nach dem Zigarettenpäckchen im Handschuhfach. Es war nicht unangenehm, sich im Wannen zu gruseln, während man hinter einer massiven Kühlerhaube und dicken Türen geborgen saß und einem das tiefe Dröhnen des Motors die Sicherheit gab, alles hinter sich lassen oder niederwalzen zu können, was etwa aus dem gespenstigen Land auftauchen mochte. Er fuhr gern bei Nacht. Es war etwas besonders Behagliches daran, sich bequem in die Polstersitze zurückzulehnen, den warmen Luftstrom der Heizung auf den Beinen zu spüren, während der Regen über die Scheiben rann und die Scheinwerfer über den schwarzglänzenden Asphalt fegten. Es war beinahe so gut, wie in einer kalten Nacht im Bett zu liegen.
Er kurbelte das Fenster einen Spalt weit herunter und drehte es rasch wieder hoch, als eisiger Regen hereinspritzte. Draußen musste es schauderhaft unfreundlich sein, dachte er, aber hier herinnen war alles in Ordnung, es war warm und dunkel und roch mild nach Zigarettenrauch, und wenn er zu frösteln anfangen sollte, brauchte er nur auf den Rücksitz zu langen und sein Jackett anzuziehen.
Plötzlich kam ihm der sonderbare Gedanke, dass die schwere Karosserie um ihn herum eine Art Rüstung sei, ein Panzer, unter dessen Schutz er sich in ein unwirtliches und gefahrvolles Land wagte. Er begann vor sich hinzulächeln. Ein paar Meilen hinter ihm lag Skibbereen, voll von Lichtern und Pubs und Cafés, und ein paar Meilen vor ihm Ballydehob, wo es immerhin einen Gendarmerieposten und eine Imbissstube gab. Er warf einen Blick auf die Uhr und sah, dass es dreiviertel eins war. „In Ballydehob", dachte er, „schlafen sie schon alle, und in Skibbereen machen sie wohl auch langsam dicht... ich glaube, ich bin der einzige Mensch im ganzen County Cork, der um die Zeit noch unterwegs ist."
Vor ihm stieg die Straße an. Aubrey blinzelte plötzlich, als er auf halber Höhe des Hügels einen weißen Fleck zu erkennen glaubte. Irgendetwas saß oder stand dort, vielleicht ein Mensch, vielleicht aber auch nur ein großer Steinbrocken, der von einer Mauer gefallen war. In dem diffusen Licht war es schwer, seine Größe zu schätzen. Jedenfalls stellte er das Fernlicht ab und fuhr langsam den Hügel hinauf.
Insgeheim war er erleichtert, als er sah, dass dort nichts weiter lag als ein Fahrrad, glänzend und glitzernd im Scheinwerferlicht. Erst eine Sekunde später kam ihm zum Bewusstsein, dass ein Unfall geschehen sein musste. Er wischte den Dunst vom Seitenfenster und spähte hinaus, ob der Fahrer irgendwo lag, aber die Straße auf und ab war kein Mensch zu sehen. Aubrey zögerte. Er öffnete versuchsweise eine Tür, aber als ihm der Regen kalt ins Gesicht schlug und der Wind ihm ins Haar fuhr, warf er sie rasch wieder zu.
Und dann fuhr er vorsichtig um das Fahrrad herum, warf noch einen Blick zurück und gab Gas.
Als er von der Höhe des Hügels zurückblickte, lag das Fahrrad noch da, ein weißlicher Fleck in der Dunkelheit, und so würde es liegenbleiben, bis das nächste Auto über die Straße nach Aughadown fuhr.
Aubrey fühlte einen Stich im Inneren, als er daran dachte, aber er zuckte die Achseln. „Ich bin für meinen Koffer verantwortlich", sagte er halblaut zu sich selbst. „Ich kann nicht mitten in der Nacht die halbe Heide nach einem Betrunkenen absuchen, der mit dem Rad auf die Nase gefallen ist. . ."
Und wenn es gar kein Unfall war?! Wenn es überhaupt nur ein schäbiger Trick war?
Der Gedanke tat ihm so gut, dass er ihm weiter nachhing. Jedenfalls, sagte er sich, bewies seine Reaktion, dass er clever gewesen war. Er war nicht einfach hereingefallen. Er hatte sich gleich sein Teil gedacht: Das Fahrrad war nichts als Staffage, so wie es da auf dem Asphalt gelegen war . . . wie ein Köder ... ganz neu, überhaupt nicht verbogen... und diese niedrigen Steinmäuerchen neben der Straße, in deren Schutz sich ein halbdutzend Wegelagerer bequem verstecken konnte!
Der Wagen schleuderte, und er presste erschrocken die Hände ums Lenkrad. „Du meine Güte!" dachte er. „Wenn du hier einen Unfall baust, dann gute Nacht - da kannst du lang liegen, bis einer vorbeikommt!"
Er warf einen Blick zurück in der vagen Hoffnung, die Scheinwerferkegel eines anderen Autos auf der Straße zu sehen, aber hinter ihm war nur Dunkelheit und die monotonen Wellen der Hügel und das fahle Band der Straße, das über sie hinwegrann wie die Zeichnung auf einem Schlangenrücken, und über ihm war nichts als der sternlose Himmel.
Die Straße sank in einer langen flachen Kurve ins Tal ab. Hinter der nächsten Steigung musste die Tankstelle sein, das Wahrzeichen von Aughadown. In der Finsternis war es unmöglich, etwas zu sehen, aber der Zeit nach musste es stimmen -und Aughadown, dachte Aubrey erleichtert, war der Anfang der Zivilisation. Von dort waren es nur mehr drei Meilen bis Ballydehob, wo es einen Gendarmen mit einem Motorrad gab-
Er biss sich ärgerlich auf die Lippen, als ihm einfiel, dass er nicht mehr gut zur Gendarmerie gehen konnte - die würden ihm augenblicklich unter die Nase reiben, dass er gesetzlich verpflichtet gewesen wäre, den Radfahrer zu suchen! Schließlich waren es ja nicht sie, die aus dem warmen Auto steigen und bei Nacht und Nebel die unheimlichen Hügel abklappern mussten, und wenn, dann hatten sie dabei nicht ihren guten Anzug an ...
„Ach wo!" sagte Aubrey zu sich. „Es ist alles in Ordnung. Sicherlich war es ein Trick. Oder wenn schon ... was soll ihm viel passiert sein, er wird sich wieder aufrappeln und heimfahren ... ich habe auch meine Pflichten."
Er dämpfte die Zigarette ab und stopfte sie in den überquellenden Aschenbecher. Es war höchste Zeit, einmal anzuhalten und die Kippen auf die Straße zu leeren, aber irgendwie gefiel ihm der Gedanke nicht sehr. Er versuchte zu entscheiden, was schlimmer war: Zigarettenstummel und Brandlöcher auf dem Boden des Firmenwagens oder eine Minute Aufenthalt in der kalten Nacht. Es würde kaum dreißig Sekunden dauern, den Aschenbecher aus seiner Verankerung zu lösen, die Stummel hinauszuschmeißen und weiterzufahren - den Mut, dachte Aubrey, sollte man denn doch wohl haben!
Er fröstelte, als er hinaus in die nasse Dunkelheit blickte. „Idiot!" dachte er. „Mach das einmal deinem Chef klar. Sag ihm, leider ist der Sitzbezug etwas verschmort, mich hat's zu sehr gegrault, den Aschenbecher auszuleeren! Sag ihm das einmal. Hast du die Courage oder nicht?"
Schließlich blieb er stehen, zerrte den Ascher heraus und klappte die Tür auf. Der Wind blies ihm die Asche ins Gesicht, als er die Stummel hinauswarf, ein kalter, böig heulender Wind, der ihm bis auf die Haut drang. „Mein Gott, ist das kalt!" dachte Aubrey. Er sah, dass er mitten auf einem hohen Hügel stehengeblieben war, auf dem ein Elfenring neben dem anderen lag, und da er sehen wollte, ob er irgendwelche Lichter entdecken konnte, ging er zur anderen Straßenseite hinüber. Der Wind zerrte an seinen Kleidern und stellte ihm das Haar auf. Er zitterte am ganzen Körper, als er die niedrige Steinmauer an der Böschung erreichte. Aughadown musste gerade vor ihm liegen, aber entweder hatten sie alle Lichter gelöscht, oder es lag doch noch ein Hügel dazwischen, denn es war in dieser Richtung genauso dunkel wie überall anders auch.
Er sah zu seinem Wagen zurück, der mit laufendem Motor und brennenden Scheinwerfern am Straßenrand stand, und plötzlich rannte er mit langen Sätzen zurück, sprang hinein, warf die Türe zu und gab Gas. Es war etwas Schreckliches an diesem leeren, fahrbereiten Wagen gewesen, etwas, das ihn in panische Angst versetzte, er könnte allein auf der nächtlichen Straße zurückbleiben . . .
Er fror weiter, obwohl die Heizung auf vollen Touren lief. Hügelauf, hügelab wand sich die Straße, eine zähklebrige Spur durch die Nacht. „Wann kommt Aughadown?" dachte er, und zum ersten Mal erschreckte ihn der Gedanke. Er konnte sich nicht verfahren haben, es gab keine Abzweigungen, nur ein paar steinige Wege, die in die Hügel hineinführten, und er konnte nicht daran vorbeigefahren sein - und selbst wenn er durch irgendeine irrwitzige Verblendung das kleine Aughadown in der Dunkelheit unbemerkt passiert hätte, musste er nach Ballydehob kommen; es war unmöglich, seine langen Häuserzeilen selbst in der tiefsten ägyptischen Finsternis zu verfehlen. Außerdem hatte Ballydehob Straßenbeleuchtung.
Aber vom Hügel aus hatte er keine Lichter gesehen.
Es war überhaupt nichts zu sehen gewesen außer der Dunkelheit und der Straße nach Aughadown.
Er starrte zähneknirschend geradeaus. Wenn er sich auf der Straße hielt, musste er nach Aughadown kommen, alles andere widersprach jeder Vernunft. Er versuchte zu lächeln, aber während er stur der Straße folgte, fühlte er sich wie ein Blinder, der sich einen Draht entlangtastet und nicht weiß, ob ihm nicht jemand einen Streich spielt.
Auf seiner Uhr war es viertel zwei. Er musste längst weitaus mehr als neun Meilen gefahren sein, aber soviel er wusste, gab es keine andere Straße über die Hügel.
Der Wagen hatte längst aufgehört, eine warme, sichere Hülle zu sein. Er war nur mehr ein nacktes Gehäuse, das keinen Schutz vor der Nacht bot - und noch weniger vor der Angst, die Aubrey erfasste, als er Meile um Meile die verhexte Straße verfolgte. Das graue Band blieb unverändert. Es schwang in sanften Kurven um die Hügel, lief in windstille Mulden hinunter und steile Hügel hinauf, die ihm seltsam bekannt vorkamen - aber die Hügel sahen sich alle gleich, und so hatte es nichts zu bedeuten. Es war vielleicht Einbildung, als er meinte, ein melancholisches Pony hinter einer Steinmauer schon einmal gesehen zu haben.
„Du hast einfach die falsche Straße gewählt", versuchte er sich selbst zu beruhigen. „Was soll's . . . irgendwo wirst du schon rauskommen. Irland ist keine Wüste, und eine Straße führt für gewöhnlich irgendwo hin . . ."
Er schob sich wiederum einen Hügel hinauf, tauchte wiederum in ein Tal. Das Gejammer des Windes schwoll an und erlosch, als die Mulden und Höhen abwechselten, aber die Straße blieb gleich.
„Mein Gott!" dachte Aubrey, den plötzlich aller Mut verließ, „Wenn es wenigstens irgendetwas gäbe, an dem man sich orientieren kann . . ."
Und dann kam eine flache Steigung, die die Straße ohne eine einzige Kurve erklomm, und in halber Höhe der Steigung glänzte ein weißlicher Fleck.
Er hielt den Wagen an, stieg aus und starrte stumm auf das Fahrrad.
Es lag da wie zuvor, neu, nass, im Scheinwerferlicht glänzend. Er streckte vorsichtig eine Hand aus und berührte das kalte Metall, dann ging er langsam zum Wagen zurück, griff durch die Türe, presste den Handballen auf die Hupe. Ein lang widerhallender Ton kam aus den Bergen zurück.
„Ist da jemand?" schrie Aubrey. „Wo sind Sie?"
Er brauchte nicht lange zu suchen. Er fand ihn im Graben hinter dem nächsten Steinmäuerchen, ein paar Meter von seinem Rad entfernt, wo er zu einem zitternden Bündel zusammengekauert lag - ein junger Mensch, fast noch ein Kind, grau und zähneklappernd vor Kälte, der zu weinen begann, als Aubrey sich über ihn beugte.
„Gott segne Sie!" stieß er mit blauen Lippen hervor. „Gott segne Sie, danke .. . danke . . ."
Aubrey gab keine Antwort. Er schleppte ihn zum Wagen, wickelte ihn in eine Decke ein, gab ihm eine Zigarette, schnallte das Rad auf den Gepäckträger, sagte, es sei alles in Ordnung und fuhr los - bis auf die Knochen durchfroren, mit nassen Schuhen und so zu Tode erschrocken, dass er an nichts anderes denken konnte als an die Straße nach Aughadown. Aber seltsamerweise war er kaum eine halbe Meile gefahren, als er die beleuchtete Tankstelle sah, und dann waren es nur noch drei Meilen bis zu den fröhlichen Lichtern von Ballydehob.
Es ist eine sonderbare Straße, und die Leute haben recht, wenn sie sagen, dass sonderbare Dinge darauf geschehen.
***
Der Hund am Wegrand
"Hier auf dieser Straße ist es passiert, dort vorne an der Kreuzung, wo der Wegweiser steht", sagte der Tierarzt zu seinem Beifahrer, dem Revierleiter des Gendarmeriepostens von Kreutzenwald. "Und ich weiß genau, dass ich mich nicht getäuscht habe. Es war eine klare, mondhelle Nacht, und außerdem hatte ich natürlich die Scheinwerfer an."
Der Gendarm machte eine unbestimmte Geste. "Erzählen Sie mir die Geschichte doch von Anfang an, Doktor."
Der Tierarzt nickte. "In Ordnung." Er schaltete zurück und fuhr langsamer, obwohl die Landstraße um diese Nachtzeit nur selten befahren wurde. Der Fernverkehr lief über die Autobahn ein paar Kilometer weiter westlich, und die Bauern mit ihren landwirtschaftlichen Fahrzeugen waren nur untertags unterwegs. Es war eine schmale Straße, links und rechts von Lärchenwald gesäumt. Sie war gebaut worden, um die Lastwagen zu den Kiesgruben zu bringen, die inmitten des Waldes lagen. Jetzt, wo die Kiesgruben aufgelassen waren, brauchte man die Straße nicht mehr. Es konnte manchmal Tage dauern, bis hier jemand vorbeikam.
"Ich war", erzählte der Tierarzt, "in Kreutzenwald gewesen, um ein paar Kontrolluntersuchungen vorzunehmen, und Sie wissen ja, wie das ist bei den Bauern – da muss der Tierarzt erst noch zum Essen bleiben und sich Stunden lang den neuesten Klatsch und Tratsch anhören, ehe er sich verabschieden darf. Es war Mitte Juli und eine wunderschöne Nacht. Ich fuhr langsamer als gewöhnlich, weil ich merkte, dass ich ziemlich müde war, und obwohl hier so wenig Verkehr ist, wollte ich auf Nummer sicher gehen dass nichts passierte. Ich fuhr also gemütlich dahin bis zu der Kreuzung, wo der Güterweg nach Dörfl führt – die Kreuzung mit dem Wegweiser, die kennen Sie ja."
"Klar kenne ich die", antwortete der Gendarm, der jeden Stein und jeden Baum im Umkreis kannte.
"Ich fuhr langsam vorbei, und ich schwöre Ihnen, ich habe mich nicht getäuscht: Da lag ein Hund. Ein ziemlich großer, dunkelbrauner Kerl mit einer faltigen Schlabberschnauze – muss ein Boxermischling oder etwas Ähnliches gewesen sein. Und erzählen Sie mir jetzt nicht, ich hätte einen Baumstrunk oder den Schatten eines Busches für einen Hund gehalten! Ich fuhr keine sechzig Stundenkilometer und ich hatte ihn voll im Scheinwerferlicht. Er lag flach auf dem Boden, die Schnauze auf den Vorderpfoten, und sah schrecklich erschöpft und deprimiert aus. Sie wissen ja, wie Hunde aussehen, wenn sie alle Hoffnung aufgegeben haben."
"Ja, sieht jämmerlich aus", bestätigte der Gendarm.
"Er sprang auf, als er mich sah, und begann vor Freude wie wild zu kläffen. Ich hielt an, und da machte er einen Satz auf mich zu, quietschend und japsend vor Freude – augenscheinlich hoffte er sein Herrchen sei wieder gekommen. Er wäre mir in die Arme gesprungen, aber er hing an dem Wegweiser fest. Ich sah sein Halsband und das Stück Reepschnur, das daran festgeknotet war. Das andere Ende war um den Pfosten geschlungen und zwei, drei Mal daran gebunden, als hätte der Scheißkerl, der das gemacht hatte, ganz sicher gehen wollen, dass das arme Vieh sich nicht befreien konnte. Zweifellos war es einer von diesen Typen gewesen, denen ihr Hund lästig wird, wenn sie in den Urlaub fahren, und die ihn dann irgendwo anbinden und seinem Schicksal überlassen. Es musste schon zwei oder drei Tage her sein, dass der Hund da ohne Wasser und Futter lag, tagsüber in der glühenden Julisonne, denn er sah jämmerlich aus – struppig und verzweifelt und halb verdurstet. Er konnte kaum noch bellen, so heiser war er."
"Armes Vieh", stimmte der Gendarm ein. "Und was war dann?"
"Natürlich sprang ich sofort aus dem Wagen, rief ihm ein paar beruhigende Worte zu und lief dann zum Kofferraum, um meine Tasche herauszuholen. Da hatte ich ein scharfes Jagdmesser drin, mit dem ich die Reepschnur durchschneiden wollte. Ein paar Sekunden lang befand sich das Auto zwischen mir und dem Hund – ich hörte ihn noch bellen – und dann war er weg. Einfach weg."
"Sowas!", sagte der Gendarm.
Der Arzt nickte. "Ich konnte es einfach nicht glauben. Der Pfosten des Wegweisers war da, aber kein Hund, kein Halsband, keine Schnur. Und kein Hälmchen Gras war zerdrückt, wo er gelegen hatte. Drei oder vier Mal lief ich wie ein Narr im Kreis um die Stelle, obwohl ich schon längst wusste, dass ich eine Halluzination gesehen hatte. Ich fuhr mit dem Schuh im Gras hin und her, als hätte der Hund sich zwischen den Halmen verstecken können, und leuchtete mit meiner Taschenlampe den Pfosten ab. Nichts. Zuletzt fuhr ich weiter, in dem Bewusstsein, dass ich mir entweder etwas völlig Verrücktes eingebildet oder das Gespenst eines Hundes gesehen hatte."
Der Gendarm nahm seine Mütze ab, kratzte sich bedächtig hinter den Ohren und nickte. "Nein, nein – eingebildet haben Sie sich das nicht, Doktor. Da war ein Hund."
"Aber –"
"Ein Bauer fand ihn, als er mit seinem Traktor in den Wald fahren wollte. Ein riesiger brauner Boxermischling, wie Sie sagten. Das arme Vieh war tot – verdurstet. Sie wissen ja, wie heiß es im Juli war. Er muss ein paar Tage lang an diesem Pfosten angebunden gelegen sein – er war abgemagert und struppig und hatte blutige Pfoten, mit denen er die Erde aufgegraben hatte, um Kühlung vor der glühenden Hitze zu suchen. Dabei hätte er ohne viel Mühe die Reepschnur durchbeißen und davonrennen können, aber so sind Hunde nun mal. Wenn ihr Herr sie irgendwo anbindet, dann bleiben sie dort sitzen und warten geduldig und hoffen, dass er wiederkommt, und warten vergeblich und hungern und leiden und sterben, während das Schwein irgendwo im Süden unbeschwert am Strand liegt und daran denkt, dass er sich ja nach den Ferien einen neuen Hund anschaffen kann." Nach einer kurzen Pause fuhr er fort: "Sie sind übrigens nicht der Einzige, der diesen Hund gesehen hat, Doktor. Ich habe dieselbe Geschichte schon ein paar Mal gehört. Leute, die hier vorbeifuhren, sahen den Hund, und wenn sie anhielten und sich um ihn kümmern wollten, war er plötzlich verschwunden. Seit ein paar Tagen allerdings –"
Der Tierarzt unterbrach ihn mit einem lauten Ausruf. "Sehen Sie doch, sehen Sie! Da vorne ist die Wegkreuzung, und da ist auch der Hund!"
Die beiden Männer starrten angestrengt durch die Windschutzscheibe. Wo das Scheinwerferlicht einen Kegel aus der Finsternis schnitt, war ganz deutlich der Pfosten zu sehen, der einen langen schwarzen Schatten warf. Vor dem Pfosten lag lang hingestreckt der Hund. Es war zweifellos derselbe große braune Boxermischling, und doch sah er ganz anders aus. Sein Fell glänzte, seine Augen waren blank und klar, und er war auch nicht mehr allein. Sein Kopf ruhte auf den Stiefeln eines jungen Mannes, eines Trampers, der den Pfosten als Rückenstütze bei einem Nickerchen benützte. Die Rechte des Trampers lag auf dem mächtigen Nacken des Hundes und kraulte im Halbschlaf sein Ohr. Der Junge sah blass und verwahrlost aus, wie er da neben seinem mächtig voll gepackten Rucksack döste. Man sah ihm an, dass er kein fröhlicher Rucksacktourist war, sondern ein obdachloser Landstreicher, der sich mühsam durchs Leben bettelte. Aber für den Hund war er eindeutig ein Prinz, ein König, ein Engel. Das Tier sah so glücklich aus, wie nur ein Hund aussehen kann, der ein liebevolles Herrchen hat.
"Aber", rief der Tierarzt bei dem Anblick verwirrt, "wieso ist denn – ich dachte, Sie sagten, der Hund sei tot gewesen?"
"War er ja auch", entgegnete der Gendarm leise. "Das war es, was ich Ihnen eben noch sagen wollte: Man sieht ihn jetzt nicht mehr so wie früher. Die beiden sind immer beisammen, und sehr glücklich miteinander, wie man sieht."
Der Tierarzt blinzelte ratlos. "Wollen Sie sagen, der Junge da hat einen Gespensterhund als Begleiter?"
"Nein, ganz so ist es nicht", erwiderte der Andere bedächtig. "Sehen Sie, der Tramper wurde vor einer Woche hier in der Nähe tot aufgefunden. Litt an irgendeiner Krankheit, sagte der Arzt, und dann die glühende Hitze und das schwere Gepäck ... Kreislaufkollaps. War schon eine Weile tot, als ein Bauer die Leiche entdeckte. Ich war selber dabei, wie sie ihn in den Transportsarg packten. Nun ja, und jetzt haben die Beiden einander gefunden, für immer und ewig, wie´s aussieht. Schauen Sie sie nur an!"
Der Tierarzt hatte aber nicht lange Zeit, sie anzusehen, denn da verblasste das Bild im Scheinwerferlicht, und langsam verschwanden vor seinen Augen der tote Tramp und der tote Hund, die jetzt beide nicht mehr verlassen waren.
***
Die Feuersalamander von Terminal
In der leuchtend schwarzen, eiskalten Wüstennacht der Welt, die Terminal genannt wurde, blühte eine einzelne rote Blume, ein Lagerfeuer. Reisende Mondscheiner hatten es angezündet, zehn Händler, Männer und Frauen, die von den Goldfeldern im Norden in die Hauptstadt zurückkehrten um dort neue Ware zu kaufen. Sie hatten ihre beiden Lastwagen abseits der Autobahn an der Wüstenpiste geparkt, in der Nähe einer Höhle, die sich in einem Felsbuckel öffnete. Nun liefen sie hin und her zwischen der Höhle und ihren Autos, zwei klapprigen Rostmühlen, deren ehemals roten und blauen Lack das Sandstrahlgebläse des Windes abgeschmirgelt hatte, und waren eifrig damit beschäftigt Kunststoffboxen mit Proviant und Kanister mit Trinkwasser zu öffnen. Es war nämlich kurz vor Mitternacht, und das war die Zeit, zu der alle Nachtleute ihre Hauptmahlzeit einnahmen.
Diesmal würde es eine kräftige warme Mahlzeit sein, denn überall zwischen den düsteren Steinblöcken lagen, zundertrocken und wie versteinert anzusehen, die Überreste von Bäumen, die vor unendlicher Zeit hier gewachsen sein mussten. Sie brauchten sie nur aufzuheben. Bald schleppte jeder und jede ein Bündel Holz. Sie waren guter Laune; Brennholz und eine Höhle in den Felsen bedeuteten eine warme und sichere Ruhepause nach der langen, nervenaufreibenden Fahrt durch die nächtliche Wüste.
"Vielleicht sollten wir die ganze Nacht und dann den Tag über hier rasten", schlug eine der Frauen vor. "Einen so guten Platz finden wir nicht bald wieder, und wir sind alle müde."
Die Höhle war tatsächlich ideal. Durch einen sehr schmalen Spalt gelangte man in einen hoch gewölbten Raum, gerade weit genug, dass die Zehn rund ums Feuer bequem darin Platz hatten, mit einem leidlich ebenen Boden, den die an ein raues Leben gewöhnten Männer und Frauen nicht allzu unbequem fanden. Vor allem aber bot sie sicheren Schutz vor der Sonne.
Mondscheiner kommen nur selten ans Tageslicht und schon gar nicht an die Sonne. Sie würden binnen einer Stunde an Erstickung und Verbrennungen sterben, wenn sie jemals der Sonne ausgesetzt würden – der kochenden, tötenden, weiß glühenden Riesensonne von Terminal. Deshalb lebten sie in der Metropole in der Unterstadt, wo nie ein Sonnenstrahl hin drang. Wenn sie an der Oberfläche unterwegs waren, mussten sie auf sich achten. Eine Tabelle mit Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten gehörte zur Standardausrüstung jedes reisenden Mondscheiners wie die Gezeitentabelle zur Ausrüstung eines Seefahrers. Sobald der jähe, kalte Windstoß der Dämmerung anzeigte, dass die Nacht zu Ende ging, verkrochen sie sich blitzschnell unter der Erde. In den Dörfern entlang der Autobahnen waren überall unterirdische Bunker gebaut worden, in denen die Nachtleute, geschützt vor der tödlichen Sonne, übertagen konnten. Auf freiem Feld mussten sie Schutz suchen, wo sie ihn finden konnten. Die reisenden Händler informierten einander daher über jeden Felsspalt, jede Sandgrube, jede halb zerfallene Hütte. Solche Informationen waren nicht nur Gold wert, sie waren lebensrettend.
Da es noch lange bis zum Morgen dauern würde und die gefährliche Sonne tief in der Unterwelt verschwunden war, hatten sie ihr Feuer außerhalb der Höhle angezündet, wo ihnen der Rauch nicht in den Augen beizte. Sie freuten sich alle auf den Aufgang der Mondin, der – wieder laut Tabelle – in einer Stunde zu erwarten war. Eine Reise durch die Wüste bot den Vorteil, dass die Mondgöttin Selene in all ihrer Pracht zu bewundern war. In der Metropole hatten die Mondscheiner nie diese Freude, denn es war ihnen von Gesetzes wegen verboten, nach Sonnenuntergang ihre Katakomben zu verlassen.
Ein etwa 12-jähriger Junge, Jeff mit Namen, der zum ersten Mal in seinem Leben mit auf Handelsreise war, entfernte sich ein paar Schritte vom Feuer und starrte in die Nacht hinaus. Er war tief beeindruckt von dieser ersten Fahrt in die Wüste, aber er wollte es sich nicht anmerken lassen. In seine raue Kleidung gehüllt, die Survival-Tasche mit Sonnenaufgangstabelle, Wasser-Notvorrat, Elektrolyttabletten und anderen Überlebensnotwendigkeiten um den Bauch geschnallt, die Hände auf die Hüften gestützt, stand er breitbeinig da und versuchte so auszusehen, als spazierte er tagtäglich in der Wüste herum. Aber in Wirklichkeit war ihm äußerst mulmig zu Mute, und er wünschte sich zurück in seine Katakombe tief unter den gläsernen Türmen von Terminal. Er war mitgefahren, weil er seine Freundin damit beeindrucken wollte, dass er auf den Goldfeldern gewesen war, aber jetzt hätte er Lizz leichten Herzens gegen die Sicherheit und Behaglichkeit des unterirdischen Terminal eingetauscht.
Die Mondin war noch nicht aufgegangen, aber ein bleiern düsteres Zwielicht herrschte, in das der rote Schein am Horizont sein Gespensterlicht mischte. Vor zwei Stunden waren sie dort vorübergefahren und hatten in der Ferne lodernde Feuertürme gesehen, jeder so hoch wie ein Sendemast. Es seien Ölseen, hatten die Erwachsenen ihm erklärt, die dort Tag und Nacht brannten. Rundum erstreckte sich die eisige Nacht voll huschender Schatten und wispernder Geräusche, und Jeff musste daran denken, was für ungeheuerliche Wesen in diesen Wüsten existierten – freilich weit, weit von Terminal City und den Siedlungen entlang der Autobahnen entfernt, Hunderte, vielleicht Tausende Kilometer tief in der weglosen Einöde.
Der Junge blickte sich um. Bizarre Felsblöcke, einer so schwarz wie der andere, häuften sich ringsum. Sie ähnelten mehr schwarzem Glas als Stein. Wenn das Feuer flackerte, glich ihre Oberfläche einem schwarzen Spiegel, in dem Flammen tanzten.
Obwohl man ihm gesagt hatte, dass ein kluger Mondscheiner sich nie mehr als zehn Schritte von seinen Gefährten entfernte, schritte der Junge weiter in die Wüste hinaus, finster entschlossen sich zu beweisen, dass das, was seinen Magen verkrampfte, nicht Furcht war. Er holte die Taschenlampe aus seiner Survival-Tasche und leuchtete den Stein an. Jetzt sah er, dass nicht der gesamte Felshaufen diese ungewöhnliche Konsistenz hatte, sondern nur einige hinter einander liegende Brocken. Es sah aus, als sei etwas darüber hinweg gefegt, das die glasige, glänzende Spur hinterlassen hatte. Vorsichtig berührte der Junge sie erst mit dem Handschuh, dann mit dem bloßen Finger. Es war wirklich Glas, und es sah genauso aus, als hätte jemand eine langen Schweif glutflüssigen Glases über die Felsen gezogen. Oder waren die Felsen selbst zu Glas geworden? Er wusste, dass Gestein zu Glas schmelzen konnte, aber woher sollte die Hochofenhitze kommen, die diesen Prozess bewirkt hatte? Das Merkwürdigste aber war, dass die Substanz, als er sie berührte, plötzlich aufleuchtete: Unmittelbar unter der Stelle, wo sein neugieriger Finger hintupfte, eilten viele rosig leuchtende Fäden zusammen und schienen nach seinem Finger zu schnappen.
Es war wunderschön und faszinierend, und der Junge steckte es in die Tasche mit dem Gedanken, wie beeindruckt Lizz sein würde, wenn er es ihr zum Geschenk machte. Er hatte die Warnung des alten Anführers Joop vergessen, in der Wüste nichts, aber auch gar nichts anzufassen und aufzuheben, weder Tier noch Pflanze noch Mineral. "Die meisten schönen Dinge, die man dort findet", hatte der finstere Greis gesagt, "sind entweder bissig oder giftig oder, noch schlimmer, verhext."
Rasch und verstohlen kehrte er zu den anderen zurück. Er wollte noch Holz auf das Feuer legen, damit es auch ordentlich unter dem Suppentopf brannte, aber eine alte Frau hielt ihn zurück. "Nicht zu viel Holz, Jeff. In der Wüste muss man vorsichtig sein mit dem Feuer. Wenn es zu hell brennt, könnte es einen Salamander anlocken. Das sind feurige Drachen, die in den Flammen und von den Flammen leben. Hilf deiner Mutter jetzt mit dem Brotschneiden, dann erzähle ich dir die Geschichte."
Es gibt nichts, was Mondscheiner mehr lieben als Geschichten – die sie mit dem schönen alten Wort "Mär" bezeichnen. Sie würden lieber hungern und frieren als auf eine wirklich gute Geschichte verzichten, ganz egal, ob sie lustig oder traurig oder zum Fürchten ist, ob sie wirklich passiert oder erfunden ist. Deshalb wartete nicht nur Jeff begierig darauf, dass die alte Frau zu erzählen begann.
"Erinnert ihr euch", sagte die Großmutter, "an die feurigen Lichter, die wir vor ein paar Stunden am Horizont gesehen haben? Das waren Ölseen. Sie brennen Tag und Nacht, denn beständig quillt neues Öl aus dem Boden herauf. Dort wohnen die Salamander, die Feuerdrachen. Sie sehen aus wie schöne Frauen und Männer mit feurigen Haaren und glühenden Augen, die in den Flammen schweben und tanzen wie Vögel in der Luft und Fische im Wasser. Allerdings habe ich noch nie einen mit eigenen Augen gesehen, und ich werde mich auch sehr hüten ihren Feuerseen in die Nähe zu kommen. Es sind tödliche Geschöpfe, und wer ihr Missfallen erregt, ist verloren. Deswegen wagt sich auch niemand daran, die Ölquellen zu nutzen. Die Leute fürchten den Fluch der Salamander, und ich meine, sie fürchten ihn zu Recht."
Jeff starrte sie mit großen Augen an. Er hatte das beunruhigende Gefühl, dass der Steinbrocken in seiner Tasche auf eine seltsame Art lebendig geworden war, seit die Rede auf die Feuerdrachen gekommen war. Er meinte ein schwaches Vibrieren zu spüren, wenn er die Hand auf die Tasche legte, und ein elektrisches Knistern und Prickeln setzte sich in seine Hand hinein fort. "Was ist ein Salamanderfluch?", fragte er.
"Etwas Scheußliches", antwortete die alte Frau. "Die Verfluchten verbrennen von innen her - wie ein Steak, das man in einen Mikrowellenherd legt. Plötzlich, weitab von jedem offenen Feuer, schlagen blaue Flämmchen aus ihrem Leib, die rasch zu mächtig lodernden Flammen werden, und binnen weniger Minuten ist nur noch eine schwarze, verkohlte Masse von ihnen übrig. Du wirst keinen Mondscheiner auf ganz Terminal finden, der sich den Feuergeistern in die Nähe wagt. Sie tragen das Feuer der Hölle in sich. Selene hat uns vor ihnen gewarnt."
Als der Name der Mondgöttin erwähnt wurde, neigten alle ehrfürchtig die Köpfe und legten zum Zeichen frommer Ehrerbietung die Handflächen zusammen, doch dann nahmen sie das Gespräch sofort wieder auf. "Was meinst du damit, Mutter", fragte der Sohn der Alten, "dass ein zu helles Lagerfeuer einen Salamander anlocken könnte? Meinst du, er würde aus den Flammen herausspringen?"
Die alte Frau nickte feierlich. "So ist es jedenfalls einem Prospektor widerfahren, der in der Wüste lagerte. Ihr wisst ja, wie die Prospektoren sind. Geldgierige Leute ohne Sinn und Verstand, die meinen, man könnte in der Wüste herumlaufen wie in den Straßen von Terminal. Keine Ahnung haben sie! Sie stolpern herum wie Betrunkene und können an nichts anderes denken, als wo es ein Grab auszurauben oder einen verschütteten Bunker zu finden gibt. Ich habe den Mann, dem das Unheil widerfuhr, selbst gekannt – nun, genau genommen hat ihn der Sohn meines Nachbarn gekannt, aber das kommt ja auf eins heraus. Jedenfalls war er einer von denen, die immer meinen alles besser zu wissen, und was man ihm auch sagte, er machte Lagerfeuer, auf denen man einen Ochsen hätte braten können. Und eines Nachts passierte es."
Zehn Augenpaare, alle fiebrig glänzend im unruhigen Flammenschein, starrten die Erzählerin fasziniert an.
"Plötzlich hörte der Mann ein Singen aus den Flammen, so fremdartig und lieblich, wie er noch nie Gesang gehört hatte. Die Flammen loderten höher und höher, sie schlängelten sich ineinander, und mit einem Mal schwebte eine Frau vor ihm, schöner als irgendein menschliches Wesen es sein konnte. Sie war wie glutflüssiges Glas, halb durchsichtig, mit Haaren aus roten Flammen und Augen wie rote Stopplichter. Der Prospektor hatte aber nicht lange Zeit sie zu bewundern, denn mit einem grässlichen Zischen stürzte sie sich auf ihn und verschlang ihn, und später fand man auf seinem Lagerplatz nur noch ein paar Klumpen verbranntes Fleisch neben seiner geschmolzenen Ausrüstung."
Der alte Anführer nickte bedächtig. "Es sind gefährliche Geschöpfe“, sagte er. „Dabei sind sie wunderschön: Die Flügel der Feuerdrachen sind anzusehen wie riesige, rot-goldene Schmetterlingsflügel. Sie sind so zart, dass man durch sie hindurchsehen kann, und funkeln und flirren wie ein Feuerwerk. Aber am Hinterteil haben diese Kreaturen einen Schwanz, so lang wie ihr ganzer Körper, hornig und gekrümmt wie der Schwanz eines Skorpions. An seinem Ende sitzt ein Hohlstachel, eine tödliche Waffe. Denn im Innern ihres Leibes haben die Salamander verschiedene, mit Säuren und giftigen Gasen gefüllte Kammern, deren Inhalt sie nach Belieben miteinander mischen und obendrein in Brand setzen können. Dann schießt aus ihren Stachel eine kochende Mischung giftiger Chemikalien oder, wie aus der Tülle eines Flammenwerfers, ein Meter langer, weiß glühender Feuerstrahl, so heiß, dass er selbst Felsen schmelzen kann."
Jeff spürte, wie sein Herz einen Schlag aussetzte. Das Summen und Knistern in seiner Tasche wurde beängstigend stark, er begann zu fürchten, die Gefährten könnten es hören. Die verglasten Felsen – waren sie in einen solchen Feuerstrahl geraten? Was für ein Gedanke, dass er ein Stück Stein in seiner Survival-Tasche trug, das der glühende Schweif des Salamanders berührt und geschmolzen hatte! Er war sehr erleichtert, als eine der jüngeren Frauen sich mit der Bemerkung einmischte: "Allerdings habe ich gehört, dass die Feuerdrachen manchmal auch gütig sind."
"So? Na, das ist mir neu", kommentierte die Großmutter spitz. "Was hast du denn gehört?"
Die Jüngere setzte sich mit freudig geröteten Wangen in Positur. (Wenn es etwas gab, was die Mondscheiner noch mehr liebten als Mären zu hören dann war es Mären zu erzählen). "Ihr wisst doch, dass ich eine Zeitlang während der Spätschicht in dem Truckstop an der Ausfallstraße aus Terminal gearbeitet habe, und dort habe ich die Geschichte von einem Trucker gehört. Dieser Trucker war einer von den harten Burschen, die die Autobahnen zu den Diamantminen befahren, hoch oben im Norden, wo es neun von zwölf Monaten bitterster Winter ist. Es ist ein knochenharter Job, und es kommt nicht selten vor, dass ein Trucker auf den vereisten Straßen verunglückt oder eine Panne hat und erfriert – und diesem Mann wäre es fast genauso ergangen. Er hatte eine Motorpanne. Nun wisst ihr ja, so etwas ist schon schlimm genug, wenn es einem hier auf der Wüstenautobahn passiert, aber dort oben in der Eiswüste bedeutet es den Tod. Sie müssen Tag und Nacht den Motor ihrer Trucks laufen lassen, sonst würde sogar das Getriebeöl gefrieren, stellt euch das einmal vor! Und wie es der böse Geist wollte, passierte ihm das noch auf einer sehr einsamen Strecke. Er konnte zwar über sein Funkgerät seine Position durchgeben und um Hilfe bitten, aber es würde wohl einen Tag dauern, bis die anderen Trucker ihn erreicht hatten – 24 Stunden in einer eisigen, stockfinsteren Ödnis, in der es keinen Span Holz gab, um ein Feuer damit zu machen. Der Trucker schnippte sein Feuerzeug an, um wenigstens eine Zigarette zu rauchen – seine letzte Zigarette, wie er dachte, wenn er aus der finsteren, eiskalten Fahrerkabine in den heulenden Blizzard hinausblickte. Der Schnee lag schon spannenhoch auf der Windschutzscheibe, und er fühlte, wie seine Hände und Füße kalt wurden. Er schnippte also das Feuerzeug an, und zu seinem Erstaunen fuhr eine armlange Flamme heraus, nicht die übliche kleine, gelblich-blaue Gasflamme, sondern eine warme, fröhlich blakende Kaminfeuerflamme. Sofort wurde es um vieles wärmer in der Kabine und die sanfte Helligkeit tat dem Mann, der da mitten in der Finsternis gefangen saß, auch gut. 24 Stunden lang brannte die warme, rettende Flamme in der Kabine, brannte solange, bis Hilfe kam, dann erlosch sie von selber. Man sieht also, die Salamander sind nicht immer grausam. Ich denke überhaupt, sie sind nur bösartig, wenn sie gestört oder belästigt werden."
Einer der Männer stimmte ihr lebhaft zu. "Ja, denkt doch nur an die kaiserliche Ölgesellschaft! Erinnert ihr euch noch? Sie wollten alle Erdöl-Seen industriell nutzen, obwohl sogar von Seiten der Solaris davor gewarnt wurde. Ihre eigenen Schriftgelehrten wiesen darauf hin, dass jeder, der sich den Besitz eines Salamanders aneignete, und sei es auch nur ein Tropfen Öl, ein Brocken Lava oder ein geschmolzener Stein, mit der furchtbaren Rache der Geschöpfe zu rechnen hat."
Jeff erstarrte. Er bekam Bauchweh – eine außergewöhnlich schlimme Art Bauchweh. Der Stein! Er hatte den Steinbrocken in der Tasche! Sein Blick flitzte ängstlich nach allen Seiten. Wenn die Feuerdrachen nun bemerkt hatten, dass er einen Stein gestohlen hatte? Nun, genau genommen hatte er ihn ja nicht gestohlen, jedenfalls nicht mit Absicht, er hatte ihn nur aufgehoben und eingesteckt – aber wie sollte er das einem Ungeheuer erklären, das mit einem siedenden Säurestrahl auf ihn zielte? Jetzt fiel ihm alles wieder ein, was der Anführer ihm geraten hatte, aber jetzt war es zu spät. Er konnte nicht einfach aufstehen und zu den Felsen hinauslaufen, um den Stein zurückzulegen. Seine Gefährten würden ihn nicht gehen lassen, egal, welchen Vorwand er gebrauchte.
Jeff schlang die Arme um die Knie und kauerte sich so eng zusammen, dass er sich selber die Luft abschnürte. Sein Herz dröhnte in der Brust. Was sollte er bloß tun? Konnten die Salamander wirklich so unbarmherzig sein, ihn wegen eines so winzigen Vergehens – sozusagen fast gar keinen Vergehens – so grausam zu bestrafen? Tränen stiegen ihm in die Augen. Es war unfair. Es war echt gemein. Mit leiser, zittriger Stimme fragte er: "Und wenn jemand ... also nur einmal angenommen, jemand würde ganz zufällig, wirklich nur ganz zufällig so einen Lavabrocken oder ... äh ... Stein aufheben, den würden sie doch nicht mit Säure bespritzen und verbrennen, nicht wahr? Das wäre doch ungerecht, nicht wahr? Oder?"
"Hmmm." Die Großmutter rieb sich nachdenklich die Nase. "Lass mich überlegen! Ich glaube, ich erinnere mich da an eine Mär von jemand, dem genau das passierte. Oh ja – ich hab´s. Es war ein Junge, etwa in deinem Alter, Jeff – ein hübscher und kluger Junge, aber noch nicht reif genug um zu wissen, dass die Welt voll gefährlicher Dinge ist und man nicht alles antappen darf, was einen interessiert. Wie Joop hier" – dabei wies sie auf den Anführer –"zu sagen pflegt: Die schönen Dinge, die man in der Wüste findet, sind alle entweder bissig oder giftig oder verhext. Nun also, dieser Junge fand einen Lavabrocken – oder war es ein Glasstein? Ja, ich glaube, es war ein Glasstein. Er steckte ihn heimlich in seine Survival-Tasche und beschloss niemand etwas zu sagen, weil ihm klar war, dass die Erwachsenen ihm heftige Vorwürfe gemacht hätten. Das war nicht nur eine Dummheit, sondern ein schweres Vergehen: Wenn der Salamander ihn attackiert hätte, hätte er die ganze Gruppe ausgelöscht, oder meinst du, ein wütender Salamander würde sich damit aufhalten, genau zu zielen?"
Jeff schüttelte stumm den Kopf. Er fühlte sich grässlich. Seine Bauchschmerzen waren unerträglich geworden, er fühlte schon richtig, wie der Drachenfluch wirkte und seine Eingeweide zu kochen begannen, und die Angst erstickte ihn beinahe. Überall in der Finsternis sah er schimmernde rote Gestalten, selbst die Sterne erschienen ihm als die feurigen Augen von Salamandern, die nach dem Dieb ausspähten.
Die Großmutter fuhr fort: "Natürlich bemerkten die Feuerdrachen sofort, dass etwas von ihrem Besitz fehlte. In dieser Hinsicht sind sie wie alle Drachen: Sie sind habgierig und versessen auf ihren Besitz. Auch wenn es nur das kleinste und unbedeutendste Stückchen ist, das jeder Andere mit dem Stiefel beiseitestoßen würde – Drachen erheben sofort ein großes Geschrei, wenn ihnen etwas abhanden kommt. Sofort erhob sich ein Spähtrupp von drei Dutzend Salamandern aus dem Flammenturm und schwärmte nach allen Seiten aus. Sie spritzten auseinander wie die Funken eines Feuerwerks, und binnen weniger Minuten hatten sie viele Quadratkilometer Wüste abgesucht. Es war ein beeindruckender Anblick. Bei Tag sind die Salamander in der Sonnenglut kaum zu sehen, man erkennt nur ein rötliches Leuchten, aber bei Nacht fahren sie wie Kometen mit ihren Feuerschweife kreuz und quer durch den Himmel und erleuchten ihren Pfad mit einem rosigen Licht. Man sagt – obwohl ich wette, dass noch keiner einen Salamander wissenschaftlich untersucht hat -, dass sie keine Augen wie die Menschen oder Tiere haben, sondern Sensoren, die auf feinste Veränderungen im Wärmespektrum reagieren. Natürlich dauerte es nicht lange, bis sie den Dieb entdeckt hatten."
Jeff kauerte steif und starr am Feuer und starrte die alte Frau an. Er wagte nicht, eine Frage zu stellen. Was war, wenn sie ihm nun nichts Anderes zu sagen hatte, als dass die Salamander diesen unglücklichen Jungen gnadenlos verbrannt und in Säure aufgelöst hatten?
"Zum Glück", fuhr die Großmutter mit bedeutungsvollem Nicken fort, "war der arme Junge nicht allein, und unter seinen Gefährten gab es kluge Leute, die sofort wussten, was zu seiner Rettung getan werden konnte. Er musste den Stein aus seiner Tasche holen, ihn, so schnell er konnte, ins Licht der Mondin legen und ihr den Stein zum Opfer darbringen. Dagegen waren die Salamander machtlos, denn der Mondin können sie nichts anhaben. Wenn sie gegen Selene aufbegehren wollen, scheitern sie: In ihrem sanften, kühlen Licht erlöscht der Feuerbrand der Drachen, und ihre glühenden Leiber verwandeln sich in flocke, graue Asche, die mit den Winden verweht. Natürlich zerstört die alte Dame am Himmel die Salamander nur, wenn sie ihr den Krieg erklären, sonst lässt sie sie genauso in Frieden wie jedes andere friedliche Lebewesen. Wer nicht beißt, der wird auch nicht gebissen, das ist ein guter frommer Spruch. Und jetzt lass uns sehen, wie lange es noch bis zum Aufgang der Mondin dauert." Sie streifte ihre Wollhandschuhe ab, zog die Tabelle aus der Außenseite ihrer Survival-Tasche und studierte sie durch die Lesebrille. "Wie ich´s dachte – nur noch zwei Minuten. Also, her mit dem Stein, Jeff."
Jeff hatte nie gedacht, dass zwei Minuten so unendlich lange dauern konnten. Hundert Mal in diesen hundertzwanzig Sekunden war er überzeugt, dass die Feuerdrachen ihn als Erste erreichen würden, dass die Sensoren in ihren roten Stopplicht-Augen ihn bereits erspäht hatten und die lodernden Schwingen mit der Geschwindigkeit eines Düsenjets durch den Nachthimmel sausten. Es half ihm auch nichts, dass die Erwachsenen ihm diese zwei Minuten mit Vorwürfen und guten Lehren verkürzten. Wie ein Ertrinkender sich an Land rettet, sprang er mit einem Riesensatz auf den ersten Flecken Mondlicht zu, der sich auf dem kalten Sand abzeichnete, und warf sich dort der Länge nach hin. Mit beiden Händen hob er den Stein über den Kopf und flehte die Mondgöttin in inbrünstigem Gebet an, ihn als Opfer anzunehmen.
Mit grenzenloser Erleichterung sah er, dass die roten Fäden, die sich im Inneren des Minerals herumschlängelten, immer blasser wurden und zuletzt in weiße, reglose Adern wie winzige Silberminen verwandelten.
Nun waren die Mondscheiner gewaltlose Leute und fanden es äußerst verwerflich Kinder zu schlagen, ja überhaupt zu bestrafen, auch wenn sie gefährliche Dummheiten angestellt hatten. Man setzte auf Güte, Belehrung und Einsicht. Deshalb wurde der Rest der Nacht damit verbracht, dass man Jeff, während der seine heiße Suppe löffelte und sich insgeheim schwor, nie wieder einen Fuß in die Wüste zu setzen, zahllose Geschichten von Leuten erzählte, die in der Wüste irgendetwas Verlockendes entdeckt und – mit den entsprechenden bösen Folgen – an sich genommen hatten.
***