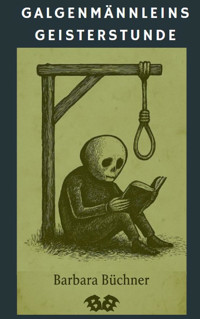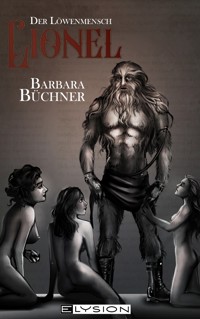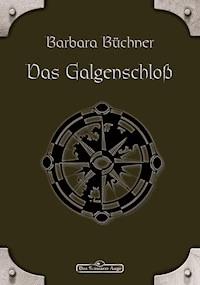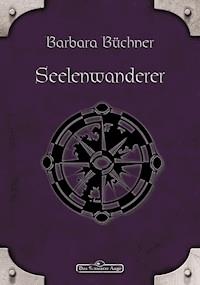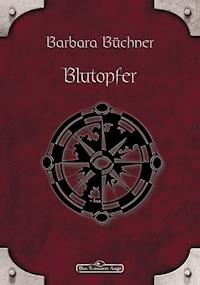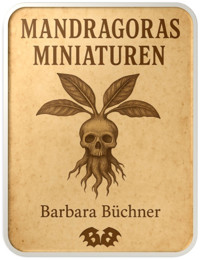
2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Diese Miniaturen wurden für späte Stunden geschrieben: nicht als hektische Schockdosen, sondern als kleine, beharrliche Stiche. Lies nicht, wenn du schlafen willst; lies, wenn du gern einen Gedanken mit nach Hause nimmst, der dort den Lichtschalter ausknipst und eine Weile bleibt. Beginne ruhig mit der ersten Erzählung, lasse die Töne sich setzen; erkenne, wie Humor und Unbehagen bei mir oft dieselbe Stimme haben. Wenn du mitten im Text kurz aufhörst, markiere die Seite, trink eine Tasse Tee, und setze nach einer Viertelstunde wieder an — viele der Stücke gewinnen, wenn man ihnen Raum lässt und den Atem anhält. Diese Sammlung ist kein Lehrbuch des Schreckens, sondern ein Spaziergang durch kleine Abgründe. Viel Vergnügen (und gute Nerven)!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mandragoras Miniaturen – Unheimliche Erzählungen
Eine Sammlung von Barbara Büchner
Aus der Reihe „Portiunculas Bibliothek“ (Band 1)
Copyright © 2025 Barbara Büchner Alle Rechte vorbehalten. Cover und Illustrationen: Barbara Büchner und „Thekla“ (GPT-5) Erstveröffentlichung in der Portiuncula-Reihe Veröffentlicht über Tolino Media GmbH & Co. KG ISBN
Prolog: Das Dorf der Miniaturen
Es gibt ein Dorf, das auf keiner Landkarte verzeichnet ist. Man erreicht es nicht mit Zügen, nicht mit Straßenbahnen, nicht einmal zu Fuß. Man stolpert hinein, wenn die Augen schwer werden, wenn das Zimmer dunkel und still geworden ist, und wenn man sich doch noch nicht ganz dem Schlaf ergeben will.
Die Hauptgasse des Dorfes zieht sich krumm und schmal zwischen buckligen Häusern hinauf. Laternen flackern in einem gelblichen Zwielicht, halb Öl, halb Elektrizität, und werfen Schatten, die länger sind, als es die Mauern erlauben dürften. Jedes Haus ist ein Rätsel, jedes eine Falle, jedes ein Ort, an dem etwas lauert.
Gleich am Eingang winkt das Spitalshaus, in dessen Fenster ein Bett steht, und aus dem lange, steife Arme ragen, bereit, den Vorbeigehenden zu packen. Ein Stück weiter hält das Museum seine Türen offen, und in der Mitte des Saales glänzt ein Spiegelbild, das sich tiefer in die Seele frisst als jede gemalte Szene. Daneben hockt schwer und unbeweglich Portiuncula, die steinerne Kröte mit ihrem rosa Panzer, die zu warten scheint, bis jemand lacht – und dann aufspringt.
Am Hang weiter oben späht Frau Reimann mit ihren großen Augen aus ihrem Fenster, unbeweglich und doch aufmerksam, wie seit hundert Jahren. Noch weiter flackert ein orangefarbenes Licht im Nebel, wo ein Waldweg ins Dorf hineinführt, blinkend wie eine Warnung vor etwas, das sich nähert.
Je länger man geht, desto bunter und gefährlicher wird die Nachbarschaft. In einem Haus verhandeln Heinzelmännchen mit Anwälten, im nächsten sitzt eine Influencerin mit einem pelzigen Urwesen auf der Schulter. Ein altes Blockhaus riecht nach Schnee und Gold, eine Küche nach einem historischen Rezept, und zwischen den Mauern flüstern Stimmen von jenseits der Zeit.
Ganz am Ende der Gasse, dort, wo keine Laterne mehr brennt, liegen die Zimmer voller Schubladen, die niemand jemals leeren wird. Wer den Mut hat, dort einzutreten, stolpert vielleicht über etwas, das er längst verloren glaubte – oder über etwas, das ihn verloren gibt.
So ist dieses Dorf: kein Ort der Zuflucht, sondern ein Panorama der Nacht. Wer es einmal betreten hat, findet schwer wieder hinaus. Aber das macht nichts. Man kann sich dort niederlassen, eine Weile herumgehen, den Kopf in Türen stecken, zuhören, wie andere flüstern, lachen, schreien. Und wenn man hinausgeht, wird man sich fragen, ob die Straße nicht doch irgendwo existiert, ein kleines Stück außerhalb der eigenen Stadt, nur ein paar Schritte entfernt vom gewohnten Heimweg.
Willkommen im Dorf der Miniaturen.
***
Gebrauchsanweisung fürs nächtliche Lesen
Diese Miniaturen wurden für späte Stunden geschrieben: nicht als hektische Schockdosen, sondern als kleine, beharrliche Stiche. Lies nicht, wenn du schlafen willst; lies, wenn du gern einen Gedanken mit nach Hause nimmst, der dort den Lichtschalter ausknipst und eine Weile bleibt.
Beginne ruhig mit der ersten Erzählung, lasse die Töne sich setzen; erkenne, wie Humor und Unbehagen bei mir oft dieselbe Stimme haben. Wenn du mitten im Text kurz aufhörst, markiere die Seite, trink eine Tasse Tee, und setze nach einer Viertelstunde wieder an — viele der Stücke gewinnen, wenn man ihnen Raum lässt und den Atem anhält.
Diese Sammlung ist kein Lehrbuch des Schreckens, sondern ein Spaziergang durch kleine Abgründe. Viel Vergnügen (und gute Nerven)!
***
Die unheimliche Bettnachbarin
Als die zukünftige Okkupantin von Bett 4, unmittelbar neben dem ihren, im Rollstuhl hereingeführt wurde, wusste Annie Wellmann sofort, dass sie es mit einem bösen Stück zu tun hatte.
Die Frau im getupften Spitalsnachthemd war uralt, wie alle Frauen auf Station Zwölf, sie war sehr groß, dürr wie ein Rechen, und ihre Augen funkelten Unheil verkündend in dunklen Höhlen. Das schlimmste aber waren ihre Arme, die sie vor sich hin und zur Seite ausstreckte, als wollte sie jemand umfassen und mit Krallenfingern an sich reißen. Sie waren so steif, als hätte die Totenstarre schon eingesetzt. Als die Frau zu Bett gebracht wurde, blieben sie in derselben bedrohlichen Haltung, trotz der Bemühungen der Schwestern, sie unter die Decke zu stopfen.
Annie Wellmann war die einzige, die sich näher für das unheimliche Weibsbild interessierte. Die übrigen acht Patientinnen waren in einem Zustand, in dem sie nicht mehr viel Interesse an ihrer Umwelt zeigten. Schließlich war das hier eine geriatrische Station.
Annie ärgerte sich, dass man sie hierher abgeschoben hatte. Sie war trotz ihrer fünfundsiebzig Jahre geistig noch vollkommen fit. Im Spital lag sie eigentlich nur, weil sie eine neue Hüfte gebraucht hatte und die Orthopädie mit frisch Operierten überfüllt war. Sie war wach, orientiert, freute sich auf ihren Morgenkaffee und die morgendliche Schmerz–Infusion und wartete ungeduldig auf den Tag, an dem sie entlassen wurde.
Sofern sie ihn jemals erlebte.
Dieses Ding da im Bett neben ihr, dieses im Rigor mortis erstarrte Skelett, war gefährlich. Annie hatte bereits die unerfreuliche Erfahrung gemacht, dass Geriatrie–Patientinnen keineswegs harmlos waren. Gleich in ihrer ersten Nacht auf der Station hatte die kleine Dicke, Nr. 7, sich aus dem Bett gewälzt und angefangen, mit ihrem Gehstock auf die Nachbarinnen einzuschlagen. Die herbei eilenden Schwestern hatten sie gerade noch daran hindern können, die Station Zwölf in ein Schlachtfeld zu verwandeln. Natürlich hatte man ihr eine kräftige Dosis Beruhigungsmittel verabreicht, aber wie lange hielt so etwas an? Annie Wellmann hatte sich angewöhnt, in der Nacht nur mit einem Auge zu schlafen.
Das kam ihr zugute, als sie ihre erste Nacht in Gesellschaft von Nr. 4 verbrachte. Das Skelett hatte sich ruhig verhalten, bis die Nachtschwester mit einem fröhlichen „Und jetzt wir alle scheen schlaafen!“ das Licht abgedreht hatte. Dann begann es sich zu bewegen. Annie hörte, wie alle seine Gelenke knackten, als Stück für Stück ein unheiliges Leben in ihnen erwachte. Zehenknochen, Fußknöchel, Knie, Hüfte. Ein Knacks nach dem anderen. Dann hob sich die dünne Bettdecke. Annie, die im Zwielicht hinüberschielte, sah deutlich, wie die fast fleischlosen Knie sich erst hoben, dann zur Seite schwenkten und den Körper in eine auf dem Bettrand sitzende Haltung bugsierten. Der vornüber gesunkene Oberkörper richtete sich mit einem leisen, mechanischen Knirschen auf. Der Kopf auf dem dürren Hals hob sich. Die Augen kugelten in den Höhlen.
Natürlich hatte sie es auf Annie abgesehen, das war von vornherein klar gewesen. Die war schließlich am besten erhalten. Annie war nicht unerfahren in solchen Dingen, und sie wusste: Das Skelett brauchte Lebenskraft. Nicht Blut, sondern die unsichtbaren Essenz, die es durch Saugnäpfe an seinen Fingerspitzen aus einem fremden Körper herausziehen würde.
Es erhob sich langsam, torkelnd wie eine Marionette an zu lockeren Fäden.
Annie seufzte. Sie hatte ihrem Beichtvater so ernsthaft versprochen, es nie wieder zu tun, aber sollte sie sich ohne Gegenwehr hier das Leben aussaugen lassen? Kein Mensch war da, ihr zu helfen. Die anderen Patientinnen zählten nicht. Die Nachtschwester würde kommen, wenn sie den Kopf drückte, aber sie würde das Skelett nur in sein Bett zurückschieben und ermahnen, ruhig liegen zu bleiben. Dann wäre es in fünf Minuten wieder auf der Pirsch. Annie, bis zum Hals von ihrer Bettdecke verhüllt, flüsterte: „Tut mir leid, lieber Gott, tut mir leid, Pater Stanislaus, ich tue es wirklich nur in äußerster Not!“
Als das Skelett sich grinsend über sie beugte und seine langen, unnatürlich verrenkten Arme nach ihr ausstreckte, riss sie die Hände unter der Decke hervor.
„Kud!“, krächzte sie, heiser vor Angst und Schuldbewusstsein. „Kud! Kuda! Aphrem!“ An ihren ausgestreckten Fingern loderten violette Flämmchen, wurden zu feurigen Strahlen.
Als würde es von einer unsichtbaren Faust vor die Brust gestoßen, wich das Skelett zurück. Seine Zähne ratterten vor Wut, als es merkte, dass ihm Widerstand entgegengesetzt wurde. Es wollte vorwärts springen, aber da schrie Annie, alle Kraft zusammen nehmend: „Kuda Kasch emmuin, emmuin!“ Ein violetter Feuerstoß flammte aus ihren Händen hervor.
Bei dem letzten Wort packte die unsichtbare Faust zu, riss das strampelnde Skelett in die Höhe und schleuderte es mit fürchterlicher Kraft quer durch den Raum, gegen das hohe Fenster, das unter seinem Anprall zerbarst, und hinaus in die finstere Nacht. Annie, zitternd vor schlechtem Gewissen, vergewisserte sich nur kurz, dass ihre Hände unverdächtig aussahen, dann zog sie die Bettdecke bis über die Nase hoch und stellte sich schlafend.
Natürlich hörte die Nachtschwester den Krach des splitternden Glases. Natürlich kam sie herbeigestürzt, drehte das Licht auf, holte Verstärkung, alarmierte den diensthabenden Arzt und die Polizei. Ebenso selbstverständlich wurde allen den aus dem Schlaf geschreckten Greisinnen versichert, es sei nur der Wind gewesen, der ein Fenster mit großem Lärm zugeschlagen hätte, und sie bekämen gleich ein feines Schlückchen Orangensaft mit etwas drinnen, das sie wieder einschlafen ließe. Annie nahm dankbar ihr Schlückchen an. Sie war jetzt einmal in Sicherheit. Mit Pater Stanislaus würde sie die Sache bei der nächsten Beichte in Ordnung bringen.
* Drei Stockwerke tiefer, im Hof des Pavillons, standen zwei ratlose Polizisten und hielten ihre Taschenlampen auf etwas gerichtet, das zwischen glitzernden Glasscherben auf dem Pflaster lag: Einen Haufen dürrer, trockener Knochen, halb bedeckt von einem getupften Spitalsnachthemd. Die erstarrten Arme ragten steif in die Höhe, als wollten sie gierig nach den Beamten – zwei jungen, von Kraft und Energie strotzenden Burschen – greifen und sie an sich reißen.
***
Der Ärger mit dem Personal
„Morgen, Hänzel“, sagte ich, als ihn zufällig traf, wie der Zipfel seiner roten Mütze um die Ecke des Stiegenhauses verschwinden wollte.
Normalerweise haben es Heinzelmännchen nicht gerne, wenn sie gesehen werden, aber diesmal, ausnahmsweise, blieb Hänzel stehen, nahm die rote Zipfelmütze ab und drückte sie verlegen gegen die Brust. „Guten Morgen, Moffa“, erwiderte er (das ist die heinzelmännisch korrekte Anrede für die jeweilige Hausfrau.) Das war schon ungewöhnlich, aber noch viel ungewöhnlicher war, dass plötzlich hinter der Treppe zwei weitere Heinzelmännchen auftauchten. Sie trugen zwar auch rote Mützen, aber anstelle der normalen Tracht steife schwarze Anzüge. Der eine hielt ein Miniatur–Handy, der andere einen ebenso kleinformatigen Laptop. Ihre Gesichter waren streng und ernst. „Wigget & Wisch, Rechtsanwälte Wir kommen in Vertretung unseres Mandanten, Herrn Hänzel“, sagte der mit dem Laptop. „Es handelt sich um …“ Er klappte den Laptop auf, „ausständige Zahlungen. Herr Hänzel ist jetzt seit drei Jahren für Sie tätig, wurde aber bislang nicht bezahlt.“ „Ich dachte, Heinzelmännchen darf man nicht bezahlen, sonst sagen sie: Hint´ scheen, vorn scheen, nimma in Dienst gehen. Und verschwinden.“ „Naja“, mischte sich der Handy–Heinzel ein, „würden Sie drei Jahre lang für eine Hose und ein Jäckchen arbeiten? Die Zeiten haben sich geändert. Ich maile Ihnen einmal kurz die derzeitigen Vorschriften für die Bezahlung von Heinzpersonen – das ist jetzt der korrekte Ausdruck – in Privathaushalten. Inklusive Zuschlag für Nachtarbeit, Zuschlag für Sonntags– und Feiertagsarbeit, Gefahrenzulage – wie wir gesehen haben, hält Ihr Nachbar eine Katze, die jederzeit in ihr Haus eindringen könnte …“ „Nicht mehr, seit ich ihr den nassen Wischmopp um die Ohren gehauen habe“, beteuerte ich. „Das ist keine ausreichende Sicherung. Machen wir weiter. Zuschlag für Umstellung auf Sommerzeit, was praktisch eine Stunde Arbeit bei Tageslicht bedeutet, und Heinzelmännchen sind nachtaktiv, also eine zusätzliche Belastung. Macht insgesamt …“ Sie rechneten und rechneten und kamen auf zweihundert Silbertaler. „Zahlbar bis zum nächsten Vollmond bei sonstiger sofortiger Exekution Ihrer persönlichen Habseligkeiten.“ „Zweihundert Taler hab ich nicht“, knurrte ich ihn an. „Zahl ich nicht. Hau ab, Hänzel, mitsamt deinen Winkeladvokaten. Das erste, was ich heute anschaffe, sind drei Katzen und ein Dackel, und die Arbeit soll meinetwegen der Teufel tun.“ „Schon zur Stelle“, meldete sich ein schrilles Stimmchen. Da stand ein kleines rotpelziges Ding mit einem langen Schwanz und spitzen Ohren. „Mache alle Arbeit schnell, perfekt, leise. Schau her!“
Er sauste den Flur auf und ab, wobei er seine Schwanzquaste als Staubwedel benutzte. Wirklich, ordentliche Arbeit. Aber … „Und wann“, fragte ich sarkastisch, „kommst du mit einem Dutzend langschwänziger Anwälte und einem Computer und berechnest mir Zuschläge für Belästigung durch sonntägliches Glockengeläute und dergleichen?“ „Nix, nix!“ Der Rotpelz wickelte verlegen seinen Schwanz um die Vorderklauen und schielte beiseite. „Die Bedingungen sind doch seit altersher bekannt. Bei uns gibt es keine Neuerungen. Sieben Jahre hundertprozentiger Einsatz meinerseits und dann …“ Er hüstelte diskret, wobei feiner Schwefeldunst aus seinem Mäulchen wölkte. Tja. Wo sonst kriegt man heute noch so fleißiges und unbezahltes Personal? Gut, ich meine, da ist die blöde Klausel mit den sieben Jahren. Sie wissen, was ich meine. Aber ich habe schließlich auch einen Rechtsanwalt. Ich zögerte nur eine Sekunde lang. Dann sagte ich. „Okay. Du bist angestellt.“
***
Das Spiegelbild
Aussage des Museums–Wachmanns Arthur D. im Jahr 1982:
Das Ölgemälde, alt und kunsthistorisch bedeutsam, ist ein Kotzbrocken. Deshalb hängt es ja auch in einem eigenen Alkoven am Ende des Gemäldesaals IV, (Realistische Epoche, 1850 bis 1900) und eine Tafel an der Tür warnt: Das hier ausgestellte Kunstwerk könnte Betrachter verstören und ängstigen. Bitte betreten Sie den Raum nicht, sofern Sie kränklich oder schwanger sind oder Kinder bei sich haben. Klar. Der fiese Ölschinken, der da als einziges Exponat auf einer Staffelei steht, effektvoll diffus beleuchtet in einem halbdunklen Raum, trägt ja auch den Titel: „Das Ergötzen an der Beute.“ Um ehrlich zu sein: Rein technisch gesehen war der viktorianische Maler keineswegs ein unbegabter Schmierant gewesen. Im Gegenteil. Das Gemälde ist geradezu fotorealistisch ausgeführt, und doch mit dieser Art von Seele, die nur ein wirklicher Künstler in sein Werk hineinlegen kann. Es ist nicht besonders groß, und zu sehen ist auch gar nicht viel. Eine Lichtung in einem finsteren, tief verschneiten Wald. Ein käsig–grünlicher Mond scheint. Mitten auf der freien Fläche kauert eine zottige, schattenhaft umrissene Kreatur über dem halbnackten, zerfleischten Leichnam eines Bauernmädchens. Was diese Kreatur eigentlich ist, erkennt man nicht genau. Ein riesiger Wolf? Eine Hyäne? Ein Bär? Es hat kein erkennbares Gesicht. Nur die Augen sind lebendig. Und wie! Das Bildnis hat etwas von diesen Geisterbahn–wiggle pictures an sich, bei denen eine liebe Oma sich in eine Hexenfratze oder ein süßes kleines Mädchen in einen Wechselbalg verwandelt Sie kennen diese Späßchen ja. Genauso war es bei dem Gemälde. Die Besucher starrten es erwartungsvoll an und verstanden nicht, was daran so arg sein sollte. Ein Raubtier ist eben ein Menschenfresser, was solls. Und dann – jedes Mal! – seufzte plötzlich jemand auf, oder wandte sich abrupt ab, und dann hörte ich immer dieselben Worte, manchmal unter Tränen, manchmal vor Abscheu erstickt: Das ist kein Tier! Das ist ein Werwolf! Ein Mensch! Ja, es sind menschliche Augen. Kein Zweifel, denn in ihren dunklen Tiefen lauert eine so höllische Bösartigkeit, wie man sie bei keinem Tier jemals sehen wird. Sie leuchten, und dennoch breiten sie einen Schleier von Finsternis über das ganze, immer noch schemenhafte Gesicht. Danach haben die Gäste es meistens eilig, den Raum zu verlassen. Gibt natürlich auch Blödmänner, die gar nichts kapieren. Die zu lachen anfangen oder obszöne Bemerkungen über das halbnackte Bauernmädchen im Schnee machen. Auf die habe ich ein Auge. Die eskortiere ich hinaus, sobald sie nur die Mundwinkel zu einem Grinsen verziehen. Ja, also, an dem fraglichen Tag war der Blödmann ein nicht mehr ganz junger Typ, Dauer–Student aus reichem Haus wahrscheinlich. So ein schwarzlockiger Everybodys Darling, der mit zwei gestylten Tussies hereinkam, an jedem Arm eine, und schon vorsorglich überlegte, welchen fiesen Witz er gleich loslassen sollte. Die beiden Weiber glotzten erst ratlos das Gemälde an, dann flüsterte eine: „Oh nein … nein …“ Ich denke, da sah er das Bildnis erst so richtig an. Und was dann passierte, das kann ich nur schwer schildern, bin ja Museumswärter und kein Dichter.
Jedenfalls krümmte er plötzlich den Rücken, ganz leicht nur, streckte den Hals vor, zog die Oberlippe zurück, runzelte die Nase wie ein angriffslustiger Hund. Es packte ihn richtig am ganze Körper. Alles an ihm wurde anders. Nicht so wie in den dämlichen Filmen, wo einem borstige Haare wachsen. Nein. Äußerlich sah er ganz gleich aus wie vorher, nur so angespannt, dass ich förmlich seine Muskeln knirschen hörte, und ihm der Speichel vor Gier aus den Mundwinkeln troff, und dass ihm gewissermaßen die Finsternis aus allen Poren quoll und ihn einhüllte wie ein Nebel, bis nur noch die Augen zu leuchten schienen. Genauso wie die Augen auf dem Gemälde. Und dann stieß er auf einmal diesen Laut aus, der halb ein Lachen und halb ein vor Lust zitterndes Heulen war. Die Mädchen kreischten gleichzeitig auf. Die eine wimmerte hysterisch: „Oh, Ted, hör auf mit dem Theater, du machst mir Angst!“, während sie sich gleichzeitig schutzsuchend an seinen Arm krallte, und die andere versuchte zu lachen, aber es gelang ihr nicht. Es hörte sich viel eher an, als wollte sie gleich kotzen. Natürlich warf ich alle drei auf der Stelle hinaus.
Und damit wäre alles gesagt, nur dass ich den Mann ein Jahr später auf einem Zeitungsfoto wiedererkannte. Darunter stand alles geschrieben: Sein voller Name war Theodor Bundy, und zu dem Zeitpunkt, als sein gemaltes Spiegelbild ihn so aus dem Gleichgewicht brachte, hatte er schon an die drei Dutzend junge Frauen umgebracht. Mit den Zähnen zerfleischt wie ein Wolf. Und sich an seiner Beute ergötzt.
***
Meine Urli, das Durli
Kyla Kalamaschri, Supermodel, Influencerin, It–Girl und Stil–Ikone, erlitt einen Nervenzusammenbruch, der das Ende ihrer Karriere bedeutete. Ihr Selbstmord folgte kurz darauf. Eine feindselige Klatschpresse sah einen Zusammenhang damit, dass Kyla im Lauf ihrer langen, sehr langen Karriere mindestens so oft in der Entzugsklinik wie beim Schönheitschirurgen gewesen war und das Gebäude ihrer perfekten Körperlichkeit zusehends brüchiger wurde. Der Grund war jedoch ein anderer. Man erfuhr ihn erst, nachdem Kyla aus der Welt geschieden war und ihre beste Freundin für eine hohe Bestechungssumme ausplauderte, was die unglückliche Influencerin ihr anvertraut hatte. Am Abend vor einer dieser Rote–Teppich–Veranstaltungen, bei denen sich alles trifft, was schön und/oder reich ist, war Kyla gerade dabei, ihrer Erscheinung die letzten Glanzlichter aufzusetzen, als etwas in den Falten des bereit gelegten Ballkleides raschelte. Sie musste einen Schrei unterdrücken, als sie sah, was es war, nämlich eine ungewöhnlich große und speihässliche Ratte mit enorm langer Schnauze und einer allgemeinen Aura von Bösartigkeit. Und dann sprach das Ding sie auch noch an.
„Ich bin mit Schönmachen fertig“, sagte es, während es noch rasch einmal über seinen struppigen, gelb–braunen Pelz leckte. „Was dagegen, wenn ich mir ein paar deiner Ringe als Arm– und Beinreifen ausborge?“ Und ohne auf eine Antwort zu warten, fuhr es blitzschnell in die offene Schmuckkassette, schnappte sich ein paar glitzernde Ringe und begann sie überzustreifen. Kyla starrte, unfähig, ein Wort herauszubringen. Sie dachte daran, dass der Doktor sie gewarnt hatte: „Ein weiterer Rückfall, und Sie werden beginnen, kleine garstige Tiere zu sehen!“ Aber ein paar Gläser Sekt und eine Handvoll Tabletten waren doch kein wirklicher Rückfall? „Nein“, erklärte das Scheusal, als hätte es ihre Gedanken gelesen. „Ich bin kein Delirium tremens. Ich bin ein Durlstotherium newmani. Das erste Säugetier und damit deine älteste Vorfahrin. Durli für dich, wenn wir gut miteinander auskommen. Und ich bin hier, weil ich auch meinen Anteil an deinem Luxusleben haben will – wozu unsere enge Verwandtschaft mich schließlich berechtigt.“ Kyla fand ihre Stimme wieder. „Verwandtschaft?“, kreischte sie. „Du willst verwandt mit mir sein, du garstige Klobürste?“ „Die garstige Klobürste will ich mal nicht gehört haben!“, erwiderte Durli, wobei sie warnend lange Rattenzähne fletschte. „Und von wegen Verwandtschaft: Ich bin deine Urgroßmutter. Klar, Urgroßmutter hoch X, wir haben schließlich schon zu Zeiten existiert, als noch die Saurier auf Erden herumstapften, aber immerhin. Meine Urli, das Durli! Klingt das nicht drollig? Unter dem Namen kannst du mich deinen Freunden vorstellen, Durlstotherium newmani kann sich doch kein Menschen merken. Ich werde auf deiner Schulter sitzen, so …“ Mit einem Satz sprang es auf die nackte Schulter der Frau (Kyla war immer sehr sparsam bekleidet, damit auch jeder sehen konnte, dass sie wirklich rundherum perfekt war), und löste damit einen hysterischen Anfall aus. Kyla schlug um sich, drehte und wendete sich, warf sich aufs Bett, sprang wieder auf, alles, um das borstige (und ziemlich streng riechende) Scheusal von ihrer Schulter zu schütteln, aber Durli krallte sich in ihrer üppigen blonden Haarmähne fest und widerstand mit akrobatischem Geschick den heftigsten Versuchen, sie loszuwerden.
„Hör auf mit dem Unsinn!“, schrillte sie, als ihr das Theater zu viel wurde. „Hier bin ich und hier bleibe ich! Mich wirst du nie wieder los. Ich sitze nämlich nicht nur auf deine Schulter, ich sitze tief, tief in deinen Genen, und von dort unten steuere ich dich, wie es mir beliebt. Das kannst du sowieso nicht ändern, also sei lieb zu mir, sonst beiße ich dich in die Milchdrüsen, genau dort, wo alle es sehen!“ Und wieder blitzten die langen, rasiermesserscharfen Zähne, gefährlich nahe an Kylas makellosem Dekolleté. Kyla vergaß alle Mahnungen des Doktors. Sie ließ sich atemlos in einen Sessel fallen und schenkte sich ein halbes Glas Whisky ein. Ihre Hand zitterte so heftig, dass das Glas an ihre Zähne klirrte. „Lass mich auch mal kosten“, verlangte Durli, und im selben Augenblick hing sie auch schon wie ein Wasserspeier über Kylas Schulter und hatte die lange Zunge schlappernd in den Whisky gesteckt.
„Hmm, schmeckt nicht übel“, erklärte sie. „Wir haben viel gemeinsam, findest du nicht? Von den Tabletten bitte nur ein Viertel, ich bin schließlich beträchtlich kleiner als du. Klein zu sein, das war unser Überlebenstrick, hast du das gewusst? Schrumpfen bis zum Geht–nicht–mehr und in Erdlöchern überdauern, während das riesige Viehzeug draußen zugrunde ging. Erst als die Luft rein war, haben wir uns wieder herausgewagt und ernsthaft mit unserer Entwicklung begonnen.“
Sie schnupperte prüfend an Hals und Achseln der Frau. „Und du bist also das vorläufige Endprodukt der evolutionären Entwicklung? Nicht übel. Hat lange gedauert, sieht aber gut aus. Und jetzt such mir irgendetwas heraus, eine Nerzstola oder dergleichen, damit ich bei der Party auch was hermache. Nichts gegen meinen Pelz, aber bei festlichen Gelegenheiten will man doch etwas Besonderes sein.“
So schwatzte sie vergnügt dahin, aber Kyla hatte inzwischen auf das Glas verzichtet und trank aus der Flasche, und nicht lange danach lag sie murmelnd und grunzend auf dem Bett hingestreckt, während Durli sich behaglich in ihren Haaren zusammenrollte. Und so nahm das Unheil seinen Lauf.
***
Sule Skerry
Überall schlägt uns Unverständnis entgegen.
Meine Freunde und Verwandten sahen gerade noch ein, dass wir uns ein neues Haus kauften. Ein Haus am Meer. Keine dämliche Schickimicki–Villa, die der erste Nordost–Sturm von der Klippe pustet, sondern ein schönes, solides Haus mit dicken Feldstein–Mauern, winzigen Fenstern und dem Atlantik vor der Haustür. Aber sie fanden, ich müsste übergeschnappt sein, ausgerechnet auf die Orkney–Inseln zu ziehen! Nur weil mein Mann behauptete, das sei für ihn der schönste Ort auf Erden! „Menschenskind, warum nicht gleich nach Spitzbergen? 300 Tage im Jahr Sturm und Regen! Springfluten! Eisige Winter! Und eine verschrobene Bevölkerung, die euch nie akzeptieren wird!“ Und dann kam natürlich der giftige Nachsatz: „Wir dachten immer, du wärst eine selbstständige Frau! Nicht so ein Weibchen nach dem Motto: Wo die Nadel hingeht, da geht der Faden auch hin! Okay, Iain ist eine imposante Persönlichkeit, aber musst du jeder seiner Launen nachgeben? Euer Swimmingpool war doch wahrhaftig groß genug, selbst für einen Extremsportler! Und du bist seinetwegen ohnehin schon jeden Sommer nach Calais gefahren, damit er für seine Kanalüberquerung trainieren kann!“ Na und?, denke ich dann. Jeder Mann sollte ein Hobby haben. Mir ist es lieber, in einem kalten Winter dickt eingemummt am Ufer zu sitzen, während Iain Eistauchen geht, als vor einer Rotlicht–Bar auf ihn zu warten! Wenigstens hat er nie versucht, mich in sein Hobby miteinzubeziehen. Da würde ich nun wirklich den Schlussstrich ziehen! Er ist ein wunderbarer Mann, also habe ich viel an ihm akzeptiert, das nicht jede Frau hinnehmen würde. Und er war fair genug gewesen, es mir zu sagen, als unsere Beziehung ernsthaft wurde. Er hatte mir einen Brief in die Hand gedrückt und gesagt: „Lies, bevor du Ja oder Nein sagst.“ Obwohl er natürlich damit rechnen musste, dass ich sagen würde: „Liebling, du bedeutest alles für mich, aber es gibt nun einmal Dinge …“ Stattdessen hatte ich – okay, nach einer kurzen Schreck–Pause – nur gesagt: „Ach, Iain, ich hatte schon gefürchtet, du hättest mir etwas wirklich Schlimmes zu beichten! Das ist doch nun wirklich keine große Sache! Du weißt, ich liebe dich.“
In dem Brief waren nur vier Zeilen gestanden, geschrieben in Iains schottischem Heimatdialekt. Ich bin ein Mann auf trocknem Land,
ich bin ein Selkie draußt im Meer
und fern der Küste, fern vom Strand,
aus Sule Skerry, da komm ich her.
Kann man als tolerante Frau doch damit leben, oder? Schließlich verwandelt er sich nur im Meer in einen Seehund. Und nicht etwa in meinem Bett.
***
Eine wahre Gespenstergeschichte
„Herr Doktor, Herr Doktor!“ Der siebenjährige Frederick drängte sich verstohlen an den Notar heran. „Wissen Sie, dass Onkel Ronald Ihnen das Spukzimmer zum Übernachten gegeben hat? Das, wo immer ein Geist aus dem Spiegel erscheint? Puh, da werden Sie aber schlecht schlafen!“ „Ich hab keine Angst vor Geistern!“, antwortete Notar Peter Forbes barsch und schob den Jungen weg. Gleichzeitig aber lief es ihm eisig über den Rücken. Ronald Thunbridge, dieser Scheißkerl! Der hatte das arrangiert. Wusste genau, wie ängstlich und nervös der Besucher war. Hatte natürlich bemerkt, mit welchem Unbehagen der Notar das unheimliche Turmzimmer betrachtet hatte. Forbes ballte die Fäuste. Natürlich hatte das Zimmer irgendwo einen geheimen Zugang, alle alten Gebäude hatten so etwas, und in der Nacht würden Frederick und seine Brüder in weiße Leintücher gewickelt hereinstürmen und „Buuuh!“ schreien. Aber so leicht ließ er sich nicht zum Narren halten. Als die Abendgesellschaft zu Ende ging und alle ihre Zimmer aufsuchten, betrat er das seine, wobei er viel Lärm machte, schlüpfte dann voll angekleidet wieder hinaus und sperrte die Türe von außen zu. Ungesehen huschte er den Flur entlang und bereitete sich ein Nachtquartier auf einem Diwan, der hinter einem Vorhang verborgen in einem Alkoven stand. Wenig später war er eingeschlafen und schlief in seliger Ruhe, bis das erste Lärmen der Hausangestellten ihn weckte. So, jetzt werden wir sehen, dachte er, als der Schlüssel im Schloss knirschte und die schwere, altertümliche Türe des Spukzimmers sich öffnete. Und tatsächlich! Wie er es erwartet hatte!
Die von Ronald angestifteten kleinen Quälgeister waren am Werk gewesen. Da, auf dem großen Spiegel, war – offenbar mit Filzstift – ein Emoji mit Hörnern und einer langen Krampuszunge gemalt, und darunter stand in grotesken, altväterischen Lettern: NOTAR FORBES IST EIN FEIGER LULU. Wutentbrannt griff der Notar nach einem Päckchen Papiertaschentücher und wischte die Zeichnung weg.
Wollte sie wegwischen. Es gelang ihm nicht. Sie war nämlich nicht mit Filzstift gemalt, sondern wie mit einem Lötbrenner tief in das Glas des Spiegels geätzt, als hätte eine weißglühende Kralle sie Strich für Strich eingebrannt! Und ein leichter Schwefelgeruch stieg davon auf.
***
Ende blau, alles blau
Herwig Wehle war vierzehn Jahre alt gewesen, als er die Nachricht im Inneren des Glückskeks im chinesischen Restaurant gefunden hatte. Wie alle solchen Nachrichten, war sie ausgesprochen zweideutig.
Finde Zitronenblau und du bist am Ziel. Viele Jahrzehnte später fand Herwig Wehle die Botschaft nicht mehr so lächerlich, wie er es als Junge getan hatte. Da war ihm nämlich die deprimierende Tatsache bewusst geworden, dass er sein ganzes, bisher 75jähriges Leben lang auf der Jagd nach dem elusiven Zitronenblau gewesen war. Auf subtile, hinterhältige Weise wurde es sein Symbol für alles, was er zu erreichen hoffte und niemals erreichte.
Dabei hatte er gar nicht wenig erreicht, was sozialen Status und finanzielle Versorgung anging. Auch eine Frau und zwei Kinder hatte er einmal gehabt, aber die Frau und die Kinder waren ebenso wenig Zitronenblau gewesen wie der Wagen, um den ihn die gesamte Nachbarschaft beneidete, die Villa am Stadtrand, die Wohnung im Zentrum und die Ehrfurcht gebietenden Titel vor seinem Namen. Dasselbe galt für die Religion, die er als Kind gelernt hatte, und die esoterische Weltanschauung, mit der er es als Erwachsener eine Zeitlang versucht hatte. Es galt sogar für das soziale Engagement, das er eingegangen war, um von seiner gutmenschlichen Tochter nicht als herzlose, geldgierige Heuschrecke verteufelt zu werden. Auch das war kein Zitronenblau gewesen: Letzten Endes hatte die Tochter ihn auch noch einen Heuchler genannt und war mit irgendeiner Sekte abgezogen. Inzwischen konnte er nur noch zynisch lächeln, wenn ihm irgendwo eine Leuchtschrift entgegenkreischte: „Finden Sie Ihr Zitronenblau! Erreichen Sie Ihr Ziel! Auch Sie können Zitronenblau sein!“
Alles Schmarrn. Abzocke. Bauernfängerei.
Die Geschichte nimmt aber dennoch ein gutes Ende. Herwig Wehle fand sein Zitronenblau. Das kam so: Als er Jahre später im Bestattungsinstitut lag, sah der Bestatter, dass der Verstorbene ohne jedes „Brimborium“ (Wehles Formulierung!) kremiert zu werden wünschte, und ihm kam eine zündende Idee. Endlich würden sie den albernen Ladenhüter anbringen, der seit Jahrzehnten im Depot vor sich hin gammelte.
Er schrie nach seinem Gehilfen. „He, Charlie, hol mal den unverkäuflichen Sarg rauf, den nie jemand wollte – weißt schon, das komische Ding in Zitronenblau!“
„Wird gemacht, Chef!“, kam die Antwort. „Wird auch Zeit, dass das Gerümpel nochmal für was zu gebrauchen ist!“
***