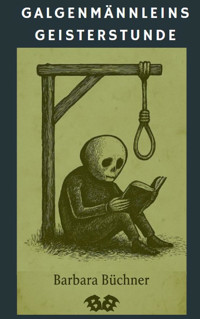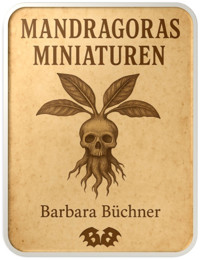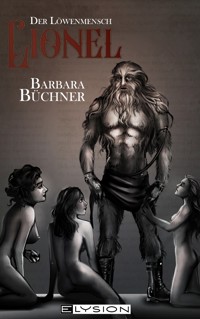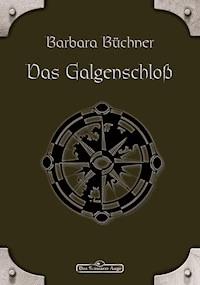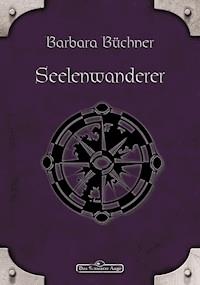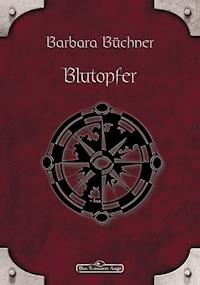2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Mord steht im Mittelpunkt aller dieser Geschichten, aber nicht alle "Mordbuben und Malefizweiber" tun Böses "aus der Bosheit eines verdorbenen Herzens heraus", wie es ein alter juristischer Leitspruch formuliert. Manche töten, um ihr eigenes Leben zu retten, manche tun es, weil ihnen irgendwann der letzte Rest Geduld verdampfte wie Milch auf der heißen Herdplatte. In diesen Geschichten begegnet man neben lustvollen Killern wie der "Blutgräfin" auch Frauen und Männern, die das Leben zu weit getrieben hat: Das ist die Bio-Bäuerin, die „so harmlos ist wie eine ausgestopfte Maus“ und doch zur Furie wird , da sind die drei gepeinigten Landgendarmen, die Patientin, die im Wahn eine Vampirin erdolcht und die drei herzlos entsorgten Ex-Frauen, die sich zum Rache-Chor vereinen– sie alle gehören zu jener großen, schweigenden Familie derer, die das Maß verloren haben. Sie töten aus Zorn, Verzweiflung oder mit eiskaltem Kalkül – Frauen und Männer, die man mitunter verfluchen, manchmal aber auch verstehen kann. Ob sie Empörung auslösen, einem leidtun oder oder man ihnen insgeheim applaudiert, möge jede Leserin, jeder Leser selbst entscheiden. Doch wer hier zu blättern beginnt, sollte wissen: Auch manche Lämmer haben Zähne.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Barbara Büchner
Mordbuben und Malefizweiber
Böse Geschichten von Gift und Galle
Mordbuben und Malefizweiber
Böse Geschichten von Gift und Galle
Die schwarze Witwe
"Oh nein - bitte nicht!" dachte Inspektor Bronsky, als die Glastüre der Wachstube sich öffnete und zusammen mit der Dunkelheit und der kalten Luft des Vorraums die unverkennbare Silhouette einer alten Frau hereinkam. "Bitte nicht zu allem anderen Ärger jetzt auch noch ein altes Weib..."
Er war ein stämmiger junger Mann, dessen etwas zu molligen Körper die Uniformjacke in Form presste. Er war im allgemeinen gutmütig und hilfsbereit, wie ein Polizist sein soll, aber er tat sich schwer mit alten Leuten, und der Abend war ohnehin eklig genug. Draußen ging in schweren Schauern der Schneeregen nieder; die Kollegen, die zu einem Einsatz hinausmussten, kamen feucht und durchfroren zurück und hockten, statt wie sonst zu plaudern, mürrisch in den warmen Winkeln des Aufenthaltsraumes. Im Moment waren sie alle unterwegs, und wenn sie zurückkamen, würden sie völlig unansprechbar sein, weil es bereits über Mitternacht hinaus war und auch Polizisten müde werden.
Bronsky rieb sich das Auge, in dem er bei dem Gedanken an Mitternacht Sand gespürt hatte. Das andere Auge wanderte rund um die Wachstube und verifizierte, dass jeder vertraute Anblick noch da war: Die hölzerne Theke mit den Formularen und Merkblättern darauf, die hölzerne Sitzbank gegenüber (auf der die Raufer und Trunkenbolde und alle schlechten Menschen sich hinsetzen mussten) und das Tischchen mit den beiden hässlichen Fauteuils (an dem die guten Menschen Platz nehmen durften, die fremde Uhren und Ringe gefunden oder ihre eigenen verloren hatten). Sein Blick streifte das Terroristenplakat, auf dem die Kollegen, wie beim Schiffchenversenken, dachte Bronsky, pedantisch die Gesichter der Erschossenen und Gefassten auskreuzten. Wanderte über den "Hinweis für Hundebesitzer" und das Phantombild eines dringend gesuchten Mörders, das dem Mörder vermutlich nicht ähnlich sah. Die kalte Luft, die aus dem Vorzimmer hereindrang und über das alles hinwegstrich, roch nach Nässe und Abgasen und alter Frau.
"Machen Sie bitte die Türe zu", sagte Bronsky, und gleichzeitig dachte er: Merkwürdig das mit dem Geruch. Irgendwie rochen sie alle, auch die feinsten von ihnen. Rochen nach Drogerie und nach lange getragenen Pelzen und aus der Mode gekommenen Parfüms. Er stützte die Arme erwartungsvoll auf die Theke und bemühte sich, etwas anderes zu riechen als den eigentümlich schwülen und stickigen Geruch, der sie umgab.
"Was kann ich für Sie tun?" fragte er. Im gleichen Augenblick ärgerte er sich darüber. "Was kann ich für Sie tun?" fragten Verkäufer, nicht Polizisten. Andererseits … wie die Frau aussah, hätte er es niemals fertiggebracht, einfach zu sagen: "Was gibts?"
Er betrachtete sie aufmerksam und ein wenig irritiert, wie sie langsam (wahrscheinlich hatte sie Wasser in den Beinen oder Arthritis in den Knien) quer durch die Wachstube auf ihn zukam und vor ihm stehenblieb. Sie wirkte exzentrisch, fast grotesk, aber sie war, dachte Bronsky, zweifellos eine Dame, wenn auch eine etwas verstaubte. Er schätzte sie zwischen sechzig und siebzig. Sie trug einen kostbaren, aber stark aus der Mode gekommenen schwarzen Pelzmantel, der sie vom Hals bis zu den Zehen verhüllte, und auf dem Kopf eine Art Duschhaube als Regenschutz. Im Neonlicht war ihr Gesicht weiß wie das eines Harlekins. Ihre Augenbrauen waren zwei nackte schwarze Striche auf der Haut, die den Stirnfühlern eines Insekts viel ähnlicher sahen als Augenbrauen. Als sie die Duschhaube abstreifte und das Wasser davon abschüttelte, kam darunter das Haar zum Vorschein: ganz unglaublich lackschwarzes, zu einem kessen Pagenkopf frisiertes und unverkennbar falsches Haar. Der glänzend geschminkte Mund vervollständigte den Eindruck, den Bronsky von ihr hatte: Weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz. Nur dass es nicht Schneewittchen zu sein schien, die vor ihm stand, sondern eher die Stiefmutter.
"Worum handelt es sich?" fragte er, bemüht, den servilen Eindruck zu verwischen, den seine erste Frage hinterlassen haben mochte.
Sie stellte ihre Handtasche aufs Pult und musterte ihn aus Augen, die in diesem kalkigen Gesicht wie die Kohlestückchen im Gesicht eines Schneemanns wirkten. "Ich möchte eine Anzeige machen". Ihre Stimme war tief und selbstbewusst. Bronsky ertappte sich dabei, wie er die Uniformjacke über den Hüften glattstrich.
Er lächelte entgegenkommend, wie man es ihm eingedrillt hatte. Gleichzeitig knüllte er in Gedanken die Anzeige, die sie machen wollte, zusammen und warf sie in den Papierkorb. Die Frau wirkte intelligent, aber auch irgendwie wunderlich. Wahrscheinlich lärmten ihre Nachbarn, oder sie benahmen sich so verdächtig, dass man sie für Kinderverführer und Staatsfeinde halten musste. "Sie müssen mir sagen, gegen wen und warum."
"Gegen wen, werden Sie feststellen müssen, Herr Inspektor, dazu ist die Polizei schließlich da." Für eine so alte Frau hatte sie eine erstaunlich wohlklingende, fast erotische Stimme; ein tiefer Ton schwang darin mit wie das Schnurren einer Maultrommel. "Und warum? Ich bin belästigt worden."
"Ich verstehe. Bitte geben Sie mir erst einmal Namen und Adresse an." Bronskys Lächeln vertiefte sich. Er zog eines der Formulare herbei, angelte nach einem Kugelschreiber und blickte die Frau erwartungsvoll an.
"Koprda", antwortete sie. "Elise. 67 Jahre alt. Witwe. Ich wohne keine zehn Minuten von hier in der Sterngasse. Nr. 7. Das Haus mit dem blauen Gitterzaun."
"Sehr gut." Er ärgerte sich selbst, wenn er sich diesen Krankenpflegerton anschlagen hörte, aber es war eine von den dummen Gewohnheiten, die der Dienst mit sich brachte. Außerdem gab es nicht allzu viele, die ihre Aussagen so präzise wie Elise Koprda machten. Die meisten erzählten ihm, wenn er sie nach Namen und Adresse fragte, in allen Einzelheiten die Todeskrankheit ihres verblichenen Gatten.
"Ja", fragte er, "und was ist Ihnen nun geschehen?"
"Ich wurde belästigt", wiederholte sie steif, fast, als betrachtete sie es als zusätzliche Belästigung, dass sie mit ihm darüber sprechen sollte.
Belästigt! Was mochte jetzt kommen? Hatte ein Passant sie vermeintlich lüstern betrachtet, oder war ihr ein Junge mit dem Skateboard vor die Füße gefahren, oder hatte ein Stadtstreicher sie angebettelt? Bronsky warf unwillkürlich einen Blick auf den Aktenschrank hinter seinem Rücken. Es war unglaublich, mit welchen Anliegen manche von diesen alten Leuten zur Polizei kamen. Wenn sie sich den Psychiater nicht leisten konnten und dem Pfarrer nicht mehr glaubten, wandten sie sich ans Bezirkskommissariat. Manche kannte er bereits vom Sehen, vor allem diejenigen, die in Abständen in die Psychiatrie gebracht werden mussten. Aber die Frau hier war ihm fremd. Nun, sie war noch verhältnismäßig jung. Die beste Zeit für Spleens und Schrullen waren die siebziger Jahre.
"Von wem belästigt?" fragte er geduldig.
"Nun - von diesem Mann." Sie stieß schnaubend die Luft aus. In ihren Augen funkelte es wie das Katzengold in der Kohle. "Sie dürfen nicht glauben, ich wäre etwa schon senil, ich bin geistig noch sehr gut beisammen, und ich lese die Zeitung. Ich fand dieses Benehmen sofort verdächtig."
"Natürlich", stimmte Bronsky zu. "Welches Benehmen?"
"Die Art, wie er mich anredete. Und mir anbot, meine Tasche zu tragen."
"Ihre Einkaufstasche?"
"Natürlich meine Einkaufstasche!" erwiderte sie im barschen Ton einer Gouvernante. "So macht er es doch immer, oder etwa nicht?"
Bronsky nickte, ohne aufzusehen. Er dachte: Wir sollten riesengroße Plakate an allen Plakatwänden der Stadt anschlagen lassen. "Männer! Die Polizei warnt euch eindringlich davor, alten Damen über die Straße zu helfen oder ihnen die Tasche zu tragen. Lasst es bis auf weiteres bleiben bis wir diesen Irren gefasst haben. Zuwiderhandelnde tun es auf eigene Gefahr."
Natürlich, dachte er dann (etwas milder gestimmt), verständlich war es schon. Da saßen sie daheim, in den Zitadellen der alten Häuser, in ihren riesigen muffigen Wohnhöhlen, hörten mit halbtauben Ohren Radio und lasen mit halbblinden Augen die Zeitung und zitterten Tag und Nacht davor, dass der Mörder plötzlich vor ihrer Tür stand. Angenehm war dieses Leben sicher nicht. Sie waren, dachte er aus seiner Polizistenerfahrung heraus, so leichte Beute... so hilflos und wehrlos und so entsetzlich dumm.
"Beschreiben Sie mir den Mann, bitte", sagte er freundlich. In solchen Situationen war es das Beste, die Nerven zu bewahren und zu Protokoll zu nehmen, was ankam. Nach den Beschreibungen, die die Polizei bis dahin erhalten hatte, war der Frauenwürger die reinste Chimäre: ein leichenblasser, dunkelhäutiger, langhaariger Kahlkopf mit grotesken nichtssagenden Zügen, ein bieder und harmlos wirkender Rocker in auffallend unbestimmbarer Kleidung. Und ein paar Männer, die hilfsbereit hatten sein wollen, waren in Handschellen abgeführt worden und hatten sich geschworen, nie wieder hilfsbereit zu sein.
Elise Koprda beschrieb den Mann als hellblond und kraushaarig und auffallend hässlich. Bronsky fügte ihrer Beschreibung (nur in Gedanken) hinzu, dass zu seiner Physiognomie vermutlich auch ein stechender Blick und ein grässliches Grinsen gehörten.
Er behielt recht.
"Mir fiel sofort dieser Blick auf", sagte die alte Frau, triumphierend stolz auf ihre eigene Klugheit. "Ein unnatürlicher Blick. Und er lächelte auf eine mehr als merkwürdige Art. Eine Bestie, das fühlte ich sofort."
Bronsky sah auf. "Das fühlten Sie?"
Sie gab seinen Blick zurück. "So etwas fühle ich, jawohl. Er hatte alle Kennzeichen eines Verbrechertyps."
Einen Augenblick lang hatte Bronsky das Gefühl, als wehte ihm eiskalter Wind ins Gesicht. Er hatte in seinen Polizeidienstjahren Zeit genug gehabt, dieses Phänomen kennenzulernen - den Hass alter Leute. Einen Hass, der ganz anders war als der junger Menschen, der etwas fast Jenseitiges an sich hatte. Er wuchs aus Gebrechlichkeit und Schwäche und dem Wissen, nicht mehr genug Zeit und Kraft zu haben, um die Rache noch blühen zu sehen. Kinder konnten hassen und denken: "Wenn ich einmal groß bin." Erwachsene konnten hassen und sagen: "Wenn ich die Gelegenheit bekomme..." Aber die Alten wussten, wie winzig ihre Chance war, zur Rache zu kommen. Sie machten keine Pläne mehr. Sie hassten nach innen, mit einer kalten höllischen Wut, die sich unter ihrer Furchtsamkeit und Unterwürfigkeit ausbreitete wie ein Morast unter trügerischem Grün.
"Sie sagten dem Mann also..." Bronskys Kugelschreiber wanderte zur nächsten Spalte des Formulars.
"Ich sagte ihm, er sollte sich trollen."
"Und das tat er?" Natürlich hatte er das getan, dachte der Inspektor. Vermutlich saß er jetzt in seinem Stamm-Café oder zuhause und sagte zu irgend jemandem: "Und das war das letzte Mal, daß ich so einer dämlichen alten Schachtel anbiete, ihr zu helfen. Die hat mich glatt einen Verbrecher genannt! Ab jetzt können sie ihre Binkel selbst schleppen, und wenn ihnen das Kreuz bricht dabei."
"Zuerst ja", antwortete Elise Koprda auf seine Frage. Sie stand immer noch vor der hölzernen Schranke, wie sie in der ersten Minute dagestanden war, aufrecht, im fest zugeknöpften Pelzmantel, eine Hand auf dem Kragenknopf, die andere auf dem Bügel ihrer Handtasche, die auf der Theke stand. Etwas an ihrem Gehabe verriet Bronsky - der ein erfahrener Polizist war - dass sich etwas in dieser Handtasche befand, das sie ihm in Kürze zeigen würde. Etwas, das ihm den Atem nehmen sollte. Er sah es deutlich an der Art, wie ihre Finger auf dem Bügel herumglitten und mit dem Verschluss spielten. Er kannte den Vorgang: Sie fühlte, dass er ihr nicht recht entgegenkam, und wehrte immer wieder die Versuchung ab, ihren Trumpf jetzt schon auszuspielen. Sie zwang sich selbst, zu warten, bis er seinen Unglauben oder seine Gleichgültigkeit deutlich verriet. Erst und dann würde sie die Tasche öffnen, dann käme unter Trompetengeschmetter und Paukengedonner das Beweisstück zum Vorschein, das ihn und alle skeptischen Polizisten der Welt ein für allemal überzeugen müsste... wahrscheinlich ein Zettel mit einer hingekritzelten Adresse darauf. ("Dort wohnt er, gehen Sie dorthin und verhaften Sie ihn, dann werden Sie schon sehen!")
"Zuerst ging er weg", berichtete Elise Koprda. "Aber dann merkte ich, dass er mir folgte. Genau genommen merkte ich es, als ich in die Drogerie ging ich bin leidenschaftliche Hobbyfotografin und kaufe einmal in der Woche neue Filme."
"Dort merkten Sie was?" fragte Inspektor Bronsky, der Angst bekam, sie könnte ihm bei dieser Gelegenheit alles über ihr Hobby erzählen.
"Dass er mir nachgegangen war. Er stand beim Zigarettenautomaten. Er stand mit dem Rücken zu mir, aber natürlich merkte ich, dass er sich auf mich konzentrierte."
"Ging er Ihnen noch weiter nach?" Bronsky war (wie seine Kollegen auch) nach Hunderten Falschmeldungen abgestumpft, aber jetzt machte sich doch ein kleines Gefühl bemerkbar - ein Gefühl, als tupfte jemand mit einer sehr kalten Fingerspitze sein Steißbein an. Ein Gedanke, der ihn (wie seine Kollegen auch) zumindest im Unterbewussten ständig beschäftigt hatte, fuhr wieder ins Bewusste empor: "Junge! Und wenn's diesmal doch wahr wäre? Einer wird ihn ja zuletzt fangen - und warum sollte der eine nicht ich sein? Angenommen, sie hat recht gesehen, und das Schwein war hier im Bezirk unterwegs..."
"Ja", sagte die alte Frau. "Er ist mir nachgegangen bis zur Wohnungstür. Er schlüpfte beim Haustor herein und blieb eine Treppe unter mir, und als ich gerade aufgesperrt hatte, rannte er die Stiegen herauf."
Aus dem kalten Tupfen auf Bronskys Rücken wurde plötzlich etwas wie ein in Eiswasser getauchter Umschlag.
Die Alte stand hier und lebte... trotzdem wurde ihm übel bei dem bloßen Gedanken, was ihr hätte zustoßen können. Er hatte die polizeiinternen Berichte über die anderen Fälle gelesen, die Berichte, in denen detailliert geschildert war, was in der Presse dann mit "zahlreiche verschiedenartige Verletzungen" diskret umschrieben wurde. Der Mann sei wahnsinnig, sagten die Psychiater. Bronsky fand, dass es nur ein Wahnsinn des Hasses sein konnte, der einen Menschen dazu trieb, mit anderen Menschen solche Dinge anzustellen, wie sie in den gerichtsmedizinischen Protokollen beschrieben wurden.
Seine Stimme war plötzlich belegt, als er fragte: "Was hat ihn vertrieben? Er drang doch nicht in ihre Wohnung ein, oder?"
"Doch", sagte sie. "Er stieß mich durch die Türe hinein, bevor ich schreien oder irgend etwas tun konnte. Er war flink wie ein Affe. Er hielt mir ein Messer vors Gesicht - ein langes dünnes Messer. Er sagte..." Sie blickte zu Boden, und Bronsky sah, wie auf ihren Wangen ein schmutziges Rot unter der weißen Puderschicht aufglühte. "Er sagte scheußliche, gemeine, obszöne Dinge."
"Sagte er sie nur?" fragte Bronsky leise. "Oder..."
Sie antwortete erstaunlich gefasst: "Manche sagte er nur, und manche tat er. Ich werde nicht darüber sprechen." Ein paar Sekunden schwieg sie, als wollte sie die Entschlossenheit des letzten Satzes auf ihn einwirken lassen, dann fuhr sie fort: "Er hatte nicht viel Zeit, etwas zu tun. Ich war immer eine fromme Frau, deshalb half mir mein Namenspatron in der Not. Der Mann stürzte - glitt auf einem Vorleger aus und stürzte genau an der Stelle, wo zwei Stufen vom Vorzimmer ins Esszimmer hinunterführen. Er schlug hin und blieb liegen."
Der Inspektor fuhr sich mit dem Handrücken über die Stirn. "Bewusstlos?!"
"Ja. Ich ging hinunter, und im ersten Zorn dachte ich, ich wollte etwas Schweres nehmen einen Leuchter oder eine Statuette und ihn damit totschlagen. Dann überlegte ich es mir anders. Ich holte Reepschnur und fesselte ihn so gründlich, dass er sich nicht mehr befreien konnte. In meiner Jugend ging ich gerne segeln, daher kenne ich mich mit Knoten gut aus."
Bronsky sah sie an, mit einem Gefühl, als sei er mehrmals hintereinander auf einer sehr langen und sehr steilen Achterbahn samt Looping gefahren. "Sie haben ihn gefesselt?"
"Ja."
"Und Sie sind sicher, dass er immer noch in Ihrer Wohnung liegt?" Er konnte es kaum glauben.
"Oh, da bin ich ganz sicher", sagte Elise Koprda.
Bronsky legte beide Hände flach auf die hölzerne Platte, um ihr Zittern zu verbergen. Es war phantastisch. Es war absurd. Diese feiste alte Katze! Andererseits... so besonders viel gehörte auch wieder nicht dazu, einen bewusstlosen Mann zu fesseln. Aufs Revier bringen würde ihn jedenfalls Inspektor Bronsky. Und für den Pressebericht konnte man die Geschichte ja ein bisschen auffrisieren... die alte Dame legte sicher nicht viel Wert darauf, groß in der Zeitung zu stehen.
Er wurde plötzlich sehr höflich und zuvorkommend (als strafte ihn das Gewissen schon heimlich für diesen Plan, sich den Ruhm zu erschleichen). "Sie müssen entschuldigen... ich lasse Sie hier stehen, nach allem, was Sie durchgemacht haben... Bitte setzen wir uns doch." Sie folgte ihm mit ihrem schwerfällig arthritischen Schritt zu dem Tischchen mit den beiden Fauteuils. Sie war - beim Gehen sah man es deutlicher als beim Stehen - eine dicke Frau. Bronsky sah sie an, und ein paar scheußlich obszöne Gedanken huschten durch seinen Kopf. Er zwang sich, an das Naheliegende und Bedeutsame zu denken. Er musste den Mann aufs Revier bringen, bevor die anderen zurückkamen, das war weit wichtiger als der Anblick einer alten Frau im Pelzmantel und die Erinnerung an gewisse Übelkeit erregende Stellen in den gerichtsmedizinischen Protokollen.
Ein Risiko allerdings bestand: Da war immer noch die Möglichkeit, dass sie ihn, absichtlich oder aus Verrücktheit, zum Besten hielt. Da war vor allem noch eine Frage, die sie ihm erst beantworten musste, bevor er ihr Glauben schenkte. Er blickte zu ihr auf. Sie stand am Tisch und knöpfte eben ihren schweren Pelzmantel auf. "Ich möchte noch eines wissen, Frau Koprda. Wann hat sich das abgespielt, diese Begegnung?" fragte er, plötzlich wieder argwöhnisch. "Sie sagten, Sie waren einkaufen, als der Mann Sie zu verfolgen begann, also war es vor sechs Uhr, und jetzt haben wir fast ein Uhr morgens. Warum kommen Sie erst jetzt zur Polizei?"
Sie setzte sich mit einer unbeholfenen Bewegung nieder. "Ich konnte nicht früher", sagte sie. "Ich hatte noch so viel zu tun."
"Zu tun?" Du meine Güte! dachte er. Diese alte Kröte hatte doch hoffentlich nicht alle Spuren aufgeputzt, bevor sie hierhergekommen war? Wie sollte man dem Kerl etwas nachweisen, wenn ihre Wohnung jetzt am Ende blitzte und blinkte? "Was zum Kuckuck hatten Sie zu tun?" rief er.
Die alte Frau richtete ihren kalten schwarzen Blick auf ihn. Sie sprach leise, und er war wieder erstaunt, wie wohlklingend ihre Stimme war und wie ruhig, in Anbetracht dessen, was sie zu sagen hatte. "Er sagte, er hasste solche wie mich. Nun, umgekehrt wird auch ein Schuh draus. Ich hasse solche wie ihn. Ich wollte erst zur Polizei gehen, aber dann dachte ich: Es war nicht die Polizei, die sich vor ihm fürchtete, es waren alte Frauen wie ich, die kaum noch wagten, auf die Bank oder zum Einkaufen zu gehen... alte Frauen, die bei jedem Klopfen an der Türe erschraken, die wussten, dass er es sein könnte, und dass ihnen niemand zu Hilfe kommen würde, dass man insgeheim über sie lachte und insgeheim fand, es sei ganz richtig so. Macht sie weg, was brauchen sie noch da herumzuhängen mit ihren großen Wohnungen und dicken Sparbüchern und hässlichen Runzelgesichtern; applaudiert dem Kerl, der sie euch vom Halse schafft..."
Sie schwieg abrupt, als hätte sie ein Limit ihrer Kraft erreicht, und sagte leise: "Ich wollte nicht sofort die Polizei alarmieren. Ich dachte über alles nach... was diesen alten Frauen durch den Kopf geht, wenn sie nachts nicht schlafen können, was mir selber durch den Kopf geht... und... Nun, und dann habe ich alles getan, was wir uns in diesen Stunden schon ausgemalt haben." Sie öffnete ihre Handtasche und zog einen kleinen Plastikumschlag heraus. "Sie glauben mir ja wohl nicht... aber Sie werden es gleich sehen. Sagte ich Ihnen nicht, ich bin begeisterte Hobbyfotografin? Ich habe auch eine Sofortbildkamera. Und ich habe jede einzelne Phase der Prozedur fotografiert."
Sie beugte sich vor und hielt ihm den Umschlag voller Fotos entgegen. Der Pelzmantel sprang auf und enthüllte, dass sie nichts weiter darunter trug als ein baumwollenes, geblümtes Unterkleid. Das Unterkleid war blutig nicht blutbespritzt, sondern vom Dekolleté bis zum Spitzensaum von Blut starrend wie eine Schlächterschürze, und Bronsky war sofort klar, dass das nicht ihr eigenes Blut war.
Seelenblut
Ob ich diese Tote kenne?
Was für eine Frage! Aber ich verstehe: das Protokoll. Das formelle Frage-und-Antwort-Spiel. Also dann: Ja, ich erkenne sie einwandfrei wieder. Wie alt sie in diesen wenigen Stunden geworden ist, wie mumienhaft alt! Wie verschrumpft ihre Augen aussehen! Ja, ich sage: Das ist sie. Das ist das Wesen, das sich auf dieser Welt Dr. Anna Elisabeth Wehle nannte.
Alles Weitere wissen Sie zweifellos aus den Niederschriften der Polizei: Wo sie ihre Praxis hatte, dass ich drei Monate lang ihre Patientin war und dass ich sie heute Morgen getötet habe - mit einem einzigen Stich eines winzigen Messers. Eines so winzigen, so zierlichen Obstmessers, dass es normalerweise niemals den Tod herbeiführen könnte. Aber Dr. Wehles Tod hat es herbeigeführt.
Sie brauchen nicht so betroffen beiseite zu blicken. Ich weiß, dass der Arzt sich wunderte, als er sie tot vor ihrem Schreibtisch liegen sah. Ich weiß, dass er den Kopf schüttelte und von Schock sprach, von überschießender Reaktion ... Ein so winziger Stich! Und doch zerstörte er das körperliche Gefüge dieses Wesens, das kein Mensch war, sondern ... etwas anderes.
Halten Sie mich nicht so energisch am Ellbogen fest, junger Mann. Ich werde nicht toben. Ich weiß, was sich gehört; ich werde nicht anfangen, in einer Leichenhalle zu randalieren. Und was einen Fluchtversuch angeht - trauen Sie denn Ihren eigenen Handschellen nicht?
Wenn ich mich unwillig zeige, dann nur deshalb, weil mir diese fahlen, unterirdischen Räume missfallen. Sie wecken Erinnerungen an die Stadt in mir, und diese Erinnerungen sind mir verhasst. Diese Stadt ist etwas, an das ich nie wieder denken will, weder im Wachen noch im Traum.
Sie legt sich wie ein Schatten über mich - kein irdischer Schatten, sondern etwas Monströses, ein Schatten aus einer anderen Welt, verfärbt, bleiern, breiig zerfließend. Ich stehe in Gedanken wieder auf der obersten Terrasse einer zerfallenden Bastion und sehe unter mir, von Horizont zu Horizont ausgebreitet, im kranken Licht ihres Sonnensterns die Stadt liegen... eine endlos steinerne Wüste, in ein schillerndes Halblicht getaucht, in dem die Türme und Brücken und Paläste lange, unheilvolle Schatten werfen. Diese Stadt hat keine Sonne und keinen Mond. Ein einziges Gestirn brennt über ihr, ein riesig aufgeblähter kalter Stern. Sein Licht zeichnet scharf alle harten Formen nach, aber es erhellt nichts. Hinter den Fensterlöchern der Ruinen steht die ebenholzschwarze Finsternis wie aus Blöcken gehauen.
Ich war oft in dieser Stadt. Ich ging in ihren Straßen herum und lernte ihre Bewohner kennen... soweit man sie erkennen konnte. Sie sprachen nie mit mir - sie sprechen auch nicht miteinander. Sie bückten mir nie ins Gesicht. Sie schlichen in dem perversen Licht und den harten Schatten herum, erschreckend verdrehte und verkrüppelte Gestalten, die jede für sich an den Mauern entlangschlurften und ihre Gesichter verhüllten, als wollten sie weder sehen noch gesehen werden.
Sie verstehen jetzt wohl, warum ich solche Räume ungern betrete. Ich fürchte, an ihrem anderen Ende den Eingang zu dieser Totenstadt vorzufinden ...
Sie beobachten mich, Herr Untersuchungsrichter. In dem hässlichen, schattenlosen Neonlicht, das den Raum erfüllt, können Sie jeden Zug in meinem Gesicht sehen, jedes Zucken eines Muskels, jeden verräterischen Hauch Feuchtigkeit, sei es Schweiß oder Tränen. Aber Sie sehen nicht, was Sie erwarten und hoffen. Kein Zeichen, das Ihnen Aufschluss über meinen Geisteszustand gäbe. Bin ich verrückt? Bin ich vernünftig? Sie suchen verzweifelt, eine Antwort auf diese Frage zu finden.
Ich zeige weder Furcht noch Trauer noch nachträgliches Entsetzen über den Tod, den ich herbeigeführt habe. Ich trete ganz gleichgültig an die Leiche heran, warte, bis man das Laken über die Schultern zurückgeschlagen hat, blicke ihr in aller Ruhe ins Gesicht und mache meine Aussage.
Nein, ich werde keines von diesen Papieren unterschreiben, die Sie mir da vorlegen wollen. Ich leugne nichts von alledem, was ich geplant und getan habe. Aber Sie wollen es ein Schuldbekenntnis nennen, ein Mordgeständnis ... und dagegen verwahre ich mich. Ich habe keine Schuld auf mich geladen, und es war kein Mord, was ich getan habe ... ganz sicher kein Mord.
Denn Mord ist etwas, das Menschen betrifft. Sie sind ein Mensch und ich bin es ebenso. Der Wachtmeister neben Ihnen ist ein Mensch, auch der Mann da hinten in der weißen Gummischürze ist einer, und das Fräulein Sekretärin, das so aufmerksam mitstenografiert, was ich sage, und mich so ängstlich von der Seite betrachtet, weil ich eine Mörderin und möglicherweise gemeingefährlich bin. Sie alle sind vielleicht - verzeihen Sie mir den geschmacklosen Scherz - keine besonders hochklassigen Menschen, aber immerhin Menschen. Geschöpfe Gottes. Ich habe mich mehr als einmal gefragt, wessen Geschöpf Dr. Wehle war. Wer (oder was) erschafft die Wesen dieser Sphäre, aus der sie kam?
Wie immer: Tötete ich einen von Ihnen vieren, es wäre Mord. Aber sie ... Ist es denn Mord, eine Sumpfblase zum Platzen zu bringen? Einen Funken verlöschen zu lassen? Tatenlos zuzusehen, wie eine Regenpfütze verdampft? Und zudem: Ich habe in Notwehr gehandelt, denn noch ein wenig länger, und sie hätte aus mir etwas ihresgleichen gemacht, ein Wesen, das die Tränen der anderen trinkt, von ihren Gefühlen mitzehrt, durch ihre Träume kriecht und ihre Gedanken durchlöchert ... einen gierigen Parasiten, der seinen Stechrüssel in Seelen senkt und ihr Blut trinkt ...
Sehen Sie sie selbst an. Sagen Sie dem Mann da, er soll das Laken noch einmal von ihrem Gesicht heben, und betrachten Sie sie mit unvoreingenommenen Augen. Ich weiß schon, der Tod tut das Seine dazu, ein Gesicht zu einem Schrecknis zu machen, und ist es nicht auch in den Vampirfilmen so, dass sie zuletzt - wenn das Verderben nach ihnen greift - schrumpfen und bröckeln und zu Asche zerfallen? Aber sie war schon so, als ich sie das erste Mal sah: Sie war ein Un-Wesen...
Ich meine damit: Sie war eines von den Geschöpfen, deren Existenz sich nur in Negativa ausdrücken lässt. Sie war unansehnlich. Sie war unbedeutend. Sie war unfrisiert. Sie war in Kleider gehüllt, die weder Stil noch Schnitt noch Farben hatten. Sie war - das war mein allererster Eindruck von ihr - eine blasse Person mit schlechten Dauerwellen und schlechten Zähnen, in klassisch grauen Strick gekleidet und so papieren spröde wie ein Wespennest.
Seltsam, es so zu sagen, aber mein zweiter Eindruck, der innerhalb eines Atemzuges auf den ersten folgte, war der: Ich spürte, dass sie eine erschreckend gierige Frau war. Und es war etwas Perverses an dieser Gier - eine kalte, schmierige, leichenschänderische Begierde, ein Hunger, der nach Erbrochenem gierte, ein saugendes Schmiegen und Sich-Anpassen, als sei sie inwendig ein Ding, das nur zum Schlucken und Verdauen geschaffen war, ein einziger grauer, saugnapfgesäumter, muskulöser Schlund...
Warum ich sie aufgesucht habe? Nun, aus dem Grund, aus dem man eben eine psychotherapeutische Praxis aufsucht. Ich hatte Probleme. Ich war missmutig und gereizt und rundum unzufrieden, und ich meinte, jemand wie sie könnte mir vielleicht helfen, diese Probleme zu sortieren - mir sagen, worin sie wurzelten, und ihnen den einen oder anderen besonders dornigen Zweig abschneiden. Als ich in ihre Praxis ging, wollte ich mich einfach einmal gründlich ausweinen und dann mit ein paar guten Tipps wieder nach Hause gehen. Ich hatte keine Ahnung, dass sich in dem Augenblick, als ich ihr gegenübertrat, etwas an mir festsaugen und mich nie wieder loslassen würde...
Da war ein Zwischenfall, der mich hätte warnen sollen. Ich achtete damals noch nicht darauf, ich war in Gedanken ganz bei den Problemen, die ich Dr. Wehle vorlegen wollte, aber später fiel es mir wieder ein. Nämlich: Die Tür zum Sprechzimmer öffnete sich, und eine dicke Frau kam heraus. Eine ganz gewöhnliche dicke Frau, mit falschem Blond im Haar und hängenden Mundwinkeln. Ich kann Ihnen kaum beschreiben, worin der beklemmende Eindruck bestand, den sie auf mich machte. Sie sah gespenstisch aus, und doch war sie viel eher das genaue Gegenteil eines Gespensts. Ich meine: Ein Gespenst ist eine Seele ohne Körper. Sie war ein Körper ohne Seele. Ein bleicher, glotzender, unkontrolliert schwabbelnder Körper, der sich vorwärtswälzte, als wollte er im nächsten Augenblick in sich zusammenfallen und vergehen. Sie sah mich nicht an. Sie sprach nicht mit mir. Sie wackelte davon, diesen starren, entsetzten Blick in den Augen, als hätte sie ihre Seele verloren und im allerletzten Augenblick noch begriffen, was ihr geschah.
Nun, genau das war ihr geschehen: Sie hatte ihre Seele verloren.
Aber ich greife vor.
Damals... da fand ich es nur ein bisschen komisch, dass Dr. Wehle mich so überschwänglich begrüßte, dass sie gleich nach dem „Guten Tag" die Arme um mich schlang und mich mit einem so schwimmend feuchten Blick ansah wie die Heldin in einem Liebesfilm und ausrief: „ Meine Liebe! Es wird Ihnen so gut tun, zu mir zu kommen!" Woher hätte ich wissen sollen, dass dieser Augenblick die letzte Chance gewesen wäre, mich von ihr loszureißen und zu fliehen?
Sie verzeihen mein Lachen, aber es klingt so bizarr, im Zusammenhang mit einem Wesen, wie Dr. Wehle eines war, von Mord zu sprechen ... als hätte sie ein Leben gehabt, das man ihr nehmen konnte. Sie hatte keines. Was sie für unsere Augen darstellte, war nur eine Maske, denn Wesen wie sie können in unserer Welt nur in Masken existieren. Sie hatte den Körper einer alten Frau und den äußeren Habitus einer Psychotherapeutin übergezogen, wie Sie oder ich einen Wintermantel anziehen. Aber darunter war es leer wie im Inneren eines Luftballons. Sie selbst hatte kein Leben. Sie hatte nicht einmal eine Existenz. Sie war ein Nein, ein Nihil, eine Negation. Selbst das Leben, das sie anderen aus der Brust sog, verwandelte sich in Tod, sobald es in sie überging.
Das Leben, sage ich, denn Sie müssen eines bedenken: Ich hatte Probleme, aber ich hatte auch Träume, wüste, feuerfunkelnde Breitwand-Technicolor-Träume, ich hatte Phantasien, so groß und bunt und leuchtend wie Neonreklamen und so voll kompliziertester Ornamente und Bilder wie die Graffiti an einer Feuermauer. Sie selbst hatte nichts, und daher wollte sie alles wissen, alles haben, alles aus mir heraussaugen.
„Wollen Sie es denn weiter verdrängen? Wagen Sie nicht, sich damit auseinander zu setzen? Haben Sie so Schlimmes zu verbergen? Ich muss alles von Ihnen wissen, um Ihnen helfen zu können. .." So redete sie mit mir, und zumindest am Anfang glaubte ich ihr und gab her, was sie haben wollte, und sah ohne Widerspruch zu, wie sie es fraß und verdaute und in das schwarze Loch ihres Hungers hinabschlang.
Warum ich mich nicht wehrte, fragen Sie, wenn es mir so zuwider war? Warum ich nicht einfach die nächste Sitzung absagte und ihr fern blieb?
Kennen Sie denn die alten Geschichten nicht, Herr Untersuchungsrichter? Ich lernte die süße Ermattung kennen, die der Kuss des Vampirs mit sich bringt: die Lähmung, die von den Zehen und Fingerspitzen bis zum Herzen kriecht, die immer tiefer sinkenden Schatten, die welkenden Träume und verblassenden Erinnerungen. Das Herz meiner Seele schlug noch, aber es schlug für einen ausgebluteten Leib.
Aber schlimmer als diese Schwäche war etwas anderes. Ich fühlte - wie alle Opfer eines Vampirs - , dass es Vergnügen bereitet, fast möchte ich sagen, Lust bereitet, ausgeblutet zu werden, in den Armen des mörderischen Saugers zu ruhen, in träge dösender Passivität zu versinken. Süßer, weicher Schlick umgab mich, warm wie ein tropisches Meer. Ich wusste, dass ich nur loszulassen brauchte, um für ewig darin zu versinken - eine ausgesogene Haut, eine Larve, durchsichtig dünn und elastisch weich ... und immerzu hungrig:
Denn werden die, die ein Vampir tötet, nicht ebenfalls zu Vampiren?
Sie wusste, wie verfallen ich ihr war. Sie schmeichelte nicht mehr, sie forderte. „Erzählen Sie mir alles. Verschweigen Sie mir nichts. Sie müssen völlig von mir abhängig sein, bevor ich Ihnen helfen kann..." Sie gab sich nicht einmal mehr die Mühe, es vor mir zu verbergen: Sie ließ alle Tarnung fallen und verwandelte sich vor meinen Augen...
Sie wenden ein, Sie sähen nichts weiter als eine tote alte Frau auf einem Nirosta-Karren. Zweifellos. Ich sehe dasselbe. Aber wie wir beide zurzeit Dr. Wehles Lunge und Leber nicht sehen können (und Sie werden doch zugeben, dass sie diese Organe in ihrem Inneren hat), so sehen Sie auch den Schlund in ihrem Inneren nicht. Die Maske verdeckt ihn, diese wehmütig-lächelnde, mitfühlend-seufzende, saccharinsüße Maske, die jetzt, vom Tode abgestreift, schlaff und faltig auf ihrem Gesicht liegt. Aber sobald man die Leichenöffnung vorgenommen hat, werden Sie an den Autopsie-Tisch herantreten und mit eigenen Augen ihre Lunge und Leber sehen. Und sobald Sie meinen Bericht zu Ende gehört haben, werden Sie auch sehen, was sie ihrem eigentlichen Wesen nach war.
Sie war, in einer Weise, ein Vampir. Sie lebte von anderen - zuletzt von mir: der Nahrungsbrei, den sie in sich hinabschlang, war meine Seele. Sie saugte mir das Mark aus den Knochen und buk einen süßen Kuchen daraus, den sie mir stückchenweise fütterte. Einen Kuchen, von dem mir übel wurde. Sie forderte mir alles ab, und was ich ihr gab, nahm sie und kaute es und speichelte es ein und verwandelte es in einen lauwarmen schleimigen Brei, den ihr Saugmaul aufschlürfte. Sie stach ihren Rüssel in mein Herz und zog heraus, was in mir lebendig war, denn davon leben sie und ihresgleichen...
Es brauchte einige Begegnungen, bis ich dieses wirkliche Wesen erkannte. Anfangs war sie freundlich - heute möchte ich sagen: Sie sonderte Freundlichkeit ab, wie Fleisch fressende Pflanzen ihre Kelche mit Zuckerschleim füllen - und ich war einsam und erfroren und in meiner Schwäche bereit, mich an einem Höllenfeuer zu wärmen. Aber Höllenfeuer haben es in sich, dass sie nicht lange wärmen, und Zuckerwasser, dass es nicht lange nährt. Ich begann an kleinen verräterischen Zeichen ihre Wirklichkeit zu entdecken: Die unersättliche Gier, den hungrigen Zorn, wenn ich ihr etwas vorenthielt, wenn sie ihr Saugmaul nach mir ausstülpte und nicht gesättigt wurde. Sie brauchte unablässig Nahrung. Ihre ganze Existenz erschöpfte sich darin, einen ununterbrochenen Verdauungsakt zu vollziehen. Sie war ein lebendiger Schluckapparat, ein Fressmechanismus, ein Ding, das nichts anderes tat (und tun konnte), als Nahrung in seinen flexiblen, wie einen Hooverschlauch gerillten Rachen zu saugen und als Schlacke wieder auszustoßen. Diese Wesen sind wie die primitiven Lebewesen unserer eigenen Welt, die hirnlos und nervenlos durch die Dunkelheit der Tiefsee treiben, Nahrungsbrei durch sich hindurchschleusend - die kaum Substanz genug sind, um sich von ihrer Nahrung zu unterscheiden.. .
Danke, ich brauche keine Beruhigungspille. Ich bin vollkommen ruhig. Sie meinen, ich sei in Gefahr, aber ich bin der Gefahr entronnen. Ich habe mich davor bewahrt, für immer in dieser Stadt der toten Seelen bleiben zu müssen, wo es keine Kraft mehr zum Handeln gibt, nur den Kerker der Selbstreflexion, das Immer-tiefer-Hinabsteigen in die Klüfte der Seele... nicht in phantastische Regenwälder des Unbewussten, sondern in versteinerte Labyrinthe, so tot und verseucht wie ein Versuchsgelände für chemische Waffen. In die Stadt, in der es keine Gebete gibt, keine Gedichte, keine Phantasien, keine Pläne, nur einen ständig sich ausbreitenden Fäkalienschlamm von „verarbeiteten" Erinnerungen, ein obszönes Belecken und Befühlen von Intimitäten, ein ewiges Scharren an Gräbern...
Ich habe das Ding getötet, das mich dorthin schleppen wollte, wie es andere vor mir hingeschleppt hat. Viele andere, denn es war schlau und heimtückisch, und die Welt war und ist voll von armen Narren.
Ich tötete es, nicht „ermordete es". Wie soll man bei einer solchen Kreatur von Mord reden? Und es ist doch auch gar nicht möglich, einen Menschen mit einem so kleinen Messer zu töten - einem so kleinen Messer aus reinem Silber!
***
Anmerkung
Dem Aberglauben zufolge können dämonische Wesen wie Werwölfe oder Vampire durch jede noch so winzige Verletzung getötet werden, wenn die Waffe aus reinem Silber besteht.
Happy Birthday, Casanova!
Langsam, ganz langsam zog Pia die Injektionsnadel aus dem Korken der Sektflasche. Der Inhalt wirkte völlig unverändert, als sie die Flasche ans Licht hob und prüfend betrachtete - nicht die Spur einer verdächtigen Trübung oder Verfärbung. Das Zeug sah aus wie Sekt, roch wie Sekt und schmeckte wie Sekt. Was es tatsächlich war, würde Bernhard erst bemerken, wenn ihn urplötzlich die Lähmung befiel, die (laut Gebrauchsanweisung) kurz vor Eintritt des Todes erfolgte.
Es war, musste Pia zugeben, keine sehr neue und originelle Methode, jemanden vom Leben zum Tode zu befördern. Inspektor Columbo hätte den Fall im Handumdrehen gelöst. Aber erstens war es Bernhard nicht wert, dass man sich seinetwegen einer neuen und originellen Mordmethode bediente, und zweitens übernahm kein Columbo den Fall, sondern irgendein überarbeiteter Notarzt, der etwas von Managerkrankheit und lustigem Leben vor sich hin brummeln würde. So, wie Bernhard jetzt aussah, war ein Herzschlag jedenfalls eine bei weitem naheliegendere Diagnose als ein Giftmord. Er war in letzter Zeit ziemlich fett geworden, und seine Wangen hatten einen ungesund violetten Stich.
Pia seufzte lautlos, während sie den Sekt in Geschenkpapier wickelte. Es hatte eine Zeit gegeben - und sie lag noch gar nicht so lange zurück - da war Bernhard ein Traummann gewesen. Ein richtiger Traummann mit sonngebräunter Haut, blitzenden Zähnen, die er beständig in knabenhaftem Lächeln entblößte, einer widerspenstigen braunen Haartolle über der Stirn und lustigen braunen Augen, ein fröhlicher großer Junge, der wie Peter Pan durchs Leben tollte. Eigentlich, dachte Pia jetzt, hätte es ihr damals schon zu denken geben sollen, dass ein angeblich so unglücklich verheirateter Mann so blendend aussehen konnte. Nur zu bald hatte sie nämlich herausgefunden, wie man aussieht, wenn man tatsächlich unglücklich ist: Sie hatte nur in den Spiegel blicken müssen, um zu sehen, welche harten Linien der Kummer um die Mundwinkel meißelt, wie geschwollen die Tränensäcke nach einer durchweinten Nacht sind und wie stumpf und tot die Haut der Verlassenen wird.
Sie hatte es herausgefunden, nachdem Bernhard sie gegen Stella ausgetauscht hatte, wie er zuerst Alice gegen Pia ausgetauscht hatte. Wen er gegen Alice ausgetauscht hatte, hatte sie nie erfahren, aber sicher war da irgendjemand gewesen ... irgendeine, die geweint hatte, bevor Alice weinte, bevor Pia weinte. Es war nur eine Frage der Zeit, bis auch Stella weinte.
Pia spürte, wie ihre Finger sich in das steife Geschenkpapier gruben. Das Papier war schwarz, mit silbernen Dreiecken darauf. Es raschelte wie das Laub von Friedhofsbäumen.
Stella musste einfach weinen. Tränen waren ihr Schicksal, wie sie das Schicksal jeder Frau waren, die an Bernhard anstreifte, von seiner Mutter angefangen, die Tränen des Schmerzes vergossen hatte, als er sich grob und unverschämt, Ellbogentechniken anwendend, aus ihrem Schoß gezwängt hatte. Stella würde weinen: Entweder, weil Bernhard auch ihr eine Neue vor die Nase setzte, oder - noch besser - bei seiner Beerdigung. Stella in ein schwarzes Spitzentüchlein schluchzend, Bernhard in einem schwarzen Sarg, auf weißem Damast, von Kränzen und Kerzen umrahmt. Der jugendliche Held stirbt, in der Hauptrolle: Bernhard Pamatzke.
Pia kicherte wie ein Schulmädchen.
Dann nahm sie sich zusammen, glitt mühelos in die Rolle der gereiften Vierzigjährigen, der Akademikerin, der Frau Doktor, nicht mehr die Jüngste, aber immer noch gut aussehend, sehr gepflegt, eine Frau von Format, immer noch eine Sünde wert, dabei gescheit wie ein Mann, zwei, drei wissenschaftliche Bücher mit ihrem Namen stehen in düster aussehenden Buchhandlungen im Universitätsviertel, eine feine Frau, eine dumme Gans, lässt sich abservieren wie ein Stubenmädchen im Grand Hotel, dem man nach einer heißen Nacht Abschied nehmend die Bäckchen kneift, das eine im Gesicht, das andere unterm glänzendschwarzen Rock. Leb wohl, mein Schatz, leb wohl.
Sie winkte ein Taxi herbei, gab die Adresse von Bernhards Wohnung an. Mit geschlossenen Augen saß sie im Fond, in Gedanken versunken. Nicht, dass sie ihre Entscheidung noch einmal überdacht hätte. Da gab es nichts mehr zu bedenken. Bernhard war in dem Augenblick ein toter Mann gewesen, in dem er sie und Stella gemeinsam zu seiner Geburtstagsfeier eingeladen hatte.
"Und Alice? Hast du die etwa auch eingeladen?" hatte sie gefragt, mit einem Gefühl in der Brust, als bohrte sich ein langer spitzer Eiszapfen von hinten durch Rippen und Herz.
"Wieso Alice?" hatte er überrascht gefragt.
Natürlich wäre er niemals auf den Gedanken gekommen, Alice einzuladen. Sie war, was Bernhards Gefühle anging, tot und begraben, was von ihr geblieben war, waren die paar teuren Geschenke, die sie ihm gemacht und die er nach der Trennung nicht wieder zurückgegeben hatte, und ein paar Anekdötchen, die er erzählte, wenn er in witziger Stimmung war und seine jeweils Neueste damit unterhielt, dass er die Neuen vor ihr zum Clown stempelte. Alice war ja zuweilen so köstlich naiv gewesen, so unbedarft! Und wie hatte er sich damals in Nizza amüsiert, als sie sich diesen Badeanzug gekauft hatte, der ihren schon etwas schlaffen Hintern unbarmherzig zu Wülsten zurechtpresste! Praktisch jeder auf der Strandpromenade hatte gelacht, als sie vorbeiging wie ein in grünen Satin gefasster Pudding, Alice, die nicht mehr ganz Junge, der Wabbelpopo, ein peinlicher Anblick an der Seite des jugendlichen Bernhard. Und damals in Berlin! Und in Hamburg! „Mädel, hab ich dir schon erzählt, wie sie damals …“ Bernhards Neue krümmten sich vor Lachen.
Pia war überzeugt, dass zu den Alice-Anekdoten inzwischen ein ganzes Sortiment von Pia-Anekdoten gekommen war.
Bernhard hatte herzlich gelacht, dieses tiefkehlige, männliche Lachen, das ihr jedes Mal dreißig Lebensjahre samt der dazugehörigen Würde und Erfahrung raubte und sie in ein linkisches Schulmädchen verwandelte, das beleidigt schniefend von einem Fuß auf den anderen trampelt, weil seine Erzfeindin zur selben Schulschluss-Party eingeladen wird. "Nun sag bloß, du bist altmodisch, Pia-mein-Schatz."
"Hast du sonst noch jemand eingeladen?"
"Nur du und Stella", hatte er mürrisch geantwortet.
"Ich kann es nicht erwarten, einen Abend mit Stella zu verbringen."
Er klang ungeduldig, als redete er mit einem albernen Kind. "Was hast du eigentlich gegen Stella? Hat sie dir irgendwas getan?"
Pia war prompt in die Falle gegangen. "Sie hat mir dich weggenommen", stieß sie mit vor Wut rauer Stimme hervor. Der letzte Abend ihrer Beziehung fiel ihr ein, wie immer, wenn Stellas Name genannt wurde, dieser feuchtkalte, sternlose, nach Lungenentzündung riechende Abend, an dem ein schmierig-verständnisinnig blinzelnder Taxifahrer sie heimgefahren hatte, während Bernhard und Stella noch händchenhaltend in der Boudoir-Beleuchtung der Bar saßen. Sie hatten ihr nachgeblickt, hatten gesehen, wie Pia, hölzern vor Wut und Jammer, auf ihren hohen Stöckelschuhen davongestolpert war wie eine Vogelscheuche ... Stella mit einem kleinen milden Siegeslächeln, Bernhard mit dem gelangweilten Blick dessen, der zu viele Siege gefeiert hat, um sie noch zu belächeln. Hänsel und Gretel verjagen die Hexe, in der Hauptrolle: Bernhard Pamatzke.