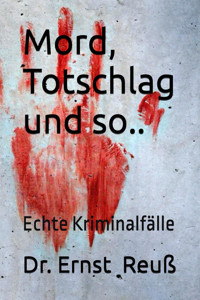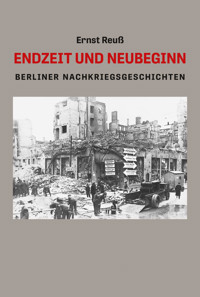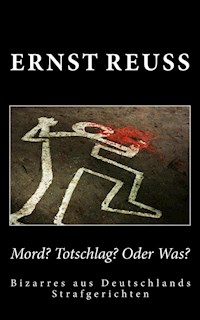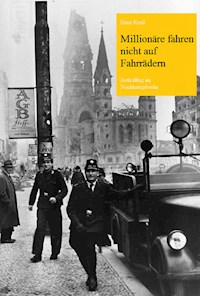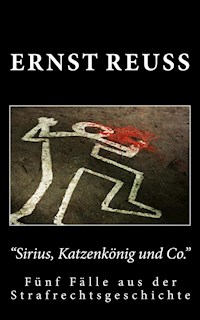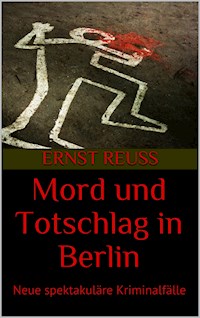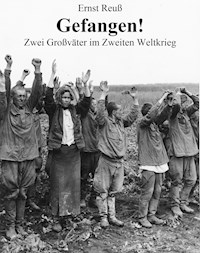
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Beide Großväter des Autors waren in der Sowjetunion. Einer in der Kommandantur eines Kriegsgefangenenlagers für sowjetische Kriegsgefangene in der Ukraine, der andere als Kriegsgefangener in genau demselben Lager, nach Ende des Krieges. Auf der Suche nach Verantwortung wird Reuß, ein Jurist aus Berlin, mit dem Problem von deutschen und sowjetischen Soldaten konfrontiert, die in die Hände des Feindes gerieten. Er recherchiert. Aus persönlicher Betroffenheit wird schließlich eine Dokumentation, wie es sie bis dato nicht gab. An die sechs Millionen Rotarmisten gingen in deutsche Kriegsgefangenschaft mehr als die Hälfte kam hier um.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Vorbemerkungen
Ein normaler Soldat
Ein anderer normaler Soldat
Kriegsverbrecher und ihre Bestrafung
Nachbetrachtung
Anhang
Ernst Reuß
Gefangen!
Zwei Großväter im Zweiten Weltkrieg
Impressum
Texte © Copyright by erma Verlag, Neue Straße 14, 97493 Bergrheinfeld, [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN-13: 978-3739393230
Vorbemerkungen
Zum Thema
„Das Schicksal der sowjetischen Kriegsgefangenen in deutscher Hand ist eines der dunkelsten Kapitel der Geschichte des Zweiten Weltkrieges1.“Nach dem Zusammenbruch des „Dritten Reichs“ bestand in Deutschland wenig Interesse am Schicksal sowjetischer Kriegsgefangener. Anteilnahme erregten lediglich die enormen deutschen Verluste in der Sowjetunion und das Schicksal deutscher Soldaten in sowjetischen Kriegsgefangenenlagern. Die Bewusstwerdung des Holocaust führte in erheblichem Maße zur Verdrängung der Verbrechen an Bürgern der Sowjetunion. Die eigenen Verbrechen dort, soweit überhaupt zur Kenntnis genommen, wurden mit Verbrechen der Alliierten aufgewogen.
Dies gipfelte darin, dass in Westdeutschland Mahnmale, die von den Sowjets oder von Überlebenden der Kriegsgefangenenlager errichtet worden waren, beseitigt oder entschärft wurden2. Schon harmlose Inschriften, die das Leid der Gefangenen darstellen sollten, waren offenbar dem Wirtschaftswunderdeutschen nicht mehr zuzumuten.
Waren gar Sowjetstern oder Hammer und Sichel auf den Denkmälern zu sehen, wurde dies in der noch jungen BRD häufig entschärft.
Waren auf den Gedenksteinen bei den sowjetischen Massengräbern Zahlen der Opfer genannt, wurde penibel nachgerechnet und notfalls eine Tafel mit einer Gegenrechnung daneben gestellt.
Obwohl bis zu 3,3 Millionen von 5,7 Millionen Gefangenen in den Lagern umgekommen sind und die sowjetischen Kriegsgefangenen somit neben den Juden diejenige Opfergruppe waren, die das schlimmste Schicksal im Zweiten Weltkrieg erleiden musste, wurde nichts Genaueres über die sowjetischen Kriegsgefangenen ermittelt.
„Systematische Massenmorde an Kriegsgefangenen sind nicht allein vom nationalsozialistischen Deutschland begangen worden. Vielmehr hat es sie in der Geschichte seit der Antike immer wieder gegeben. Dennoch ragt auch hier wieder der deutsche Fall heraus, wegen der enormen Dimensionen, die noch einmal durch das kalkulierte Hungersterben in den Schatten gestellt wurden.“3Wenngleich es sich bei den deutschen Lagern im Osten zumindest anfangs um reine Vernichtungslager für „slawische Untermenschen“ handelte, interessierten sich weder Sowjets noch Amerikaner für eine umfassende Aufklärung.
Die Amerikaner hatten zu Beginn des Kalten Krieges kein sonderliches Interesse, das Leiden der sowjetischen Kriegsgefangenen ausführlich zu dokumentieren. Außerdem wurden mitverant-wortliche Wehrmachtsgeneräle für den Neuaufbau einer westdeutschen Armee, als Bollwerk gegen den Kommunismus, dringend gebraucht.
Den Sowjets andererseits war daran gelegen, den weitgehenden Zusammenbruch ihrer Armee im Sommer 1941, bei dem über 5 Millionen sowjetische Soldaten gefangen genommen wurden, zu verschleiern.
Außerdem galt ein Kriegsgefangener nach stalinistischer Doktrin als Verräter, und sich gefangen nehmen zu lassen, wurde als Straftat bewertet. Propagandastellen hatten dazu aufgerufen, sich stattdessen das Leben zu nehmen. Alle sowjetischen Kriegsgefangenen standen unter einem generellen Kollaborationsverdacht, wurden nach Ende des Krieges in „Filtrationslagern“ verhört und in vielen Fällen erneut zu langjähriger Lagerhaft verurteilt.
Aus diesen Gründen unterblieb lange Jahre auch jede Beschäftigung deutscher Historiker mit diesem brisanten Thema. Die Vergangenheitsbewältigung in Büchern und anderen Massenmedien während des Kalten Krieges bestärkte vielmehr die Überzeugung, dass im Krieg gegen die Sowjetunion lediglich einige Exzesse der SS zu bedauern wären.
Immer wieder wurde versucht, Kriegsverbrechen von sowjetischen Soldaten und die vielen Untaten des Diktators Stalin mit den deutschen Verbrechen in der Sowjetunion und den Untaten des Diktators Hitler aufzurechnen.
Mit diesem Buch sollen das „Unternehmen Barbarossa“, also der Feldzug der deutschen Wehrmacht gegen die Sowjetunion, und die damit verbundenen Folgen, insbesondere die Kriegsgefangenschaft, aus der Sicht zweier einfacher Soldaten dargestellt werden. Als zentraler Punkt wird die Behandlung und das unterschiedliche Schicksal von sowjetischen und deutschen Gefangenen thematisiert, was bisher – zumindest betrifft dies die kriegsgefangenen sowjetischen Soldaten – nur sehr unzureichend und im Hinblick auf die kriegsgefangenen deutschen Soldaten oftmals lediglich verzerrt geschah.
Durch die Tatsache, dass beide Protagonisten des Buches in grundsätzlich unterschiedlichen Positionen im selben Kriegsgefangenenlager in Winniza in der Ukraine waren – der eine in der Kommandantur unter deutscher Herrschaft, der andere als Gefangener unter sowjetischer Herrschaft – kann die ungleiche Behandlung von Kriegsgefangenen im Zweiten Weltkrieg exemplarisch dargestellt werden.
Möglicherweise ist der unterschiedliche militärische Werdegang dieser beiden Soldaten auch typisch für jene Zeit. Auf jeden Fall werden aber zwei deutsche Militärangehörige an der Ostfront gezeigt, die gegenüber dem Nationalsozialismus gegensätzliche Haltungen einnehmen. Aus den noch vorhandenen persönlichen Zeugnissen jener Zeit, insbesondere Fotos und Feldpostbriefen, soll ein Bild der Geschichte gezeichnet werden, welches das Schicksal einfacher Menschen im Zweiten Weltkrieg begreifbarer macht.
Quellenlage
Auf Weisung des Oberkommandos der Wehrmacht wurde nach Kriegsbeginn bei allen Wehrkreisen je ein „Kommandeur der Kriegsgefangenen“ für die einzurichtenden Kriegsgefangenenlager bestellt. Die Abteilung Kriegsgefangenenwesen, die für die Angelegenheiten der Kriegsgefangenen zuständig war, führte ab 1942 die Bezeichnung „Chef des Kriegsgefangenenwesens“. Auf Weisung Hitlers wurde Ende Juni 1943 zudem ein „Generalinspekteur für das Kriegsgefangenenwesen der Wehrmacht“ eingesetzt. Zuletzt wurde Heinrich Himmler, der Reichsführer SS, angewiesen, Aufsicht und Kontrolle über das Kriegsgefangenenwesen auszuüben. Zu diesem Zeitpunkt waren aber bereits fast alle außerhalb des Deutschen Reichs befindlichen Kriegsgefangenenlager geräumt.
Die Kommandeure der Kriegsgefangenen mussten Kriegstagebücher führen, die dann in das Heeresarchiv nach Potsdam gelangten. Vermutlich wurden diese Bestände jedoch in der Nacht zum 15. April 1945 bei einem schweren britischen Luftangriff vernichtet oder zusammen mit anderen Kriegstagebüchern und Akten von den deutschen Stellen verbrannt.
Man hatte ja schließlich einiges vor den anrückenden Alliierten zu verbergen. Die Registraturen der Kriegsgefangeneneinrichtungen selbst mussten keine Unterlagen an das Heeresarchiv abgeben. Wahrscheinlich wurden beim Rückzug oder zum Kriegsende all diese Unterlagen vernichtet.
Dadurch gibt es große, nicht mehr zu schließende Lücken, so dass die Aufarbeitung des Schicksals der Gefangenen sich heute zum Teil schwierig gestaltet und umfassende Aussagen zu den meisten Lagern überhaupt nicht mehr möglich sind.
Das Bundesarchiv in Freiburg verwahrt lediglich Akten von wenigen, im Reichsgebiet befindlichen Kriegsgefangenenlagern. Einige Angaben zu den Kriegsgefangenenlagern im Osten lassen sich auch auf Wehrkreisebene bei den Kommandeuren der Kriegsgefangenen oder bei den Beständen mit Bezug auf die rückwärtigen Armeegebiete finden. Allerdings sind auch diese Überlieferungen mehr als lückenhaft, geben aber teilweise anschauliche Einblicke in die katastrophalen Zustände einzelner Lager. Material zum Thema Kriegsgefangenenwesen ist neben den regionalen Archiven auch in ministeriellen Beständen sowie in den erhalten gebliebenen Unterlagen der zentralen Ämter der SS zu finden, die vom Bundesarchiv in Berlin verwahrt werden. Auch die Zentralstelle für die strafrechtliche Aufarbeitung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg verfügt über Schriftgut im Umfang von etwa einem Kilometer, darunter einzelne Unterlagen zu Kriegsgefangeneneinrichtungen.
Zum Teil befinden sich von den Alliierten erbeutete Akten auch noch in deren Archiven, beispielsweise im Staatsarchiv Moskau und im Militärarchiv in Prag. Personenbezogene Unterlagen über das Kriegsgefangenenwesen wurden grundsätzlich in der Wehrmachtsauskunftsstelle in Berlin verwahrt, aber zu Kriegsende in der Drachenbergkaserne in Meiningen ausgelagert. Dort wurden die Unterlagen nach dem Krieg von den Amerikanern beschlagnahmt und nach dem Wechsel der Besatzungsmacht in Thüringen mit unbekanntem Ziel in die UdSSR gebracht. Das sehr umfangreiche Schriftgut soll beim Abtransport in 377 Kisten verpackt worden sein. Im Zentralen Archiv des Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation in Podolsk bei Moskau wurde dieser Aktenbestand der Wehrmachtsauskunftsstelle gefunden. Aber auch diese Unterlagen tragen wenig zur Aufarbeitung des Kriegsgefangenenwesens im Zweiten Weltkrieg bei, da es sich dabei nur um Personalakten handelt.
Literatur zum Thema „Kriegsgefangene“ gibt es reichlich. Allerdings beschränkt sich diese zumeist auf das Schicksal der deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion oder auf das Schicksal der zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppten Kriegsgefangenen. Andere Bücher streifen bei der Beschreibung des Zweiten Weltkrieges oder bei einzelnen Aspekten des Krieges die Kriegsgefangenen lediglich am Rande.
Die wenigen vorhandenen deutschen Publikationen über Kriegsgefangenenlager sind eher dem heimatkundlichen Bereich zuzuordnen. Daher verwundert es nicht, dass es auch keine fundierte Untersuchung über die Lager auf den Gebieten des Generalgouvernements und der Reichskommissariate Ostland und Ukraine gibt.
Bücher auf Deutsch, die sich wirklich intensiv mit den Verbrechen an den sowjetischen Kriegsgefangenen auseinandersetzen, gibt es nur drei:
Müller, Nikischin, Wagenlehner (Hrsg.), Die Tragödie der Gefangenschaft in Deutschland und in der Sowjetunion 1941–1956, von 1998; Alfred Streim, Die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangenenlager im „Fall Barbarossa“, aus dem Jahre 1981 und Christian Streit, Keine Kameraden, von 1978.
Es handelt sich dabei um wissenschaftliche Untersuchungen, die sich lediglich abstrakt mit dem Verbrechen beschäftigten, ohne direkt auf das Schicksal einzelner Menschen einzugehen, also keine Sicht „von unten“ bieten.
Warum dieses Buch?
Es war im Oktober 1999, als ich eine Ausstellung zum Holocaust sah und ein Foto mich sehr berührte: das Foto einer Erschießung im Zweiten Weltkrieg. Ein am Rand einer Grube mit Leichen kniender einzelner Zivilist, der direkt in die Kamera des Fotografen blickt, während ein deutscher Soldat von hinten die Pistole auf seinen Kopf richtet. Der Fotograf hatte offensichtlich kurz vor der Liquidierung auf den Auslöser gedrückt. Als Bildunterschrift war auch der Ort angegeben, an dem die Erschießung stattgefunden hatte. Es war Winniza4 in der Ukraine. „Der letzte Jude von Winniza“ soll auf dem Originalfoto gestanden haben, das nach sowjetischen Angaben bei einem gefallenen deutschen Soldaten gefunden wurde. Ob es tatsächlich so war, lässt sich wohl nie wieder verifizieren. Sicher ist aber, dass sich solche Szenen hunderttausendfach im Rücken der Ostfront abspielten5.
Das Foto der Erschießung in Winniza
Winniza?
Winniza hatte ich schon gehört. Mein Großvater soll dort gewesen sein, während des Krieges. Mein Großvater Ernst, der zu früh Verstorbene, nach dem ich benannt worden war. Er war zwar Parteimitglied, aber weit hinter der Front in einer Schreibstube tätig, hieß es. Vom Krieg soll er kaum etwas mitbekommen haben.
Von da an interessierte es mich brennend, was in Winniza geschah und wo genau meine Großväter im Zweiten Weltkrieg tätig waren. Mich ließ das Thema nicht mehr los. Ich begann nachzuforschen. Nach den Büchern über den Feldzug gegen die Sowjetunion und den darin veröffentlichten Bildern zu schließen, geschahen solche Liquidationen anscheinend häufiger, auch weit hinter der Front. Irgendwie konnte ich mir nicht vorstellen, dass man als Soldat von derartigen Verbrechen nichts mitbekam.
Zu meinem Erstaunen und dem Erstaunen meiner Familie musste ich erfahren, dass mein Großvater in der Kommandantur eines Kriegsgefangenenlagers tätig gewesen war. Ich las alles, was ich dazu finden konnte, und erfuhr, dass in derartigen Lagern entsetzliche Verbrechen geschehen waren.
Zu meinem noch größeren Erstaunen stellte ich fest, dass zwar viel über deutsche Kriegsgefangene in Sibirien zu lesen war, aber es kaum etwas über das Schicksal der sowjetischen Kriegsgegangenen gab, obwohl 3,3 Millionen von ihnen in den deutschen Vernichtungslagern umgekommen waren. Einzig Christian Streit hatte 1978 eine umfassende Dissertation über das Problem geschrieben. Sein Buch „Keine Kameraden“ hatte wohl zu einigen Diskussionen geführt, aber danach herrschte wieder weitgehend Ruhe, was dieses Thema betraf.
Zu meinem allergrößten Erstaunen erfuhr ich bei meinen Nachforschungen, dass mein anderer Großvater, der kein Nazifreund war, mehrere Jahre – als Gefangener in russischer Hand – in eben diesem Lager in Winniza verbringen musste, nachdem die Deutschen abgezogen waren.
Ich wollte nun noch genauer wissen, was in Winniza geschehen war. Stipendiumsanträge oder Anfragen an renommierte Wissenschaftler, inwieweit es möglich wäre, mich bei der Erforschung dieses Teils der Geschichte zu unterstützen, blieben ergebnislos. Meist war es den Angesprochenen nicht einmal eine Antwort wert. Private Fotomaterialien und Rechercheergebnisse, die dem Deutsch-Russischen Museum in Berlin-Karlshorst zur Verfügung gestellt wurden, blieben für immer verschwunden. Angeblich seien sie gestohlen worden. Anzeige wurde deswegen seltsamerweise nicht gestellt. Kontaktaufnahmen mit Historikern aus der Ukraine führten auch nicht weiter. Trotzdem versuchte ich, weitere Erkenntnisse zu gewinnen und besuchte alle deutschen Archive, die etwas zu dieser Thematik hergeben konnten. Am effektivsten waren dabei zwei Aufenthalte in der Zentralstelle für die Aufarbeitung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg. Aber auch in den Bundesarchiven in Berlin und Freiburg wurde ich fündig. Leider waren die Ergebnisse begrenzt, doch viele Originalakten führten dazu, dass das Bild immer klarer wurde.
Das Bild von zwei einfachen Soldaten an der Ostfront.
Das Bild von schrecklichen, zumeist ungesühnten Verbrechen.
Aus diesem Grund beschloss ich, da nunmehr dafür genügend Material vorhanden war, ein Buch zu verfassen, um diese viel zu kurz gekommene Thematik zumindest jetzt einem breiteren Publikum vor Augen zu führen.
Ein derartiges Buch aus dem Blickwinkel Betroffener, das sich auch intensiv mit den Verbrechen an sowjetischen Kriegsgefangen beschäftigt, gibt es bisher nicht. Ausgehend vom Lager in Winniza soll die Gesamtproblematik dargestellt werden.
Die letzten deutschen Kriegsgefangenen verließen erst 1955 die Sowjetunion.
2015 jährt sich dieses Ereignis zum sechzigsten Mal und zum siebzigsten Mal der Tag der Befreiung. Es ist zu befürchten, dass die dazu erscheinenden Publikationen sich hauptsächlich mit dem schweren Schicksal deutscher Kriegsgefangener in der Sowjetunion beschäftigen werden. Mit den Verbrechen an sowjetischen Gefangenen wird man sich dabei wahrscheinlich erneut kaum auseinander setzen.
Das „Unternehmen Barbarossa“
1941
Am 22. Juni 1941 beginnt der deutsche Überfall auf Russland mit dem Vormarsch dreier Heeresgruppen. Rumänien, Italien, die Slowakei, Finnland und Ungarn schließen sich dem Deutschen Reich an. Der dem Angriff zugrunde liegende „Barbarossaplan“ spielt auf Kaiser Friedrich I. an, der im 12. Jahrhundert einen Kreuzzug gegen die „Ungläubigen“ angeführt hatte. Das ZK der KPdSU ruft daraufhin den „Vaterländischen Krieg“ aus. Der deutsche Vormarsch an allen Fronten scheint unaufhaltsam. Im Juli und August werden große sowjetische Verbände in Kesselschlachten vernichtet. In Bialystok und Minsk werden mehr als 300 000 Gefangene gemacht, in Smolensk nochmals 310 000. Im September wird Leningrad von jeder Landverbindung abgeschnitten. Östlich von Kiew kommt es zur Gefangennahme von über 600 000 sowjetischen Soldaten. Allerdings haben die deutschen Truppen – durch anhaltenden sowjetischen Widerstand – ebenfalls starke Verluste zu verzeichnen. Der Vormarsch verlangsamt sich. Dennoch, mit dem am 2. Oktober beginnenden Angriff auf Moskau kommen die deutschen Truppen bis auf 30 km vor Moskau. Die Artillerie ist in der Lage, den Kreml ins Visier zu nehmen. Doch schon am 5. Dezember 1941 erfolgt eine sowjetische Gegenoffensive mit frischen Kräften, welche die Deutschen erstmals zum Rückzug zwingt. Ein erster Wendepunkt in der Geschichte des Zweiten Weltkrieges6.
1942
Allerdings wird dieser Rückzug in einer Verteidigungsstellung unter starken Verlusten im Januar 1942 stabilisiert. Dabei sind die Verluste der deutschen Armee derartig hoch, dass an eine breite Gegenoffensive nicht mehr zu denken ist. Die weitergehende Winteroffensive der sowjetischen Armee erzielt bis März Teilerfolge, erreicht jedoch nicht die angestrebten Ziele. Im Mai scheitert eine sowjetische Offensive bei Charkow, bei der erneut circa 250 000 Soldaten in deutsche Gefangenschaft geraten.
Gefangene Rotarmisten 1942. Bundesarchiv, Bild 183-B21845 / Wahner / CC-BY-SA
Im Sommer 1942 versucht nun wieder die deutsche Armee eine Offensive. Man erreicht die Wolga und die kaukasischen Ölfelder, was die Sowjetunion wiederum in eine erhebliche Krise stürzt. Im Juni wird durch die deutschen Soldaten die Festung Sewastopol und damit die gesamte Krim erobert. Im August erreichen deutsche Truppen die Kaukasushöhen, können allerdings die Sowjets nicht entscheidend schlagen. Einen Monat später beginnen die Kämpfe um Stalingrad. Die Stadt ist im Oktober zu 90 Prozent besetzt. Am 19. November kommt es zu einer sowjetischen Gegenoffensive, die zur Einkesselung der 6. Armee und rumänischer Verbände führt.
1943
Am 31. Januar 1943 kapitulieren die eingeschlossenen Truppen bei Stalingrad. Von ehemals 250 000 Mann gehen 90 000 Überlebende in Gefangenschaft. Im Sommer, am 5. Juli, versucht die deutsche Armee erneut eine Großoffensive bei Kursk mit 600 000 Mann und 2 700 Panzern. Die deutschen Soldaten werden jedoch aufgehalten und bis an den Dnjepr zurückgedrängt. Erfolglos wird versucht, den sowjetischen Vormarsch aufzuhalten. Die Sowjets erobern am 6. November Kiew zurück. Nach der Landung der Alliierten auf Sizilien wurde zuvor schon Hitlers wichtigster Verbündeter Mussolini am 25. Juli 1943 abgesetzt und verhaftet. Mit den US-Amerikanern vereinbarte Italien danach ein Waffenstillstand, der am 8. September 1943 öffentlich gemacht wurde. Am 13. Oktober 1943 erklärte Italien dem Deutschen Reich den Krieg und trat an der Seite der Alliierten wieder in den Krieg ein.
1944
Im Januar 1944 wird die Heeresgruppe Nord hinter den Peipussee zurückgedrängt, was auch das Ende der Belagerung Leningrads bedeutet. Während der sowjetischen Frühjahrsoffensive im März werden die deutschen Truppen ganz aus der Ukraine vertrieben. Die Krim wird erst im Mai unter großen Verlusten geräumt. Drei Jahre nach Beginn des Feldzugs gegen die Sowjetunion beginnt am 22. Juni die sowjetische Sommeroffensive, die zur Zerschlagung des ganzen Frontabschnitts führt und zur Gefangennahme beziehungsweise zum Tod von 350 000 deutschen Soldaten. Am 28. Juli befinden sich die sowjetischen Truppen in Brest. Im August wird der Warschauer Aufstand gegen die deutsche Besatzungsmacht blutig niedergeschlagen. Kurz danach wechselt in Rumänien die Regierung und erklärt Deutschland den Krieg. Italien Finnland vereinbart mit den Alliierten am 19. September einen Waffenstillstand, und im Oktober wird Belgrad durch sowjetische und jugoslawische Truppen besetzt.
1945
Am 12. Januar 1945 beginnt die sowjetische Offensive, die bis Anfang Februar von Warschau bis nach Schlesien und über die Oder führt. Große Fluchtbewegungen bei der deutschen Zivilbevölkerung setzen ein. Man befürchtet Racheexzesse. Am 11. Februar wird Budapest, am 13. April Wien erobert. In der Nacht vom 15. auf den 16. April beginnt der Angriff auf die letzten deutschen Abwehrstellungen an der Oder. Der Marsch nach Berlin kann nicht mehr aufgehalten werden. Am 30. April begeht Hitler Selbstmord. Der Berliner Stadtkommandant Weidling kapituliert zwei Tage später. Am 7. Mai wird in Reims beziehungsweise in der Nacht auf den 9. Mai in Berlin/Karlshorst die Kapitulation Deutschlands unterzeichnet.
Prof. Dr. Hans Mommsen in: Haus der Geschichte, Kriegsgefangene, 1995, S. 141 f.↩
Vergleiche beispielsweise Borgsen/Volland, Stalag X B Sandbostel, 1991, S. 248 ff und Stiftung Sächsischer Gedenkstätten, Für die Lebenden, 2003, S. 22.↩
Pohl, Die Herrschaft der Wehrmacht, 2008, S. 237.↩
Laut Yad Vashem Photo Archives 2626/4.↩
Knopp, Bilder, die wir nie vergessen, 2014, S. 146 ff.↩
Beevor, Der Zweite Weltkrieg, 2014, S. 298: „Durch den Rückschlag vor Moskau und den Eintritt der USA in den Krieg geriet der Dezember 1941 zum Wendepunkt der Weltpolitik. Von nun an war Deutschland nicht mehr in der Lage, den Zweiten Weltkrieg eindeutig zu gewinnen, auch wenn noch die Kraft besaß, schreckliches Unheil anzurichten und Tod zu verbreiten.“.↩