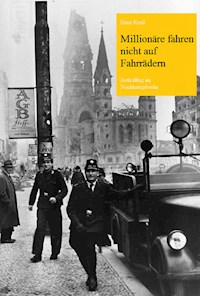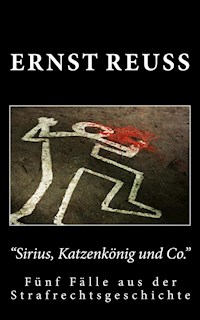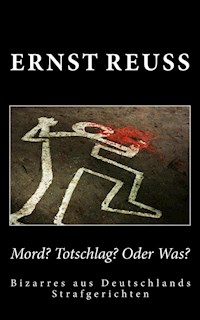
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Ein angeblicher Außerirdischer überredet eine Frau zum Selbstmord. Ein Mann ist bereit, zum Schutz der Menschheit ein Menschenopfer darzubringen ... Von tragischen, skurrilen und bizarren Strafrechtsfällen aus dem Bereich Mord und Totschlag handelt das Buch von Ernst Reuß. Jeder Fall hat seine besondere juristische Eigentümlichkeit. Es geht um erweiterten Suizid, Totschlag auf Verlangen, Ehrenmord, tödliche Zivilcourage und andere Sachverhalte. In kurzweiligen verständlichen Texten kommentiert der Autor Urteilsbegründungen aus Originalquellen. Er spürt der Frage nach: Warum wurde so und nicht anders geurteilt? Überaus spannend sind diese Fälle, die fast ausschließlich von der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert bis in das Jahr 2013 reichen und deutschlandweit in den Medien verfolgt wurden. Interessant für den Jurastudenten wie für den juristischen Laien, doch nichts für schwache Nerven.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Ernst Reuß
Mord? Totschlag? Oder was?
Bizarres aus Deutschlands Strafgerichten
Dieses eBook wurde erstellt bei
Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Buch interessieren! Noch mehr Infos zum Autor und seinem Buch finden Sie auf tolino-media.de - oder werden Sie selbst eBook-Autor bei tolino media.
- gekürzte Vorschau -
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
Einleitung
Der Sirius-Fall
Staschynskij
Impressum tolino
Vorwort
Man könnte meinen, Mord und Totschlag boomen – in den Buchhandlungen stehen regalweise Krimis zur Auswahl und auf den Fernsehkanälen gibt es täglich dutzende Filmleichen zu sehen. Meist geht es um Verbrechen, Motive und Ermittlungen. Am Ende steht in der Regel der Erfolg, der Täter ist gefasst. Abspann. Buch zu.
Das vorliegende Buch „Mord? Totschlag? Oder was?“ nimmt sich des Themas der Strafverfolgung und Tatbewertung an. Es macht auf eindrucksvolle Weise deutlich, worin bei Straftatbeständen mit Todesfolge die Probleme in der Abgrenzung liegen. Wann wird ein Täter für Mord oder Totschlag oder was auch immer bestraft – und warum? Worin liegen die Schwierigkeiten für ein Gericht, dies zu entscheiden? Manches Urteil wird dem Leser oder der Leserin skurril vorkommen. Oder wenig nachvollziehbar.
Mord und Totschlag sind im juristischen Studium Kernbestandteile. Die Abgrenzung zwischen beiden, die immer wieder debattierte Frage ob es sich um eigenständige Straftatbestände oder beim Mord um eine Qualifizierung des Totschlages handelt, ist im Studium Gegenstand von Hausarbeiten und Klausuren.
Das Buch erscheint in einer Zeit, wo Bewegung in die Debatte um Mord und Totschlag gekommen ist. Möglicherweise ist es in nicht allzu ferner Zeit eher eine Geschichtslektüre. Die schleswig-holsteinische Justizministerin Anke Spoorendonk stieß Ende 2013 eine Debatte um die sprachliche Bereinigung der Tötungsdelikte an. Der jetzige Bundesminister für Justiz- und Verbraucherschutz, Heiko Maas, hat nunmehr eine Kommission einberufen, die einen Vorschlag für die Neuformulierung der Definition der Tötungsdelikte vorlegen soll.
Worin liegt eigentlich das Problem? Die bis heute gültige Formulierung des Mordparagraphen im Deutschen Strafgesetzbuch (§ 211 StGB) stammt aus dem Jahr 1941. Der Mordparagraph enthält sogenannte Gesinnungsmerkmale, beispielsweise die „niedrigen Beweggründe“ oder die „Heimtücke“. Es wird nicht eine Tat bestraft, nämlich das Töten eines Menschen, sondern die Tatbegehung. Und ob es dann Mord oder Totschlag ist, das hängt davon ab, wie Richterinnen und Richter die Gesinnungsmerkmale auslegen. Es obliegt ihrer subjektiv-moralischen Bewertung, ob die Tatbegehung eine aus „niedrigen Beweggründen“ oder aus „Heimtücke“ ist oder nicht. Das nennt sich Täterstrafrecht, weil ein Täterbild bestraft wird.
Das deutsche Strafrecht ist aber ein Tatstrafrecht, eben weil eine Tat bestraft werden soll. Die Kuriosität des Täterstrafrechts besteht zum Beispiel darin, dass eine Frau die ihren körperlich überlegenen Mann – nachdem er sie jahrelang geschlagen hat – im Schlaf erstickt, wegen heimtückischen Mordes verurteilt werden muss. Der Mann hingegen, der seine Frau totprügelt, kann mit einer Verurteilung wegen Totschlags rechnen. Sie bekommt eine lebenslängliche Freiheitsstrafe, er bekommt eine zeitige Freiheitsstrafe. Klingt nicht nur ungerecht, das ist auch ungerecht.
In verschiedenen Büchern und Schriften finden sich eindeutige Hinweise darauf, dass die Formulierung des Mordparagraphen an die sogenannte Tätertypenlehre der NS-Zeit anknüpft. Diese stellt bei der Formulierung von Straftatbeständen nicht auf konkrete Handlungen ab, sondern umschreibt Tätertypen. Deshalb finden sich Formulierungen im Strafgesetzbuch wie „Mörder ist, wer ...“.
Das vorliegende Buch ist nicht vordergründig politisch. Es fällt aber in eine hochpolitische Zeit. In eine Zeit, wo es nach vielen Jahren Debatte tatsächlich möglich erscheint, dass die Gesetze zu Tötungsdelikten neu gefasst werden. Das ist längst überfällig.
Dieses Buch ist aber nicht nur für Insider oder angehende Juristen lesenswert, sondern wegen der anschaulichen Kommentierung des Autors auch für den juristischen Laien verständlich. Möge es die fachliche Debatte bereichern und beim Laien dafür Verständnis wecken.
Berlin, den 1. Juli 2014 Halina Wawzyniak
Mitglied des Rechtsausschusses des Bundestages
Einleitung
Es muss wohl Mitte der 90er Jahre gewesen sein, als ich das erste Mal vom Sirius-Fall hörte, während einer Strafrechtsvorlesung in meinen Anfangssemestern an der Universität. Ein Mann hatte seine Bekannte überredet sich umzubringen, damit sie mit ihm, ohne ihren dafür hinderlichen Körper, zum Planeten Sirius reisen kann, um dort eine gemeinsame glückliche Zukunft haben zu können.
Mich elektrisierte dieser Fall sofort. Wie konnte so etwas Absurdes geschehen? Als angehenden Juristen interessierte mich natürlich noch mehr, ob man jemanden wegen solch einer Tat juristisch belangen könnte. Ein Selbstmord ist nun mal nicht strafbar.
Häufig wurde ich gefragt, wie ich so etwas „Trockenes“ wie Jura studieren könnte. Ich konterte gern, indem ich einen solch grotesken Fall schilderte. Meist erntete ich von meinen Zuhörern ein verwundertes Kopfschütteln und die Bemerkung, warum sie noch nie davon gehört hätten.
Schon damals hatte ich die vage Idee, eines Tages diese Geschichten aufzuarbeiten. Es gibt vermutlich ein breites Publikum, das sich für derartig merkwürdige und juristisch brisante Fälle interessiert. Nun endlich erscheint eine Auswahl davon in Buchform.
„Mord? Totschlag? Oder was?“ ist ein Buch über ältere und jüngere Strafrechtsfälle, die für den Bereich Mord und Totschlag exemplarisch sind. Wie der Auslöser des Ganzen, der Sirius-Fall, haben auch alle folgenden Fälle eine besondere juristische Eigentümlichkeit.
Warum wird jemand als Mörder verurteilt? Warum ein anderer „nur“ als Totschläger?
Mordmerkmale wie „Habgier“, „niedrige Beweggründe“, „Heimtücke“, „Mordlust“ und „Grausamkeit“ spielen in den Urteilen und deshalb natürlich auch in diesem Buch eine große Rolle. Vielleicht wird von diesen Mordmerkmalen bald nur noch in den Geschichtsbüchern die Rede sein. Eine Gesetzesänderung zur Neuregelung der Straftatbestände Mord und Totschlag ist in Vorbereitung.
Bei den Sachverhalten in diesem Buch handelt es sich um tragische, skurrile und außergewöhnliche Tatbestände. Bizarr, so lassen sich die meisten dieser Fälle am ehesten beschreiben. Da bringt beispielsweise ein Täter allein und eigenhändig mehrere Menschen um – und wird trotzdem nur als Gehilfe verurteilt. Wie kann so etwas sein? Einem anderen Täter wird eingeredet, dass ein „Katzenkönig“ existiert, der die gesamte Menschheit bedroht, falls er ihn nicht durch den Opfertod einer Frau besänftigen würde. Wie irrsinnig ist das denn? Jemand bringt einen ihm vollkommen Fremden um und zerstückelt seine Leiche. Wo bleibt das Motiv? Ein Mann verbrennt seine eigenen Kinder, eine Frau tötet fünf ihrer Kinder sofort nach der Geburt. Schrecklich, aber was sind die Hintergründe solcher Taten? Jemand trinkt sich zu Tode und sein Zechpartner wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt. Wie kann das denn sein? Ein bis dahin unbescholtener Grundschullehrer vergiftet mehrere seiner Sexualpartner. Warum? Es geht um „Totschlag auf Verlangen“, Kannibalismus, um Ehrenmord und um andere juristisch schwer zu fassende Tatbestände.
Die Recherche zu den Fällen war nicht immer einfach und so manches Gericht weigerte sich, die Urteile zugänglich zu machen. Ergänzend zu den Informationen aus den Medien ist es mir gelungen, auch andere juristische Quellen auszuwerten und damit Urteilsbegründungen kritisch zu erläutern, um beim Leser ein tieferes Verständnis dafür zu wecken, welche Abwägungskriterien bei solchen Urteilen eine Rolle spielen.
So ist ein Buch entstanden, das sowohl das juristisch interessierte Publikum anspricht als auch den aus dem Bauch heraus urteilenden Laien, den es brennend interessiert, warum ein Gerichtsurteil genau so ausgefallen ist, wie er es aus Zeitungen oder anderen Medien erfahren hat.
Mitunter gehen die Tateinzelheiten allerdings über das allgemein Erträgliche hinaus. Die Details wurden jedoch nur insoweit wiedergegeben, wie das zur Erläuterung der juristischen Wertung notwendig war.
Berlin, September 2014 Ernst Reuß
Der Sirius-Fall
Lag ein versuchter Mord vor?
Vor dieser äußerst kniffligen Frage stand im Juli 1983 der erste Strafsenat des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe. Im Juristendeutsch lautet das Problem, über das das Gericht zu urteilen hatte:
„Abgrenzung von strafbarer Tötungstäterschaft und strafloser Selbsttötungsteilnahme in Fällen, in denen der Suizident durch Täuschung zur Vornahme der Tötungshandlung bewogen wird.“
Was war geschehen?
Das Landgericht Baden-Baden hatte am 3. November 1982 in einem fünftägigen Prozess den zu diesem Zeitpunkt 35-jährigen Angeklagten Fred G. – Mitinhaber eines Galvanobetriebes in Bayern – wegen versuchten Mordes, wegen Betruges, wegen vorsätzlicher Körperverletzung, wegen unbefugten Führens akademischer Grade und wegen eines Vergehens gegen das Heilpraktikergesetz zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Dagegen hatte Fred G. – beziehungsweise dessen Anwalt – Revision eingelegt.
G. soll „einen Suizidenten“ dazu überredet haben sich selbst umzubringen. Abgesehen davon, dass es sich bei „dem Suizidenten“ um eine Frau namens Heidrun T. handelte, mit der Fred G. seit mehreren Jahren eng befreundet gewesen war und ein Selbstmord möglicherweise moralisch verwerflich, beziehungsweise aus religiösen Gründen nicht erlaubt sein mag, ist eine solche Tat nach unserem Strafgesetzbuch definitiv nicht strafbar. Für sein eigenes Leben ist jeder immer noch selbst verantwortlich.
Es war also die Frage zu klären, ob man wegen massiver Beeinflussung eines Selbstmordkandidaten als Mörder verurteilt werden kann. Genau das versuchte das Gericht zu klären.
Weil der Selbstmordversuch der damals 29-Jährigen am 1. Januar 1980 erfreulicherweise nicht klappte, blieb es allerdings lediglich bei einer Anklage wegen versuchten Mordes.
Kann man also jemanden wegen des Selbstmordversuches eines anderen verurteilen?
Doch eher nicht, oder?
Anstiftung zu einem Selbstmord ist nicht strafbar, denn wer zu einer straflosen Tat anstiftet, kann deswegen nicht verurteilt werden.
Klingt einfach. Aber dieser Fall war speziell.
Ein vollkommen wirres Knäuel nicht nachvollziehbarer Phantastereien und menschlicher Abgründe wurde erneut einem Gericht vorgelegt. Der Bundesgerichtshof hatte die schwierige Aufgabe darüber zu entscheiden, ob wirklich ein versuchter Mord vorlag, wie das Landgericht Baden-Baden zuvor geurteilt hatte. Folgendes war geschehen:
Anfang der 70er Jahre lernte der Angeklagte in einer Diskothek in der Nähe von Aalen die vier Jahre jüngere Heidrun T. kennen. Diese war laut Schilderung von Zeugen damals noch eine unselbstständige junge Frau von Anfang 20, die ziemlich komplexbeladen gewesen sein soll. Der anscheinend umwerfende Charmeur Fred G. hatte sich als Heilpraktiker, Privatdozent und Doktor der Psychologie vorgestellt. Heidrun war stark beeindruckt von seinen Hochstapeleien und verliebte sich heftig, obwohl sie gewiss war, dass ihre Liebe von diesem aus ihrer Sicht großen, weisen – aber mit anderen Frauen liierten – unerreichbaren Mann nicht erwidert werden konnte. So entwickelte sich eine äußerst intensive, aber doch nur platonische Freundschaft.
Man diskutierte sich hauptsächlich die Köpfe heiß.
Die Gespräche gingen meist um Psychologie und Philosophie. Fred – der angeblich promovierte Psychologe – wusste einfach auf alles eine Antwort. Die ausgebildete Chefsekretärin Heidrun T., die inzwischen zur Tageszeitung „Welt“ nach Bonn gegangen war, befand sich in einer Selbstfindungsphase und war gerade dabei den Sinn des Lebens zu ergründen. Fred G. stand ihr zur Seite. Da sie nicht in derselben Ortschaft wohnten, wurden diese Diskussionen oft in mehrere Stunden dauernden Telefongesprächen geführt.
Laut Auffassung des Landesgerichtes Baden-Baden wurde Fred G. für die Heidrun T. im Laufe der Zeit zum Lehrer und Berater in allen Lebensfragen. Sie vertraute und glaubte ihm blindlings. Er war immer für sie da.
Zumindest telefonisch!
1978 verließ sie schließlich Bonn und zog in eine Fred gehörende Eigentumswohnung in die Nähe von Baden-Baden.
Die Nähe zwischen ihr und ihrem Freund in allen Lebenslagen nahm noch mehr zu. Ihre Abhängigkeiten und ihre persönlichen Probleme allerdings auch. Fred wusste natürlich Rat, auch wenn der sich letztendlich als teuer herausstellen sollte.
Damit sie ihre Probleme überwinden könne, meinte G., benötige sie einer geistigen und philosophischen Weiterentwicklung. Einer vollkommenen Entfaltung ihrer Persönlichkeit. Dazu bedürfe es natürlich größter geistiger Anstrengung zu denen selbst er – der große Lehrmeister Fred G. - nicht in der Lage sei. Er könne allerdings Hilfe anbieten, denn er kenne einen Mönch namens „Uliko vom Volke der Dogen“.
Der wäre ein noch größerer Lehrmeister als er selbst. Er würde für sie meditieren, was allerdings nicht ganz billig wäre, denn das Kloster, in dem dieser leben würde, brauche Geld. Sehr viel Geld selbstredend! Das verstand Heidrun.
Im guten Glauben überreichte sie dem wahrscheinlich innerlich glucksenden Fred G. einen Scheck. Sie hatte zuvor einen Bankkredit aufgenommen.
Dass es sich bei „Uliko“ schlicht um ein Fantasieprodukt des Angeklagten handelte, braucht hier nicht näher dargelegt werden. Dass Heidrun T. keine Zweifel an Fred hatte, braucht wohl auch nicht erläutert zu werden. Und, dass Fred G. das ganze Geld mit dem ihm eigenen Selbstverständnis seinem eigenen Konto gut schreiben ließ, sicherlich erst recht nicht!
Laut dem etwas trockenen Deutsch des Bundesgerichtshofs spielte sich die Geschichte wie folgt ab:
„Als der Angeklagte erkannte, daß ihm die Zeugin vollen Glauben schenkte, beschloß er, sich unter Ausnutzung dieses Vertrauens auf ihre Kosten zu bereichern. Er legte der Zeugin dar, sie könne die Fähigkeit, nach ihrem Tode auf einem anderen Himmelskörper weiterzuleben, dadurch erlangen, daß sich der ihm bekannte Mönch Uliko für einige Zeit in totale Meditation versetze. Dadurch werde es ihrem Körper möglich, während des Schlafes mehrere Ebenen zu durchlaufen und dabei eine geistige Entwicklung durchzumachen. Dafür müßten allerdings an das Kloster, in dem der Mönch lebe, 30000 DM gezahlt werden. Die Zeugin glaubte dem Angeklagten. Da sie nicht genügend Geld besaß, beschaffte sie sich die geforderte Summe durch einen Bankkredit.“
Deswegen wurde Fred G. dann auch später vom Landgericht Baden-Baden zu Recht wegen Betrugs verurteilt.
So weit, so klar.
Aber versuchter Mord?
Es musste also noch mehr vorgefallen sein.
So war es auch. Mit ihrer geistigen Weiterentwicklung war Heidrun nicht ganz zufrieden, und das trotz der pünktlich übergebenen 30.000 DM. Der Erfolg der Meditation des Mönches „Uliko vom Volke der Dogen“ stellte und stellte sich nicht ein. Heidrun fühlte sich kein bisschen verändert. Die skurrile Geschichte ging also weiter. Das Gericht stellte später fest:
„Sooft sich die Zeugin in den folgenden Monaten nach den Bemühungen des Uliko erkundigte, vertröstete sie der Angeklagte. Später erklärte er ihr, der Mönch habe sich bei seinen Versuchen in große Gefahr begeben, gleichwohl aber keinen Erfolg erzielt, weil ihr Bewußtsein eine starke Sperre gegen die geistige Weiterentwicklung aufbaue. Der Grund dafür liege im Körper der Zeugin; die Blockade könne nur durch die Vernichtung des alten und die Beschaffung eines neuen Körpers beseitigt werden.“
Aha! Heidrun T. war also selbst schuld! Ihr Körper war ihr im Weg. Ein Missgeschick, dem „leicht“ abgeholfen werden konnte!
Ganz schön dreist von unserem Angeklagten!
Und ziemlich durchsichtig, doch die arglose Frau schöpfte keinen Verdacht. Sie war Fred G. vollkommen verfallen.
Eines Tages hatte Fred ihr in einem ihrer unzähligen esoterisch angehauchten Gespräche überraschenderweise erzählt, dass er ja, um ehrlich zu sein, eigentlich gar kein Mensch sei, sondern von einem fremden Stern stamme. Er sei Sirianer, also ein Bewohner des weit, weit entfernten Sternes Sirius.
Vom Sirius?
Ja!
Und Heidrun T., der offensichtlich keine von Freds Storys zu albern war, glaubte ihm unvorstellbarerweise tatsächlich auch diese Geschichte.
Fred G. erzählte ihr in den folgenden Tagen einiges von „seinem“ Planeten. Unter anderem berichtete er davon, dass die Sirianer eine Rasse seien, die philosophisch auf einer weit höheren Stufe stehen als die Menschen und er deswegen zur Erde gesandt worden sei, weil er den Auftrag habe es einigen besonders brillanten Menschen zu ermöglichen auf dem Sirius weiterzuleben. Selbstverständlich gehörte auch die leichtgläubige aber geschmeichelte Heidrun T. zu dieser Elite. Freilich gab ein klitzekleines Problemchen. Ein Weiterleben auf dem Sirius sei erst nach dem völligen Zerfall des eigenen Körpers möglich.
Ihr Körper war also erneut im Weg, denn nur mit ihrer Seele könne sie auf einem fremden Planeten und natürlich auch auf dem Sirius weiterleben.
Nun hatte Fred G. offensichtlich „Blut geleckt“. Voller Freude, dass ihm die junge Frau auch diese völlig aberwitzige Münchhausengeschichte glaubte, fasste er einen perfiden Plan. Laut Bundesgerichtshof lautete der wie folgt:
„Der Angeklagte spiegelte ihr vor, in einem roten Raum am Genfer See stehe für sie ein neuer Körper bereit, in dem sie sich als Künstlerin wiederfinden werde, wenn sie sich von ihrem alten Körper trenne.“
Heidrun T. sollte sich also „von ihrem Körper trennen“. Für Außenstehende schwer verständlich, erklärte er ihr auch noch, dass sie eine Lebensversicherung zu seinen Gunsten abschließen solle.
Unglaublich, aber auch das schluckte das vertrauensselige Mädchen, denn es würde sich ja nicht wirklich umbringen, sondern sofort in einem neuen Körper aufwachen.
Dem Körper einer Künstlerin!
Auch in diesem neuen Leben bräuchte sie ja Geld, und Kunst ist bekanntlich brotlos.
In welchen schillernden Farben Fred unserer leichtgläubigen Heidrun diesen neuen Körper vorher schilderte, geht aus dem Urteil leider nicht hervor. Es muss auf jeden Fall sehr überzeugend gewesen sein. Heidrun T. glaubte ihrem Sirianer ohne den Hauch eines Zweifels und ließ sich darauf ein, eine Lebensversicherung über 250.000 DM abzuschließen. Bei Unfalltod sollte sich die Summe auf 500.000 DM erhöhen. Daher musste der „Übergang in den neuen Körper“ wie ein Unfall aussehen. Jemanden zum Selbstmord zu überreden, um dann auch noch davon finanziell zu profitieren – schon der gesunde Menschenverstand findet es unverschämt habgierig, was sich unser Fred hier ausgeklügelt hat!
Er allerdings schien nicht zu wissen, dass Habgier – neben Mordlust, Befriedigung des Geschlechtstriebs, Heimtücke, Grausamkeit, Tötung mit gemeingefährlichen Mitteln oder aus niedrigen Beweggründen – eines der Mordmerkmale im Sinne des § 211 Strafgesetzbuch ist. Eines davon genügt, um jemanden wegen Mordes zu verurteilen.
Fred G. hatte mit Sicherheit nicht mit einer Anklage wegen Mordes gerechnet.
Der Versicherungsschutz von Heidrun T. begann ab 1. Dezember 1979. Ihre monatliche Versicherungsprämie belief sich auf 587,50 DM. Ein ganz schöner Batzen Geld bei ihren Einkommensverhältnissen. Aber bald wäre sie ja Künstlerin und die Versicherungsprämie wäre dann hinfällig. Ihr konnte es zu diesem Zeitpunkt egal sein.
Heidrun T. bestimmte Fred G. zum Bezugsberechtigten und bereitete sich auf ihr neues Leben vor. Das Geld – so versprach Fred – werde er ihr nach Auszahlung der Versicherungssumme und sie sofort nach dem Unfall – den sie in Bälde erleiden würde – sofort überbringen. Sie glaubte ihm, bedingungslos.
Vorab gab sie ihm schon mal ihre Ersparnisse in Höhe von 4000 DM.
„… weil sie, wie er ihr sagte, nach dem Erwachen am Genfer See das Geld, das er ihr sofort überbringen werde, als »Startkapital« benötige. Die Auszahlung der Versicherungssumme könne sich verzögern. Ihr »jetziges Leben« sollte die Zeugin nach einem ersten Plan des Angeklagten durch einen vorgetäuschten Autounfall (…) beenden.“
Beide gemeinsam fanden den günstigsten Platz für den Autounfall: den Brückenpfeiler eines Autobahnzubringers. Der „Unfall“ sollte Weihnachten 1979 stattfinden. Heidrun war zu diesem Zeitpunkt gerade 28 Jahre alt.
Ihr Plan ging allerdings nicht sofort auf, denn tragischerweise durchkreuzte Freds Ehefrau Heike den Plan, indem sie sich kurz zuvor am 3. Dezember selbst erschoss. Fred hielt sich während des Selbstmordes seiner Frau in der Wohnung auf und hatte wegen der nachfolgenden Ermittlungen der Polizei erst einmal ganz andere Probleme zu bewältigen. Es liefen Ermittlungen gegen ihn, denn schon zuvor sollen Freundinnen von ihm auf recht dubiose Weise ums Leben gekommen sein.
Ob seine Ehefrau Heike sich von ähnlichen Motiven wie Heidrun zu ihrem Selbstmord leiten ließ, blieb im Dunkeln, obwohl deren Mutter im späteren Gerichtsprozess die Ansicht vertrat, dass nur Fred an ihrem Tod schuldig sein konnte.
Doch dem G. war vorerst nichts nachzuweisen.
Fred bastelte schon bald wieder munter an seinen Plan, wie sich Heidrun am besten selbst umbringen könnte. Beide nannten es verniedlichend „Körpervernichtung“.
Da sich Fred und seine ihm hörige platonische Beziehung nicht sicher waren, ob Heidrun bei einem Autounfall dann möglicherweise doch „nur“ schwer verletzt sein würde und die Familie seiner gerade erst verstorbenen Ehefrau von den Plänen Wind bekommen hatte, entschlossen sich die beiden es mit einem eingeschalteten Fön in der Badewanne zu versuchen. Anfang der 80er Jahre war das wohl noch eine sehr „angesagte“ Suizidart.
Mit einem Stromstoß in ein neues Leben – mit einem neuen Körper.
So sollte es geschehen!
„Evakuieren“ nannte Fred das. Evakuieren auf den Planeten Sirius.
Weit, weit weg in ferne Galaxien sozusagen.
Zuvor sollte Heidrun – damit es auch wirklich nach einem Unfall aussah – Wäsche waschen, einen Kuchen backen, eine Bekannte für den Abend einladen und das Telefon neben die Badewanne stellen.
Fred gab telefonisch den Startschuss.
Das Gericht fährt in seiner Tatbestandsschilderung unnachahmlich fort:
„Auf Verlangen und nach des Anweisungen des Angeklagten versuchte die Zeugin, diesen Plan am 1. Januar 1980 in ihrer Wohnung in Wildbad zu realisieren, nachdem sie zuvor, einer Anregung des Angeklagten folgend, einige Dinge getan hatte, die darauf hindeuten sollten, daß sie ungewollt mitten aus dem Leben gerissen worden sei. Der tödliche Stromstoß blieb jedoch aus. Aus »technischen Gründen« verspürte die Zeugin nur ein Kribbeln am Körper, als sie den Fön eintauchte.“
Blöd gelaufen! Doch Fred G. gab nicht auf! Er, der sich nach dem Tod der Gattin diesmal nicht am Tatort eines Selbstmordes aufhalten wollte, wartete am Telefon auf das nahende Ende seiner Freundin und war hörbar überrascht als Heidrun T. bei seinem Kontrollanruf den Hörer abnahm. Sie saß immer noch mit ihrem Fön in der Badewanne und versuchte verzweifelt damit ihren Körper zu vernichten. Fred half ihr mehr oder weniger „uneigennützig“ dabei:
„Etwa drei Stunden lang gab er ihr in etwa zehn Telefongesprächen Anweisungen zur Fortführung des Versuchs, aus dem Leben zu scheiden. Dann nahm er von weiteren Bemühungen Abstand, weil er sie für aussichtslos hielt.“
Nach stundenlangem erfolglosen Experimentieren also, doch noch mittels Stromschlag in der Badewanne ihr Leben auszuhauchen, stieg Heidrun aus dem – inzwischen wohl kalt gewordenen – Wasser und ging vermutlich frustriert ins Bett. Fred hatte zuvor den Befehl gegeben „Aufhören jetzt“, was sein Anwalt später in der Revision als Rücktritt von der geplanten Tat gewertet sehen wollte. Damit hatte er allerdings keinen Erfolg.
Der Gutachter des TÜV Karlsruhe hatte im Prozess festgestellt, dass Heidrun ihr Überleben einer Bauschlamperei zu verdanken hatte, denn die Badewanne war nicht geerdet!
Möglicherweise wollte Heidrun T. im tiefsten Inneren ja denn doch nicht aus dem jetzigen Leben scheiden? Weitere Versuche sich das Leben zu nehmen – um auf dem Sirius weiter zu existieren – sind nämlich nicht gerichtsbekannt.
Wie der Vorfall dann zur Polizei gelangte, lässt sich nur vermuten. Möglicherweise hatte jemand aus der Familie von Freds Ehefrau gepetzt. Sie hatte ihrem Leben ja kurz zuvor mit einer Pistole ein Ende gesetzt und wohl über Freds Pläne familienintern geplaudert. Jedenfalls hatte Heidrun bei einer ersten richterlichen Vernehmung im Februar 1980 noch wahrheitswidrig ausgesagt, dass nichts dergleichen am 1. Januar 1980 geplant war.
Erst am 23. August 1980 ging Heidrun zur Polizei und brachte damit den ganzen Fall ins Rollen. Aus welchen Motiven dies geschah, blieb im Dunkeln. Wahrscheinlich war es der jungen Frau einfach unmöglich, die monatliche Versicherungsprämie von 587,50 DM zu zahlen, und sie plauderte ihre Problemlage aus.
Die Polizei ermittelte, doch das größere Problem hatte die Justiz. Fred G. lachte sich wahrscheinlich erst einmal ins Fäustchen. Vielleicht war ihm auch ein bisschen mulmig zumute.
Aber ein Selbstmord ist nun mal nicht strafbar. Da beißt die Maus keinen Faden ab!
Betrug? Okay! Ein gewisses Sümmchen hatte er sich von der Heidrun ergaunert.
Aber versuchter Mord?
Nein, da war er sich sicher!
Angriff ist die beste Verteidigung, dachte Fred und warf der Kriminalpolizei einen „wüsten Amoklauf“ gegen seine Person vor und titulierte den gegen ihn ermittelnden Kriminalbeamten frech als „Zombiejäger“. Sein Anwalt trug vor, dass nur straflose Beteiligung am versuchten Selbstmord in Betracht gezogen werden könnte. Das war natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen.
Da stand die Justiz erst mal da. Doch ein Mann mit solch großer krimineller Energie und dieser dubiosen Vorgeschichte musste verurteilt werden. Straflos sollte so einer nicht ausgehen!
Das war doch zu dreist gewesen.
Das Gericht begründete:
„Die Zeugin handelte in völligem Vertrauen auf die Erklärungen des Angeklagten. Sie ließ den Fön in der Hoffnung ins Wasser fallen, sofort in einem neuen Körper zu erwachen. Der Gedanke an einen »Selbstmord im eigentlichen Sinn«, durch den »ihr Leben für immer beendet würde«, kam ihr dabei nicht. Sie lehnt eine Selbsttötung ab. Der Mensch habe dazu kein Recht. Dem Angeklagten war bewußt, daß das Verhalten der ihm hörigen Zeugin ganz von seinen Vorspiegelungen und Anweisungen bestimmt wurde.“
Soll heißen, dass allein Fred G. eine mögliche Tötung zu verantworten hatte. Die leichtgläubige Heidrun T. dachte ja nicht mal an Selbstmord, sie glaubte ohne Weiteres tatsächlich, im Körper einer Künstlerin in einem roten Raum in Genf zu erwachen und mit diesem Körper dann endlich zum Sirius zu entfleuchen.
Das Gericht war der Ansicht, dass die Abgrenzung einer „strafbaren Tötungstäterschaft von einer straflosen Selbsttötungsteilnahme“, die allein durch eine Täuschung zustande kam, nicht abstrakt beantwortet werden kann, sondern im Einzelfall bewertet werden muss.
„Die Abgrenzung hängt im Einzelfall von Art und Tragweite des Irrtums ab. Verschleiert er dem sich selbst ans Leben Gehenden die Tatsache, daß er eine Ursache für den eigenen Tod setzt, ist derjenige, der den Irrtum hervorgerufen und mit Hilfe des Irrtums das Geschehen, das zum Tod des Getäuschten führt oder führen soll; bewußt und gewollt ausgelöst hat, Täter eines (versuchten oder vollendeten Tötungsdelikts kraft überlegenen Wissens, durch das er den Irrenden lenkt, zum Werkzeug gegen sich selbst macht.“
Aha!
So ist das also!
Übersetzt für den Nichtjuristen bedeutet es: Soweit der potenzielle Selbstmörder beziehungsweise in diesem Fall die potenzielle Selbstmörderin sich gar nicht bewusst ist, dass sie gerade im Begriff ist sich umzubringen und der Hintermann, der sie zu dieser Tat anleitet, dieses hohe Maß an Einfältigkeit ausnutzt, ist der Hintermann als Täter anzusehen, denn er benutzt ein willenloses Werkzeug gegen sich selbst.
Klar?
Deshalb, und nur deshalb, kam das Gericht zum Ergebnis, dass in diesem Fall Fred G. wegen versuchten Mordes zu verurteilen war, obwohl er gar nicht persönlich Hand angelegt hatte – ja nicht einmal anwesend war – und Selbstmord nicht strafbar ist.
Das Gericht sagte also:
„Nach den Feststellungen des Tatgerichts spiegelte der Angeklagte seinem Opfer nicht vor, es werde durch das Tor des Todes in eine transzendente Existenz eingehen, sondern versetzte es in den Irrtum, es werde – obgleich es scheinbar als Leichnam in der Wanne liege – zunächst als Mensch seinen irdischen Lebensweg fortsetzen, wenn auch körperlich und geistig so gewandelt, daß die Höherentwicklung zum astralen Wesen gewährleistet sei. Die Überzeugung, daß ihre physisch-psychische Identität und Individualität lediglich Modifikationen erfahre, ergab sich für Frau T. nicht nur daraus, daß sie, wie ihr der Angeklagte sagte, auf diesem Planeten verblieb und Geld zur Deckung ihres Lebensbedarfs brauchte, sondern auch daraus, daß er ihr vormachte, sie werde im roten Raum am Genfer See Beruhigungspillen und im Nebenzimmer die erforderlichen Papiere finden. Was Frau T. nicht ahnte und wollte, erstrebte der Angeklagte: Der von beiden als sicher erwartete Stromstoß sollte dem Leben der Getäuschten ein Ende setzen und dem Angeklagten die Versicherungssumme verschaffen, von der sein Opfer annahm, sie sei die wirtschaftliche Grundlage des neuen Lebensabschnitts. Der Angeklagte, der auch das eigentliche Tatgeschehen durch stundenlang erteilte Anweisungen maßgeblich steuerte, beging infolgedessen ein Verbrechen der versuchten mittelbaren Fremdtötung.“
Dem Anwalt des Angeklagten, der versuchte, der Geschädigten – immerhin eine zwar noch junge, aber erwachsene Frau – einen Teil der Verantwortung zuzuweisen, weil sie so unbegreiflich leichtgläubig war, entgegnete das Gericht:
„Diese rechtliche Feststellung wird nicht dadurch in Frage gestellt, daß Frau T. völlig unglaubhaften Suggestionen erlag, obwohl sie keine psychischen Störungen aufwies. Der Angeklagte hatte sich die Psyche seines Opfers für diese Suggestion erschlossen. Das Erstaunliche dieses Vorgangs entlastet ihn nicht.“
Das Gericht fügte sogar noch an:
„Auch wenn Frau T. angenommen hätte, daß dem ‚Erwachen’ in einem roten Raum am Genfer See ihr Tod vorausgehen müsse (…) bestünde die Verurteilung des Angeklagten zu Recht.“
Denn – um es salopp zu sagen – Fred G. war der kritiklosen und naiven Heidrun T. weit überlegen, und nur seine Täuschungen führten dazu, dass sie arglos Hand an sich selbst legte. Von allein hätte sie es nie getan.
Dafür sprach auch, dass sie selbst in der Gerichtsverhandlung ein Recht auf Selbsttötung ausdrücklich negierte und ja eigentlich ernsthaft beabsichtigt hatte in einem neuen Körper weiterzuleben.
So kann also jemand, der im wörtlichen Sinn eigentlich keine Tat begangen hatte, als mittelbarer Täter für die Handlung eines anderen verantwortlich sein.
Ganz schön kompliziert!
Genau deshalb musste Fred G. wegen versuchten Mordes zu Recht einige Jahre in der Justizvollzugsanstalt Neumünster schmoren, auch wenn er selbst von einer „teuflischen Hetzjagd“ und einem „absurden Fehlurteil“ gegen sich sprach.
Vollkommen untätig blieb er in den nächsten Jahren auch in der Haft nicht. Als am 31. Oktober 1988 seine Strafe eigentlich verbüßt gewesen wäre, musste er gleich weiter im Gefängnis bleiben. Selbst in der JVA Neumünster war er nicht untätig geblieben. Wieder mit Hilfe einer leichtgläubigen Frau – der er offensichtlich auch überzeugend vom Sirius erzählt hatte – und einer selbst gegründeten Briefkastenfirma hatte er versucht ziemlich viel Geld zu ergaunern.
Er blieb für weitere zwei Jahre und drei Monate im Gefängnis.
Nach Verbüßung der Strafe verliert sich seine Spur.
Wer weiß schon, wem er wieder vom Sirius erzählt hat, denn offensichtlich hatte der Charmeur in der Justizvollzugsanstalt nichts von seiner stark ausgeprägten Überzeugungskraft und seiner Wirkung auf Frauen eingebüßt!
Quellen:
BGHSt 32, 38 ff. Urteil vom 05.07.1983 Az. 1 StR 168/83 bzw. Landgericht Baden-Baden Urteil vom 3.11.1982 Az. Ks 3/82;
Mitteilung des Landgerichtes Baden-Baden, 18.09.2007;
Zeitungsartikel der örtlichen Tagespresse und der Lokalnachrichten aus der Zeit vom 25.10 bis 3.11.1982 aus dem Privatarchiv des Richters P. Ruh am Landgericht Baden-Baden) (ohne Quellenangaben).
Staschynskij
Ganz anders entschied der Bundesgerichtshof 1962 beim so genannten Staschynskij-Fall:
„Wer eine Tötung eigenhändig begeht, ist im Regelfalle Täter; jedoch kann er unter bestimmten, engen Umständen auch lediglich Gehilfe sein.“
Wie kann das sein?
Jemand der einen anderen eigenhändig tötet, soll nun nur Gehilfe sein? Etwa Gehilfe seiner eigenen Hände? Oder wie ist das zu verstehen?
Die als Staschynskij-Fall bekannt gewordene Entscheidung des Bundesgerichtshofs urteilte über die Mordtaten des 1931 geborenen KGB-Agenten Bogdan Nikolajewitsch Staschynskij. Wieder ging es um die Abgrenzung zwischen Täterschaft und Teilnahme.
Die konservative „Welt“ schrieb am 5. Oktober 1962 in einem Vorbericht zum Verfahren Folgendes:
„Eine tolle Spionagestory wird am kommenden Montag der 30 Jahre alte Sowjetbürger Bogdan Staschynskij den fünf in rote Roben gekleideten Mitgliedern des Dritten Strafsenats des Bundesgerichtshofes erzählen. Seine Geschichte von der Tötung der beiden ukrainischen Exilpolitiker Lew Rebet und Stefan Bandera durch Schüsse aus einer geheimnisvollen Blausäurepistole, klingt so unglaublich, daß der zudem recht sympathisch wirkende junge Mann einige Schwierigkeiten haben wird, die Richter von der Richtigkeit seines Mordgeständnisses zu überzeugen.“
Offensichtlich hatte der Autor mit dem akzentfrei und fließend deutsch sprechenden Angeklagten viel Mitgefühl.
Der „sympathisch wirkende“ 30-jährige Staschynskij war im KGB in der „Abteilung für Terrorakte im Ausland“ beschäftigt.
Ja, tatsächlich. So etwas gab es in Zeiten des Kalten Krieges!
Trotz des sehr bürokratisch klingenden Namens der Abteilung, in der Staschynskij ein kleiner Angestellter war, war er auf „gut deutsch“ nichts anderes als ein gedungener KGB-Killer.
1957 erhielt er den Auftrag, einige als störend empfundene Exilpolitiker, nämlich führende Mitglieder der Organisation Ukrainischer Nationalisten und des russischen Nationalen Bundes der Schaffenden, zu liquidieren.
Dafür wurde er nach Ost-Berlin entsandt. Auftragsgemäß und zügig tötete er schon im Herbst 1957 Lew Rebet vom „Nationalen Bund“. 1959 „erledigte“ er dann Stepan Bandera, den Vorsitzenden der Ukrainischen Nationalisten, der im Zweiten Weltkrieg eine Zeit lang mit Hitler paktiert hatte. In beiden Fällen hatte es auf den ersten Blick nicht nach Mord ausgesehen: Rebet wurde am 12. Oktober 1957 im Treppenflur am Münchener Karlsplatz tot aufgefunden. Der unter dem Pseudonym Stefan Popel in München lebende Bandera starb zwei Jahre später, am 15. Oktober 1959, ebenfalls in einem Münchener Treppenflur. Bei Rebet wurde Herzschlag als Todesursache vermutet, bei Bandera glaubte man an Selbstmord.
Die westdeutsche Frankfurter Allgemeine Zeitung verhielt sich neutral und schrieb am 20. Oktober 1959 unter der Überschrift „Bandera starb an Zyankali“, dass es umstritten sei, ob es sich um Mord oder Selbstmord handelte, aber das ukrainische Informationsbüro in der Bundesrepublik von Mord ausgehe. Bandera sei nach deren Darstellung von mehreren Menschen überfallen worden, wobei ihm das Zyankali in den Mund gesteckt worden sei. Allerdings habe er entgegen seinen sonstigen Gewohnheiten den Leibwächter vor dem Betreten des Treppenhauses weggeschickt, was möglicherweise dann doch eher für Selbstmord sprechen würde.
Das ostdeutsche „Neue Deutschland“ schrieb einen Tag später unter der Überschrift: „Verfassungsschutz hintertreibt Ermittlungen des Bandera-Mörders“, dass der „Mordgehilfe Oberländers“, des damaligen Bonner CDU-Ministers für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte, starb, „weil er zu viel über dessen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg wußte.“
(Anm. d. Verf.) Theodor Oberländer (1905-1998), umstritten wegen seiner Rolle bei den Massenmorden in Lemberg im Juli 1941. Er wurde deswegen 1960 in der DDR in einem rechtsstaatlich fragwürdigen Prozess in Abwesenheit zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt.
Es war eben Kalter Krieg.
Als Tatwaffe hatte Staschynskij eine schon mehrfach und stets mit Erfolg verwendete Giftpistole zum Versprühen von Blausäuregas verwendet, welches er seinen Opfern direkt ins Gesicht sprayte. Durch die Blausäure wurde das Opfer durch Verengung der Atmungsorgane ohnmächtig und starb zwei oder drei Minuten später. Staschynskij bekam ein Gegenserum, das er einsetzen sollte, falls er bei der Tatbegehung aus Versehen etwas davon einatmete. Auch vor einer Tat nahm er sein Gegenmittel ein, um sich vor solchen Eventualitäten zu schützen.
Den ersten Versuch, Bandera zu töten, hatte Staschynskij abgebrochen, weil er die Tat angeblich nicht über sich bringen konnte. Beim zweiten Anlauf hatte er dann weniger Skrupel. Laut seiner eigenen Schilderung war er mittels eines Dietrichs ins Treppenhaus von Banderas Wohnung gekommen, wo er auf ihn wartete. Das Gericht beschreibt das so:
„Dort hörte er alsbald, dass die Haustür geöffnet wurde. Daraufhin ging er hinunter und sah, dass Ba., soeben hereingekommen, im rechten Arm ein Körbchen mit Tomaten, jedenfalls mit ‚etwas Rotem‘, mit der linken Hand versuchte, den anscheinend verklemmten Türschlüssel wieder abzuziehen. Um diese Verzögerung zu überbrücken, bückte sich S. und tat, als ob er an seinen Schuhriemen nestele, obwohl er Halbschuhe ohne Schuhbänder trug. Gleich darauf ging er auf Ba. an der Haustür zu, sagte im Vorbeigehen etwa ‚Funktioniert es nicht?‘, fasste mit der linken Hand den äusseren Türknopf, richtete mit der rechten Hand die von der Zeitung verdeckte Waffe auf den Kopf des ahnungslosen Ba., drückte beide Abzüge zugleich ab, was ohne Mühe möglich war, und zog die Haustür eilig von draussen zu. Dann zerdrückte er die Gegenampulle, atmete den Inhalt ein und lief in Richtung zum Hofgarten. Den Nachschlüssel warf er ohne besondere Überlegung in ein Gully, die Waffe wiederum in den K.bach.“
Beim Mord an Bandera war die Waffe mit zwei Ampullen Blausäure geladen, um den eigentlich erwarteten Leibwächter gegebenenfalls auch umzubringen. Angeblich sei er dabei – laut seiner späteren Aussage – hin und her gerissen und „wie in einem Trancezustand“ gewesen, als er schließlich die Säure versprühte.
Das war damals also die übliche KGB–Methode, um unliebsame Regimekritiker aus dem Verkehr zu ziehen!
Soweit so schlecht.
Genauso wie Bandera wurde auch Rebet heimtückisch getötet.
Also ermordet, denn Heimtücke ist laut § 211 StGB eines der Tatbestandsmerkmale für Mord. Zumindest diesbezüglich waren sich die fünf Richter in den roten Roben einig, denn heimtückisch tötet, wer das Opfer unter bewusster Ausnutzung von dessen Arg- oder Wehrlosigkeit umbringt.
Das Gericht führte aus:
„R. wie B. waren im Augenblick der Tatausführung in dem dargelegten Sinne arglos. R. hatte soeben ein an belebtester Stelle Münchens gelegenes Bürogebäude, in dem sich seine Arbeitsräume befanden, B. sein gewöhnlich und auch am Tattage abgeschlossenes Wohnhaus betreten. Beide hatten zur Tatzeit in Richtung auf den Angeklagten keinerlei Argwohn. Beide Taten geschahen von einem den Opfern Fremden, in völlig unverfänglicher, keinen Argwohn erregender Weise blitzartig aus nächster Nähe. Sie schlossen jede Gegenwehr praktisch aus und schon nach dem ersten Atemzug des Opfers auch jede Aussicht auf Rettung. Dieser Arg- und Wehrlosigkeit der Opfer und aller Umstände, auf denen sie beruhte, war sich St. bewußt. Er hat sie zu den beiden Attentaten geradezu ausgenutzt. Seine Auftraggeber hatten sie von vornherein eingeplant.“
Staschynskij hatte also Rebet und Bandera höchstpersönlich umgebracht. Auch diesbezüglich gab es seitens des Gerichts keine Zweifel mehr. Beide waren jedenfalls tot und Staschynskij wurde von seinem Auftraggeber dafür geehrt.
Für seine Verbrechen bekam Staschynskij den „Kampforden vom Roten Banner“, was auch immer das bedeuten mag. In der „Laudatio“ hieß es selbstverständlich nicht, dass der Orden für mindestens zwei Morde verliehen wurde. Verliehen wurde der Orden „für die Durchführung eines wichtigen Regierungsauftrages“ oder wie es in seiner dienstlichen Beurteilung durch den KGB hieß: „für die Bearbeitung eines wichtigen Problems“.
Staschynskij bekam aber nicht nur den Rotbanner-Orden, er durfte auch mit Erlaubnis des Komitees für Staatssicherheit – O-Ton „Die Welt“ 1962 – „das Ostberliner FDJ Mädchen Inge F.“ heiraten. Seine Frau war eine gelernte Friseuse.
Da Banderas Tod zu einiger Aufregung in Emigrantenkreisen und in der Bundesrepublik geführt hatte, wurde Staschynskij erst einmal aus dem Verkehr gezogen und nach Moskau zurückbeordert. Dort wohnte er gemeinsam mit seiner Frau, die sich für ihre große Liebe ebenfalls verpflichten musste, für den KGB tätig zu sein.
Staschynskij wäre ein hoch dekorierter Mann jenseits des Eisernen Vorhangs gewesen. In der BRD hätte es zwei ungesühnte und vielleicht noch unentdeckte Verbrechen gegeben, wenn alles wie immer gelaufen wäre.
Es kam jedoch ganz anders.
Das Problem für die bundesdeutsche Justiz entstand um den 13. August 1961, jenem bedeutsamen Datum im deutsch-deutschen Verhältnis – beziehungsweise Nichtverhältnis – und im Kalten Krieg, denn zum Zeitpunkt des Baus der Berliner Mauer war Staschynskij bereits mit seiner deutschen Ehefrau nach Westberlin geflüchtet. Dort kam er kurze Zeit später, am 1. September 1961, in Untersuchungshaft. Staschynskij hatte sich selbst angezeigt. Die Selbstbezichtigungen des Mannes vom KGB wurden von den zuerst ungläubig staunenden Ermittlungsbeamten ziemlich lange geprüft, ehe Anklage erhoben wurde.
Die Gründe und die Umstände der Flucht waren allerdings etwas nebulös. Angeblich hatte Staschynskij sich unter dem Einfluss seiner Frau, der er seine Taten reumütig gebeichtet hatte – vollkommen gewandelt. Soll ja schon mal vorkommen in einer Ehe. Außerdem soll die innerliche Umkehr angeblich schon unmittelbar nach seinem Mord an Bandera begonnen haben, als er sein totes Opfer bei einem Kinobesuch in der Wochenschau sah und er sich seiner Taten richtig bewusst geworden wäre.
Endgültig mit seiner Heimat und seinem „erlernten Beruf“ gebrochen hat er laut BGH aber erst einige Zeit später, als er – sinnigerweise bei der Ungeziefersuche im Schlafzimmer – eine Wanze, allerdings eine elektronische, fand. Das Gericht:
„Auch entdeckten beide eines Tages bei der Wanzensuche im Zimmer eine verborgene Abhörvorrichtung.
- Ende der Buchvorschau -
Impressum
Texte © Copyright by erma Verlag Neue Straße 14 97493 Bergrheinfeld [email protected]
Bildmaterialien © Copyright by erma Verlag, Titelfoto: kaibieler/photocase.de
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN: 978-3-7393-9324-7