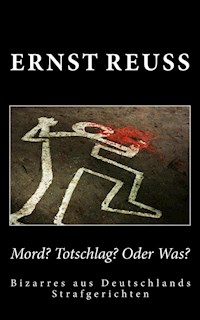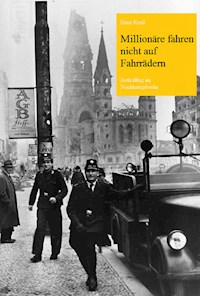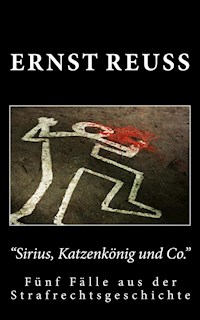9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: erma
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Mehr als eine halbe Million Straftaten wurden 2016 in Berlin angezeigt. Das Spektrum reicht von Taschendiebstahl über Drogenhandel und Schlägereien bis zu Mord. Der Autor, einer der besten Kenner der Berliner Justizgeschichte, hat spektakuläre Fälle aus den beiden letzten Jahrzehnten ausgewählt. Es handelt sich ausschließlich um Tötungsdelikte – darunter der Mord an Hatun S., die 2005 mitten auf der Straße erschossen wurde, ein „Ehrenmord“, der eine politische und gesellschaftliche Debatte auslöste, wie auch der Fall eines Dänen, der 2011 seine beiden minderjährigen Töchter bei lebendigem Leibe verbrannte, um sie nach verlorenem Sorgerechtsstreit nicht seiner Ex-Frau überlassen zu müssen. Zwei weitere Fälle haben die Öffentlichkeit 2012 monatelang beschäftigt: der von Jonny K., der am Alexanderplatz von einer Gruppe Jugendlicher zu Tode geprügelt wurde, und das Mordkomplott, dem die junge Pferdewirtin Christin R. aus Lübars zum Opfer fiel. Ernst Reuß ruft Kriminalfälle ins Gedächtnis, die illustrieren, dass Berlin nicht nur im politischen Sinne Hauptstadt ist …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Vorwort
Ku’damm-Raser
Jonny K.
Drogen, Sex und dunkle Räume
Zerstückelt
Der Feuermord
Tod aus dem Schlafzimmerschrank
Familienehre?
Der Hammermörder
Tödliche Wette
Mord mit Gummibärchen und Chloroform
Unfall oder Mord?
Maria
Tod eines Szenegirls
Pferde, Intrigen, Mordanschläge
Der Autor
Impressum
Ernst Reuß, Mord und Totschlag in Berlin, Neue spektakuläre Kriminalfälle
Texte © Copyright by erma Verlag, Neue Straße 14, 97493 Bergrheinfeld, [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Titelfoto: kaibieler/photocase.de
ISBN: 9783739483108
Vorwort
Schon Mitte der Neunziger als junger Jurastudent war ich fasziniert von Strafrechtsfällen, die wir allerdings immer nur rein rechtlich betrachteten. Schon damals hatte ich die vage Idee, eines Tages die Geschichten hinter den Fällen ein wenig aufzuarbeiten, damit auch die Allgemeinheit von solch äußerst merkwürdigen und juristisch interessanten Fällen Kenntnis erlangen kann. Viele Jahre später ist mir das nun schon zum zweiten Mal gelungen.
Häufig wurde ich gefragt, wie ich so etwas „Trockenes“ wie Jura studieren könne. Ich konnte das nie so ganz nachempfinden. Manche, denen ich einen Fall und dessen Hintergründe schilderte, schüttelten meist verwundert den Kopf und fragten sich, warum sie noch nie davon gehört hatten.
Die Fälle dieses Buches drehen sich um Mord und Totschlag –alle sind in der jüngsten Zeit in Berlin und Brandenburg geschehen. Abseits von dem, was in der Presse stand, werden die Urteilsbegründungen kritisch erläutert, um ein tieferes Verständnis der Abwägungskriterien bei solchen Urteilen zu wecken.
Mehr als eine halbe Million Straftaten kam 2016 in Berlin zur Anzeige. Fast 45 000 Straftäter wurden verurteilt, mehr als 3 000 sitzen in Berlin im Gefängnis. Das Spektrum reicht von Schwarzfahren, Taschendiebstahl über Drogenhandel, U-Bahn-Schlägereien bis zu Mord. Vor allem die größte deutsche Stadt Berlin ist und bleibt ein Brennpunkt der Kriminalität. Angesichts dieser Herausforderungen ist es der überlasteten Polizei und Justiz hoch anzurechnen, dass sie in der Lage sind, dennoch für Recht und Ordnung zu sorgen.
Das Buch geht der Frage nach, warum jemand als Mörder oder „nur“ als Totschläger verurteilt wird? Mordmerkmale wie „Habgier“, „niedrige Beweggründe“, „Heimtücke“, „Mordlust“ und „Grausamkeit“ spielen in den Urteilen und deshalb natürlich auch in diesem Buch eine große Rolle. Vielleicht ein letztes Mal, denn bald wird es diese Mordmerkmale wohl nur noch in den Geschichtsbüchern geben. Eine Gesetzesänderung ist in Planung. Mord und Totschlag sollen im Strafgesetzbuch neu geregelt werden.
So ist ein Buch entstanden, welches sowohl das juristisch interessierte Publikum als auch die Leserinnen und Leser von Tageszeitungen anspricht, die schon immer wissen wollten, warum das Urteil genau so ausgefallen ist, wie es in den Zeitungen berichtet wurde.
Mitunter gehen die Tateinzelheiten schon über das hinaus, was ein schwächerer Magen vertragen kann, und wurden daher nur insoweit so detailliert wiedergegeben, wie das zur Erläuterung der juristischen Wertung notwendig ist.
Ku’damm-Raser
Am 1. Februar 2016 starb bei einem Autounfall in Berlin der 69-jährige Rentner Michael W., ein pensionierter Arzt, der auf dem Heimweg zu seiner Wohnung in der Nähe des Kurfürstendamms war. Sieben Monate danach mussten sich deswegen Marvin N. und Hamdi H. vor der 35. Strafkammer des Landgerichts Berlin verantworten. Sie waren wegen Mordes angeklagt. Mord? Das verwunderte viele unabhängige Prozessbeobachter.
Bei ähnlichen Fällen waren die Unfallverursacher bisher immer nur wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden. Das Strafmaß war dabei wesentlich niedriger als bei Totschlag oder gar Mord. Meist kamen die Täter mit einer Bewährungsstrafe davon. Aber dieser Unfall hatte hohe Wellen geschlagen und wurde medial in ganz Deutschland beachtet. Wieder einmal hatten verantwortungslose, testosterongesteuerte Raser einen Unfall gebaut und ein Unschuldiger war gestorben. Es war nicht der erste Fall dieser Art und es wird wohl nicht der letzte bleiben. Im ganzen Land beobachteten Politiker, Richter und Staatsanwälte den Berliner Prozess.
Die Berliner Zeitung schrieb: „Der Unfall wirkt wie der sprichwörtliche letzte Tropfen, der ein Fass zum Überlaufen bringt. Über 50 illegale Autorennen auf Berliner Straßen hat die Polizei im vergangenen Jahr registriert. Unfälle wurden dadurch verursacht und Menschen verletzt. Überall in der Republik gibt es diese Problemgruppe: junge Männer mit zu viel PS, Männer, die hochmotorisierte Autos brauchen, um sich größer und bedeutender zu fühlen. Sie messen sich auf deutschen Straßen. Wer kann schneller, wer ist geiler? Manchmal passiert es, dass bei diesen Rennen Menschen sterben.“
Die Polizei hatte zunächst wegen fahrlässiger Tötung ermittelt und weitete dann die Ermittlungen auf Totschlag aus, woraufhin die beiden Unfallverursacher am 1. März 2016 in Untersuchungshaft landeten. Möglicherweise war dies aber auch dem Umstand geschuldet, dass die Öffentlichkeit nach erzürnten Presseberichten kein Verständnis dafür hatte, dass der 24-jährige Marvin und der 27-jährige Hamdi weiterhin frei herumliefen. Die Boulevardpresse und deren Paparazzi waren ihnen jedenfalls hart auf den Fersen.
Während der Untersuchungshaft änderte dann die Staatsanwaltschaft den Tatvorwurf ein drittes Mal. Man warf den beiden Männern nun vor, den Tod von Michael W. billigend in Kauf genommen zu haben. Das war ein Mordvorwurf. Doch kann man eine solche Tat wirklich als Mord werten oder war das nur der öffentlichen Entrüstung geschuldet? Die Empörungsmaschinerie lief jedenfalls in der ganzen Bundesrepublik über alle Kanäle. Zu Recht – bei dieser Tat, angesichts derer sich jedermann als potenzielles Opfer sehen konnte.
Folgendes war ermittelt worden: Marvin N. und Hamdi H. hatten mit ihren aufgemotzten Autos offenbar ein Rennen am Kurfürstendamm veranstaltet, das vor dem berühmten Kaufhaus des Westens auf der Tauentzienstraße abrupt endete. Sie waren über den Ku’damm gerast. Links der weiße Mercedes von Marvin mit 380 PS, rechts der weiße Audi von Hamdi mit 225 PS. Es war 0.45 Uhr, als Hamdi H. mit mindestens 160 Stundenkilometern seitlich auf den bei Grün abbiegenden pinkfarbenen Jeep von Michael W. prallte. Der pensionierte Arzt hatte keine Chance zu reagieren. Der Jeep hob ab, flog 72 Meter weit und blieb auf der Seite liegen. Für den Fahrer des Jeeps kam jede Hilfe zu spät. Der Aufprall riss bei seinem Auto das komplette Dach fort, und eine Stange bohrte sich in seinen Kopf. Der Audi streifte Marvins Mercedes, der daraufhin eine Fußgängerampel umfuhr, dann gegen eine Mauer prallte und schließlich sechzig Meter weiter stehen blieb. Der Mercedes flog ein paar Meter und blieb ebenfalls liegen.
Täter waren der 1989 im Kosovo geborene, aber seit 1990 in Berlin lebende Hamdi H. und der 1991 in Berlin geborene Marvin N. Sie gehörten zu einer Szene von Autonarren, die nachts in Berlin in verschiedenen Shisha-Bars verkehrten.
Hamdi H. wuchs in Berlin als ältestes Kind gemeinsam mit fünf Geschwistern bei seinen Eltern auf. Dort lebte er zum Zeitpunkt des Tatgeschehens immer noch. Die Schule hatte er ohne Abschluss verlassen, den er später nachholte. Eine Lehre als Kfz-Mechaniker beendete er nicht. Er lebte in den Tag hinein. Manchmal hatte er einen Job, zuletzt lebte er jedoch von Hartz IV. Seit sechs Jahren war er in einer festen Beziehung und seit Kurzem auch verlobt.
Schon früh zeigte sich Hamdis fataler Hang zur Raserei. Seine Kumpels nannten ihn „Transporter“, nach dem Titelhelden einer Actionfilmreihe. Hamdi trug seinen „Kampfnamen“ mit Stolz nach dem Motto „nomen est omen“, denn in den Transporter-Filmen geht es vor allem um wilde Verfolgungsfahrten in schnellen Wagen, bei denen ein großes Trümmerfeld hinterlassen wird – genauso wie am 1. Februar 2016 vor dem KaDeWe. 2009 hatte Hamdi H. den Führerschein erworben, bestand aber nicht die zweijährige Probezeit. Er hatte bald danach einen schweren Verkehrsunfall verursacht, sodass die Probezeit verlängert wurde. 2013 wurde ihm der Führerschein zunächst endgültig entzogen, am 3. Februar 2014 jedoch schon wieder erteilt. Erst nach dem späteren Gerichtsverfahren wurde beiden Unfallverursachern gemäß § 69 StGB lebenslang die Fahrerlaubnis entzogen. Das Gericht urteilte über Hamdi: „Der Angeklagte verstößt bereits seit langem konsequent und beharrlich gegen bestehende Verkehrsregeln, setzt sein Fahrzeug nach Belieben als nötigendes, behinderndes oder im hiesigen Fall gefährliches Mittel zur Durchsetzung seiner Interessen und in Selbstüberhöhungstendenz ein und gefährdet insbesondere in seiner Eigenschaft als Schnellfahrer in Permanenz andere an Leib und Leben.“
Wie sein großes Vorbild Transporter hielt er sich an keine Verkehrsregeln. Hamdis Liebe zu seinem Auto müsse man sich vorstellen wie die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind, sollte später die Gutachterin erklären. Es habe massiv dazu beigetragen, sein Selbstwertgefühl zu steigern. Hamdi hatte wie erwähnt schon Unfälle gebaut und war bereits wegen fahrlässiger Körperverletzung und wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort bestraft worden. Zwar war er immerhin auch zweimal wegen Einbrüchen auffällig geworden, aber mehr als zwanzig Mal musste er ein Bußgeld wegen überhöhter Geschwindigkeit und Falschparken zahlen. Seine Strafzettel kassierte er mitunter innerhalb von wenigen Stunden. Hamdi schien sich nicht großartig an den Bußgeldern zu stören. Vielleicht hatte er ja auch andere Einnahmequellen. Zumindest der Staatsanwalt vermutete, dass er das Geld für den gebrauchten Audi zusammengeraubt habe. Dafür gab es aber keine Beweise.
Marvin N., der andere Unfallverursacher, war Einzelkind und wohnte noch bei seinen Eltern. Er hatte den Mittleren Schulabschluss und trat 2011 einen vierjährigen Dienst bei den Fallschirmjägern als Zeitsoldat an, kam dort aber nicht klar. Danach war er Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, womit er zuletzt etwa 1 600 Euro brutto pro Monat verdiente. Dennoch leistete er sich ein teures Hobby, denn auch er war versessen auf schnelle Autos, insbesondere auf Mercedes-Benz. Zuletzt hatte er einen Mercedes-Benz CLA AMG 45 4Matic geleast – für monatlich 651,54 Euro, immerhin fast die Hälfte seines monatlichen Nettoverdienstes. Keine zwei Monate vor dem Unfall hatte er ihn schließlich für 50 500 Euro gekauft. Was sein Fahrzeug betraf, war Marvin N. ausgesprochen pingelig, denn seine Freundin durfte sich im Auto nicht schminken, damit kein Puder auf die „Alcantara-Sitze“ gelangen konnte. Essen im Auto war selbstverständlich auch nicht erlaubt. Auch Markenklamotten, insbesondere von Gucci, hatten es Marvin angetan. Er trug teure Sonnenbrillen, fuhr gern mit heruntergelassenen Fenstern und dröhnender Musik. An Ampeln ließ er mit großem Vergnügen den Motor aufheulen. Fast jeder hat dieses Gehabe schon erlebt, und wahrscheinlich haben die meisten resigniert mit dem Kopf geschüttelt, für die Fahrer selbst bedeutet diese Effekthascherei jedoch unverständlicherweise eine Steigerung des Selbstwertgefühls.
Marvin N. war zwar nicht vorbestraft, aber auch mehr als zwanzig Mal wegen Falschparkens und Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit aufgefallen. Einmal, ein halbes Jahr vor dem Unfall, musste er ein Aufbauseminar absolvieren. Genutzt hatte es offensichtlich nichts. Wie seinem Mittäter wurde ihm später lebenslang die Fahrerlaubnis entzogen. Das Gericht stellte fest: „Der Angeklagte ist (…) autoverliebt, protzt mit dem Fahrzeug, steigert über dieses sein Selbstwertgefühl und erachtet es im Wertesystem nach den Bekundungen seiner in der Hauptverhandlung gehörten Freundinnen als über diesen stehend.“ In bemerkenswerter Diktion fuhr das Gericht fort: „In diesem Sinne setzt er es auch ein, ‚fickt die Straße‘, ‚brettert im Highway-Modus‘ über den Kudamm, lässt sich nur von ‚Bastardampeln‘ (bedauerlicherweise nicht im hiesigen Fall) stoppen, fordert andere Fahrer zu einem Stechen heraus und schafft es auch an nur einem Tag, zwei oder drei (festgestellte) Verkehrsordnungswidrigkeiten zu begehen. Bei wertender Gesamtbetrachtung kam daher auch bei diesem Angeklagten nur die Anordnung einer unbefristeten Sperre in Betracht.“ Zu dieser Einschätzung kam das Gericht, weil Marvin auch Videos seiner Fahrten ins Netz gestellt hatte, wo er sie mit markigen Sprüchen derart kommentierte, dass bei einem Daimlerfahrer das Portemonnaie immer voll sei, weil die Nutten das Geld liefern. War dies ernst zu nehmen? Eher nicht, wohl Geprotze zur Steigerung des Selbstwertgefühls. Jedenfalls nahm das Gericht die Videos ernst genug, um dadurch auf Marvins Persönlichkeit und seine zukünftige Fahrtauglichkeit zu schließen.
Marvin wollte am Abend der Tat um 0.30 Uhr seine 22-jährige Freundin Olesya nach Hause bringen, mit der er erst seit Kurzem liiert war. Beide wohnten in Marzahn. Der Weg sollte über den Kurfürstendamm, die Tauentzienstraße und den Wittenbergplatz führen. Jeder Berliner kennt diese „Rennstrecke“, an der nach Geschäftsschluss oft laut dröhnende, getunte Luxuskarren und ihre testosterongesteuerten Fahrer ihr Unwesen treiben. An Geschwindigkeitsbegrenzungen halten die sich für gewöhnlich nicht. Wenn man einen potenziellen Rennpartner ausspäht, verständigt man sich spontan an einer Kreuzung durch Spielen mit dem Gaspedal im Leerlauf und Handzeichen durch die Seitenfenster, um dann bis zur nächsten Kreuzung um die Wette zu fahren. So geschah es auch an diesem Abend.
Die beiden Autonarren kannten sich flüchtig, sie hatten sich bereits vorher in einer Shisha-Bar, in der sich Gleichgesinnte trafen, über ihr Hobby unterhalten. Man wusste also von den gemeinsamen Neigungen, als Hamdi sich am Adenauerplatz von hinten näherte und an der roten Ampel mit heruntergelassener Beifahrerscheibe direkt neben Marvin hielt. Mit Gaspedal und Handzeichen machte er auf sich aufmerksam und lud so zu einer Wettfahrt – einem sogenannten Stechen – ein. Die beiden unterhielten sich kurz durch das geöffnete Autofenster, während Olesya Nachrichten in ihr Smartphone tippte und nicht auf das Gespräch achtete. Offenbar nahm Marvin nach kurzem Zögern die Herausforderung an und beide rasten los. Da Marvin noch an zwei Ampeln gehalten hatte, versuchte er ab Olivaer Platz seinen Konkurrenten einzuholen, der offensichtlich keinen Gedanken daran verschwendete, sich an diese Verkehrsregel zu halten. Von nun an tat Marvin das auch nicht mehr. Olesya sagte später vor Gericht aus: „Ich war schockiert von der Geschwindigkeit. Es war wie in der Achterbahn“. Marvin beschleunigte seinen mit 380 PS ausgestatteten Mercedes so stark, dass er Hamdi in Höhe der U-Bahnstation Uhlandstraße einholte. Zwei Fußgängerinnen sprangen hinter das Geländer des U-Bahneingangs zurück, um nicht von den Rasern erfasst zu werden. Erst hintereinander, dann nebeneinander jagten sich die Möchtegern-Rennfahrer in Richtung Wittenbergplatz. Um die Kurve vor der Gedächtniskirche rasten sie – wie der Gutachter später feststellte – mit Vollgas, ohne die seit mindestens 17 Sekunden rote Ampel an der Kreuzung zu beachten. Hamdi, dessen Audi „nur“ auf 225 PS kam, versuchte, Schritt zu halten. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit durchgetretenem Gaspedal. Eine Zeugin sollte später aussagen, dass sie die Geräusche an die eines startenden Sportflugzeugs erinnerten. Das Gericht dazu in seinem Urteil: „Mit einem noch leichten Vorsprung von wenigen Metern und einer Geschwindigkeit von 139 bis 149 km/h fuhr der Angeklagte N. bei Rot in den Kreuzungsbereich Tauentzienstraße / Nürnberger Straße ein. Auch der Angeklagte H. fuhr bei Rot in den Kreuzungsbereich ein, wobei dieser aufgrund des vollständig durchgetretenen Gaspedals zwischenzeitlich eine Geschwindigkeit von mindestens 160 bis 170 km/h erreicht hatte.“ Spätestens da soll laut Gericht beiden bewusst gewesen sein, dass „ein die Nürnberger Straße befahrender, bei grüner Ampelphase berechtigt in die Kreuzung einfahrender Fahrzeugführer und etwaige Mitinsassen bei einer Kollision mit den von ihnen gelenkten Pkw nicht nur verletzt, sondern aufgrund der von ihnen im Rahmen des vereinbarten Rennens gefahrenen sehr hohen Geschwindigkeiten mit großer Wahrscheinlichkeit zu Tode kommen würde.“ Den Tod anderer Verkehrsteilnehmer nahmen sie bei ihrer Irrsinnsraserei billigend in Kauf, so sah es jedenfalls das Gericht.
Es kam wie es kommen musste. Der Jeep von Michael W. wurde durch den Aufprall „um die eigene Längs-, Hoch- und Querachse gedreht und mit einer Geschwindigkeit von etwa 60 km/h rund 70 m durch die Luft in Richtung Wittenbergplatz geschleudert, so dass es auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand kam“, so das Gericht. Hamdis Audi drehte sich, kollidierte mit Marvins Mercedes und prallte mit 140 Stundenkilometern gegen die aus Granit bestehende Hochbeeteinfassung des Mittelstreifens. Eine Frau wurde nur um wenige Zentimeter von an ihrem Kopf vorbeifliegenden Auspuffteilen verfehlt. Der Audi selbst kam erst rund 60 Meter nach dem Aufprall zum Stehen. Marvin krachte frontal in eine Fußgängerampel, fällte diese und prallte im weiteren Verlauf frontal ebenfalls gegen eine Hochbeeteinfassung – da hatte er immer noch 149 Stundenkilometer auf dem Tacho. Eine Zeugin des Unfalls ging angesichts der überall herumfliegenden Trümmerteile von einem Bombenattentat aus. Die eintreffenden Polizeibeamten sprachen von einem „Schlachtfeld“.
Laut Verkehrsgutachter war Hamdis Auto mit einer Geschwindigkeit von rund 160 bis 170 Kilometern pro Stunde frontal gegen die linke Seite des Jeeps geprallt. Hamdi, Marvin und dessen Freundin konnten ohne fremde Hilfe ihr Fahrzeug verlassen, sie hatten nur leichte Schrammen. Michael W. jedoch erlag noch am Unfallort seinen multiplen Verletzungen. Die Schädel- und Hirnverletzungen, die mannigfaltigen Knochenbrüche und die Verletzung von Lunge, Leber, Herz, Milz und des Darms, die mit erheblichen inneren Blutungen einhergingen, hatten zu einem schnellen Tod geführt.
Marvin irrte nach der Tat umher und suchte sein Handy. Er stand unter Schock und hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht realisiert, dass ein drittes Fahrzeug am Geschehen beteiligt war. Hamdi erlitt angeblich eine Amnesie. Er hockte blutüberströmt und in Socken auf dem Asphalt. „Wie konnte das nur passieren?“, wimmerte er Zeugenaussagen zufolge. Die Wucht des Aufpralls hatte seine teuren Markensneakers ausgezogen, die im Trümmerfeld lagen. Immer wieder soll er sich bei Polizisten und Rettungskräften nach dem Zustand seines heiß geliebten Wagens erkundigt haben. So stand es zumindest in der empörten Boulevardpresse, die die angebliche Gefühllosigkeit der Täter anprangerte. Hamdis Verteidiger wiederum wollte dann im Prozess das Wimmern seines Mandanten als Beweis für das Nichtvorhandensein eines Vorsatzes gewertet wissen. Das Gericht sah dies jedoch anders und meinte, dass das Verhalten des Angeklagten nur geringe Aussagekraft habe, und urteilte: „Unabhängig davon, dass diese Frage von vielen Menschen nach Ereignissen wie dem vorliegenden oft rein rhetorisch gestellt wird, lässt sich aus ihr kein wie immer gearteter Schluss auf das Vor- bzw. Nichtvorliegen des Wissens- oder Wollenselements des bedingten Tötungsvorsatzes ziehen; denn der Angeklagte litt nach dem Unfall an einer Amnesie und musste sich diese Frage, auf die er keine Antwort fand, naturgemäß stellen.“
Sympathiepunkte hatten die Angeklagten mit ihrem Verhalten vor, während und nach der Tat jedenfalls nicht gemacht. Sie sagten nicht aus und hatten sich bisher auch nicht entschuldigt. Voll schuldfähig waren sie auf jeden Fall, denn beide hatten keinen Alkohol getrunken oder Drogen genommen. Auch andere Persönlichkeitsdefizite tangierten laut Gericht die Schuldfähigkeit nicht: „Die (…) narzisstische Selbstüberhöhungstendenz und Opferhaltung bewegen sich auf der Skala menschlicher Persönlichkeitsvielfalten und unterfallen nicht den Eingangsmerkmalen der §§ 20, 21 StGB.“
Das Urteil wurde schließlich nach 17 Verhandlungstagen am Montag, dem 27. Februar 2017, ein Jahr nach dem Tod von Michael W. gefällt. Es war eine juristische Sensation und hochumstritten, denn Hamdi und Marvin wurden tatsächlich wegen „Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs“ zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Sie hätten gemeinschaftlich, also in Mittäterschaft gemäß § 25 Abs. 2 StGB, bedingt vorsätzlich mit gemeingefährlichen Mitteln einen Mord begangen. Eine gefährliche Körperverletzung gemäß §§ 223 Abs. 1, 224 Abs. 1 StGB gegen Marvins Freundin, die Nebenklägerin war und eine Lungenquetschung erlitten hatte, sowie vorsätzliche Gefährdung des Straßenverkehrs gemäß § 315 c Abs. 1 Nr. 2 a) und d) StGB kamen hinzu.
Im Gegensatz zur bewussten Fahrlässigkeit, bei der darauf vertraut wird, dass „schon nichts passieren wird“, nimmt der bedingt vorsätzlich Handelnde das Ergebnis billigend in Kauf. War das in diesem Fall wirklich so? War es Marvin und Hamdi vollkommen egal gewesen, ob bei ihrem Geschwindigkeitsrausch ein Dritter stirbt? Das Gericht bejahte das und begründete es damit, dass dies bei äußerst gefährlichen Gewalthandlungen naheliege. Schon eine Gleichgültigkeit gegenüber dem zwar nicht erstrebten, wohl aber hingenommenen Tod des Opfers rechtfertige die Annahme eines bedingten Tötungsvorsatzes. Bedingt vorsätzlich handelt derjenige, der erkennt hat, dass genau das geschehen könnte, was dann auch geschieht. Es genüge ein nach der Lebenserfahrung ausreichendes Maß an Sicherheit, sodass vernünftige Zweifel nicht aufkommen können. Das muss bei jedem Täter selbst vorliegen, und das erkannte das Gericht auch bei den beiden Unfallverursachern.
Die Verteidigung brachte verschiedene ähnliche Fälle aus der jüngsten Vergangenheit vor, bei der nur von einer fahrlässigen Tötung ausgegangen worden war, was das Gericht allerdings nicht besonders beeindruckte, denn es sei immer der konkrete Fall zu bewerten und man könne diese Fälle nicht mit dem vorliegenden Fall vergleichen. Auch das von der Verteidigung vorgebrachte Argument, dass in der Welt der Raserszene die Risiken des Fahrens mit hoher Geschwindigkeit grundsätzlich ausgeblendet seien und so auch kein bedingter Vorsatz möglich sei, verfing beim Gericht nicht. Man könne nicht eine ganze Menschengruppe aus der Verantwortung entlassen, nur weil sie jegliche Gefahr ihres Handelns generell negiere, argumentierten die Richter. Die bedingt vorsätzliche Tötung eines anderen Menschen ließe sich nur nach einheitlichen Maßstäben beurteilen. Das Gericht meinte, dass sowohl Hamdi als auch Marvin alt und reif genug gewesen seien, um dies zu erkennen. Beide hätten ihr Selbstwertgefühl über ihre Autos und den Fahrstil gesteigert, ohne sich dabei um die Straßenverkehrsordnung zu kümmern: „Auch (…) der an einem Rennen Teilnehmende bleibt eine Person, die ihren Verstand benutzen kann, Lebens- und Verkehrserfahrung gesammelt hat, eine theoretische und praktische Führerscheinprüfung abgelegt und bestanden hat, und die grundsätzlich weiß und erkennen kann, dass ein höchstgefährlicher Fahrstil geeignet ist, den Tod und die Verletzung anderer Menschen zu verursachen.“
Hamdi H., dessen Anwalt sich von einer verkehrspsychologischen Begutachtung viel versprach, ließ sich im Gegensatz zu Marvin N., untersuchen. Die Gutachterin kam dabei zum Schluss, dass er kein realistisches Bild des Gefahrenpotenzials entwickelt habe. Kurz gesagt: Hamdi hielt sich für unverwundbar, weil er am Ku’damm angeblich „kilometerweit voraussehen konnte“. Die Gutachterin meinte, dass die unrealistische Einschätzung des Fahrvermögens nicht auf ein grundsätzliches Unvermögen beruhe, sondern darauf, dass er trotz der vielen Regelverstöße nie ausreichend sanktioniert worden sei und die Freude darüber den negativen Lernprozess noch verstärkt habe. Außerdem sehe er die Ursache in Straßenverkehrskonflikten immer nur bei anderen Autofahrern, die ihm nicht ausweichen, mache Gesetze verantwortlich oder schlechte Bremsen. Auch nach dem Unfall sei das noch so. Er lebe immer noch in dem Glauben, er könne – eigentlich – niemanden gefährden.
Darauf hatte der Verteidiger auch hinausgewollt, denn das würde ja bedeuten, dass sich Hamdi H. keiner Gefahr bewusst gewesen war und den Unfall daher auch nicht billigend in Kauf nehmen konnte. Die Verteidigung argumentierte, dass jemand, der sich für einen übermenschlichen Fahrer hält, gar nicht daran denke, dass er andere umbringen könnte. Dies klingt zumindest nachvollziehbar. Also doch kein bedingter Vorsatz?
Das Gericht widersprach den Argumenten der Sachverständigen und billigte dem Gutachten, das in den Gesamtkontext eingebunden werden müsse, nur „eine indizielle Aussagekraft“ zu. Die verkehrspsychologische Beurteilung eines Geschehens sei für die juristische Vorsatzfeststellung nicht bindend, da der „psychische Sachverhalt“ mit dem „juristischen Psychogramm“ wenig gemein hat. Bei Grundsatzproblemen der Vorsatzdogmatik spreche man nicht dieselbe Sprache. Nun ja, das könnte man auch anders sehen.
Das Gericht war der Auffassung, Raserei stelle keine seelische Krankheit dar, womit es wahrscheinlich durchaus Recht hatte. Jeder Autofahrer könne „schon bei durchschnittlicher Sinnes- und Geistesanspannung“ erkennen, dass ein Unfall bei einem derartigen Rennen passieren kann – selbstverständlich auch in diesem Fall. Dies alles ergab aus Sicht des Gerichts das Bild von unbelehrbaren Verkehrsrowdys.
Marvin, der ein ähnliches Bußgeldregister aufzuweisen hatte und laut Aussagen von Freundinnen als arroganter, selbstgefälliger „Protzer“ galt, den es nicht interessierte, wenn die Beifahrerin von einem „Stechen“ nicht sonderlich begeistert war, wurde auch ohne Sachverständigengutachten ähnlich beurteilt. Im Vordergrund stand für beide Angeklagte der Sieg bei dem Rennen um jeden Preis zum Zwecke der Selbstbestätigung. Sie durchfuhren dabei eine „Rennstrecke“ von etwa 2,5 Kilometern und passierten elf Ampeln, die teilweise auf Rot standen.
Nach Abwägung aller Umstände, hätte – laut Gericht – jedermann wissen müssen, dass ein solches Verhalten tödliche Folgen zeitigen konnte. Aber haben sie es auch wirklich gewollt? Das Gericht bejahte auch dies, denn Marvin N. und Hamdi H. hätten den Tod eines Dritten zwar nicht gewünscht, sich jedoch mit der tödlichen Tatbestandsverwirklichung abgefunden und sich diesbezüglich gleichgültig verhalten. Sie waren bereit, für eine hirnrissige Raserei schwerwiegendste Folgen in Kauf zu nehmen. Auch Marvins Gleichgültigkeit gegenüber dem Wohlergehen seiner Beifahrerin und der Gesundheit und dem Leben anderer Verkehrsteilnehmer zeige das mehr als deutlich. Die Tatsache, dass das Rennen nachts bei niedrigerem Verkehrsaufkommen stattfand, spiele dabei keine Rolle, denn gerade der Ku’damm zwischen der Gedächtniskirche und dem KaDeWe sei ein sehr zentraler Bereich Berlins.
Das Argument der Verteidigung, dass keiner der Täter sein „Heiligtum“ Auto beschädigen wollte, zog vor dem Gericht nicht. Es urteilte: „Die Fahrer dieser Fahrzeuge fühlen sich in ihren tonnenschweren, stark beschleunigenden, mit umfassender Sicherheitstechnik ausgestatteten Autos geschützt, stark und überlegen wie in einem Panzer oder in einer Burg und blenden jegliches Risiko für sich selbst aus.“ Die Beschädigung ihrer eigenen Fahrzeuge hatten Hamid und Marvin während des Rennens also ausgeblendet. Gewinnstreben, die Selbstbestätigung, die Dominanz und das Ansehen unter Gleichgesinnten hätten demnach im Vordergrund gestanden. Mögliche Ängste um das „schöne Auto“ seien im Adrenalinrausch und im „Kick“ des Rennens untergegangen, so das Gericht.
Allerdings sei nicht jeder zu schnell fahrende Autofahrer ein potenzieller Mörder. Es seien immer die Gesamtumstände der Tat zu werten. Dem konnte man nicht widersprechen. Nach all dem kam die Schwurgerichtskammer zum Schluss: „Den möglichen Tod eines querenden Fahrzeugführers wünschten sie nicht, nahmen ihn aber angesichts ihres Gewinnstrebens gleichgültig hin. Ihre extreme Geschwindigkeit, Vollgas, die Missachtung roten Ampellichts, ihre ‚Blindfahrt‘ und die Tatörtlichkeit als innerstädtischer Großstadtbereich beließen dem Geschädigten keine Überlebenschance, zumal auch die Angeklagten selbst keine Möglichkeit mehr hatten, das Unfallgeschehen durch ein Brems- oder Lenkmanöver zu vermeiden.“
Bedingter Vorsatz also und damit keine fahrlässige Tötung. War es aber auch Mord? Passte ein Tatbestandsmerkmal des § 211 StGB. Das Gericht bejahte auch dies. Es verneinte zwar niedrige Beweggründe, also Motive „die nach allgemeiner sittlicher Anschauung verachtenswert waren und auf tiefster Stufe standen“, was bei dem islamistischen LKW-Attentäter vom Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz sicherlich anders ausgesehen hätte, wenn es da zu einem Prozess gekommen wäre. Das Gericht sah aber das Mordmerkmal der Tötung mit gemeingefährlichen Mitteln als erfüllt an. Das Auto konnte als ein gemeingefährliches Mittel angesehen werden. Zwar nicht grundsätzlich, aber in dieser konkreten Situation schon. Erforderlich bei diesem Mordmerkmal ist die Tatsache, dass für einen vom Täter nicht eingrenzbaren größeren Personenkreis eine konkrete Lebensgefahr bestand. Das war hier der Fall. Durch ihre Amokfahrt und dem dadurch entstandenen „Trümmerfeld“ bestand für jedermann, der sich zu dieser Zeit am Ort des Geschehens aufhielt, eine konkrete Gefahr für Leib und Leben. Es ist lediglich glücklichen Umständen zu verdanken, dass zum Unfallzeitpunkt nur das Auto des Opfers die Unfallkreuzung befuhr. Das Gericht dazu: „Dass ihnen dies bewusst war, ist offensichtlich. Ihre Wegstrecke und insbesondere der nähere Tatortbereich waren eben nicht auto- und menschenleer. Wie (…) ausgeführt worden ist, herrschte ein mäßiger, der Nachtzeit entsprechender Verkehr vor, an dem zumindest die benannten Zeugen als Fußgänger teilnahmen. Auf den inner- bzw. hauptstädtischen Charakter des fraglichen Kreuzungsbereichs zwischen Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche / Europacenter und Wittenbergplatz / KaDeWe ist bereits hingewiesen worden. Dass dort auch zur Nachtzeit Menschen in welcher Form auch immer am Verkehrsgeschehen teilnehmen würden, lag auf der Hand und war den Angeklagten für ihre Lieblingsstrecke und den „Lifestyle-Kudamm“ auch bekannt.“
Sowohl Marvin, als auch Hamdi wurden zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt. Bei einem Mord gibt es eben nur diese eine Strafe! Weniger gibt das Strafgesetzbuch nicht her. Eine strikte Systematik. Die Richter stecken in solch einem Fall im Dilemma. Fahrlässige Tötung mit einer Höchststrafe von fünf Jahren ist vielen bei solchen Taten zu niedrig. Totschlag aber wird bei einem Autounfall wegen der Gemeingefährlichkeit schnell zum Mord, was ein wesentlicher Grund dafür ist, weshalb die Justiz für gewöhnlich zurückhaltend ist, bei rücksichtslosen Rasern einen Tötungsvorsatz anzunehmen.
Das Urteil war in juristischer Hinsicht eine Sensation, wurde in der Boulevardpresse stürmisch gefeiert, erfuhr aber in Fachkreisen heftige Kritik.
Das Verfahren sei ein „populistisches Pilotprojekt“, monierte der Anwalt von Marvin N. In der Zeit schrieb ein Professor für Strafrecht unter der Überschrift „Raser sind Verbrecher, aber keine Mörder“: „Nichts ist einfacher, als die Berliner Raser zu Mördern zu machen. Juristisch einfach, weil ihr Verhalten so schreiend lebensgefährlich war, dass sie doch wirklich nicht darauf vertrauen konnten, es werde schon gut gehen. Dann liegt das vor, was Juristen Eventualvorsatz nennen – auch bedingten Vorsatz – und der reicht für den Mordtatbestand (…) Außerdem lässt sich die Wahnsinnsfahrt ohne Weiteres als gemeingefährlich bezeichnen. Und schon ist alles beisammen, was einen der insgesamt neun Fälle ausmacht, in denen das Gesetz eine Tötung zum Mord erklärt: das vorsätzliche Töten mit einem gemeingefährlichen Mittel. Auch moralisch und politisch ist es einfach, die Berliner Raser zu Mördern zu stempeln. Denn ihre Tat ist so empörend, weckt so viel Wut, dass jeder auf Applaus rechnen kann, der ruft: ‚Das ist Mord! Höchststrafe her!‘“ Aber dies sei nicht gerecht, da bei einem Mord nur eine lebenslange Strafe in Betracht käme. Selbst eine so rücksichtslose und tödliche Raserei sei noch etwas anderes als ein Auftrags-, ein Lust- oder ein Giftmord, meinte der Autor. Der Tagesspiegel kommentierte: „Die Höchststrafe anzuwenden auf Männer und ihre Tat, die erst aufgrund eines Zufalls – weil ihnen ein anderer Fahrer in die Quere kam – zu einer ebensolchen werden konnte, wirft Widersprüche auf. Zum Mörder wird man nicht aus Zufall.“
Viele Juristen waren daher der Ansicht, es bedürfe eine Reform des Strafgesetzbuches, insbesondere der aus dem „Dritten Reich“ stammenden Mordmerkmale. Daran arbeiteten Juristen und die Politik schon lange, ohne nennenswerten Erfolg – bisher. Der Autor des oben erwähnten Zeit-Artikels kritisierte die Anwendung des Mordmerkmals Gemeingefährlichkeit. Als der Gesetzgeber von Gemeingefährlichkeit sprach, habe er Bomben vor Augen gehabt und an vergiftetes Trinkwasser oder Brandstiftung gedacht, an Autorennen dagegen gewiss nicht. Außerdem bezweifelte der Strafrechtler das Vorhandensein des bedingten Vorsatzes. Er machte das an einer Testfrage fest: „Haben die Täter versucht – im Rahmen ihrer Wahnsinnsfahrt – Unfälle zu vermeiden? Oder waren sie ihnen egal?“ Kein Eventualvorsatz sei es aber, wenn jemand darauf vertraut, dass es schon gutgehen werde. Für die Gerichte kommt es dabei nicht darauf an, ob jemand vernünftigerweise darauf vertrauen durfte, dass es gutgehen werde. Sondern es kommt nur darauf an, ob er tatsächlich darauf vertraut hat. Dabei komme es nicht darauf an, was ein vernünftiger Mensch hätte denken müssen, sondern nur, „was diese beiden in ihren beschränkten Hirnen tatsächlich gedacht haben“. Daher dürfte es juristisch der ehrlichere Weg sein, den Vorsatz zu verneinen, so der Zeit-Autor. Dies führe aber wiederum zu einem anderen Problem, da derartige Taten nach der momentanen Gesetzgebung zu gering bestraft würden. Fahrlässige Tötung gemäß § 222 StGB und Gefährdung des Straßenverkehrs gemäß § 315c StGB sehen eine Höchststrafe von fünf Jahren vor. Der Gesetzgeber sei nun gefordert, meinte der Autor und den Gerichten gab er den Rat, „nicht einen Mord zu fingieren, der keiner war.“ Starker Tobak.
Der Tagesspiegel resümierte: „Sollte der Schuldspruch vor dem Bundesgerichtshof Bestand haben, wird der Druck auf Staatsanwaltschaften wachsen, solche Taten als Mord oder Totschlag anzuklagen. Häufigere Anklagen wegen Mordes werden vielleicht, wie gewünscht, einige abschrecken. Verurteilungen wegen Mordes werden dennoch nicht immer der tatsächlichen Schuld angemessen sein.“
Am 1. März 2018 entschied schließlich der Bundesgerichtshof und es kam wie es kommen musste, denn der Bundesgerichtshof hob das Urteil auf und wies die Sache zur Neuverhandlung an eine andere Kammer des Landgerichts zurück. Der 4. Strafsenat war der Ansicht, dass die Verurteilung wegen Mordes keinen Bestand haben kann, „weil sie auf einer in mehrfacher Hinsicht rechtsfehlerhaften Grundlage ergangen ist.“
Schon der vom Landgericht Berlin festgestellte Geschehensablauf trage den Vorsatzvorwurf nicht, denn laut Urteil des Landgerichts hätten Marvin und Hamdi die Tötung eines anderen Verkehrsteilnehmers erst dann billigend in Kauf genommen, als sie in die Unfallkreuzung einfuhren. Gleichzeitig habe das Landgericht jedoch festgestellt, dass die beiden Verurteilten zu diesem Zeitpunkt keine Möglichkeit mehr hatten, den Unfall zu verhindern; weil sie zu dem Zeitpunkt absolut unfähig gewesen waren, noch zu reagieren. Laut BGH ein Widerspruch, denn ein Tötungsvorsatz kann ja dann nicht mehr gefasst werden, wenn man auf das weitere Geschehen sowieso keinen Einfluss hat. Dementsprechend sei das Urteil des Landgerichts insoweit unlogisch und musste daher aufgehoben werden.
Im Übrigen gibt der BGH zu bedenken, dass die vom Landgericht aufgestellte Behauptung, dass sich die beiden Fahrer „wie in einem Panzer oder in einer Burg“ absolut sicher fühlten und jegliches Risiko ausgeblendet hatten, nicht belegt sei. Einen Erfahrungssatz dieses Inhalts gäbe es nicht. Man hätte zumindest prüfen müssen ob die etwaige Eigengefährdung einen Vorsatz ausschließe. Das Landgericht habe das aber nicht mal geprüft, da es die nicht belegte Behauptung aufstellte.
Widersprüchlich habe das Landgericht auch insoweit geurteilt, weil es Marvin gleichzeitig vorwarf den Tod seiner mitfahrenden Freundin billigend in Kauf genommen zu haben. Wie könne das sein, wenn er sich „sicher, wie in einer Burg“ gefühlt habe?
Zuletzt kritisiert der BGH, dass das Landgericht Marvin, dessen Auto ja nicht in Michaels Jeep raste, so ohne weiteres als Mittäter behandelt worden sei, da die Verabredung, gemeinsam ein illegales Straßenrennen auszutragen, alleine für die Annahme eines mittäterschaftlichen Tötungsdelikts nicht ausreichen würde.
Das waren schon einige Ohrfeigen für die Richter am Landgericht Berlin.
Marvin und Hamdi können nun auf eine mildere Strafe hoffen, aber auch da wird man sehen, wie die neue Kammer des Landgerichts entscheiden wird. Ein Persilschein für Raser ist das Urteil nämlich nicht, denn Raser können weiterhin als Mörder verurteilt werden. Es kommt jedoch immer auf den Einzelfall an.
Es wird daher auf jeden Falls spannend bleiben. So einfach wie zuvor werden uneinsichtige Raser sicherlich nicht mehr davonkommen.
Inzwischen hat nämlich der Gesetzgeber an einem Gesetz gearbeitet, welches derartige Taten härter bestrafen kann, ohne sie gleich als Mord zu klassifizieren. Ende Juni 2017 beschloss der Bundestag den neu eingefügten § 315d StGB „Verbotene Kraftfahrzeugrennen“. Veranstalter und Teilnehmer von illegalen Rennen sollen von nun an mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft werden. Ihre Fahrzeuge, auf die sie so stolz sind, können nun eingezogen werden. Bis zu zehn Jahren Gefängnis gibt es dann, wenn jemand bei einem derartigen Rennen schwer verletzt oder getötet wird. Das könnte ein Weg aus dem strafrechtlichen Dilemma zwischen „fahrlässiger Tötung“ und „Mord“ sein. Zuvor war die Teilnahme an solchen Rennen mit 400 Euro Bußgeld und einem Monat Fahrverbot geahndet – ein Witz angesichts der Gemeingefährlichkeit derartigen Tuns!
Tragischerweise hatte sich auch das Opfer der Tat mit diesem Thema beschäftigt und sich nicht allzu lange vor seinem Tod in einem Leserbrief an eine Tageszeitung gewandt, in dem er sich über die milde Strafe von derartigen Rasern beschwerte. Ihm nützt das Urteil und das neue Gesetz leider nichts mehr, aber vielleicht hat sein schrecklicher Tod etwas in den Köpfen geändert und offensichtlich den Gesetzgeber endlich zum Handeln bewegt. Abschreckend könnten das Urteil und der neue Paragraf allemal wirken, auch wenn „testosterongesteuerte“ Raser nicht unbedingt vernunftbegabt sind. Unbelehrbare wird es immer geben, so wie der Mercedes- und der Audifahrer, die nur kurz nach dem Kudamm-Urteil des Landgerichts bei einem Wettrennen in Berlin-Kreuzberg ebenfalls einen Unfall mit hohem Sachschaden verursachten, der Gott sei Dank kein Menschenleben kostete.
Quellen
Berliner Morgenpost vom 24.08.2016
Berliner Zeitung vom 26.01.2017
Der Tagesspiegel vom 27.02., 05.07.2017
Die Zeit vom 28.02.2017 (Gastbeitrag von Tonio Walter)
Welt am Sonntag vom 26.02.2017
rbb online vom 08.09.2016, http://www.rbb-online.de/panorama/beitrag/2016/09/warum-mord-kudamm-raser-kurfuerstendamm-prozess-.html (abgerufen am 26.09.2016)
Landgericht Berlin, Urteil vom 27.02.2017, Az: (535 Ks) 251 Js 52/16 (8/16)
Bundesgerichtshof Mitteilung der Pressestelle Nr. 045/2018 vom 01.03.2018
Jonny K.
Im Oktober 2012 erschütterte Berlin ein Gewaltverbrechen wie noch kaum eines zuvor. Der 20-jährige Jonny K., Sohn einer Thailänderin und eines Berliners, starb, nachdem er am Berliner Alexanderplatz von einer Gruppe Jugendlicher massiv geprügelt worden war. Das Rote Rathaus, Dienstsitz des Regierenden Bürgermeisters, der zu diesem Zeitpunkt Klaus Wowereit hieß, war nur gut 200 Meter vom Tatort entfernt.
Jonny, der noch bei seinen Eltern in Spandau lebte und gerade dabei war, sein Fachabitur zu machen, starb an Blutungen im Gehirn. Nachdem sich seine Angehörigen von ihm verabschiedet hatten, wurden die lebenserhaltenden Maschinen abgeschaltet. Die Ärzte waren zur Auffassung gekommen, dass dem jungen Mann nicht mehr zu helfen war.
Wieder einmal wurde das Thema jugendliche Gewalt heftig und sehr erregt diskutiert. Die Berliner Zeitung schrieb am 15. Oktober unter der Überschrift „Mord am Alexanderplatz“: „Der am Wochenende am Alexanderplatz in Berlin zusammengeschlagene 20-Jährige ist tot. Die Maschinen, die den Mann im Krankenhaus am Leben hielten, wurden abgeschaltet. Von den Tätern fehlt weiterhin jede Spur.“ Doch was war zuvor geschehen?
Jonny K. war am Abend des 13. Oktober 2012 mit Freunden feiern, wie es junge Leute vor allem am Wochenende so zu tun pflegen. Es galt, den Geburtstag zweier gemeinsamer Freunde zu begehen. Die Feier fand am Alexanderplatz in einem unterhalb des Fernsehturms gelegenen Lokal statt. Sturztrunk war anscheinend angesagt, denn die Freunde tranken so viel, dass sie letztendlich aus dem Lokal geworfen wurden. Einer von ihnen hatte sich in den Räumlichkeiten übergeben. Man beschloss daher, den besoffenen Kumpel in ein Taxi nach Hause zu setzen. Es wurde auch Zeit, denn es war schon fast 4.00 Uhr morgens. Ihr Gefährte war sogar so betrunken, dass er nicht mehr gehen konnte. Gerhardt C., wohl der Stärkste aus der Truppe, schleppte ihn daraufhin huckepack aus dem Lokal. Ein weiterer Begleiter machte sich auf den Weg, um ein Taxi zu besorgen. Nachdem ihm sein betrunkener Freund zu schwer geworden war und er ihn auf einem Stuhl vor einem bereits geschlossenen Café absetzen wollte, schien genau dies offensichtlich eine andere Gruppe von sechs jungen Männern zu provozieren, die zuvor in der Nähe eine andere Party besucht hatten und auch auf dem Heimweg waren. Einer von ihnen machte sich einen Spaß daraus, dem Volltrunkenen den Stuhl wegzuziehen, sodass er hilflos am Boden lag. Als Jonny seinem Freund helfen wollte, wurde er brutal zusammengeschlagen und getreten, bis er bewusstlos war. Die Situation war in weniger als einer Minute eskaliert und dauerte nicht lang, dann lag Jonny im Koma. Den Ermittlungen zufolge standen die Täter in einem Kreis um ihr am Boden liegendes Opfer und traktierten es mit Tritten. Auch Jonnys 29-jähriger Freund Gerhardt C. wurde von der Tätergruppe verprügelt und erlitt, nach mindestens zehn Boxhieben ins Gesicht, einen Bruch des linken Jochbeins, des linken Augenhöhlenbodens und des linken Handwurzelknochens. Im Spiegel konnte es so gelesen werden: „Es kommt zum Gerangel zwischen Onur U. und Gerhard[t] C. Wie von Sinnen soll U., ein ehemaliger Amateurboxer, auf den anderen eingeprügelt haben. So heftig, dass sich noch heute alle daran erinnern können, wie sie durch die Menge schrien: ‚Onur, es reicht!‘, ‚Hör auf! Hör auf!‘ und ‚Willst du ihn umbringen?!‘ Gerhard[t] C. sei danach trotzdem wieder aufgestanden.“
Jonny jedoch stand nicht wieder auf. Das Gericht sollte später in seinem Urteil feststellen: „Am Morgen des 14. Oktober 2012 gegen 4.00 Uhr kam es infolge von Gewalteinwirkungen aus der Gruppe der Angeklagten gegen den Kopf oder einen durch Gewalt verursachten Sturz mit dem Kopf auf das Straßenpflaster des 20 Jahre alt gewordenen Jonny K. zu massiven Subarachnoidalblutungen (Hirnblutungen) bei diesem. Am Morgen des 15. Oktober 2012 wurde um 9.57 Uhr sein Hirntod festgestellt.“
Ein Motiv war nicht ersichtlich. Laut Berliner Zeitung sprachen die Fahnder von „reiner Mordlust“. Von den Schlägern fehlte jede Spur, sodass von der Staatsanwaltschaft „aufgrund der Brutalität dieses Verbrechens auf öffentlichem Straßenland“ eine Belohnung von bis zu 15 000 Euro für Hinweise auf die Täter ausgelobt wurde.
Die Öffentlichkeit war sehr empört, denn auch diesmal konnten sich viele vorstellen, selbst Opfer einer derart sinnlosen Gewalttat zu werden. Ähnlich war es zuletzt 2009 beim Fall Dominik Brunner in München gewesen. Auch da kochte die Volksseele und das Sicherheitsgefühl der Allgemeinheit war massiv beeinträchtigt. Wieder waren es brutale jugendliche Schläger! Früher hat es so etwas nicht gegeben! Es wird immer schlimmer. Diese und ähnliche Sätze konnte man in den Medien und in den Gesprächen der Menschen vernehmen. Die Öffentlichkeit, Medien und Politiker waren sich wieder mal einig, auch wenn die Kriminalitätsstatistiken diese Wahrnehmungen nicht bestätigten. Selbstverständlich wurden schärfere Gesetze gefordert und einige Politiker sonnten sich mit „Law and Order“ - Forderungen in der medialen Öffentlichkeit. Wie immer, wenn etwas derart Unbegreifliches geschieht.
Die Polizei ermittelte fieberhaft, es gab Hinweise auf eine Gruppe Jugendlicher, die in einem nahe gelegenen Lokal gefeiert haben sollen. Dort fand die After-Show-Party eines in türkischen Kreisen bekannten Sängers statt. Die Polizei wertete Fotos aus, die dort von dem Event für eine Zeitschrift gemacht wurden. Schon fünf Tage später war ein gewisser Onur U. mehr als verdächtig. Sein Name war bei Vernehmungen öfters gefallen. Onur U. war früher ein talentierter Boxer gewesen und hatte einen bekannten Onkel, der es bei den Olympischen Spielen in Atlanta 1996 als Boxer sogar zu einer Silbermedaille für Deutschland gebracht hatte.
Onur war bereits in die Türkei abgehauen und hatte schleunigst sein Facebookprofil gelöscht, wie die Polizei feststellte. Wie die Polizei später ermittelte, hatten auch seine später festgenommenen Mittäter ihre Facebookprofile gelöscht und einige sogar ihre SIM-Karte weggeworfen. Man hatte sich offenbar abgesprochen. Aber das nützte nichts, denn ein Mitwisser hatte geplaudert, was ein anderer zufällig in einem Friseurladen aufschnappte. Dieser wiederum ging mit seinem Wissen zur Polizei.
Nachdem von Jonnys Tod in den Zeitungen berichtet wurde, gab es viel Klatsch. Einige kannten die Täter, die sich anfangs noch mit ihrem „Kampf“ gebrüstet hatten. Nun – nach der Todesmeldung – waren sie bestürzt und wussten nicht so recht weiter. Ein gemeinsamer Ratschlag der Väter der Beteiligten führte erst einmal nicht weiter. Nicht alle Väter waren dafür, dass sich ihre männlichen Nachkommen freiwillig der Polizei stellen sollten. Die Polizei suchte inzwischen weiter nach Onurs Mittätern. In abgehörten Telefonaten eines Intensivtäters fielen noch mehr Namen, und bereits am 23. Oktober 2012 nahm die Polizei in Berlin-Wedding den 19-jährigen Osman A. fest, der zu der sechsköpfigen Tätergruppe gehört haben soll. Am nächsten Tag schon berichtete die Presse über zwei weitere Festnahmen. Der Fahndungsdruck war offenbar zu groß geworden, denn die beiden Mittäter Memet E. (19) und Melih Y. (21) meldeten sich schon am Tag nach Osman A.s Festnahme in Begleitung ihrer Rechtsanwälte bei der Mordkommission in der Schöneberger Keithstraße. Hüseyin O. (21), ein weiterer Täter, stellte sich einen Monat später freiwillig der Polizei. Auch er hatte wohl die letztendliche Vergeblichkeit des Versteckspiels eingesehen. Auch die letzten beiden Täter, die sich zwischendurch in die Türkei abgesetzt hatten und dort provokant einem Bildzeitungsreporter Rede und Antwort gestanden hatten, stellten sich einige Monate später. Sie hatten mittlerweile ebenfalls die Aussichtslosigkeit ihrer Flucht eingesehen. Onur U. (19) und Bilal K. (24) kehrten im März bzw. April 2013 mehr oder weniger freiwillig zurück, nachdem sich sogar Bundeskanzlerin Merkel eingeschaltet und mit dem türkischen Ministerpräsidenten Erdogan über die Auslieferung verhandelt hatte. Da rechneten sie sich dann wohl doch keine Chance mehr aus, ungeschoren davon zu kommen.
Der Tagesspiegel, der die Gruppe als „fünf harmlose Typen und ein bekannter Schläger“ charakterisierte, beschrieb die Täter später folgendermaßen: „Sie alle sind in Berlin geboren und aufgewachsen, haben türkische und griechische Pässe, Onur U.