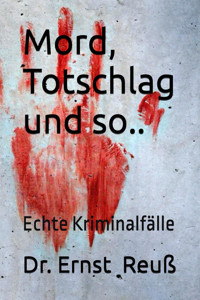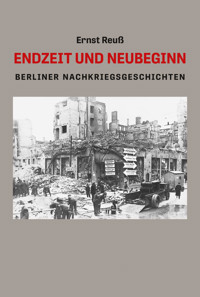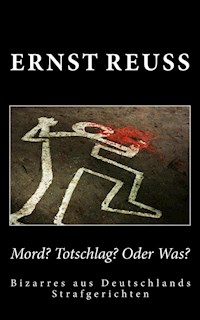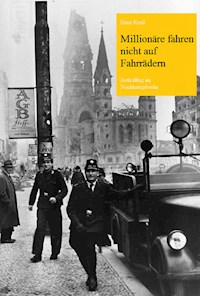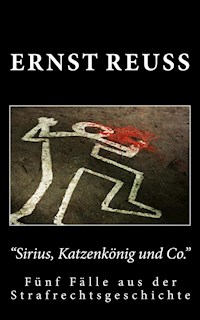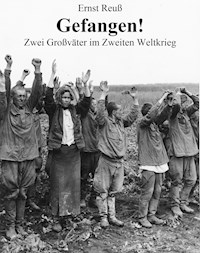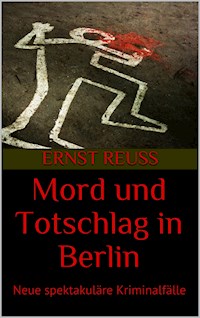9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Diese Arbeit über den Neuaufbau der Berliner Justiz nach dem Zweiten Weltkrieg vermittelt ein lebendiges, illustrierendes Bild der Nachkriegszeit und zeigt, in welchem politischen Spannungsfeld der Neuaufbau stattfand. Die Aufarbeitung der Justizgeschichte, und dabei insbesondere die Rolle der Ostberliner Justiz nach der Spaltung, trägt zu einem rechtshistorisch und rechtssoziologisch geprägten Bild der Probleme und Nöte der Justiz und der Bevölkerung in den ersten Nachkriegsjahren bei und gewährt spezifische Einblicke in die Entstehung eines neuen Rechts- und Gesellschaftssystems. Berlin in der Nachkriegszeit, als Miniaturbild des Kalten Krieges, ist für eine solche Untersuchung besonders geeignet, da es gerade dort nun galt, die entscheidenden Machtpositionen zu sichern. Das Justizsystem wurde dabei zu einem Eckpfeiler bei der Sicherung der Macht; in ihm spiegelten sich die sich gegenüberstehenden, sehr unterschiedlichen politischen Ideologien wider. Die Untersuchung von ca. 3000 Gerichtsakten des Amtsgerichts Berlin-Mitte aus der Zeit von 1945 bis 1952 zeigt, wie rasch sich die Justiz und die Bevölkerung auf die neuen Machtverhältnisse einstellten - und wie leicht ausgebildete oder auszubildende Juristen Spielball einer Ideologie wurden. Kurz nachdem am 2. Mai 1945 für Berlin die Kapitulationsurkunde unterzeichnet wurde, machte sich die siegreiche Rote Armee nicht nur daran die Trümmer des „1000-jährigen Reiches“ aufzuräumen und die Versorgung der Berliner Bevölkerung zu sichern, sondern organisierte auch Verwaltung, Polizei und Gerichte neu. Bereits am 8. Mai wurde eine Eheschließung registriert, die nach den NS-Rassegesetzen niemals möglich gewesen wäre. Ab 14. Mai verkehrten wieder die ersten U-Bahnzüge. Am 19. Mai begann der neue Magistrat seine Tätigkeit. Der Aufbau der neuen Gerichtsorganisation war zum 1. Juni abgeschlossen, was auch überaus notwendig war, denn in der ausgebluteten, ausgehungerten und zerbombten Stadt wurde geplündert, geraubt und gemordet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Ernst Reuß
Berliner Justizgeschichte
Eine Dissertation zum strafrechtlichen Justizalltag im Nachkriegsberlin
Dieses eBook wurde erstellt bei
Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Buch interessieren! Noch mehr Infos zum Autor und seinem Buch finden Sie auf tolino-media.de - oder werden Sie selbst eBook-Autor bei tolino media.
- gekürzte Vorschau -
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort zum E-Book
Vorwort zur Dissertation
Einleitung
Erstes Kapitel: Die Rolle der Strafjustiz in Umbruchzeiten
Impressum tolino
Vorwort zum E-Book
Diese Arbeit hat der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin im Wintersemester 1999/2000 als Dissertation vorgelegen und wurde anschließend publiziert.
Mit der Veröffentlichung als E-Book soll die leicht überarbeitete Dissertation nicht nur den Benutzern wissenschaftlicher Bibliotheken vorbehalten sein, sondern einem breiteren Kreis von Interessierten zugänglich gemacht werden. Denn im Gegensatz zu dem bei einem wissenschaftlichen Fachverlag hohen Verkaufspreis einer Printausgabe ist eine Ausgabe als E-Book für jedermann erschwinglich.
Die damalige, d. h. vor der Rechtschreibereform gültige Schreibweise wurde beibehalten.
Zum Inhalt: Die Arbeit beschreibt anhand von ca. 3000 Gerichtsakten den Neuaufbau der Berliner Justiz. Sie zeigt ein lebendiges, illustrierendes Bild der Nachkriegszeit. Kurz nachdem am 2. Mai 1945 für Berlin die Kapitulationsurkunde unterzeichnet wurde, machte sich die anfangs allein zuständige Rote Armee nicht nur daran die Trümmer des „1000-jährigen Reiches“ aufzuräumen und die Versorgung der Berliner Bevölkerung zu sichern, sondern organisierte unter Einbeziehung von politisch meist nicht belasteten Deutschen auch Verwaltung, Polizei und Gerichte neu.
Bereits am 8. Mai wurde eine Eheschließung registriert, die nach den NS-Rassegesetzen niemals möglich gewesen wäre. Ab 14. Mai verkehrten wieder die ersten U-Bahnzüge. Am 19. Mai begann der neue Magistrat seine Tätigkeit. Der Aufbau der neuen Gerichtsorganisation war zum 1. Juni abgeschlossen, was auch überaus notwendig war, denn in der ausgebluteten, ausgehungerten und zerbombten Stadt wurde geplündert, geraubt und gemordet. Nur mit einer funktionierenden Strafverfolgung konnten Rechtsverstöße verfolgt und ein geregeltes Zusammenleben ermöglicht werden, was den Wiederaufbau und das spätere „Wirtschaftswunder“ erst möglich machte.
Ernst Reuß
Berlin, Januar 2015
Vorwort zur Dissertation
Die Arbeit, die der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin im Wintersemester 1999/2000 als Dissertation vorlag, beschäftigt sich mit dem Neuaufbau der Berliner Justiz nach dem Zweiten Weltkrieg und soll ein lebendiges, illustrierendes Bild der Nachkriegszeit zeigen sowie einen Beitrag zur Entwicklung der Rechtsgeschichte und Rechtskultur der Nachkriegszeit leisten, der auch verdeutlicht, in welchem politischen Spannungsfeld der Neuaufbau stattfand. In der Arbeit wird der spezielle Status Berlins und der Einfluß der sowjetischen Administration auf die Großberliner und später auf die Ostberliner Justiz besonders berücksichtigt.
Für Anregungen und mannigfache Unterstützung bei der Entstehung dieser Arbeit habe ich vielen Menschen zu danken:
Für die Tatsache, daß es mir ermöglicht wurde, diese Arbeit anzufertigen, bin ich besonders Herrn Prof. Dr. Rainer Schröder und Herrn Prof. Dr. Hubert Rottleuthner zu großem Dank verpflichtet. Ferner danke ich Herrn Dr. Thomas Lorenz für wertvolle Quellenhinweise, Herrn Dr. Klaus Peinelt-Jordan und den Studenten der Freien Universität Berlin für die Hilfe bei der Datenerhebung, sowie Herrn Rechtsanwalt Albrecht Lediger, der sich trotz einer anstrengenden Tätigkeit noch der Mühe der Lektorierung unterwarf und letztendlich den immer freundlichen und hilfsbereiten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landesarchivs Berlin.
Ernst Reuß
Berlin - Kreuzberg, August 2000
Einleitung
Ziele der Untersuchung
Mit der vorliegenden Untersuchung soll das soziale Phänomen der Kriminalität sowie deren Ursachen und Ahndung in Umbruchphasen analysiert werden. Dabei soll ein lebendiges, illustrierendes Bild der Nachkriegszeit gezeigt und ein Beitrag zur Entwicklung der Rechtsgeschichte und Rechtskultur der Nachkriegszeit vorgelegt werden, der verdeutlicht, in welchem politischen Spannungsfeld der Neuaufbau stattfand. Diese Aufarbeitung der Justizgeschichte, und dabei insbesondere die Rolle der Ostberliner Justiz nach der Spaltung, versucht zu einem rechtshistorisch und rechtssoziologisch geprägten Bild der Probleme und Nöte der Justiz und der Bevölkerung in den ersten Nachkriegsjahren beizutragen und spezifische Einblicke in die Entstehung eines neuen Rechts- und Gesellschaftssystems zu gewähren.
Aufgrund des Umfangs des ausgewerteten Aktenbestandes, der nur Urteile von Einzelrichtern vor deutschen Gerichten umfaßte, ist es möglich, einige spezielle Teilausschnitte der Kriminalität zwischen 1945 und 1952 zu zeichnen. Dabei wird keine Strukturanalyse des Strafrechts in der SBZ und später in der DDR durchgeführt, sondern anhand einzelner Beispiele der Umgang einer neu geschaffenen Justiz mit den neu entstandenen Problemen gezeigt.
Die Berliner Justizgeschichte in der Nachkriegszeit ab 1945 ist für eine solche Untersuchung besonders geeignet, da durch die Aufteilung Groß-Berlins in Besatzungszonen und der dort vorherrschenden materiellen und organisatorischen Problematiken die Lage in ganz Deutschland, insbesondere aber auch der West-Ost Konflikt, widergespiegelt wird. Die „Frontstadt“ Berlin, in der sich die vier Siegermächte an einem Punkt versammelten, gibt als Miniaturbild des Kalten Krieges beim Neuaufbau einer Justiz ein gutes Beispiel ab, denn dieser Konflikt warf schon bald nach der Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation am 7./8. Mai 1945 in Reims und Berlin seine ersten Schatten und es galt nun, für die sich von ehemaligen Koalitions- zu Konfrontationsmächten entwickelnden Sieger, die entscheidenden Machtpositionen zu sichern. Das Justizsystem wurde dabei zu einem Eckpfeiler zur Sicherung der Macht in den folgenden Jahren; in ihm spiegelten sich die sich gegenüberstehenden, sehr unterschiedlichen politischen Ideologien wider.
In der Arbeit wird der spezielle Status Berlins und der Einfluß der sowjetischen Administration auf die Großberliner und später auf die Ostberliner Justiz besonders berücksichtigt. Genauer zu betrachten war der Versuch der Errichtung einer einheitlichen Justiz unter verschiedenen Gesellschaftssystemen. Das Scheitern dieses Versuchs durch die Spaltung der Berliner Justiz. Sowie der danach beginnende Aufbau einer sozialistisch geprägten Justiz im Osten der Stadt.
Die Darstellung von Problemen, die der Neuaufbau des Berliner Justizsystems mit sich brachte, soll nicht nur aufschlußreiche Erkenntnisse über die Anfänge der Justiz in der Bundesrepublik und in der DDR geben, sondern auch die Anfänge des Kalten Krieges beleuchten. Die Geschichte der Strafgerichtsbarkeit in Berlin ab 1945 und in den ersten Jahren der neu gegründeten DDR soll Licht auf die Grauzone zwischen dem Ende des Nationalsozialismus und der Gründung der DDR bzw. der BRD werfen.
Die Untersuchung des strafrechtlichen Justizalltags ist für die Darstellung der immensen Probleme, die ein solcher sozialer Umbruch nach sich zieht, besonders geeignet. Die Entwurzelung eines großen Teils der Bevölkerung, der sich oftmals seiner bisherigen Lebensgrundlagen beraubt sah, sowie die Schaffung neuer Eliten und die Kompliziertheit des Alltags in der Nachkriegszeit führte zu einer erhöhten, aber auch zu einer neuartigen, der speziellen Nachkriegsproblematik angepaßten, Kriminalität. Belegen läßt sich dies auch anhand der damals verwendeten Strafvorschriften, die sich von den heutigen zum Teil erheblich unterscheiden.
Ein weiterer Blick soll dabei darauf gerichtet werden, inwieweit bei der Errichtung eines neuen Gesellschaftssystems Recht und Gerechtigkeit eine Rolle spielten, oder ob lediglich ein rechtspositivistisches Verwalten der besonderen Nachkriegssituation stattfand. Dabei soll der Umgang der Justiz mit aus Not zu Straftätern gewordenen Bürgern und die daraus resultierende Änderung der Rechtskultur untersucht werden. Dies wird anhand des dazu vorhandenen Aktenbestandes untersucht, geschieht aber auch durch Auswertung der dazu vorhandenen Literatur sowie der damals erschienenen Fachzeitschriften, in denen sich beispielsweise unter anderem auch die Frage stellte, ob sich der Strafrichter angesichts der Not nicht weigern müsse, gewisse Vorschriften über die Rationierung und die Verbrauchsregulierung mit strafrechtlichen Mitteln durchzusetzen. Anhand von Urteilsbegründungen und dem Erlaß neuartiger Gesetze sowie den Einlassungen der Angeklagten wird untersucht, wie rasch sich die Justiz und die Bevölkerung auf neue Gegebenheiten einstellten. Von besonderem Interesse ist die Frage, inwieweit schon im Sprachgebrauch der Urteilsabfassung eine Anpassung an die neuen Verhältnisse bzw. an das neu zu schaffende „sozialistische Rechtsbewußtsein“ erfolgte.
Ein Amtsgericht ist deshalb ein gutes Fallbeispiel, weil nur dort die Bagatellkriminalität abgeurteilt wurde. Gerade durch die Analyse dieser Form der Kriminalität können die Besonderheiten der Nachkriegssituation beleuchtet werden. Dabei bietet die Rechtsprechung des Amtsgerichtes Berlin-Mitte aufgrund seiner zentralen Lage und seiner besonderen Zuständigkeiten auch deshalb einen für die Untersuchung guten Ansatz, weil es besonders mit der Problematik zweier nebeneinander existierender unterschiedlicher Gesellschaftskonzeptionen und der daraus resultierenden sektorenübergreifenden Kriminalität zu tun hatte und in so fern typisch für die Situation Groß-Berlins war. Mittels der vorhandenen Aktenbestände des Amtsgerichts Berlin-Mitte konnte ein Teil der Alltagskriminalität untersucht und damit ein Ausschnitt der Nachkriegsjahre in die zeithistorische Forschung mit einbezogen werden. Über die Analyse der Akten hinaus wurden Normen, veröffentlichte Literatur und statistisches Material herangezogen.
Eine weitergehende Untersuchung der Landgerichte und der alliierten Gerichtsbarkeit kam nicht in Betracht, da keine vergleichbaren Aktenbestände zur Verfügung standen. Eine ausführliche Darstellung der Justizpolitik der Verwaltungen und Parteien würde im übrigen den Rahmen der Untersuchung sprengen. Untersucht werden konnte jedoch die Gesetzgebung und deren unmittelbare Auswirkung, sowie der Umgang der Amtsrichter mit den neuen bzw. neu zu bewertenden Normen. Die zeittypischen Normen wie z. B. Stromdiebstahl, Kuppelei, gewerbliche Unzucht, und Obdachlosigkeit, die zeittypischen notbedingten Vergehen, wie beispielsweise Schwarzhandel und Buntmetalldiebstahl sowie die zeittypischen umbruchbedingten Vergehen wie z.B. Verstöße gegen die Wirtschaftsordnung und Devisenvergehen wurden dabei genauer untersucht. Durch eine derartige Aufarbeitung werden die der Spaltung vorausgehenden Geschehnisse sowie die Anfänge der langjährigen Spaltung Deutschlands aus der Sicht der Justiz dargestellt. Dabei wird ein Bild der justizrelevanten Alltags- und Bagatellkriminalität gezeichnet sowie die soziale Bedingtheit der Kriminalität in Berlin von 1945 bis 1952 herausgearbeitet. Berücksichtigt wurde ebenfalls der, aus der Neuordnung der rechtsprechenden Gewalt resultierende, personelle Umbruch in der Strafgerichtsbarkeit, sowie die Frage, inwieweit nach 1945 ein Richterwechsel stattfand.
Nicht nur resümierende Literaturstudien und zeitgeschichtliche Forschungen, sondern eine rechtstatsächliche Erhebung von ca. 3 000 gut erhaltenen Akten des Amtsgerichts Berlin-Mitte aus den Jahren von 1945 bis 1952 sind eine Gelegenheit zur Gewinnung aufschlußreicher Erkenntnisse über die besondere Nachkriegssituation und die Anfänge der neuen Justiz.
Erfaßt wird ein Teilbereich der sozialen Problematik, welcher durch die Strafgerichtsbarkeit bewältigt werden sollte. Mit den vorhandenen persönlichen Daten der Angeklagten können Rückschlüsse auf Täterpersönlichkeiten bzw. deren Umfeld gezogen werden. Die Personalstruktur der Gerichte, die Strafzumessung und vorhandene tendenziöse Urteile können auf politische Vorgaben einer neu inszenierten Justizpolitik hinweisen. Letztendlich soll die Arbeit aber auch den neuen Juristengenerationen als warnendes Beispiel dienen, wie leicht ausgebildete oder auszubildende Juristen Spielball einer Ideologie sein können und wie fraglich der Begriff der wertfreien Wissenschaft gerade in der Jurisprudenz sein kann.
Für die Untersuchung stellten sich daher folgende Fragen:
1. Welche Probleme beim Neuaufbau einer Justiz waren zu meistern, um die Transformation einer Justiz von einer faschistischen Diktatur in eine Nachkriegsjustiz unter gänzlich anderen Vorzeichen zu bewältigen?
2. Welche Mittel und Methoden wurden von den neuen Machthabern angewendet, um die Justiz und deren Personal bereits wenige Jahre nach Kriegsende wieder zu einem willfährigen Instrument der Staatsräson zu machen?
3. Welchen Einflüssen unterlag die Bagatellkriminalität und wie hat sie sich entwickelt?
4. Welche Rolle spielte die Alltagskriminalität in Umbruchphasen und wie wurden die zeittypischen Vergehen bestraft?
5. Hat sich die Strafzumessung im Laufe der Jahre bzw. nach der Spaltung der Justiz in Berlin geändert?
Zum Stand der Forschung
Eine intensive Beschäftigung mit der Berliner Justizgeschichte nach 1945 fand nur durch Friedrich Scholz statt (Scholz, Berlin und seine Justiz, 1982), der die Geschichte des Kammergerichtsbezirks von 1945 bis 1980 darstellte. Umfassendere Untersuchungen der Nachkriegssituation waren bisher vorrangig beschränkt auf Struktur- und Zeitgeschichtsanalysen (so z.B. Rottleuthner, [Steuerung der Justiz, 1994] und Broszat/Weber, [SBZ-Handbuch, 1993]). Rechtstatsächliche Erhebungen zur Lebenssituation der Bürger unter einem sich neu bildenden Strafrechtssystem fanden bisher nicht statt (zur Zivilgerichtsbarkeit aber schon, vgl. Schröder, [Zivilrechtskultur der DDR, 1999]), da normalerweise Gerichtsakten aus dem Bereich der Bagatellkriminalität aus der Nachkriegszeit in Deutschland nicht mehr vorhanden bzw. der Forschung nicht zugänglich sind, so daß diese Untersuchung eine einmalige Chance zur Illustration der unmittelbaren Nachkriegsjustiz bietet.
Auszuwertender Aktenbestand
Im Januar 1991, 15 Monate nach der Vereinigung, wurde eine auf Schätzung beruhende Bestandsaufnahme von Akten auf den Dachböden des Gerichtsgebäudes Littenstraße vorgenommen. Dort, am ehemaligen Stadtbezirksgericht und früheren Kammergericht, lagerten noch sehr viele Strafrechtsakten des AG Berlin-Mitte aus der unmittelbaren Nachkriegszeit. Es wurde schließlich eine Anzahl von ca. 47 000 noch vorhandener Strafrechtsakten aus dem Zeitraum 1945 bis 1952 geschätzt. Es handelte sich dabei um General- und Prozeßakten. Die Akten sollen anschließend in verschiedene Archive gebracht worden sein.
Nach Auskunft des Landesarchivs Berlin wurden die Akten 1992 vom Amtsgericht Berlin-Mitte in ungeordnetem Zustand übernommen. Es gab keine Übergabelisten, so daß man weder einen Überblick über den Inhalt, noch über die Menge der Akten entnehmen konnte. Die Übernahmezahlen konnten daher nur geschätzt werden. Insgesamt wurden ca. 1 000 laufende Meter Akten übernommen (Zivil- und Strafgerichtsbarkeit aus der Zeit von 1934 bis 1952 und von 1960 bis 1964). Der Anteil der Strafakten aus dem Zeitraum 1945 bis 1952 machte ca. 115 laufende Meter á 100 Akten aus. Es wurden also ca. 11 500 strafrechtliche Prozeßakten an das Landesarchiv überliefert. Davon wurden inzwischen 6 646 Akten vernichtet. Bei den vernichteten Akten handelte es sich vor allem um Akten mit den Registerzeichen As, Bs, Cs, Es, Gs, die teilweise Bestandteil dieser Untersuchung waren. Nur wenige Akten aus diesem Bereich wurden zur Aufbewahrung ausgewählt (Kriterien waren: Interesse an besonderen Deliktsgruppen, Umfang der Akten, Personen des öffentlichen Lebens). Das Schriftgut mit den Registerzeichen Ds und Dls blieb allerdings komplett erhalten und wird momentan erschlossen, so daß am Landesarchiv nun insgesamt noch ca. 5 000 Strafprozeßakten vorhanden sind. Die übrigen Strafakten aus der Zeit nach 1945 sind momentan nicht auffindbar und befinden sich nach dortiger Auskunft weder beim Landgericht Berlin noch beim Amtsgericht Berlin-Mitte noch bei einem anderen Archiv.
Ein Teil der im Landesarchiv lagernden Strafrechtsakten wurde von Studenten der FU Berlin im Rahmen eines Seminars gesäubert, sortiert und teilweise ausgewertet. Viele Akten waren jedoch in einem nicht mehr archivierbaren Zustand. Mittels eines im Anhang beigefügten Erhebungsbogens wurden 2 745 Akten mit 3 405 Angeklagten statistisch erfaßt. Desweiteren wurden stichprobenartig ungefähr 300 Akten und alle vorhandenen Generalakten inhaltlich und textanalytisch untersucht. Der erschlossene Aktenbestand enthält gut erhaltene Strafakten aus dem Bereich der Alltagskriminalität der Nachkriegszeit. Der Aktenbestand setzt sich aus verschiedenen Verfahrensarten zusammen. Teilweise wurden die Verfahren vor einem Schnellgericht geführt, teilweise erging lediglich ein Strafbefehl (oft mit standardisierten Strafbefehlsvordrucken für bestimmte Vergehen) ohne mündliche Verhandlung, teilweise handelt es sich um Privatklageverfahren und um Verfahren vor Jugendgerichten. Der überwiegende Teil enthält normale Verfahrensabläufe.
Eine Erschließung eines derartigen Bestandes von Strafakten in Anbetracht der besonderen Nachkriegssituation Ostberlins fand bisher noch nicht statt. Erfaßt werden sollte ein möglichst repräsentativer Querschnitt aus allen Jahren. Leider waren bestimmte Jahrgänge und Verfahrensarten nur sehr unvollständig vorhanden, so daß das ursprüngliche Ziel nicht erreicht werden konnte. Bei der Aktenanalyse handelt es sich daher nicht um eine repräsentative Auswertung; dennoch ist anhand der normalen Verfahrensabläufe und der neuartigen Normen ersichtlich, was damals als notwendig angesehen wurde, um den Wiederaufbau unter neuen Vorzeichen zu bewerkstelligen und es konnte untersucht werden, wie spezifische Nachkriegsverbrechen geahndet worden sind.
Erstes Kapitel: Die Rolle der Strafjustiz in Umbruchzeiten
Allgemeiner historischer Überblick
Mit der Kapitulation des „Dritten Reiches“, die am 7. Mai 1945 im amerikanischen Hauptquartier in Reims unterzeichnet wurde und in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945 im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst wiederholt worden war (1), wurde auch der Startschuß zum Wiederaufbau des deutschen Gerichtswesens gegeben.
Auf den Konferenzen in Teheran (November 1943) und Jalta (Februar 1945) hatten sich die Alliierten über die Errichtung eines Alliierten Kontrollrats, die Einteilung Deutschlands in Besatzungszonen und die gemeinsame Verwaltung Berlins geeinigt.
Das von der Europäischen Beratenden Kommission erarbeitete „Protokoll über die Besatzungszonen in Deutschland und die Verwaltung von Groß-Berlin“ vom 12. September 1944 sowie das „Londoner Abkommen über die Kontrolleinrichtungen in Deutschland“ vom 14. November 1944 wurden bei der Jalta-Konferenz in Kraft gesetzt. Frankreich, als vierter Alliierter, trat dann diesem Abkommen entsprechend dem Ergänzungsabkommen zum Londoner Protokoll am 26. Juli 1945 bei (2).
Schon seit Kriegsbeginn war der Gerichtsbetrieb stark eingeschränkt (3), aber noch bis Mitte/Ende April 1945 wurde versucht, den Gerichtsbetrieb notdürftig aufrecht zu erhalten. Trotz Bombardierung Berlins gingen noch viele Richter zu Fuß zum Gericht, da öffentliche Verkehrsmittel nicht mehr fuhren (4).
Mit dem Sieg der Roten Armee hatte die bisherige Justizorganisation aufgehört zu bestehen. Ermittlungstätigkeit und Rechtsprechung in Berlin waren eingestellt. In der Erklärung der Regierungen der Sowjetunion, der USA, Großbritanniens und Frankreichs vom 5. Juni 1945 (5) über die Übernahme der obersten Regierungsgewalt in Deutschland „einschließlich aller Befugnisse der deutschen Regierungen, Verwaltungen oder Behörden der Länder, Städte und Gemeinden“ hieß es, daß die oberste Gewalt „von jedem in seiner eigenen Besatzungszone und gemeinsam in allen Deutschland als ein Ganzes betreffenden Angelegenheiten“auszuüben sei. „Die Verwaltung des Gebiets von Groß-Berlin wird von einer interalliierten Behörde geleitet, die unter der Leitung des Kontrollrates arbeitet und aus vier Kommandanten besteht, von denen jeder abwechselnd als Hauptkommandant fungiert.“
Der von der sowjetischen Besatzungsmacht eingesetzte Magistrat hatte allerdings seine Tätigkeit in Berlin bereits am 19. Mai 1945 aufgenommen. Er bestand aus 14 Abteilungen mit Stadträten als Abteilungsleitern und einem Beirat für kirchliche Angelegenheiten. Oberbürgermeister wurde Dr. Arthur Werner. Er hatte vier Stellvertreter, von denen zwei zugleich Abteilungsleiter waren (6). Dem von den Sowjets eingesetzten Magistrat gehörten somit, neben sechs kommunistischen Funktionären, je zwei Sozialdemokraten und Parteilose sowie sieben dem bürgerlichen Lager zuzurechnenden Mitgliedern an (7).
Nach Einmarsch der westlichen Besatzungsmächte konstituierte sich am 11. Juli 1945 die Alliierte Kommandantur und am 30. Juli 1945 der Alliierte Kontrollrat. Der Alliierte Kontrollrat mit Sitz in Berlin, bestehend aus den vier Oberkommandierenden der Streitkräfte Frankreichs, Großbritanniens, der Sowjetunion und der Vereinigten Staaten entfaltete eine Gesetzgebungstätigkeit, die nicht nur den vordringlichen Zielen der Beseitigung des Nationalsozialismus und der Bestrafung von Kriegsverbrechern galt, sondern auch der Bekämpfung der Alltagskriminalität. Der Alliierte Kontrollrat konnte nur einstimmig entscheiden und entschied nur über Sachen, die Deutschland im Ganzen betrafen(8)
Die Verwaltung und damit auch die Justizverwaltung Groß-Berlins wurde einer interalliierten Behörde, der Alliierten Kommandantur, überlassen. Auch sie bestand aus Vertretern der vier Siegermächte und unterstand unmittelbar dem Kontrollrat.
Anders als in den übrigen Zonen Deutschlands galten die von den Oberbefehlshabern erlassenen Gesetze in den entsprechenden Sektoren Berlins erst, wenn dies ausdrücklich angeordnet wurde (9).
In den sowjetischen Besatzungszonen gab es außerdem die Sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD). Diese wurde durch eine vom Rat der Volkskommissare der UdSSR bestätigte Anordnung vom 6. Juni 1945 geschaffen. Ihr Sitz war Berlin. Sie war in den Ländern und Provinzen durch eine „SMA“ auf Landesebene vertreten. Die Gesetzgebungsakte der SMAD ergingen als Befehle des Obersten Chefs der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland (10).
Die Zeit unmittelbar nach der Kapitulation
Der Neuanfang
Schon am 28. April 1945 konnte der Militärkommandant der Stadt Berlin, Generaloberst Bersarin (11), mit dem Befehl Nr. 1 bekanntgeben, daß die gesamte administrative und politische Macht in Berlin auf ihn übergegangen sei (12). Am 2. Mai 1945 wurde dann in Tempelhof die Kapitulationsurkunde durch den letzten deutschen Kampfkommandanten für Berlin, General Helmut Weidling, unterzeichnet. Durch diese Unterzeichnung waren Berlin und damit auch die Berliner Justiz nun vollständig in der Gewalt der Roten Armee. Verwaltung und Justiz Berlins waren also nicht erst mit der deutschen Kapitulation am 7./ 8. Mai 1945 auf die sowjetische Besatzungsmacht übergegangen, sondern schon an jenem 2. Mai 1945. Schon kurz nach der Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde durch General Weidling machte sich die sowjetische Besatzungsmacht daran, nicht nur die Versorgung der Bevölkerung zu sichern, sondern auch einen neuen Verwaltungs- und Justizapparat (13) aufzubauen, so daß bereits am 8. Mai im Bezirksamt Charlottenburg eine Eheschließung registriert werden konnte, die nach den NS-Rassegesetzen nicht möglich gewesen war (14).
Bis zum Einzug der westlichen Alliierten im Juli 1945 war Berlin alleine durch das sowjetische Militär besetzt und wurde daher auch alleine von der sowjetischen Siegermacht verwaltet. Generaloberst Bersarin ordnete schon Anfang Mai 1945 den Aufbau eines Gerichtswesens an. Dies geschah, um die zu erwartende Nachkriegskriminalität, die durch die sowjetische Militärgerichtsbarkeit alleine nicht zu bewältigen gewesen wäre, einzudämmen. Der eigentliche Justizaufbau-Befehl von Stadtkommandanten Bersarin datiert vom 25. Mai 1945 (15).
Max Berger, der spätere Militäroberstaatsanwalt der DDR, schrieb dazu in seinen Erinnerungen (16):
„In diesen ersten Stunden und Tagen nach der Zerschlagung des Faschismus kam bei einem großen Teil der Bevölkerung der verheerende Einfluß der Naziideologie darin zum Ausdruck, daß Menschen, die noch einige Stunden zuvor im Keller um ihr Leben gebangt und gelobt hatten, jahrelang trocken Brot essen zu wollen, wenn nur der schreckliche Krieg ein Ende nähme, die Befreiung dazu benutzten, leerstehende Geschäfte und Wohnungen zu plündern und sich zu bereichern.
Ein anderer Bevölkerungsteil, an der Spitze Kommunisten, Sozialdemokraten und andere Antifaschisten, die aus dem KZ, aus Zuchthäusern und Gefängnissen zurückgekehrt waren, ging sofort, ohne nach Essen und Trinken und Entlohnung zu fragen, daran, mit Unterstützung durch die Kommandanten der Roten Armee wieder Ordnung in dieses Chaos zu bringen.“
Ob Bergers möglicherweise weltanschaulich gefärbte Sicht der Dinge so als allgemeingültig angesehen werden kann, erscheint eher zweifelhaft. Dennoch entspricht es den Tatsachen, daß schon unmittelbar nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges viele Menschen tatkräftig damit begannen, das Land und auch dessen Justiz wieder aufzubauen. Es handelte sich dabei selbstverständlich oft auch gerade um diejenigen, die während der Herrschaft der Nationalsozialisten ausgegrenzt oder gar verfolgt wurden und jetzt endlich wieder konstruktiv tätig sein konnten. Ein Zeitzeuge, der spätere Generalstaatsanwalt beim Kammergericht Günther, beschrieb diese Anfangszeit in pathetischen Worten, wie folgt (17):
„Nie wird der Chronist jenen Tag vergessen, als er, mit Freunden zusammen aus Potsdam, wo er die letzten Kriegswochen erlebt hatte, nach Berlin aufbrach, um sich, zwölf Jahre nach der nunmehr beendeten Machtübernahme, der Justiz wieder zur Verfügung zu stellen. Es war ein strahlend schöner Maienmorgen. Beim Verlassen des Waldes, unweit von Zehlendorf, herrschte tiefe friedliche Stille ringsum. Nur einige Soldatengräber sowie ein zerschossener, ausgebrannter Straßenbahnwagen am äußersten Rande der großen Stadt erinnerten daran, daß hier, wenige Tage zuvor, noch Kampfhandlungen stattgefunden hatten. Einer der Freunde sprach aus, was in der zeitlosen, undurchdringlichen Stille dieses an sich so heiteren Maientages jeder empfand: ‘Es ist wie bei Erschaffung der Welt.’ Fast feierlich sagte er das; und ein anderer präzisierte den Eindruck, indem er hinzusetzte: ‘Wie nach der Sintflut.’ Etwas davon lag, nur für einen Augenblick lang, in der Luft. Wir sind noch einmal davongekommen. Dieser Gedanke hatte etwas fast überwältigendes; doch das beglückende Gefühl, das er auslösen mochte, war nur von kurzer Dauer. Sehr bald stand, die Fata Morgana verdrängend, wieder hart die Wirklichkeit im Raum:
Am Anfang war alles wüst und leer. Dies war das Bild, das sich, wenige Stunden später, in den Bezirken der Innenstadt bot. Ein Bild des Chaos. Dennoch begann vor diesem Hintergrund, trotz aller Zerstörung und Verwüstung, das Neue; und auf eben diesen Trümmern und Scherben baute auch, unbegreiflich genug und fast aus dem Nichts, die Justiz wieder auf.
Wüst und leer lag das große Gerichtsgebäude da, als nach beschwerlichem Fußmarsch das Ziel, die Neue Friedrichstraße, erreicht war. Auf den langen Korridoren des zerschossenen, durch- und durchgepusteten Steinpalastes trieb der Frühlingswind Bürostaub und Papierfetzen vor sich her. Aus den Regalen der Registraturen waren, soweit Gestelle und Schränke überhaupt noch standen, zerfetzte Akten und Bücher gefallen. Da lagen sie, unter ausgelaufenen, halb eingetrockneten Tintenfässern, Amtssiegeln, Stempeln und Stempelkissen, bunt durcheinandergewirbelt und mit Mörtelstaub dick überpudert; zwischen umgestülpten Tischen und Bänken; unter zerbrochenen Stühlen und abgebrochenen Mauerteilen. Unbewacht und jedermann zugänglich, zu Urkundendelikten geradezu herausfordernd, blieb das alles tage-, wochen- und monatelang unverändert so liegen. Auch nachdem in den weniger zerstörten Räumen der Betrieb wieder aufgenommen worden war, gab es nicht Kräfte genug, die gegen soviel Staub und Zerstörung hätten ankommen und der maßlosen - einer bis dahin nie gekannten - Unordnung hätten Herr werden können.
Dieses Tohuwabohu war ein Symbol: Es bedeutete das Ende der alten Justiz, der ‘Rechtswahrerherrlichkeit’ des ‘Dritten Reiches’, von der nichts geblieben war als dieses Bild des Chaos und des Jammers. Zugleich aber war das der Anfang einer neuen Justiz. Sie sah sich vor eine kaum zu bewältigende Aufgabe gestellt; vor ein schier hoffnungsloses Unterfangen. Es gehörte damals viel Mut, sehr viel Tatkraft und Zuversicht dazu, einfach zu beginnen und irgendwo zuzupacken.“
Jedenfalls mußten Polizei, Gerichte und Staatsanwaltschaften neu organisiert werden. Generaloberst Bersarin kann wohl als oberster Gerichtsherr Berlins angesehen werden (18).
Die Neuordnung des Gerichtswesens
Am 18. Mai 1945 (19) fand im Gebäude des bisherigen Amtsgerichts Lichtenberg (20) ein Zusammentreffen aller sowjetischen Militärkommandanten der Berliner Stadtbezirke mit den von ihnen ernannten Staatsanwälten und Richtern sowie Generaloberst Bersarin statt. Lediglich fünf der Ernannten waren keine Juristen (21).
Auf dieser Tagung am 18. Mai wurde die Marschroute zum Neuaufbau der Berliner Justiz vorgegeben, wobei den Richtern und Staatsanwälten freie Hand bei Organisation und Besetzung als auch bei der Wahl des Sitzes der Bezirksgerichte gelassenwurde (22). Max Berger erinnerte sich so (23):
„Am 5. Mai 1945, nur wenige Tage nach dem Einmarsch der Roten Armee in Berlin, erhielt ich vom Bürgermeister des Verwaltungsbezirkes Prenzlauer Berg den Auftrag, mich bei dem Kommandanten der Roten Armee im Bezirk zu melden. Der Militärkommandant erklärte mir, nachdem er sich eingehend mit mir über meinen Werdegang und meinen Beruf unterhalten hatte, dass ich ab sofort als Staatsanwalt im Bezirk Prenzlauer Berg eingesetzt sei. Gleichzeitig erhielt ich den Auftrag, im Bezirk Prenzlauer Berg den Aufbau der Staatsanwaltschaft und des Gerichts zu organisieren und einen für das Amt des Richters geeigneten Bürger vorzuschlagen. Ich war zunächst sprachlos, denn ich hatte auf keinen Fall an den Aufbau einer ordentlichen Gerichtsbarkeit gedacht, sondern angenommen, dass Tribunale gebildet werden sollten, um Naziverbrecher und Plünderer abzuurteilen. Jetzt aber stand eine schwierige Aufgabe vor mir, denn vom gesamten technischen Apparat eines Gerichts und einer Staatsanwaltschaft hatte ich doch keine genaue Kenntnis, obwohl ich vor 1933 einige Jahre lang als Rechtsbeistand vor den Berliner Zivilgerichten aufgetreten war. Tagelang habe ich nach einem Juristen gesucht, der das Richteramt hätte übernehmen können. Adressen aus dem Telefonbuch führten mich von einer Trümmerstätte zur anderen, aber es gab kein Haus, in dem sich noch eine Rechtsanwaltspraxis befand. Richter und Staatsanwälte wohnten ja im Osten Berlins ohnehin sehr selten, und sie wären auch sicherlich nicht geeignet gewesen, ein neues Richteramt zu übernehmen. Nach längerer Umfrage erhielt ich dann schließlich die Adresse eines alten ehemaligen Richters, der jedoch schwer krank war und sich deshalb nicht zur Verfügung stellen konnte. Er empfahl mir aber einen anderen ehemaligen Richter jüdischer Konfession, der auch bereit war, das neue Richteramt anzunehmen; er wurde daraufhin vom Kommandanten des Bezirks als Richter eingesetzt. In der Zwischenzeit war es mir auch gelungen, in einer Schule in der jetzigen Dimitroffstraße, in der sich ein Teil der Bezirksverwaltung befand, einige Räume für Gericht und Staatsanwaltschaft zu sichern (...) Nun ging es an die Erfüllung der Aufgabe, bis zum 1. Juni 1945 im Bezirk Prenzlauer Berg eine arbeitsfähige Staatsanwaltschaft und ein arbeitsfähiges Amtsgericht zu errichten. Der Stadtbezirk Prenzlauer Berg hatte damals etwa 250 000 Einwohner, und wir mußten daher mit einem erheblichen Arbeitsanfall rechnen. Die Frage war jetzt: wie und wo anfangen? Von der Bezirksverwaltung konnte ich keine große Hilfe erwarten, denn die war mit ihren wenigen Kräften selbst genug beschäftigt, das Leben wieder in Gang zu bringen. Ich mußte also aus eigener Initiative heraus handeln. Ich begann damit, daß ich in der Hosemannstraße ein gut erhaltenes Gebäude, das früher von faschistischen Organisationen benutzt worden war, beschlagnahmte und als Sitz für die Staatsanwaltschaft und das Amtsgericht bestimmte. Von früheren Geschäftsstellen der Nazipartei und anderer Naziorganisationen wurden Mobilar, Schreibmaschinen und Schreibutensilien aller Art besorgt, um die Geschäftsstellen der Staatsanwaltschaft und des Amtsgerichts damit auszustatten. Aus dem Gerichtsgebäude in der jetzigen Littenstraße erhielten wir zwei Richterpodien und einige Aktenregale, aus dem Kriminalgericht in Moabit Gesetzestexte und Kommentare sowie Schreibpapier und Formulare, die wir auf dem Handwagen zu unserem Gericht schafften. Die erforderlichen Mitarbeiter meldeten sich auf einen Anschlag im Bezirkbürgermeisteramt hin: ein ehemaliger Amtsanwalt, mehrere Justizangestellte und ein alter Gewerkschafter, der als Strafrichter eingesetzt wurde. Von den insgesamt 18 Justizangestellten waren einschließlich des aufsichtführenden Richters 50 Prozent ehemalige Justizangestellte. Am 25. Mai 1945 war die Staatsanwaltschaft und das Amtsgericht Prenzlauer Berg ordnungsgemäß eingerichtet und arbeitsbereit. Es bestand aus einer Verwaltungs-, einer Zivilprozeß- und einer Strafprozeßabteilung.“
Durch den Befehl des Generalobersten Bersarin und den Einsatz der ernannten juristischen Aufbauhelfer sollte die bisherige Organisation entscheidend reformiert werden: künftig sollte es nicht mehr die Zweiteilung Amts-/Landgerichte geben, sondern nur noch ein einziges Eingangsgericht (dies aber in jedem Verwaltungsbezirk). Genauso sollte die Staatsanwaltschaft (24) aufgebaut werden.
Diese Neugestaltung der Gerichtsbarkeit bedeutete eine wesentliche Abweichung von den Bestimmungen des bis dahin geltenden Gerichtsverfassungsgesetzes. „Diese Gerichtsorganisation kannte nur zwei Instanzen und verwies alle Strafsachen und bürgerlichen Streitigkeiten an das Bezirks- bzw. Amtsgericht; also auch die Ehescheidungssachen.“ (25)
Die Bezirksgerichte, die Ende Mai 1945 ihre Tätigkeit aufnahmen, waren daher für alle (26) Strafsachen, Zivilrechtsstreitigkeiten und Arbeitsgerichtsachen inerster Instanz zuständig. Besetzt waren sie mit einem Vorsitzenden und zwei Schöffen, wobei hier neben politisch unbelasteten Juristen sofort auch Nichtjuristen wie etwa Arbeiter, Verfolgte des NS-Regimes und andere Antifaschisten eingesetzt wurden. Für alle Gerichte sollte es ein einziges Berufungs- und Beschwerdegericht, (27) das „Stadtgericht“ (28), geben, dessen erster Präsident am 20. Mai 1945 (29) Prof. Dr. Arthur Kanger wurde (30). Eine dritte Instanz gab es vorerst nicht.
Der neue Präsident war kein Jurist, sondern als Pharmazieprofessor langjähriger Gerichtschemiker. Da er jedoch aus dem Baltikum stammte und mehrere Jahre in Odessa als Hochschullehrer wirkte, war er der russischen Sprache mächtig, was nach den Chronisten wohl der Hauptgrund seiner Ernennung war. Allerdings wurden ihm erfahrene Juristen als Berater zur Seite gestellt und er kümmerte sich lediglich um die Gerichtsorganisation.
Am Stadtgericht gab es insgesamt nur drei, mit je einem Stadtgerichtsdirektor und zwei Räten besetzte Kammern, je eine für Straf-, Zivil- und freiwillige Gerichtsbarkeit. Zwar wurde das „Stadtgericht“ in einem anderen Gebäude (Neue Friedrichstraße, seit 1951 Littenstraße) untergebracht; es kann dabei aber immer noch davon ausgegangen werden, daß es sich dabei eigentlich um das hier weiterbestehende Kammergericht handelte. Grund für die Verlegung in ein anderes Gebäude war der Wille der Sowjets, das Kammergericht in ihrem Einflußbereich zu behalten. Das alte Gerichtsgebäude in der Elßholzstraße war jedenfalls weitestgehend unbeschädigt (31) und Sitz des Bezirksgerichtes Schöneberg (32).
All dies war so bei der Zusammenkunft in Lichtenberg am 18. Mai 1945 beschlossen worden, wobei auch erklärt wurde, daß als Richter und Staatsanwälte nur zuverlässige Demokraten tätig sein durften. Hilde Benjamin schrieb dazu (33):
„Am 18. Mai 1945 wurde ich in aller Eile zum russischen Kommandanten geholt: Ich erhielt den Auftrag (der etwa um die gleiche Zeit in jedem Berliner Bezirk einem antifaschistischen Juden erteilt wurde), ein neues Gericht für den Steglitzer Bezirk zu organisieren (...) Es gehört zu meinen stärksten Erlebnissen, wie wir am 18. Mai durch das zerschossene, noch rauchende Berlin fuhren, um im Lichtenberger Amtsgericht an der denkwürdigen Sitzung teilzunehmen, in der durch den Vertreter des Generals Bersarin das neue Berliner Gerichtswesen konstituiert wurde. Von sämtlichen Berliner Bezirken waren die Richter und Staatsanwälte versammelt, um in ihre Ämter eingesetzt zu werden. Ich weiß nicht, ob damals oder später überhaupt allen Beteiligten klargeworden ist, was es bedeutete, daß zwei Wochen nach der Kapitulation der Sieger dem Besiegten ein solches Vertrauen aussprach, daß er ihm unter eigener Veranwortung die Gerichtsbarkeit wieder übertrug. Die ersten Strafsachen, die in Steglitz verhandelt wurden, spiegelten die Lage jener Tage wider: Zwei Frauen, die entnervt durch die Schrecken des Krieges ihre Kinder getötet hatten und dann sich selbst das Leben nehmen wollten; einer der Marodeure der Kampftage, der sich mit falschen Vollmachten bereichern wollte; Jugendliche, die glaubten, ihre Raubzüge, die sie im letzten Kriegswinter unternommen hatten, fortsetzen zu können; Plünderer des Stubenrauchkrankenhauses, die durch keinen Aufruf zu bewegen gewesen waren, die in blinder Gier zusammengerafften Sachen, ärztliche Einrichtungsgegenstände, Betten, Verbandszeug, Medikamente, zurückzugeben.“
Die Bezirksgerichte nahmen ihre Tätigkeit also nicht nur im Umfang ihrer früheren Geschäfte (34) auf, sondern taten dies ohne Rücksicht auf die Höhe des Streitwerts und ungeachtet des Charakters der einzelnen Delikte sowie der hierfür angedrohten Strafen; sie waren ausnahmslos für sämtliche Zivil- und Strafsachen zuständig (35). Sie verhandelten und entschieden sogar in den nach dem Gerichtsverfassungsgesetz vor das Schwurgericht gehörenden Verfahren. Sie konnten mithin die Todesstrafe verhängen und taten dies auch (36). Allerdings fanden sich keine derartigen Verfahren im ausgewerteten Aktenbestand.
„Mit diesem Intermezzo, das freilich nur ein halbes Jahr währte, waren die wesentlichsten Teile des Gerichtsverfassungsgesetzes praktisch außer Kraft gesetzt, und zwar nicht nur hinsichtlich der Vorschriften über den Aufbau, die (berufsrichterliche) Zusammensetzung und die Zuständigkeit der einzelnen Spruchkörper, sondern im wesentlichen auch hinsichtlich der einleitenden Bestimmungen über die Gerichtsbarkeit sowie über das Präsidium und die zur Feststellung des ‘gesetzlichen Richters’ bis dahin in Kraft gewesenen strengen Vorschriften über die Geschäftsverteilung.“ (37)
Die in Lichtenberg erteilten Aufgaben wurden in einen engen Zeitrahmen gepreßt, denn der Aufbau dieser neuen Gerichtsorganisation sollte bis zum 1. Juni 1945 abgeschlossen sein. Tatsächlich konnte dieses Ziel auch erreicht werden. Am 1. Juni konnten alle, nunmehr 21, Bezirksgerichte ihre Funktionsbereitschaft melden. Ebenso konnten dies das Stadtgericht als Berufungs- und Beschwerdeinstanz und die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin-Mitte (38).
Der Zahl nach blieben die 21 „Bezirksgerichte“ vorerst erhalten, obwohl es nur 20 Bezirke (39) gab. Bis 1945 hatte es in Berlin zwölf Amtsgerichte gegeben. Die neue Bezeichnung Bezirksgerichte war allerdings nicht sonderlich lang gebräuchlich (40):
„Die Bezeichnung ‘Bezirksgerichte’ bürgerte sich nicht ein. Sie hielt sich nicht lange. Nach knapp drei Wochen wurde sie abgeschafft; und zwar aus einem sehr schlichten und praktischen Grund: Bei dem Mangel an Papier und Arbeitskräften hatte es sich als lästig erwiesen, die durchweg noch auf die alte Bezeichnung ‘Amtsgericht’ lautenden Vordrucke und Stempel auf das ‘Bezirksgericht’ umzuschreiben. Wie nicht selten in dieser Welt der Bürokratie zeigte sich auch hier, daß Stempel und Formulare stärker sein können als die Menschen, die sie benutzen. So also kam es, daß die neu errichteten Bezirksgerichte, der altvertrauten Bezeichnung entsprechend, sehr bald wieder ‘Amtsgerichte’ hießen.“
Legislative Tätigkeit
Grundsätzlich galt die Gesetzgebung bis Januar 1933. Aber auch später erlassene Gesetze konnten weiterhin angewandt werden, soweit sie keinen rassenfeindlichen Charakter hatten und nicht auf die nationalsozialistische Weltanschauung zurückzuführen waren. Auf Seite 1 des Verordnungsblattes der Stadt Berlin im Jahre 1945 wurde folgende Generalklausel verlautbart:
„Die Richtlinien der Alliierten sind für das deutsche Volk Gesetz. Danach sind alle von der nationalsozialistischen Regierung erlassenen Gesetze, soweit sie rassenfeindlichen Charakter tragen und der nationalsozialistischen Weltanschauung entspringen, aufgehoben. Es gilt also im wesentlichen die Gesetzgebung bis Januar 1933. Sache der Verwaltungs- und Justizbehörden ist es, ihre Tätigkeit mit dem Geiste der neuen antifaschistischen und demokratischen Weltanschauung zu beleben bis zum Erlaß neuer Gesetze, die der kommenden Zeit vorbehalten bleiben müssen“
Diese Verlautbarung führte natürlich zu gewissen Unsicherheiten bei den aktiven Richtern oder Staatsanwälten (41). Beispielsweise klagte in einem Fall (42) ein Staatsanwalt noch am 1. August 1945 einen Postbeamten, der Feldpostsendungen unterschlagen hatte, wegen Verstosses gegen § 4 der Verordnung gegen Volksschädlinge vom 5. September 1939 (43) an. Nach § 4 dieser Norm (Ausnutzung des Kriegszustands als Strafschärfung) konnte ein Angeklagter mit dem Tode bestraft werden, „wenn dies das gesunde Volksempfinden wegen der besonderen Verwerflichkeit der Straftat erfordert.“ Im Termin wurde dieser Anklagepunkt jedoch nicht mehr aufrechterhalten. Aufgrund dieser Unsicherheiten trat daher erstmals bereits am 27. Juli 1945 ein juristischer Prüfungsausschuß zusammen, der sich mit einer einheitlichen Rechtsanwendung befaßte, da man einsehen mußte, daß man nicht wie ein „Cutter“ aus dem Film zwölf Jahre Gesetzgebung herausschneiden konnte (44). Dazu meinte der Stellvertreter des Stadtgerichtspräsidenten, Dr. Greffin, bei der Konferenz der Bezirksbürgermeister am 20. Juni 1945 (45):
„Eine solche Generalklausel ist ein zweischneidiges Schwert und es wird Schwierigkeiten geben. Aber zunächst kam es darauf an, dem Richter gewissermaßen eine Faustregel an die Hand zu geben, eine Grundlage, von der aus er Recht sprechen kann. Eine besondere Kommission, bestehend aus mir, 2 Richtern des Stadtgerichts, 2 Richtern des Amtsgerichts, 2 Rechtsanwälten und 2 Mitgliedern der Staatsanwaltschaft, wird sämtliche Gesetze, die nach 1933 erlassen sind, durchprüfen und alle Bestimmungen ausmerzen, die dem Geist des neuen Staates widersprechen. Hierbei kann es sich nur um ein Auskämmen handeln. Der Ausschuß beginnt seine Tätigkeit in der nächsten Woche. Das Volk muß wieder das Gefühl bekommen, daß Recht gesprochen wird.“
Später, mit Kontrollratsgesetz Nr. 1 vom 20. September 1945 (46), wurden ausdrücklich 25 Gesetze, Durchführungsbestimmungen, Verordnungen und Erlasse aus der Nazizeit aufgehoben. Dasselbe geschah dann nochmals mit Kontrollratsgesetz Nr. 11 im Januar 1946 (47). In den folgenden Jahren gab es dann eine gemeinsame, rege Gesetzgebungstätigkeit der vier Alliierten, wobei der Kontrollrat bis zum letzten gemeinsam erlassenen Gesetz am 20. Februar 1948, insgesamt 62 Gesetze erlassen hatte.
Die gemeinsame Herrschaft der vier Siegermächte und deren gemeinsame Gesetzgebungstätigkeit war erst in dem Moment beendet, in dem der sowjetische Zonenbefehlshaber Marschall Sokolowskij am 20. März 1948 aus Protest gegen die beabsichtigte Errichtung einer Westunion und eines föderativen Regierungssystems in Westdeutschland (48), den Kontrollrat, der nur einstimmig beschließen konnte, verließ und damit beschlußunfähig machte. Der Alliierte Kontrollrat trat danach nicht mehr zusammen.
Die Besetzung der Gerichte
Die Gerichtsverhandlungen fanden, wie schon erwähnt, in der Besetzung des Gerichts mit einem Vorsitzenden und zwei Schöffen statt. Bemerkenswert ist jedoch, daß die Sowjets die Stellen der Gerichtsvorstände nicht mit linientreuen Kommunisten besetzten, wozu sie möglicherweise (49) in der Lage gewesen wären, sondern mit Antifaschisten aus dem eher bürgerlichen Lager. Scholz schreibt dazu (50):
„Noch heute oder gerade heute muß es besonders wundernehmen, daß die sowjetische Stadtkommandantur nicht einmal bei der Besetzung der Spitzenpositionen der neuen Berliner Justiz mit dem Stadtgerichtspräsidenten, seinen Vertretern und dem Generalstaatsanwalt Kommunisten wählte.“
Er war allerdings der Ansicht, daß das Gerichtswesen nur deswegen neu errichtet wurde, um vollendete Tatsachen zu schaffen (51). Aus anderen Quellen geht hervor, daß nur ein Drittel (52) der maßgeblichen Leute Kommunisten sein sollten, damit die Westmächte nach ihrem Einzug in Berlin die Personalbesetzungen der Sowjets bestätigten (53). Günther meinte (54):
„Wer waren und woher kamen die Männer, in deren Hände die Führung der neuen Justiz gelegt worden war? Daß gerade sie und nicht andere berufen wurden, hing zum Teil und mehr, als man denken sollte, vom bloßen Zufall, freilich auch von dem Umstand ab, daß es damals nicht allzu viele Juristen gab, die weder der NSDAP noch einer ihrer Gliederungen angehört hatten. Ohne diese Voraussetzung wurde anfangs niemand in die Berliner Justiz übernommen. Sonst aber war die damalige Personalpolitik, wenn davon überhaupt die Rede sein konnte, sehr viel weniger gezielt, als gemeinhin angenommen wurde.
So hätte es, aus der Sicht des sowjetischen Kommandanten betrachtet, an sich nahegelegen, einen Mann wie den ehemaligen Kammergerichtsrat Dr. Melsheimer oder die frühere Rechtsanwältin Hilde Benjamin in die Führung der Justiz zu berufen. Es mag sein, daß die Fähigkeiten, die Dr. Melsheimer dann später als Vizepräsident der sowjetzonalen Justizverwaltung sowie als Generalstaatsanwalt der DDR entwickelt hat, im Mai 1945 noch nicht hinreichend bekannt waren. Vorerst mußte er sich mit dem Amt des Oberstaatsanwalts bei dem Bezirksgericht Friedenau begnügen. Nicht anders erging es Hilde Benjamin, die in der ‘DDR’ einmal Justizminister werden sollte. Sie wurde 1945 Staatsanwältin bei dem Bezirksgericht Steglitz. Ihr und Dr. Melsheimer wurden seinerzeit Männer wie Dr. Greffin und Dr. Kühnast vorgezogen. Sie waren keine Kommunisten. Die sowjetische Besatzungsmacht hatte, wie sich später zeigte, wenig Freude an ihnen.“
Außer dem Stadtgerichtspräsidenten Kanger wurden Dr. Günther Greffin und Dr. Wilhelm Kühnast in die führenden Gerichtspositionen berufen.
Kangers Stellvertreter wurde Dr. Günther Greffin, der vorher als Rechtsanwalt und Syndikus bei Schultheiss und Salamander tätig war. Er hatte sich zunächst freiwillig als einfacher Transportarbeiter zur Verfügung gestellt und war während der Aufräumungsarbeiten im Mai 1945 von einem Offizier der Roten Armee in das Amtsgericht Lichtenberg geholt worden und wurde kurzerhand damit beauftragt, im Bereich der Justiz die Aufräumungsarbeiten fortzusetzen (55).
Als Generalstaatsanwalt wurde der 46-jährige, seit 1936 am Amtsgericht Berlin tätige, frühere Zivilrichter und Ex-Sozialdemokrat Dr. Wilhelm Kühnast eingesetzt. Hierbei wird sogar behauptet, daß Bersarin bei der Besetzung der Generalstaatsanwaltsstelle seine Berater gefragt habe, wer denn der „größte“ Jurist sei und dies aufgrund eines Übersetzungsfehlers auf die Körpergröße bezogen wurde, so daß schließlich Dr. Kühnast aufgrund seiner Körpergröße berufen wurde (56).
Zu den allgemeinen Personalien in der Justiz führte Stadtgerichtspräsident Kanger bei der Konferenz der Bezirksbürgermeister am 20. Juni 1945 aus (57):
„Was die personelle Besetzung der Gerichte angeht, werden die Bewerber der zuständigen russischen Stelle zur Bestätigung vorgelegt. Bei der Anstellung von Richtern und höheren Mitarbeitern erfolgt die formelle Ernennung durch den Oberbürgermeister der Stadt Berlin, nachdem die Sachen den sonst üblichen Verfahrensweg durchlaufen haben.“
Insgesamt läßt sich feststellen, daß sich die Sowjets bei der Besetzung durchaus des bürgerlichen, nationalsozialistisch unbescholtenen Lagers bedienten (58). Allerdings zählte die Justizpolitik anfänglich nicht zu den wesentlichen Politikfeldern der Sowjets, da der Eigentumspolitik und Bildungspolitik ideologisch eine höhere Priorität zugestanden wurde. Im übrigen waren Probleme wie die Ernährungsfrage, die Wohnraumfrage und andere dringende Probleme der unmittelbaren Nachkriegszeit vorrangig zu behandeln (59). Besonders was die Ernährungsfrage betrifft wurde von den Sowjets unter Führung des Stadtkommandanten Bersarin erstaunliches geleistet, so soll die Versorgungslage in Berlin im Mai 1945 besser als in Moskau gewesen sein, was auch zu einigen Unmut bei den sowjetischen Soldaten führte (60).
Als dann im Juli 1945 die anderen drei Siegermächte ihre Besatzungszonen in Berlin übernahmen, (61) kam es zu einer vorübergehenden Spaltung des Gerichtswesens, die erst im September 1945 im Zusammenhang mit dem Kontrollratsgesetz Nr. 4 (zur Umgestaltung und Vereinheitlichung des deutschen Gerichtswesens) überwunden wurde (62). Der Neuaufbau der Justiz erfolgte dann auch im sowjetischen Sektor auf der Grundlage der Gerichtsverfassung, die bereits vor 1933 bestand.
Die Neuorganisation der Berliner Justiz unter sowjetischer Alleinherrschaft war also nur von kurzer Dauer. Die Tatsache, daß die Justiz von den Sowjets organisiert worden war, konnten und wollten die Westmächte schon aus machtpolitischen Gründen so nicht hinnehmen.
Entnazifizierung
Entnazifizierung in der SBZ
Untersucht man die Entnazifizierung in Berlin bzw. die Entnazifizierung und die Personalstruktur am Amtsgericht Berlin-Mitte, müssen zumindest kurz die Entnazifizierungsmaßnahmen in der SBZ beleuchtet werden, da sich diese Maßnahmen ja spätestens nach der Justizspaltung in Berlin auch auf die Personalstruktur im Justizwesen auswirkten (63).
In der DDR-Historie wurde die Entnazifizierung in der SBZ in vier Etappen gegliedert:
Erste Phase: bis Juli 1945, von der Beendigung der Kampfhandlungen bis zur Errichtung der Landes- und Provinzialbehörden.
Zweite Phase: Juli 1945 bis November 1946, gekennzeichnet durch den SMAD-Befehl Nr. 49 von 1945.
Dritte Phase: Dezember 1946 bis August 1947, gekennzeichnet durch die Durchführung der Kontrollratsdirektive 24 und der Kontrollratsdirektive 38 von 1946.
Vierte Phase: August 1947 bis März 1948, gekennzeichnet durch die SMAD- Befehle Nr. 201 und 204 vom 16. bzw. 23. August 1947 bis zur Auflösung der Entnazifizierungskommissionen durch den SMAD-Befehl Nr. 35 vom 25. Februar 1948 (64).
In der ersten Phase der Entnazifizierung bestimmten die örtlichen Kommandanten antifaschistische Laien zu „Richtern und Staatsanwälten im Soforteinsatz“, da viele Richter geflohen waren.
Mit Hilfe des SMAD-Befehls Nr. 49 vom 4. September 1945 wurden in der zweiten Phase sämtliche (65) ehemaligen Mitglieder der NSDAP oder deren Gliederungen entfernt, was zur Entlassung von 85% der Richter führte (66). Entlassen wurden auch jene, die nur nominell belastet waren (67). Ausnahmen wurde nur bei einigen, wenigen HJ-Mitgliedern gemacht, die als Referendare zugelassen wurden. Die Entnazifizierung der Justiz erfaßte auch alle sonstigen Mitarbeiter (68). Statistische Erhebungen belegen, daß im sowjetisch besetzten Teil Deutschlands 80% der Richter und 78% der Staatsanwälte Mitglieder der NSDAP waren (69). Weiterhin wurde am 30. Juli 1946 der SMAD-Befehl Nr. 228 über die Nichtigkeit von Urteilen in politischen Sachen, die während der Zeit des Faschismus ergingen, erlassen.
Am 12. Januar 1946 wurde vom Alliierten Kontrollrat die Direktive Nr. 24 erlassen, mit deren Durchführung die dritte Phase begann: es wurde die Entfernung von Personen aus Ämtern und verantwortlichen Stellungen, die den Bestrebungen der Alliierten feindlich gegenüberstanden, angeordnet. Es kam jedoch nur noch zu wenigen Entlassungen, da die strenge Handhabung des SMAD-Befehls Nr. 49 bereits ihre Wirkung gezeigt hatte (70). Mit der Direktive Nr. 38 vom 12. Oktober 1946 (71) wurde die Verhaftung und Bestrafung von Kriegsverbrechern, Nationalsozialisten und Militaristen veranlaßt. Es sollten all diejenigen bestraft werden, die das nationalsozialistische Regime gefördert und gestützt hatten.
Es gab 3 Kategorien: 1. „Hauptschuldige“
2. „Belastete“
3. „Minderbelastete“
Mit dem SMAD-Befehl Nr. 201 vom 16. August 1947 (72), der die Überschrift trug: „Richtlinien zur Anwendung der Direktiven Nr. 24 und Nr. 38 des Kontrollrats über die Entnazifizierung“, wurde das Ende der Entnazifizierungsmaßnahmen und somit die vierte und letzte Phase eingeleitet. Mit diesem Befehl wurden die deutschen Gerichte zwar ausdrücklich verpflichtet (73), aktive Nationalsozialisten und Militaristen zu bestrafen; andererseits aber wurde auch ausdrücklich festgestellt, daß eine allgemeine gerichtliche Verfolgung sämtlicher, ehemaliger, nomineller Mitglieder der NSDAP und deren Organisationen nicht in Betracht komme, da dies dem demokratischen Aufbau Deutschlands schaden würde (74). Die „Minderbela-steten“, die nun als „Verbrecher der 2. Stufe“ bezeichnet wurden, sollten nur bei „persönlicher Schuld“ bestraft werden. Allerdings wurde mit dem SMAD-Befehl Nr. 204 vom 23. August 1947 (75) ausdrücklich klargestellt, daß Richter und Staatsanwälte, die ehemalige Mitglieder der NSDAP oder deren Gliederungen waren oder an den Strafmethoden des NS-Regimes unmittelbar beteiligt waren, nicht eingestellt werden durften (76).
Im Februar 1948 wurde schließlich durch den SMAD-Befehl Nr. 35 in der SBZ die Entnazifizierungskommission ganz aufgelöst. Trotzdem wurde durch die SMAD weiterhin versucht, formal belastete Juristen zu entlassen. Im übrigen waren ehemalige HJ- und BDM- Mitglieder immer noch von den Entnazifizierungsregeln betroffen und nur in wenigen Ausnahmefällen konnten solche Personen als Richter oder Staatsanwälte tätig sein. Ehemalige NSDAP-Mitglieder und Wehrmachtsoffiziere konnten nach wie vor nicht einmal Schöffen oder Geschworene werden (77). Mit diesen Maßnahmen sollen in der SBZ - bis 1948 - etwa 520 000 NS-belastete Personen durch die SMAD aus dem öffentlich-politischen und beruflichen Leben entfernt worden sein (78), was natürlich zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Neuorganisation führte (79).
Entnazifizierung in Berlin
Bis zur Justizspaltung
Im Gegensatz zu den übrigen, sowjetisch besetzten, Ländern der SBZ, in denen die Landesjustizverwaltungen mit der zentral organisierten Deutschen Justizverwaltung rivalisierten, lag die Kompetenz in Berlin alleine bei der Alliierten Kommandantur, da hier die zentrale Deutsche Justizverwaltung (DJV) nicht zuständig war (80). Die Alliierte Kommandantur erließ Vorschriften über die Arbeit der Berliner Justiz, setzte auf Vorschlag des Kammergerichtspräsidenten das Justizbudget fest, gab (einstimmig) verwaltungstechnische Weisungen und ernannte Richter und Staatsanwälte. Zum Richter oder Staatsanwalt wurde nur derjenige zugelassen, der nicht der NSDAP oder ihrer Gliederungen angehörte. Insoweit schieden die seit 1934 auf Lebenszeit Angestellten aus, weil zu jener Zeit „Nachweis des rückhaltlosen Einsatzes für Partei und Staat“, also meist Mitgliedschaft in der Partei, Einstellungsvoraussetzung war (81).
Zudem wurden die Gerichte, Staatsanwaltschaften und der Strafvollzug auf Grund der Bestimmung Nr. 10 des Kontrollrats vom 20. Dezember 1945, unter Berücksichtigung der hierzu erlassenen Direktive Nr. 24 vom 12. Januar 1946 über die Entfernung von Nationalsozialisten aus Ämtern und verantwortlichen Stellungen von belasteten Mitgliedern gesäubert (82). Besonderer Wert wurde in der Berliner Justiz auch auf die Vermeidung nazistischer Ausdrücke (83) gelegt.
Als die Entnazifizierung aufgrund ihres großen Arbeitsaufwandes von den Alliierten nicht mehr bewältigt werden konnte, wurden am 26. Februar 1946 mit der Direktive 101a (84) der zu entlassende Personenkreis festgesetzt und mit der Direktive 102 (85) die Einrichtung von Entnazifizierungskommissionen (86) mit je sieben Mitgliedern in den 20 Verwaltungsbezirken, den Sektoren (87) sowie beim Magistrat der Stadt Berlin (88) angeordnet, die der Alliierten Kommandantur gegenüber durch das Alliierte Komitee für Entnazifizierung (89) verantwortlich waren. Dabei wurde im sowjetisch besetzten Sektor anscheinend besonders hart durchgegriffen (90), was auch daran lag, daß die dortigen Entnazifizierungkommissionen in der Mehrheit von SED-Mitgliedern besetzt waren, während die Besetzung in den Westzonen paritätisch erfolgte (91).
Entlassen wurden auch Referendare (92), sonstige Mitarbeiter und all jene, die nur nominell belastet waren (93). Die durch die Entnazifizierung schon sehr stark reduzierte Anzahl an Richtern und Staatsanwälten nahm weiter ab, da es erhebliche Ausfälle durch Tod, Dauererkrankung oder einfach Dienstunfähigkeit wegen Erschöpfung gab. Im übrigen gab es außerdem andere Entlassungen aus politischen Gründen und einen sichtlich zunehmenden Zug nach Westen (94).
Die von der SED und der sowjetischen Kommandantur geforderte Heranziehung von Volksrichtern (95) wurde westlicherseits abgelehnt. Dennoch konnte seit der Order der Alliierten Kommandantur vom 31. Mai 1947 das Universitätsstudium auf vier Semester und die Referendarsausbildungszeit auf zwei Jahre verkürzt werden, wenn es sich um aktive Antifaschisten oder um Personen handelte, die wegen ihrer politischen Haltung, ihrer religiösen Überzeugung oder ihrer Rasse verfolgt worden waren (96).
Um die Richternot zu beheben, wurden desweiteren auch bereits pensionierte, unbelastete Richter und Staatsanwälte reaktiviert, Studenten aushilfsweise herangezogen, Rechtsanwälte dienstverpflichtet (97) und „Richter im Soforteinsatz“ bestellt (98). Trotzdem drohte die ganze Rechtspflege steckenzubleiben (99). Die damalige Situation illustriert am besten nachfolgender, gemeinsamer Bericht des Kammergerichtspräsidenten, des Generalstaatsanwalts und des Präsidenten der Rechtsanwaltskammer an das Rechtskomitee der Alliierten Kommandantur vom 27. April 1948 (100):
Nach der Justizspaltung
Gegenseitige Schuldzuweisungen, im Hinblick auf mangelnde Bestrafung von Kriegs- und Naziverbrechern, prägten das Bild der Berliner Justiz bis zur Justizspaltung im Jahre 1949. Mit der Justizspaltung war dann jedoch das Problem des Richtermangels auf beiden Seiten weitgehend gelöst. Während in Westberlin durch ankommende Richter (101) weitere Dienstverpflichtungen hinfällig wurden, konnten in Ostberlin nun endlich Volksrichter eingesetzt werden.
Sofort nach der Justizspaltung im Februar 1949 beschloß der Ostmagistrat, die Entnazifizierung zu beenden (102). Man war der Ansicht, daß im Ostteil der Stadt keine Entnazifizierung mehr notwendig sei, da der Einfluß ehemaliger Nazis ausgeschaltet sei und daß die Anzahl von noch nicht überprüften NSDAP-Parteimitgliedern unwesentlich sei. Im übrigen, meinte man (103), daß ein weiterer Teil der belasteten Nationalsozialisten, aufgrund der weniger scharfen Entnazifizierung in den westlichen Zonen oder Sektoren, dorthin geflüchtet wären.
„(...) Trotzdem dürfte die Zahl der im sowjetischen Sektor vorhandenen Aktivisten (Hauptschuldige und Belastete im Sinne der Direktive 38) verhältnismäßig gering sein, weil die sowjetische Besatzungsbehörde in der Vergangenheit einen großen Teil der Aktivisten internierte und die Aktivisten zu einem weiteren Teil in die Westsektoren oder Westzonen abgewandert sind oder nicht nach Berlin zurückkehrten (Grund: Der nicht unbegründete Glaube, in den Westsektoren oder Westzonen bessere Bedingungen zu finden).“
Was die Entnazifizierung in den Westzonen betrifft, entspricht die Meinung des SED-Landesleitung der von Chefpräsident Dr. Loewenthal, der in einem Schreiben vom 20. April 1948 an die Rechtsabteilung der westlichen Besatzungsmächte, den Richtermangel beklagt und darum bittet, nicht allzu strenge Maßstäbe bei der Entnazifizierung von Richtern und Referendaren anzulegen, da (104)
„hierdurch eine große Unsicherheit unter diesen Richtern hervorgerufen wird,“
und zu befürchten sei,
„daß, wie dies schon geschehen ist, einzelne von ihnen zu anderen Berufen z.B. zur Anwaltschaft oder zu anderen Behörden übergehen oder in die westlichen Zonen abwandern, da dort nicht derartig strenge Maßstäbe an ihre politische Zuverlässigkeit angelegt werden, wie es für die Berliner Justiz der Fall ist.“
Laut Entscheidung des Ostmagistrats sollten in Zukunft noch notwendige Entnazifizierungsmaßnahmen als politische Aufgaben angesehen werden und nicht mehr mit den bisher gehandhabten, administrativen Methoden allein gelöst werden. Im übrigen seien bei den Beurteilungen nicht mehr nur von objektiven, formalen Merkmalen der BK/O (46) 101a bzw. der Direktive Nr. 24 auszugehen, sondern es sei (105)
„die Gesamtpersönlichkeit (...) zu bewerten, darunter auch das Verhalten seit 1945, vor allem Bereitschaft zur Arbeit, Verhalten im Arbeitseinsatz, Aufgeschlossenheit für fortschrittliche Gedanken usw.“
Während des beginnenden Kalten Krieges ließ das Interesse an Entnazifizierungsmaßnahmen vor allem in den westlichen Zonen erheblich nach und der größte Teil der zunächst suspendierten Richter kam dort, beginnend mit der Amnestie BK/O (49) vom 5. April 1949 (106), nach und nach zurück.
In der SBZ wurde dagegen eine völlige personelle Erneuerung der Justiz nach Einführung von Volksrichterlehrgängen in Angriff genommen (107), so daß bereits Mitte 1950 die Meinung vertreten wurde, daß die Berliner Justiz den Vorstellungen der neuen Machthaber eher entsprechen würden als die in der übrigen SBZ (108).
Die Situation der Berliner Justiz nach dem Einmarsch der Alliierten
Das Justizsystem nach der Aufteilung Berlins in vier Besatzungszonen
Erneute Umorganisation
Nachdem die weiteren Alliierten Anfang Juli 1945 (109) die ihnen zugewiesenen Zonen besetzt hatten, nahmen sie im Rahmen des Viermächtestatus auch ihr Mitregierungsrecht über ganz Berlin in Anspruch. Auf der Potsdamer Konferenz (110) der drei Siegermächte Sowjetunion, USA und Großbritannien wurde beschlossen, Deutschland zu entmilitarisieren, zu entnazifizieren, zu demokratisieren, zu dekartellisieren und zu dezentralisieren (111).
Mit Befehl Nr. 1 wurde die alleinige Befehlsgewalt des sowjetischen Stadtkommandanten durch das Kollektiv der vier alliierten Kommandanten abgelöst. Zwar blieben alle bisher getroffenen Anordnungen in Kraft, aber alle zukünftigen Beschlüsse mußten einstimmig gefaßt werden. Dies galt auch für Änderungsbeschlüsse an vorangegangenen Befehlen und Anordnungen (112). Dadurch änderte sich natürlich auch die Situation der Berliner Justiz. Ein verbitterter Max Berger, „dessen“ Bezirksgericht am Prenzlauer Berg schon bald danach aufgelöst wurde und im AG Berlin-Mitte aufging, merkte dazu an (113):
„Während dieser ersten Monate unserer Tätigkeit wurde von der vorgesetzten Justizbehörde weder an der Tätigkeit des Gerichts noch der Staatsanwaltschaft irgendwie Kritik geübt. Die Rechtsanwälte und die rechtsuchende Bevölkerung brachten der Arbeitsweise der Amtsgerichte und der Staatsanwaltschaft Prenzlauer Berg großes Vertrauen entgegen. Es schien, als ob die, vom Gerichtsverfassungsgesetz von 1877 abweichende, Struktur des neuen Gerichtswesens und die neue Art der Rechtsprechung sich durchgesetzt hatten und zwar auch bei den akademisch ausgebildeten Richtern und Staatsanwälten. Das änderte sich aber mit dem Einzug der westlichen Besatzungsmächte in Berlin. Durch die Proklamation Nr. 3 des Alliierten Kontrollrates vom 20. Oktober 1945 und das Kontrollratsgesetz Nr. 4 vom 30. Oktober 1945 wurde dann auch die alte Gerichtsstruktur nach dem Gerichtsverfassungsgesetz von 1877 mit dem Aufbau Amtsgericht, Landgericht und Kammergericht wiederhergestellt.“
An der Spitze der ordentlichen Gerichte auf dem Gebiet der Justizverwaltung stand der Kammergerichts- bzw. Stadtgerichtspräsident (114), jedoch wurde die Verwaltung von Groß-Berlin nun von der Alliierten Kommandantur geleitet, der auch die Justizbehörden zugeordnet war. In Berlin galten daher nicht die von den Militärregierungen für die einzelnen Zonen erlassenen Gesetze und Anordnungen, sondern neben den Gesetzen, Proklamationen und Direktiven des Kontrollrats lediglich die Anordnungen der Alliierten Kommandantur. Die ordentlichen Gerichte und die Staatsanwaltschaft unterstanden nicht dem Magistrat von Groß-Berlin, der eine eigene Rechtsabteilung hatte, sondern der Alliierten Kommandantur, auf die die Befugnisse des ehemaligen Reichsjustizministeriums übergegangen waren (115).
Dem Kammergerichtspräsidenten standen keine rechtsetzenden Befugnisse mehr zu, wobei ihm aber auf dem Gebiet der Gesetzgebung ein Vorschlagsrecht eingeräumt war. Der Kammergerichtspräsident war verantwortlich für die Disziplin der bei den Berliner Gerichten Beschäftigten oder zum Praktizieren zugelassenen Personen. Ihm oblag vorbehaltlich der Bestätigung durch die Alliierte Kommandantur die endgültige Einstellung, Versetzung und Beförderung der Richter, die er persönlich vor Dienstantritt zu beeidigen hatte. Die Entlassung der Richter konnte nur auf Anordnung oder mit Einwilligung der Alliierten Kommandantur erfolgen (116).
Als oberster Leiter der staatsanwaltlichen Behörden von Groß-Berlin fungierte der Generalstaatsanwalt beim Kammergericht. Auch er unterstand - genau wie der Kammergerichtspräsident - unmittelbar der Alliierten Kommandantur, in haushaltsrechtlicher Beziehung jedoch dem Magistrat von Groß-Berlin.
Erste Unstimmigkeiten zwischen den Alliierten
Die Amerikaner beauftragten schon am 6. August 1945, einen Monat nach ihrem Einzug in die Stadt, den bis dahin als Direktor des Amtsgerichtes Zehlendorf (117) amtierenden Dr. Siegfried Loewenthal damit, ein eigenes Landgericht zu bilden und ernannten ihn zum „Chief President.“
Das Landgericht sollte als Berufungsinstanz für die Amtsgerichte Kreuzberg, Neukölln, Schöneberg, Steglitz, Tempelhof und Zehlendorf sowie als erste Instanz in dem, durch das Gerichtsverfassungsgesetz zugewiesenen Kompetenzbereich dienen. Als Vorzeichen des Kalten Krieges und um die sowjetischen Alliierten vor vollendete Tatsachen zu stellen, erhielt das neue Landgericht den Namen Landgericht II, obwohl überhaupt kein Landgericht I bestand. Dies geschah in der Absicht der Amerikaner, das Stadtgericht im sowjetischen Sektor auf die Landgerichtsebene zu stellen und selbst gleichzuziehen (118).Durch dieses neue Landgericht II war das Stadtgericht in zweiter und letzter Instanz nur noch für den sowjetischen, den britischen und den französischen Sektor zuständig.
Die Folge dieses Schrittes der Amerikaner war, daß eine mögliche Spaltung Berlins erstmals konkret spürbar wurde, da der sowjetische Stadtkommandant dem Schritt der Amerikaner nicht zustimmte. Den Amerikanern, die sich dem sowjetischen Einfluß entziehen wollten, wurden Spaltungsabsichten (119) unterstellt. Dadurch, daß der von den Sowjets vorgesehene Justizaufbau einfach ignoriert wurde(120), war faktisch eine erste Aufspaltung des Gerichtswesens in eine sowjetische und eine amerikanische Zone gegeben. Jedoch konnte eine weitere Aufspaltung durch den Alliierten Kontrollrat auf seiner zwölften Sitzung am 27. September 1945 verhindert werden. Aufgrund von Vorschlägen einer Kommission, wurde ein einheitlicher Gerichtsaufbau für Berlin beschlossen, der erneute Umstruktuierungen mit sich brachte und zur Wiederherstellung der Gerichtsorganisation aus den Zeiten vor dem Zweiten Weltkrieg führte.
Siehe dazu auch den undatierten Bericht (121) zur Organisation und Besetzung der Berliner Justiz an Walter Ulbricht:
„Nach dem Einmarsch der Amerikaner und Engländer in Berlin versuchten diese, für ihren Besatzungssektor die Gerichtsorganisation nach eigenem Gutdünken zu gestalten. Insbesondere die Amerikaner wünschten nicht, daß das von den Russen errichtete Stadtgericht übergeordnete Instanz über den Amtsgerichten des amerikanischen Sektors bleiben und begannen, für ihren Sektor ein eigenes Landgericht in Zehlendorf zu errichten; sie deuteten sogar an, daß sie nicht davor zurückschreckten, ein eigenes Obergericht für ihren Sektor zu schaffen, weil sie das Landgericht nicht nur als Berufungsinstanz, sondern auch als erste Instanz für bedeutendere Zivil- und Strafsachen einführen wollten, so wie es dem Zustand vor dem Einmarsch der roten Armee entsprach. Die Engländer neigten der gleichen Ansicht zu und sahen die Errichtung eines Landgerichts in Charlottenburg für den englischen Sektor vor. Das wäre ein unhaltbarer Zustand geworden, die Einheitlichkeit der Rechtsprechung in Berlin wäre vernichtet worden.“
In diesem Bericht wurde im übrigen auch die mangelnde Präsenz von KPD-Genossen bei der Postenbesetzung beklagt.
Wiederherstellung der alten Gerichtsorganisation
Mit dem Gesetz Nr. 4 (122) vom 30. Oktober 1945 in Verbindung mit der Proklamation Nr. 3 vom 20. Oktober 1945 wurde die frühere Gerichtsordnung nach dem Gerichtsverfassungsgesetz von 1877 in der Fassung vom 22. März 1924 (123) wiederhergestellt. Dies hatte zur Folge, daß es wieder Amtsgerichte, ein Landgericht (Sitz der Zivilkammern im amerikanischen Sektor in Zehlendorf und Sitz der Strafkammern im britischen Sektor in Moabit) und das Kammergericht (Sitz im Sowjetsektor in der Neuen Friedrichsstraße) als letzte Instanz gab, was auch schon in einem Kommuniqué der Alliierten Kommandantur nach ihrer Sitzung am 27. September 1945 vorweggenommen wurde.
Dadurch, daß die Sowjets das oberste Gericht für ganz Berlin in ihrem Sektor behielten, konnte die Gefahr der Spaltung der Berliner Justiz vorerst abgewendet werden. Die Amerikaner hatten sich mit dem Erhalt des Landgerichts II (nunmehr nur noch Landgericht) und ihrem „Chef-präsidenten“ Dr. Loewenthal die Mittelinstanz für Zivil- und Strafsachen in ihrem Sektor gesichert und auch die Briten bekamen einen erheblichen Anteil, was durch die verabredete Rückverlagerung der Strafsachen nach Moabit sowie die Unterbringung der Registerabteilung des Amtsgerichts Mitte geschah. Wichtig für die Briten war vor allem die Rückverlagerung des Handelsregisters in das im Amtsgerichtsbereich Charlottenburg liegende Landgerichtsgebäude am Tegeler Weg 21. Die Franzosen nahmen bei dieser Umgestaltung kaum Einfluß.
Dr. Loewenthal, der Präsident des Amtsgerichts Zehlendorf, Präsident des Landgerichts und Vizepräsident des Kammergerichts in einer Person war, wurde in seiner Funktion als Vizepräsident des Kammergerichts schon sehr bald abgelöst. Sein Nachfolger wurde am 12. Oktober 1945 Dr. Strucksberg (124), der im weiteren Verlauf der Berliner Justizgeschichte noch eine wesentliche Rolle spielen sollte.
Demgemäß hatte sich an dem Gerichtsaufbau, der vor dem 8. Mai 1945 gegeben war, nicht viel geändert. Die einzige Veränderung war darin zu finden, daß das Kammergericht vorerst die letzte Instanz darstellte, wobei an eine Wiedereröffnung des Reichsgerichts nicht zu denken war. Die sowjetische Militäradministration hatte vielmehr ausdrücklich die vor dem 8. Mai 1945 beim Reichsgericht anhängig gewordenen und noch nicht entschiedenen Revisionen teils als zurückgenommen, teils als an die Oberlandesgerichte zurückverwiesen erklärt (125).
Als bemerkenswerte Personalia sei noch erwähnt, daß die fünf (126) im Mai 1945 eingesetzten Staatsanwälte und Richter, die keine juristische Ausbildung vorweisen konnten, entlassen wurden. Die Entlassung von Max Berger und August Potthoff wurde jedoch nach Protesten widerrufen (127). Berger vermerkte (128):
„Durch obigen Beschluß blieben lediglich die Staatsanwälte Potthoff und Berger im Dienst. Beide waren bis 1933 als Rechtsbeistände tätig. Aufgrund dieser juristischen Vorbildung ist der obige Kompromiß-Beschluß zustande gekommen. Die drei anderen Staatsanwälte Freter, Laske und Hildebrandt werden entlassen, trotzdem sie, ohne juristische Vorbildung von der Neugründung der Berliner Gerichte und Staatsanwaltschaften bis heute, ihren Dienst unbeanstandet ausgeübt haben. Alle drei sind bewußte Antifaschisten, die vom ersten Tage an, an vorderster Stelle am Neuaufbau entscheidend mitgewirkt haben.“