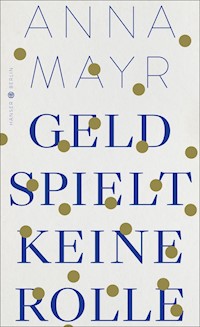
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser Berlin
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
„Anna Mayrs Furor ist wichtig.“ (Christian Baron, Der Freitag) Nach ihrer Streitschrift ‚Die Elenden' schreibt sie radikal persönlich über das Thema Geld und die innere Zerrissenheit angesichts ihrer eigenen Verschwendung. Geld gab es in ihrer Familie immer zu wenig. Als Kind fragte sie sich deshalb, wie manche achtlos hunderte Euro für Taschen, Schuhe, Steaks ausgeben können, während es gleichzeitig so viele Menschen gibt, für die 100 Euro ein kleines Vermögen sind. Inzwischen ist sie selbst eine von denen geworden, die verschwenderisch Geld ausgeben: 60 Euro für einen Skipass, 225 Euro für eine Katzentherapeutin, 748 Euro für ein Brautkleid. Immer noch rechnet sie die Beträge beim Bezahlen in Hartz-IV-Regelsätze um. Ganz offen erzählt Anna Mayr von ihrer eigenen Bürgerlichwerdung. Doch je willkürlicher die Summen werden, die sie bereit ist zu zahlen, desto mehr sehnt sie sich nach einer Handlungsoption, nach einem Ausweg aus der Zerrissenheit. Wie hält man das Leben aus, wenn man sich selbst am liebsten enteignen würde?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
»Anna Mayrs Furor ist wichtig.« (Christian Baron, Der Freitag) Nach ihrer Streitschrift ›Die Elenden' schreibt sie radikal persönlich über das Thema Geld und die innere Zerrissenheit angesichts ihrer eigenen Verschwendung.Geld gab es in ihrer Familie immer zu wenig. Als Kind fragte sie sich deshalb, wie manche achtlos hunderte Euro für Taschen, Schuhe, Steaks ausgeben können, während es gleichzeitig so viele Menschen gibt, für die 100 Euro ein kleines Vermögen sind. Inzwischen ist sie selbst eine von denen geworden, die verschwenderisch Geld ausgeben: 60 Euro für einen Skipass, 225 Euro für eine Katzentherapeutin, 748 Euro für ein Brautkleid. Immer noch rechnet sie die Beträge beim Bezahlen in Hartz-IV-Regelsätze um.Ganz offen erzählt Anna Mayr von ihrer eigenen Bürgerlichwerdung. Doch je willkürlicher die Summen werden, die sie bereit ist zu zahlen, desto mehr sehnt sie sich nach einer Handlungsoption, nach einem Ausweg aus der Zerrissenheit. Wie hält man das Leben aus, wenn man sich selbst am liebsten enteignen würde?
Anna Mayr
Geld spielt keine Rolle
Hanser Berlin
Eat The Rich
Viele Dinge, die ich mache, sind Quatsch. Noch merke ich das. Noch habe ich ein Gefühl von Fremdheit, wenn ich ein Sofa für 2000 Euro kaufe oder eine Mango für 3,49 Euro. Aber es kann gut sein, dass das bald nicht mehr so sein wird. Deshalb will ich es konservieren, in diesem Buch. Ich will das Gefühl festhalten, dass die Welt falsch eingerichtet ist und ich davon in vollem Bewusstsein profitiere. Bevor ich einer dieser Menschen werde, die sich einreden, dass alle Dinge genauso sein müssen, wie sie sind, dass es keine andere mögliche Gesellschaft gibt, kein anderes mögliches Ich für sie selbst. Diese Menschen, die meinen, sie wären durch ihre eigene Leistung reich geworden. Noch weiß ich, dass es nicht Leistung ist, die einen weiterbringt, sondern Glück.
In diesem Buch geht es um meine Zerrissenheit, um meinen Kampf gegen mich selbst, und das ist gar nicht so leicht zu formulieren. Es geht nicht um etwas, das gewesen ist, sondern um das, was ist; um die Wohnung, in der ich mich aufhalte, um die Möbel, die mich umgeben. Um die Dinge, die ich im Supermarkt kaufe, weil sie mir schmecken, nicht, weil sie günstig sind. Neulich stand ich mit M. vor einem Regal in einem italienischen Feinkostladen. M., das muss man vielleicht wissen, ist mein Partner, wir teilen kein Konto, aber einen Haushalt und auch sonst alles miteinander, wir sind eine bourgeoise Kleinfamilie, demzufolge Feinde des Sozialismus. Als diese standen wir also in dem Laden, vor uns in einem Regal: winzige Gläser mit Trüffeln drin, 16,85 Euro für 50 Gramm. M. sagte: »Kauf das. Du liebst Trüffel.« Obwohl er weiß, wie sehr ich es hasse, Trüffel zu lieben. Ich habe ein Gläschen gekauft.
Mein erstes Buch war eine Anklage. Ich stand vor der Gesellschaft, vor meinem Publikum, und zeigte auf all die Dinge, die ich erlebt und recherchiert hatte. Ich zeigte auf die Widersprüchlichkeiten der deutschen Sozialpolitik, auf die historische Verachtung der Unterschicht, auf meine Kindheit, die sorgenfreier hätte sein können. Ich wollte zeigen, dass diese Gesellschaft Armut und Arbeitslosigkeit braucht, um zu funktionieren, und wie sehr ich darunter gelitten habe.
Eine Frage, die mir seitdem oft gestellt wird: »Wann hast du gemerkt, dass deine Familie arm ist?« Manchmal in Abwandlungen: »dass ihr anders seid«, »dass ihr weniger Geld hattet«, »dass weniger Ressourcen da waren«, oder, positiver formuliert, »dass andere Kinder mehr Geld hatten als du«. Bisher habe ich immer brav geantwortet, dass Armut auch nur eine von vielen ökonomischen Realitäten ist. Deshalb habe ich — wie eigentlich alle Kinder — erst in der Pubertät einen Unterschied zwischen mir und meiner Umgebung bemerkt. An dem Punkt eben, an dem man beginnt, sich als Teil der Gesellschaft zu begreifen.
Warum wollen Menschen den schmerzlichen Moment nacherzählt bekommen, in dem ein Teenager sich seiner Benachteiligung bewusst wird? Warum empfinden sie so große Lust dabei, anderen dabei zuzusehen, wie sie mit Geld umgehen, mit Geld konfrontiert werden, an Geld und dessen Fehlen leiden? Bei Zeit Online werden Texte über Geld ähnlich häufig angeklickt wie Texte über Sex. Liegt wohl daran, dass Geld ähnlich große Gefühle auslöst. Glück, Erleichterung, Verzweiflung. Es hat also schon fast etwas Voyeuristisches, jemanden zu fragen, wie er seiner eigenen ökonomischen Verhältnisse gewahr wurde. Denn ökonomische Verhältnisse sind intim. Sie lösen so große Gefühle aus, dass man ungern selbst darüber spricht — und wenn, dann lieber retrospektiv.
Deshalb will ich jetzt auf mein heutiges Leben zeigen, das ein Leben mit Geld ist. Ich will dieses Leben nicht anders, ich habe lieber Geld als kein Geld. Aber ich mag den Menschen, zu dem ich mit Geld geworden bin, nicht besonders.
Die meisten Leute, so habe ich es mir sagen lassen, denken beim Geldausgeben nicht darüber nach, ob das, was sie kaufen, wirklich notwendig ist. Ob die zehn oder zwanzig Euro, die sie ausgeben, nicht eigentlich besser bei jemand anderem aufgehoben wären. Bei jemandem, der sich davon Essen kaufen würde oder ein Paar Handschuhe. Die meisten Leute nehmen die Verteilung von Ressourcen als gegeben hin. Einer hat viel, weil er viel arbeitet oder sich doll angestrengt hat. Eine hat wenig, weil sie Pech hatte oder faul war. Deshalb kann einer sich von 100 Euro ein Abendessen kaufen, während eine andere von 100 Euro sich selbst und zwei Kinder durch einen Monat bringen muss.
Wenn man Geld hat, muss man also akzeptieren, dass andere leiden, während es einem selbst gut geht. Dass man das Leid der anderen theoretisch lindern könnte, mit nur wenigen eigenen Einbußen. Dass man sich allerdings dagegen entscheidet, aus Angst, aus Unsicherheit, aus Konformität, aus Gewohnheit. Man konsumiert Dinge, obwohl man sie selbst überhaupt nicht braucht, während andere nicht das konsumieren können, was sie unbedingt brauchen. Ich finde es faszinierend, dass das menschliche Gehirn fähig ist, eine derart elementare Ungerechtigkeit auszuhalten. Oder dass es wenigstens lernt, sie zu verdrängen.
Das geht zum Beispiel, indem man sich einredet, dass Glück aus Konsum besteht und Konsum denjenigen vorbehalten ist, die etwas »erarbeiten«. Dass wir unseren Lohn also nicht nur verdienen in dem Sinn, dass er monatlich auf unser Konto kommt, sondern dass wir ihn im moralischen Sinn verdienen, denn wir tragen bei zum großen Ganzen, wir verbessern den menschlichen Zustand, sodass er ein Wohlstand werde. Es ist in dieser Logik nicht ungerecht, dass andere Leute weniger verdienen. Sie müssen ihre Arbeitskraft verkaufen, sie müssen im Restaurant bedienen, an der Kasse im Supermarkt, sie müssen Kinder hüten. Niemand ist bereit, sie dafür besser zu bezahlen, denn ihre Arbeit ist weniger wert. Warum auch immer. Wenn wir aufhörten, daran zu glauben, dass diese Unterschiede gerechtfertigt sind, dann ginge all die Sicherheit flöten, die die Marktwirtschaft verspricht. Die Sicherheit nämlich, dass der Staat privaten Besitz schützt. Dass man sich Dinge erarbeiten kann, die man nie wieder verliert. Dass jeder durch Leistung und Willen ein freier, wohlhabender Mensch werden kann. Natürlich sind das Illusionen. Jedoch sehr schöne.
Ich bin ein Teil dieser Verlogenheit. Ich verdiene Geld, ich kann mir viel kaufen, ich mache mir keine Sorgen. Wenn mich jemand in einem Interview fragt, ob es nicht doch so etwas gebe wie »Leistung«, ob ich nicht das beste Beispiel sei, dass man durch harte Arbeit an sein Ziel kommt, dann gebe ich immer noch die Antwort, die ich von mir selbst hören will: Dass alles aus Glück besteht und Leistung egal ist. Abstieg und finanzielle Not, sage ich, sind nie eigene Schuld, sondern immer einfach Pech. All die Argumente dafür zähle ich auf, ohne darüber noch groß nachzudenken; die Momente, in denen ich Glück hatte, die Statistiken, die zeigen, dass arme Kinder meistens arm bleiben. Ich weiß sogar, mit welchen Gesten ich welche Aussage untermauere, damit man sie besser versteht. Aber ein Teil von mir zweifelt daran. Ein Teil von mir will Belohnung und Anerkennung.
Neulich habe ich das einer Freundin verraten, als wäre es ein Geheimnis. »Weißt du«, sagte ich, als wir auf das Thema kamen, vor mir stand ein Stück veganer Schokokuchen für 5,60 Euro, »ich denke in letzter Zeit viel über Leistung nach. Darüber, ob es so was nicht vielleicht doch gibt.« Sie hat sich ziemlich darüber gewundert, wie peinlich mir das war.
Zerrissenheit ist viel intimer als Wut. Es fällt mir schwer, sie zu erklären. Ich möchte nichts abgeben, gleichzeitig möchte ich eine bessere Welt. Ich bin eine Salonlinke, ich wäre bereit, mein Einkommen höher zu versteuern, setze mich aber nur halbherzig dafür ein, dass das passiert. Ich bin wie all diejenigen, die ich einst wachrütteln wollte. Eat the rich, darf man das noch rufen, wenn man sich damit selbst den Fuß abbeißen würde?
Oft fragen mich Moderatorinnen bei Veranstaltungen oder Lesungen, was zu tun sei. Was sich ändern müsse — und was jede Einzelne ändern könne, damit weniger Menschen arm sind. Ich sage meistens, dass es gesellschaftliche Mehrheiten für ein soziales Sicherungssystem braucht, in dem Menschen nicht verarmen. Aber das stellt Zuhörer nicht unbedingt zufrieden. Also sage ich dazu: Was jede Einzelne tun kann, ist, sich selbst ehrlich zu betrachten. Sich zu fragen, wie man eigentlich zur Welt steht, welche Privilegien man hat, was man kauft und was man wäre, wenn man all das nicht kaufen könnte. Die Leute lieben es, ihre Privilegien zu reflektieren. Denn aus der Erkenntnis, dass man Privilegien hat, muss nichts folgen. Man kann sich sogar darüber freuen festzustellen, wie gut man es hat. Vielleicht wird man zusätzlich etwas mitleidiger gegenüber denjenigen, die keine Privilegien haben. Aber damit sich politisch etwas ändert, muss eine kritische Masse von Menschen nicht nur ihre Privilegien reflektieren, sondern auch zu der Erkenntnis kommen, dass diese ungerecht sind.
In meinem letzten Sommerurlaub haben wir in einem Boutique-Hotel geschlafen, das schönste Hotel, in dem ich je war. Beim Frühstücken schauten wir aufs Meer, und morgens, beim Aufwachen, auf eine kleine Terrasse. Tagsüber fuhren wir an Strände und lagen auf Liegen herum, deren Miete 25 Euro pro Tag kostete. Abends tranken wir in Bars Apérol Spritz, ein Glas für 15 Euro. Es war wunderbar und schrecklich. Denn ich begann in diesem Urlaub, Stimmen zu hören. Sie sagten: Ja, ja, das ist alles toll hier. Aber brauchst du das? Bist du das jetzt?
Mir begegnet im Alltag häufig der Vorwurf, ich würde meine Privilegien falsch reflektieren. Die falschen Schlüsse ziehen aus dem, was ich erlebe und erlebt habe. Manche Menschen mit Geld finden, es wäre langsam an der Zeit, dass ich aufhöre, linke Positionen zu vertreten; schließlich sei das unauthentisch, da ich ja nachweislich inzwischen genug Geld habe. Diese Haltung ist, nun ja, verunglückt-identitätspolitisch. Als könnte man nur die Dinge richtig finden und vertreten, von denen man selbst profitiert. Wiederum finden Menschen ohne Geld oft, dass ich nicht radikal genug bin. Weil ich kein bedingungsloses Grundeinkommen fordere und weil ich mit Sozialdemokraten spreche, ohne ihnen die Augen auszukratzen. Diese Wut kann ich verstehen, sie beschäftigt mich.
Denn natürlich hätten wir auch in einem billigeren Hotel eine wunderbare Zeit haben können. Oder auf einer billigeren Insel. Wir hätten die Differenz zu diesem Urlaub berechnen und den restlichen Betrag jemandem überweisen können, der Geld braucht. Wir waren nicht die besten Menschen, die wir hätten sein können. Ich war nicht der beste Mensch, der ich hätte sein können.
Das Private ist politisch. Erstens dringen politische Verhältnisse in unser Dasein ein, sie umgeben uns, sie verändern, wie wir leben. Und zweitens ist es umgekehrt nicht egal, wie sich der einzelne Mensch in der Gesellschaft verhält. Geld ist Macht. Besitz ist Macht. Und trotzdem fühle ich mich nicht mächtiger, seitdem ich Geld verdiene. Ich fühle mich nur selbst sicherer. Wenn meine Freunde oder meine Familie Geld brauchen, dann kann ich es ihnen geben. Wenn keine Tram fährt, kann ich mir ein Taxi rufen, um früher nach Hause zu kommen und eine halbe Stunde mehr Schlaf zu bekommen. Ich war seit Jahren nicht mehr wirklich krank, weil ich mir immer sofort alle möglichen Medikamente kaufe (Bärentrauben-Tabletten gegen Blasenentzündung, 17,44 Euro). Weil ich draußen nie friere und immer genau das esse, worauf ich Lust habe (Mindestbestellwert bei meinem Lieblings-Sushiladen in Prenzlauer Berg: 50 Euro). Klingt banal. Ändert aber alles.
Probleme sind in unserer Gesellschaft falsch verteilt. Wenige Leute haben sehr wenige oder sehr kleine Probleme, wozu ich zum Beispiel nierenkranke Katzen, schlechte Schulnoten oder sexlose Partnerschaften zählen würde. Währenddessen haben viele Leute sehr große Probleme. Zum Beispiel schwere Krankheiten, Arbeitslosigkeit, Diskriminierung, Einsamkeit. Diese großen Probleme des Lebens sind meistens die, die sich mit Geld zumindest lindern lassen.
Blöd nur, dass auch das Geld falsch verteilt ist: Viele haben sehr wenig, 40 Prozent der Deutschen geben in Umfragen an, dass sie quasi gar keine Ersparnisse haben. Sie verbrauchen jeden Monat all das Gehalt, das sie verdienen, um die grundlegenden Dinge des Lebens zu kaufen. Gleichzeitig haben sehr wenige sehr viel. Das reichste Prozent der Deutschen besitzt 30 Prozent des Volksvermögens1, und mehr als die Hälfte derjenigen, die große Vermögen besitzen, hat diese Vermögen geerbt.2 Jede Minute werden in Deutschland im Schnitt 500.000 Euro vererbt3, während gleichzeitig jeden Tag Leute hungern, weil sie sich kein Essen kaufen können.
Eigentlich haben wir alle Zugang zu allen Informationen. Jeder, der Zeitung liest, weiß, wie ungerecht die Welt ist. Man kann nachlesen, dass das Geld vieler der reichsten deutschen Familien aus der Nazizeit weitervererbt wurde. Man kann nachlesen, auf welche Weise verschiedene Industrien auf Gesetzgebungen Einfluss nehmen. Man kann nachlesen, wo die Deutsche Bank ihr Geld anlegt. Aber das Wissen über all diese Dinge beeinflusst unsere Handlungen nicht.
Man sagt, dass wir alle unbewusst das Patriarchat verinnerlicht haben. Dass Frauen sich deshalb mehr für Kinder verantwortlich fühlen als Männer, obwohl sie auf einer abstrakten Ebene wissen, dass die Männer genauso verantwortlich sind. Auf eine ähnliche Weise haben wir die Ungerechtigkeit verinnerlicht. Die Leistungsgesellschaft. Noch im edelsten Sozialisten schlummert ein wohlhabender Schnösel, der nur darauf wartet hervorzutreten. Wer im Kapitalismus von »Chancengleichheit« spricht, meint deshalb damit immer: die gleichen Chancen, ein reicher Unsympath zu werden. Denn das ist es, was »Aufstieg« bedeutet.
Je mehr Geld man Leuten gibt, desto unempathischer werden sie, desto unsozialer verhalten sie sich. Diese These ist nicht aus anekdotischer Evidenz entstanden, sondern durch Studien von Dacher Keltner mehrfach belegt worden. Reich zu sein erhöht die Wahrscheinlichkeit, schäbig zu sein,4 persönlicher Überfluss verdirbt uns, selbst wenn wir es schaffen, einen offenen Blick für Ungerechtigkeit zu bewahren. Leute mit Geld setzen sich deshalb selten für ihre eigene Besteuerung ein. Das liegt nicht daran, dass sie diese Besteuerung unbedingt falsch finden. 67 Prozent der Deutschen befürworten höhere Steuern auf höhere Einkommen, fand eine Studie von Infratest dimap52021 heraus. 94 Prozent der Deutschen, ergab im gleichen Zeitraum eine Forsa-Umfrage6, finden es richtig, Kinderarmut zu bekämpfen. Die meisten Menschen würden sich also in einer gerechteren Gesellschaft wohler fühlen, aber die wenigsten tun etwas dafür, dass die Gesellschaft gerechter wird. Das liegt daran, dass sie beschäftigt sind. Sie müssen in Geschäften stehen und Kleidung anprobieren. Sie müssen den Überfluss verwalten, der ihr Verdienst ist.
Die folgenden Kapitel handeln von Dingen, die ich mir gekauft habe. Manchmal auch von Dingen, die andere Leute sich gekauft haben. Ich will erzählen, was ich eigentlich lieber verdrängen würde. Ich will alle Gedanken zulassen, die ich mir mache, über Gerechtigkeit und Konsum-Unsinn. Manchmal sind sie naheliegend. Manchmal abwegig. Manchmal schäme ich mich für sie, weil ich mich selbst nicht mehr erkenne.
Geld ist absurd, alles daran. Wenn ich in den vergangenen Monaten Freunden und Bekannten von dieser These erzählt habe, begannen einige, mir ihre eigenen absurden Käufe aufzuzählen. Weinkühlschränke. Erste-Klasse-Zugtickets. Urlaubsflüge. Küchengeräte. Andere wurden ganz zurückhaltend. Waren darauf bedacht, immer wieder zu erwähnen, wie privilegiert sie sind und dass sie das aber total reflektieren. Wie viel sie spenden oder wie schlecht sie sich fühlen wegen des Autos. Mensch-Geld-Beziehungen, vermute ich, sind noch häufiger gestört als Eltern-Kind-Beziehungen. Vielleicht kann dieses Buch zu etwas Entwirrung beitragen.
600 Euro für einen Umzug
Vier Männer in blauschwarzen Anzügen saßen um M.s Esstisch, in seiner offenen Küche, und warteten darauf, dass ich Kaffee koche. Wobei, ich muss es anders sagen: Es ist ja jetzt in gewisser Weise auch mein Esstisch, denn die Männer haben meine Möbel in die Wohnung getragen. Das heißt, dass ich jetzt hier wohne. Die Männer hatten sich darüber gewundert, dass ich so wenige Möbel besitze. Wir hatten zusammen gelacht darüber, wie einsam meine Sachen in dem riesigen Lkw standen. Sie hätten mit dem Kleintransporter kommen können, sagte einer. Was ich nett fand, denn unangenehme Situationen werden ein bisschen weniger unangenehm, wenn man darüber lacht, und ich finde es unangenehm, dass ich vier Männer gemietet habe, die meinen Umzug erledigen. Aber es schien mir, als wäre jetzt die Zeit im Leben gekommen, in der ich jemanden bezahle, um meine Möbel zu tragen, anstatt Freunde zu fragen.
Das Prinzip Arbeitsteilung setzt — wenn man mal ernsthaft darüber nachdenkt — eigentlich Lohngleichheit voraus. Eigentlich müssten die Möbelpacker genauso viel verdienen wie ich. Denn in der Zeit, in der sie den Laster vorfahren und die Kisten einladen, kann ich etwas anderes tun. Indem ich ihnen Geld gebe, kaufe ich mir Zeit, um selbst Geld zu verdienen. Das heißt, dass unsere Zeit, meine und die der Möbelpacker, im Grunde gleich viel wert ist. Ähnlich ist es mit Erziehern und den Eltern der Kinder, die die Erzieherinnen betreuen. Wenn sie nicht wären, dann könnten die Eltern nicht arbeiten. Das heißt, dass die Erzieher eigentlich den Gegenwert mindestens eines Arbeitstages erwirtschaften, wenn sie gleichzeitig mehrere Kinder betreuen. Aber sie bekommen dieses Geld nicht, weil man ihre Tätigkeit für eine geringere hält als die einer, sagen wir, Marketingleiterin, die ihr Kind morgens in der Kita absetzt und so durch die Arbeit der Erzieherin Geld verdient. Was soll ich sagen: Ich sehe diese Ungerechtigkeit, aber wenn die Möbelpacker dasselbe verdienen würden wie ich, dann hätte ich mir diesen Einzug nicht leisten können, dann hätte ich doch Freunde bitten müssen, mir ihre Zeit zu schenken. Die Arbeit der Möbelpacker wird also mehr nachgefragt, je schlechter sie bezahlt werden.
Umzüge sind Gewahrwerdungsmomente. Man muss jedes einzelne Objekt, das man besitzt, einmal in die Hand nehmen und bewerten. Und merken, wie relativ alles ist. Meine Küchenstühle zum Beispiel. Hatte ich mir im Sonderangebot gekauft, zusammengeschraubt, sie wahnsinnig schön gefunden und bequem. In unserer Wohnung war kein Platz für sie. Die Dinge, über die man sich heute freut, können übermorgen schon Sperrmüll sein.
Als ich etwa fünf Jahre zuvor meine Wohnung in Dortmund ausräumte, um nach München zu ziehen, weil dort die Journalistenschule war, stellte ich eine Kiste mit Sachen auf die Straße, die ich nicht einpacken wollte. Ich hatte ein schlechtes Gewissen deshalb. Ich befürchtete, die Leute könnten sich belästigt fühlen von meiner alten Schreibtischlampe und ein paar Bettbezügen, an denen ein Schild klebte: »Zu verschenken«.
Aber die Kiste war schon nach drei Minuten leer. Eine Frau blieb zwischen meinen Umzugskisten auf dem Bürgersteig stehen, deutete auf den Müll und sagte: »Das wollen Sie nicht mehr?« Ich nickte und ging schnell wieder rein, weil ich es komisch fand, dass da jemand begutachtete, was ich nicht mehr zu brauchen meinte. Als ich wieder aus der Wohnung kam, war die ganze Kiste weg und die Frau auch.
Meine Freunde haben meine Möbel dann weggefahren, von Dortmund nach München, in einem Transporter, den ich gemietet hatte. Der Transporter kostete viel mehr, als meine Möbel alle zusammen wert waren, 180 Euro, plus Sprit. Ich hatte so um die 2000 Euro auf dem Konto, Ersparnisse, übrig geblieben von Stipendien und Honoraren. Das kam mir damals wahnsinnig viel vor. Es reichte für Umzugskosten und Wohnungskaution.
In München angekommen stellten wir alle Möbel und Kisten nebeneinander in ein Zimmer. Um sie auf die Wohnung zu verteilen, wollte ich nicht noch mal jemanden um Hilfe bitten. Weil ich nicht wirken wollte wie so eine, die immer bei allem Hilfe braucht. Ich habe das Bett allein aufgebaut, obwohl auf der IKEA-Aufbauanleitung zwei Personen abgebildet waren. Die Sperrmüll-Massivholzschränke, die ich nicht anheben konnte und auch nicht übers Parkett schleifen durfte, habe ich durch den Flur gekippt, von einer Seite auf die andere, die Türen vorher mit Panzertape fixiert, damit sie nicht aufgehen. Und weil ich den Vermieter nicht nerven wollte beziehungsweise weil ich mich nicht traute, etwas zu sagen, habe ich die Jalousien repariert, die sich nicht mehr in ihrem Kasten einrasten ließen, auf der Fensterbank stehend, mit einem Holzkeil und Spachtelmasse.
Die Wohnung in München hatte keinen Balkon, aber eine breite Fensterbank in der Küche, auf der ich morgens immer die erste Zigarette geraucht habe, in den paar Monaten, in denen ich schon morgens rauchte, weil so viel gleichzeitig passierte, dass ich etwas zum Festhalten brauchte. Das Besteck, das ich besaß, war aus der Kölner Unimensa geklaut, und das Geschirr bestand zur Hälfte aus Einmachgläsern. Einmal saß ich abends mit Freunden in dieser Küche, zu zehnt auf Fensterbank und Klappstühlen. Einer machte einen blöden Kommentar über die Einmachgläser. Hipstermäßig sei das, und warum ich nicht einfach normale Gläser für ein paar Cent kaufen könne. Ich antwortete, dass man für normale Trinkgläser eine Art Verantwortung trage. Während ich die Einmachgläser einfach wegwerfen könne, wenn ich wieder umziehe. Über normale Trinkgläser muss man nachdenken: Finde ich die noch schön? Oder war ich einfach nur pleite, als ich sie gekauft habe? Sind sie es überhaupt wert, in Zeitungspapier eingeschlagen zu werden? Einmachgläser stellen keine Fragen, die kommen einfach in dein Leben, mit Gurken drin, und dann wirfst du sie Monate später in den Altglas-Container.
Genau so habe ich es gemacht. Für den Tag, an dem ich aus München wegzog, mietete ich einen winzigen Laster. Kostete trotzdem wieder viel Geld, 220 Euro, wenn man das Benzin mitrechnet. Das Bett ließ ich für den Nachmieter da, die Einmachgläser warf ich weg. Ich war betrübt, nicht zu Tode, aber betrübt, diese Wohnung zu verlassen, den kleinen Platz davor mit dem Baum, an dem man die Jahreszeiten erkennen konnte, die Bäckerei mit den Brötchen für 90 Cent, das Café, das nur von Donnerstag bis Sonntag geöffnet hatte und in dem die Leute Zeitung lasen, als wäre es ein Sport — ich musste extra gefühllos ausziehen, um damit zurechtzukommen. Eine Zeit lang erzählte ich allen, es wäre mein großer Wunsch, meinen Besitz auf das Kofferraumvolumen eines VW-Golf zu reduzieren. Man kann sich überall wohlfühlen, dachte ich, und überhaupt hängen die meisten Leute zu sehr an Dingen.
Ich hänge auch an Dingen, sogar sehr, aber nur so lange, wie es keinen Aufwand macht. Ich habe die Traurigkeit natürlich gespürt, das erste Möbelstück zurückzulassen, das ich mir von meinem eigenen Geld gekauft habe (IKEA Hemnes Bett in Braun, damals 180 Euro, die Eltern meines damaligen Freundes hatten mir einen Gutschein geschenkt über 100 Euro), die erste Stadt, in der ich mich zu Hause gefühlt habe. Es ist erlaubt, schlechte Gefühle zu haben. Das weiß ich. Das heißt nur nicht, dass ich mir erlauben würde, aus den schlechten Gefühlen Konsequenzen zu ziehen. Schlechte Gefühle ändern nichts. Denn es ist so: Bei den meisten Sachen kann man sich dafür entscheiden, keine große Sache daraus zu machen. Ab auf den Sperrmüll damit. Habe ich mich jemals wohlgefühlt in Berlin? Nein, natürlich nicht. Habe ich drübergestanden? Eben.
Also, unsere Wohnung. Die Wohnung, die mir so viele Fragen gestellt hat: Welche meiner Sperrmüll-Möbel mir wirklich etwas bedeuten und welche ruhig im Keller verschimmeln können, welche meiner Bücher mir peinlich sind und für welche es sich lohnt, Platz im Regal zu machen. Ich bin mit eingezogen in diese Wohnung, weil wir keine größere, schönere Wohnung finden konnten und meine paar Sachen sich zwischen M.s quetschen ließen. Im Wohnzimmer zum Beispiel standen vor meinem Einzug nur ein Sofa und ein Fernseher.
»Schöne Wohnung«, sagte einer der Möbelpacker, als ich die Kaffeekanne auf den Tisch stellte, er suche seit Monaten, sagte er, aber mit drei Kindern ist es schwierig, eigentlich unmöglich, etwas in Berlin zu finden. Ja, sagte ich, es ist wirklich schlimm. Obwohl das natürlich ein Verschleierungsversuch meinerseits war. Wir suchen nicht auf demselben Wohnungsmarkt, wir haben nicht die gleichen Ansprüche, wir werden uns wahrscheinlich niemals auf einem Besichtigungstermin treffen. Immerhin: Die Umzugshelfer wurden mit diesem Auftrag dank meines Minimalismus deutlich früher fertig als vereinbart. Ich erwischte mich bei dem Gedanken, dass ich von der Frau im Möbelpacker-Sekretariat verarscht worden war — vier Männer und so ein Riesenlaster, für den Umzug einer Einzimmerwohnung? Die Hälfte des Preises, dachte ich, wäre wohl angemessener gewesen. Woraufhin ich die Rechnung einscannte, um sie von der Steuer absetzen zu können. Vier Männer waren morgens aufgestanden, hatten sich angezogen, die Wohnungen verlassen, in denen ihre Kinder vielleicht gerne mit ihnen gespielt oder gekuschelt hätten, hatten nicht einmal gestöhnt, als sie voll beladen die Treppen vom dritten Stock runtermussten, immer wieder, Bücherkisten in den Händen. Und ich war trotzdem unverschämt genug zu denken, dass ihre Arbeit mein Geld nicht wert sei. Aus Umzügen lernt man viel über sich selbst, wie gesagt.
Als ich das erste Mal in unserem Wohnzimmer saß, habe ich mich wie ein Gast gefühlt in einem Leben, in dem man solche Sofas besitzt und solche Balkonschiebetüren. War ich ja auch. Jetzt ist es meins, sowohl das Sofa als auch das Leben. Und mit dem Sofa war es wie mit der Fußbodenheizung oder dem Fernseher: Niemals hätte ich mir diese Dinge gewünscht oder gar gekauft, für mich. Aber ein halbes Jahr später, wir hatten immer noch ein Immobilienscout-Abo für 29,99€ im Monat, weil wir dachten, die perfekte Wohnung käme vielleicht, stellte ich fest, dass ich alle Wohnungen ohne Fußbodenheizung kategorisch wegwischte.
»Wie im Hotel«, hat meine Mutter gesagt, als sie ein paar Monate später vorbeikam und in unserem Wohnzimmer stand, Blick auf das Sofa, den Balkon dahinter. Ich lachte und erschrak. Genau das hatte ich auch gedacht, als ich zum ersten Mal hier war.





























