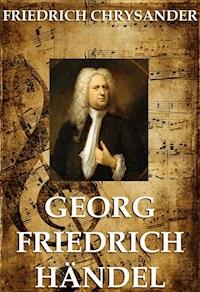
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Chrysanders Lebenswerk ist die unvollendete, mit dem Jahr 1740 abbrechende Biographie Händels (Leipzig 1858-67, Bd. 1-3, erste Hälfte), die zu den bedeutendsten Leistungen auf musikgeschichtlichem Gebiet gehört. Dieser Band umfasst mehrere tausend Bildschirmseiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1958
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
G.F. Händel
Friedrich Chrysander
Inhalt:
Friedrich Chrysander – Lexikalische Biografie
G.F. Händel
Erster Band
An G. G. Gervinus.
Erstes Buch - Jugendzeit und Lehrjahre in Deutschland - 1685–1706
Zweites Buch - Die große Wanderung - 1707–1720
Zweiter Band
Vorwort.
Drittes Buch - Zwanzig Jahre bei der italienischen Oper in London - 1720–1740
Beilagen
Dritter Band
Viertes Buch - Uebergang zum Oratorium - Vollendung und Ende - 1738–1759
G. F. Händel, Friedrich Chrysander
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Freesurf - Fotolia.com
Friedrich Chrysander – Lexikalische Biografie
Deutscher Musikhistoriker, geb. 8. Juli 1826 in Lübtheen im Mecklenburgischen, gest. 3. Sept. 1901 in Bergedorf, studierte in Rostock Philosophie und lebte, nachdem er hier die philosophische Doktorwürde erworben, längere Zeit im Ausland, namentlich in England. Nach Deutschland zurückgekehrt, hielt er sich teils zu Lauenburg, teils zu Vellahne in Mecklenburg auf; seit 1866 hatte er seinen Wohnsitz in Bergedorf bei Hamburg. Chrysanders Lebenswerk ist die leider unvollendete Biographie Händels (Leipz. 1858–67, Bd. 1–3, erste Hälfte), die zu den bedeutendsten Leistungen auf musikgeschichtlichem Gebiet gehört, und die Redaktion, ja zum großen Teil sogar der Stich der Gesamtausgabe der Werke Händels (Ausgabe der Händel-Gesellschaft, 1859–94, 100 Bde.). Zahlreiche historische Studien Chrysanders erschienen in der von ihm redigierten »Allgemeinen musikalischen Zeitung« (bestand 1868–82), in den 1863 und 1867 von ihm herausgegebenen »Jahrbüchern für Musikwissenschaft« und der »Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft« und an andern Orten. Hervorzuheben sind auch seine »Denkmäler der Tonkunst« (vierstimmige Motetten von Palestrina, 4 Oratorien von Carissimi, Corellis Werke und Couperins »Pièces de Clavecin«) sowie seine gekürzten Bearbeitungen Händelscher Oratorien für den heutigen Konzertgebrauch (nicht gedruckt).
G.F. Händel
Erster Band
An G. G. Gervinus.
Vom Leben Händel's überreiche ich hier den ersten Band, die Bildungsgeschichte. Wie weit mein Händelbild dem Ihrigen entspricht, wird nun darauf an kommen. Aber der äußere Umriß, die Abgränzung des Stoffes dürfte so ziemlich Ihre Billigung haben. Denn Sie fanden es gerathen, statt der Monographie über Händel, an der ich arbeitete, eine enger gefaßte Biographie herauszugeben und das übrige Material seiner Zeit für eine allgemeinere Geschichte zu verwerthen; auch theilten Sie meine Hoffnung, so am ersten könne etwas Zeitgemäßes und für die Verbreitung Händel'scher Kunst Förderliches gethan werden. Größere monographische Arbeiten dürften auch schwerlich einen ihrem Umfange entsprechenden Nutzen haben, da sie so leicht verleiten die Geschichte für den Helden zuzuspitzen. An Beispielen fehlt es nicht. Die streng historischen Beweise sind nur da zu führen, wo die Geschichte wirklich in voller Breite zur Sprache kommt, wo jeder Künstler eine seiner inneren Bedeutung entsprechende Berücksichtigung findet: dann steigt die wahre Größe von selbst empor. An einer derartigen Aufgabe mich einmal zu versuchen, werden Arbeiten und Neigungen gleichmäßig antreiben, und meinen Sie nicht auch, daß für eine Geschichte der Musik in den drei letzten Jahrhunderten Palestrina der passende Anknüpfungspunkt wäre? – Hier aber habe ich es ausschließlich mit dem Leben, der Kunst, der historischen und künstlerischen Umgebung Händel's zu thun, und in diesen Dingen der Wahrheit auf den Grund zu gehen, war mein alleiniges Bestreben. Was Ihnen dabei an Vergleichungen, an Vor- und Rückblicken, an allgemein geschichtlichen Zügen begegnet, beurtheilen Sie gütigst als Fingerzeige, als Andeutungen der historischen Stellung, die nur dann ohne Schaden für das Verständniß noch gedrängter hätten gegeben werden können, wenn sich die geschichtlichen Untersuchungen der Tonkunst in einem weniger barbarischen Zustande befänden, als leider der Fall ist. Denn was ist Geschichte der Musik? Ein Trümmerhaufen, von dem neun Zehntel mit Staub bedeckt sind, das letzte Zehntel aber nach Geschmacksrücksichten unter den »Liebhabern« Obdach hat.
Meine Quellen sind immer an dem Orte sichtbar geworden wo sie in die Darstellung einfließen. Was ich über diejenigen Schriftsteller denke, welche ich als meine Vorgänger respectiren muß, habe ich zum Theil gesagt, zum Theil für mich behalten; durchweg mehr bestrebt ihre guten Nachrichten zusammenzuleiten, als ihre Fehler aufzuzählen, habe ich doch stellenweise, wo die Irrthümer wie trockene Holzscheite geschichtet lagen, nicht umhin können ein kleines Feuer zu unterhalten. Gedruckte Ausgaben der Händelwerke werden Sie nur sehr spärlich angeführt finden. Ich denke, wer mir eine gewissenhafte Untersuchung der Originalhandschriften zutraut, und das darf ich wohl beanspruchen, wird mir eine beständige Verweisung auf die vorhandenen Drucke gern erlassen; dadurch allein sind einige hundert Noten gespart. Wäre ich zu meiner Sicherstellung gezwungen die Citate noch massenhafter zu geben, so würde das Gewicht der Noten den Text nur um so mehr belasten, und da ich ohnehin mit Schwierigkeiten aller Art zu ringen hatte, dürfte ich nicht hoffen von der leicht verständlichen einfachen Haltung, der ich nachstrebte, irgend etwas erreicht zu haben.
Vielleicht fällt Ihnen auf, daß ich das anonym erschienene Büchlein Memoirs of the life of the late George Frederic Handel, London 1760. 8, von dem bisher nur so obenhin die Rede war, bei jedem Schritte sorgfältig zu Rathe gezogen habe. So überaus unvollkommen es auch ist, besitzt es doch wesentlich alle Vorzüge, die derartigen Berichten von Zeitgenossen eigen zu sein pflegen. Der Verfasser – John Mainwaring, ein theologischer Gelehrter, damals 25 Jahre alt – that von seinem Eignen wenig mehr hinzu, als eine recht lebendige, etwas breitläufige Rede, er schrieb die über Händel's Leben bekannt gewordenen Nachrichten und die Ansichten über seine Kunst so zusammen, wie sie dem England von 1760 vorstanden. Die abgerundeten, ausgebildeten, nicht selten ausgeschmückten Geschichten zeigen, wie vielfach Händel's Leben schon in mündlicher Erzählung umgelaufen war. Mainwaring's Schrift war durchaus kein Erzeugniß besonderer Pietät, sondern ein reines Buchhändlerunternehmen, das sich nicht einmal Händel's ausschließliche Verehrer als Käufer dachte, vielmehr die große Zahl derjenigen Engländer die sich die Erscheinung des ausländischen Tonmeisters klar zu machen wünschten. Wie merkwürdig ihnen dieser Mann vorkam, auch seinen Widersachern, können wir uns kaum noch lebendig genug vorstellen; hier will ich nur daran erinnern, daß von allen großen Musikern, die vor Händel lebten, keiner mehr als eine Leichenrede, ein akademisches Programm, ein Carmen, einen Nachruf in der Zeitung, ein Conterfei, einen Artikel im Lexikon davon brachte. Wirklich ist Mainwaring's Büchlein die erste Biographie irgend eines Tonkünstlers; auch in dieser Hinsicht, auch für die Würdigung der Musiker als geistig bedeutender Menschen war Händel's Erscheinung entscheidend. Für eine höhere Auffassung seines Wesens ist durch Mainwaring freilich nichts gethan, doch hat er in aller Unschuld manchen geistig und historisch bedeutsamen Zug bewahrt. So umstellt er den Händel von seiner Kindheit an mit einer Schaar treuer Freunde, die wie gute Engel überall da sind, wo es etwas zu bewachen, zu rathen, zu lenken giebt. Gute Freunde ergreifen die Partei des Sohnes gegen den alten Vater, wissen das Anerbieten des preußischen Hofes abzulehnen, rathen zu einem einstweiligen Aufenthalte in Hamburg, bringen ihn nach Italien, bereden ihn zu einer Carnevaloper, laden ihn nach England ein, führen ihn nach Hannover, und so weiter durch's ganze Leben; Orte, Zeiten, Personen wechseln, aber diese treue Schutzmannschaft ergänzt sich immer wieder und läuft nach und nach aus in die Bewunderung des ganzen England, der ganzen Welt. Zu einer solchen Auffassung kam Mainwaring nicht aus eignem Nachdenken, er gab die Erzählungen einfach in der Gestalt in welcher sie vorlagen. Wie viel sachlich dabei zu ergänzen und zu berichtigen bleibt, wird schon dieser erste Band zeigen, aber auch wie sehr eine solche Anschauung aus dem Charakter Händel's und seiner Zeit hergenommen ist. An dem Buche läßt sich noch die ziemlich gleichmäßige Beachtung der verschiedenen Lebensabschnitte loben, dabei hält sich das Urtheil immer hübsch unparteilich; und ist das Bekenntniß, gewisse Dinge im Händel müsse man, an natürlicher Erklärung verzweifelnd, kurzum für göttliche Erleuchtung halten, nicht ein tapferer Ausspruch in Voltaire's Zeitalter? Dennoch ist es sehr zu bedauern, daß sich unter Händel's persönlichen Bekannten keiner fand, der die runden schlagartigen Ausdrücke über sein Leben, über Vorgänger und Zeitgenossen, so wie sie aus seinem eignen Munde kamen, in ein Buch bringen mögen; namentlich, daß beide Johann Christoph Schmidt, Vater und Sohn, die ihn aus persönlichem Umgange durch sechzig Jahre kannten, nur zum Notenschreiben die Feder zu führen wußten: sonst hätten wir schon seit hundert Jahren ein Leben des Meisters, ein Händelbuch haben können in einer Treue Fülle und Frische, wie ein solches von keinem zweiten Künstler dagewesen wäre, und die Pilgerfahrten nach Händel's Spuren von einem so spätgebornen und geringen deutschen Landsmanne, wie ich bin, wären mehr als überflüssig gewesen. Niemand kann dieses lebhafter wünschen, als ich selber, denn was an historischer Kunde einmal verklungen ist, läßt sich mitunter durch Anderes ersetzen, aber in ursprünglicher Gestalt nie völlig wiedergewinnen. Was jetzt in Mainwaring, Hawkins, Burney, (Coxe und anderswo zerstreut ist, zeigt nur wie diel Material vorlag. Uns Späteren würde auch bei vollständigster und treuester Ueberlieferung der Lebensnachrichten in der allseitigen Würdigung der Tonwerke immer noch eine bedeutende Aufgabe bleiben.
Händel's Werke sind es denn auch, deren volleres Verständniß alle unsere jetzigen Bestrebungen müssen bewirken helfen. Wer jemals von Händel erfaßt ist, der wird den Wunsch theilen, seine Schöpfungen aus dem Ganzen heraus und als Ganzes kennen zu lernen, zu hören und gedruckt zu besitzen. Fast alle sind in der Handschrift des Meisters noch vollständig erhalten, und eine erneuerte Untersuchung hat über Erwarten bestätigt, wie so vieles noch unbekannt oder ungenügend bekannt ist, welche Reihe von Kunstwerken uns die nächsten Erben Händel's zu beschreiben, zu drucken, zu verbreiten übrig gelassen haben. Besonders in Deutschland fehlte den Händelwerken bisher das, was einem Baume fehlt der auf der Schattenseite steht. Ich wiederhole nur Ihren Gedanken, wenn ich sage, daß wir arbeiten in der Hoffnung, sie werden endlich auch hier für die Kunst vollgedeihlich ausschlagen. Treulich der Ihrige.
Am 1. Januar 1858.
Friedrich Chrysander.
Erstes Buch - Jugendzeit und Lehrjahre in Deutschland - 1685–1706
1. Name und Familie.
Händel schrieb seinen Namen in Deutschland von Anfang an so wie wir ihn jetzt allgemein schreiben, aber in Italien und mitunter später bei italienischen Compositionen Hendel, und in England sowie bei englischen und französischen Briefen Handel. Die Schreibart Händel war schon seinen Eltern geläufig als ein Unterscheidungszeichen von der noch jetzt in Halle vorhandenen Nebenlinie Hendel. Die gewöhnliche Annahme, erst aus dem englischen Handel sei unser Händel entstanden, ist also nicht richtig. »Im Orch. II stehet dieser Name loco quarto, weil er damals mit einem e geschrieben wurde; da aber nachdem ein a daraus geworden ist, habe ihn loco tertio setzen müssen« – sagt Händel's Zeitgenosse Mattheson im Jahre 17251, hinweisend auf das sieben Jahre vorher von ihm herausgegebene »Beschützte Orchestre.« Diese bestimmte, wiederholt von ihm ausgesprochene Behauptung wird den Irrthum veranlaßt haben. Die wirre Orthographie der damaligen Zeit brachte ein Dutzend und mehr abweichende Schreibarten zuwege: Händel Hendel Händeler Hendeler Händtler Hendtler – Handel Haendel Hendel Handell Hendall Hendell Hondel Handle. Das Wort Händeler in den Halle'schen Urkunden offenbart die ursprüngliche Bedeutung dieses Namens; es kann für uns natürlich nicht weiter maßgebend sein, sonst müßten wir jetzt Händler sprechen und schreiben.
Das Geschlecht des großen Mannes hat der verstorbene Förstemann2 bis zu dem Großvater hinauf verfolgen können. Dieser, der Kupferschmiedemeister Valentin Händel, über den schon Olearius3 das Nöthige mitgetheilt hat, erscheint hiernach als der Stammvater. Er wurde im Jahre 1582 zu Breslau geboren, kam auf seiner Wanderung nach Halle und erwarb sich hier 1609 das Bürgerrecht; verheirathet war er seit 1608 mit Anna Beichling (1586–1670), einem Mädchen seines Standes, der Tochter des Kupferschmiedemeisters Samuel Beichling zu Eisleben. Seine Vorfahren und mehrere seiner Nachkommen nährten sich von demselben Geschäfte. Als er am 20. August 1636 im 54. Lebensjahre starb, hinterließ er an Kindern eine verheirathete Tochter und drei Söhne.
Während Valentin und Christoph, die beiden ältesten, bei dem Gewerbe des Vaters blieben, schlug der im September 1622 geborne Georg, unseres Händel's Vater, eine andere Richtung ein. Er wurde Barbier und Wundarzt, wählte also zu seiner Berufsthätigkeit ein Mittelding zwischen Wissenschaft, Handwerk und Kunst. Den Anfang hierin machte er gewiß als einfacher Barbier, und seine erste bürgerliche Stellung begründete er sich durch eine frühzeitige Heirath. Am 15. April 1639 starb der Halle'sche Barbier Christoph Oettinger, hinterlassend eine Wittwe mit der er erst seit 41/2, Jahren verbunden war. Vier Jahre später, am 20. Februar 1643, heirathete Georg Händel diese Wittwe und erreichte dadurch, daß er schon jetzt nach kaum zurückgelegtem zwanzigsten Lebensjahre als »Meister Görge« in die Bürgerrollen der Stadt eingezeichnet wurde. Die Vermuthung liegt nahe, Wittwe Anna Oettinger habe durch Gesellen das Geschäft ihres Mannes fortgesetzt, Georg Händel sei noch von Oettinger selber in die Lehre genommen worden, dann der Frau untergeben gewesen, bis er sich mit ihr ehelich verband. Sie war ihm an Alter zehn Jahre überlegen. In dieser Ehe wurden ihm sechs Kinder geboren, drei Söhne und drei Töchter, von denen aber nur das erste und das fünfte Kind, Dorothea Elisabeth und Karl, das Geschlecht fortpflanzten.
Meister Görge blieb nicht im Niedrigen sitzen, sondern strebte rüstig aufwärts. Einen bedeutenden äußeren Erfolg seiner Geschicklichkeit errang er schon 1652, da er zum Chirurgen des Amtes Giebichenstein ernannt wurde. Wann er weiter zum fürstlich sächsischen (und churfürstlich brandenburgischen) geheimen Kammerdiener und Leibchirurgen zu Halle aufrückte, war nicht zu ermitteln; jedenfalls vor 1674.
Am 9. October 1682 starb seine Ehefrau Anna im 72. Lebensjahre. Georg Händel zählte schon zweiundsechzig, dennoch schritt er zur zweiten Ehe. Er erwählte sich Dorothea, die Tochter des Pastor Georg Tauft zu Giebichenstein, dem er lange bekannt und wahrscheinlich auch gut befreundet war; ebenfalls kannte er die Jungfrau seit vielen Jahren. Schon am 23. April 1683 war die Hochzeit, und der alte Pastor schrieb ganz vergnügt in sein Kirchenbuch:
»Der Edele, wol Ehrenveste, grosachtbare und kunstberühmte Hr. Georg Hendel, Churfürstl. Brandenburg. wolbestalter Kammerdiener mit Jungfer Dorotheen, meiner Tochter, den 23. Aprilis zu Giebichenstein.«
Schloß und Dorf Giebichenstein an der Saale, im Norden von Halle gelegen und damals eine viertel Stunde von dieser Stadt entfernt, ist jetzt fast ganz mit derselben verbunden und nach und nach zu einem reizenden Vergnügungsorte der Hallenser umgeschaffen. Von der alten Kirche zu St. Bartholomäus ist der Thurm erhalten, alles Uebrige aber mußte um 1740 einem Neubau Platz machen. Hier wirkte Georg Tauft von 1654 bis zu seinem Tode 1685 als der siebente evangelische Prediger an dieser Kirche.4 Vorher war er zu Neuendorff, und von 1648 bis 1654 zu Dießkau, in einem Dorfe welches eine kleine Meile von Halle an der alten Leipziger Landstraße liegt.5
Dorothea Tauft sollte Händel's Mutter werden. Weil ich so glücklich war noch ein Exemplar des Leichen-Sermons zu finden, der zu ihrem Andenken gehalten und auf Kosten ihres großen Sohnes gedruckt wurde, so kann ich auch über sie und ihre Eltern alles mittheilen was man nur wünschen mag. Lasse aber die Memoria Defunctae, diese Urchronik der Händelschen Familie, selbst reden, da sie uns den protestantisch frommen Sinn und die altehrwürdigen Sitten derselben besser als jegliche Beschreibung veranschaulicht. Es heißt dort:
»Sie erblickte das Licht dieser Welt zum erstenmal im Jahr Christi 1651 den 8. Febr. st.v. [nach dem alten Kalender] zu Dießkau. Ihr Herr Vater war Tit. Herr George Tauft, wohlverdienter Pastor zu besagtem Dießkau, der aber nachhero von der damahligen Hochfürstl. Herrschaft zum Diener des göttlichen Worts bey der Gemeinde zu Giebichenstein und Crotwitz ordentlich vociret worden. Ihre Frau Mutter ist gewesen Frau Dorothea, eine gebohrne Cunoin, Tit. Herrn Johann Christoph Cunoes Not. Publ. und Arendatoris des Amts Beesen, wie auch hernachmahls wohlbestalten Ober-Bornmeisters alhier, eheleibliche Tochter. Der Herr Groß-Vater, von väterlicher Seite, war Herr Johann Tauft, welcher bey den damahligen Religions-Troubeln und harten Verfolgung der Augspurgischen Confessions-Verwandten [um 1625], der reinen Evangelischen Wahrheit zur Liebe, aus dem Königreich Böhmen entwichen, alle seine Güter nach der Vorschrift Christi Matth. XIX, 29. freywillig verlassen, und lieber als ein privatus allhier zu Halle, als in seinem Vaterlande in gutem Ansehen und großem Vermögen leben wollen; welches veste Vertrauen auch der Höchste ihm reichlich vergolten. Die Frau Groß-Mutter, mütterlicher Seiten, ist gewesen Frau Catharina, gebohrne Oleariin, des Tit. theuren Herrn Johann Olearii S.S. Theol. Doctoris Superintendentis, wie auch Ober-Pfarrers und Pastoris bey der Kirchen zu U.L. Frauen eheleibliche Tochter.«
»Sie zehlete dis unter die besonderen Wohlthaten, welche Ihr GOtt erwiesen, daß Sie aus priesterlichen Geschlechte herstamme und einen frommen Vater gehabt, welcher durch einen gerechten Eyffer vor die wahre Religion in die Fußstapffen seines lieben Vaters getreten. Von mütterlicher Seite her, konte Sie sich rühmen, daß Sie mit dem gesegneten Stamm derer um die Kirche Christi, besonders an diesem Orte, hochverdienten Olearien, genau verwand. Dis gereichet Ihr aber zu noch mehrern Ruhm, daß Sie denen Tugenden derer Eltern und Groß-Eltern zu folgen sich ernstlich angelegen seyn ließ.«
»Vorerwehnte fromme Eltern liessen, so viel an Ihnen war, nichts mangeln, was eine GOtt und Menschen wohlgefällige Aufferziehung erforderte: dahero Dero Herr Vater, als er einen aufgeweckten Kopf und ein gut Gedächtniß, womit GOtt Sie vor vielen andern ihres Geschlechts begabet, an seinem Kinde gewahr worden, es bey der Information privat-Praeceptorum nicht bloß bewenden ließ, sondern, so viel seine Amts-Verrichtungen es verstatten wolten, selbst Hand anlegte, und Sie so wohl im Christenthum vester zu gründen, als auch das H. Bibel-Buch bekannt zu machen, bemühet war; welche Arbeit der HErr auch dergestalt gesegnet, daß Sie bey mehrern Jahren, ja die gantze Zeit ihres Lebens, aus diesem in ihrer Jugend eingesamleten Schatz der besten Kern-Sprüche einen Vorrath über den andern zu ihrer eigenen und anderer Erbauung herausnehmen können. Diese ihre Christliche Aufführung und übrige angenehme Gemüths- und Leibes-Gaben, nebst vollkommener Wissenschaft einer Haushaltung vorzustehen, bewogen, bey ihren mannbaren Jahren, viele Gemüther, um eine eheliche Verbindung mit Ihr, bey ihren Eltern anzusuchen. Ob nun wohl diese einer glücklichen Veränderung niemahlen entgegen, vielmehr ihre Versorgung wünschten, so war Sie doch hierzu, aus Liebe zu Denselben, welche Sie bey ihren hohen Jahren, (zumahlen den Herrn Vater, nachdem Derselbe durch den Todt der Frau Mutter Anno 1681 in den Witwer-Standt gesetzet,) zu verlassen, Sie wider die kindliche Pflicht zu seyn hielte, auf keine Art zu bringen; ja die Liebe gegen ihren alten und wegen eines harten Falls elend gewordenen Herrn Vater war so groß, daß Sie, bey damals grassirender Contagion, ihr eigenes Leben (für welches doch der Herr Vater gesorget und seine Tochter anderswo hingebracht) nicht schonete, vielmehr ihn, da die Pfarr-Wohnung zu Giebichenstein bereits starck inficiret, nicht unbesuchet gelassen, noch erwogen, daß der Todt, so ihre Jungfer Schwester, ältesten Herrn Bruder, als Adjunctum seines Herrn Vaters, und dessen Eheliebste durch diese Seuche dahin gerissen, auch ihrer daselbsten warten möchte. Vielmehr blieb sie bey Leistung ihrer kindlichen Pflicht unerschrocken und getrost, indem sie wuste, daß GOtt in diesen trübseeligen Zeiten Sie erhalten, und auch vom Tode erretten könne, wie denn unsere Selige zum Preise GOttes, daß sie seines allmächtigen Schutzes damals an ihr erfahren, öffters zu erzehlen pflegte. Als aber solche Plage hinwieder gäntzlich cessiret, und ihr alter Herr Vater, durch eine anderweitige Adjunction ihres jüngsten Herrn Bruders, in etwas, bey seinen nunmehr beschwerlich gewordenen Amts-Verrichtungen, soulagiret; vermochte die Seelige der weisen Führung des Höchsten und dem vielen Zureden ihres Herrn Vaters auch andrer guten Freunde nicht länger zu widerstehen, und resolvirte sich, nach vorhergegangenem fleissigen Gebet, in dem Namen GOttes, mit dem um Sie anhaltenden Herrn George Händeln, Sr. Hochfürstl. Durchl. Herrn Augusti, Hertzoges zu Sachsen und Postulirten Administratoris des Primats-Ertz-Stiffts Magdeburg, wohlbestalten Geheimten Cammer-Diener in ein Christliches Ehe-Verbindniß einzulassen, welches auch kurtz darauf zu Giebichenstein an H. Stätte, durch priesterliche Copulation, die ihr Herr Vater zu seinem höchsten Vergnügen noch selbst verrichten konnte, am Tage Georgii, war der 23. April des 1683. Jahres, vollzogen wurde.«
Wer diese Mittheilungen aufmerksam liest, der wird leicht bemerken, daß alle hervorstechenden Züge der Mutter bei dem Sohne wieder zu Tage kommen. Den hellen Geist, die tiefe Frömmigkeit und Bibelkenntniß, die starke Liebe zu den Eltern, die geringe Neigung zur Heirath eben in der Blüthe der Jugend, die Tüchtigkeit in dem gesammten Tagewerk, den Ernst und die Sittsamkeit: das alles hat sie mit ihm gemein, hat sie ihm eingeboren und eingebildet. Jungfrau Dorothea stand im dreiunddreißigsten Lebensjahre, der erwählte Gemahl im dreiundsechzigsten, im Greisenalter; über die Zeit, welche man die besten Jahre nennt, war auch sie schon hinweg. Wohin man sieht, überall Gesundheit und züchtig ehrbarer Sinn, aber nirgends eine Spur von hervorstechender Körperschönheit, wie sie sonst in den nächsten Geschlechtern nach dem 30jährigen Kriege so auffallend häufig erscheint, noch Werthlegung darauf. Auch das ist eine Eigenthümlichkeit, die sich beim Sohne wiederfindet. Man sieht also, daß einige Grundlinien für seinen Charakter schon hier gezogen waren.
»Wie nun Ehen,« heißt es in dem Lebensbericht der Mutter weiter, »die auf kein vergängliches Interesse, sondern vielmehr auf Gleichheit der Gemüther und wahre Tugend gegründet, nicht anders als wohl gerathen können; also hat auch unsere Seelige mit diesem ihrem Ehe-Herrn bis an den Tag seines Todes, jederzeit ruhig, vergnügt und Christ-friedlich gelebet, auch mit ihm gezeuget Vier Kinder: als zwo Söhne, davon aber der erstere gleich in der Stunde seiner Geburt Ao. 1684 hinwieder seelig verstorben; dessen Verlust aber der Grundgütige GOtt, zu der Eltern und des Herrn Groß-Vaters Freude, hinwieder ersetzte durch Schenkung des andern Sohnes, nemlich
Georgen Friederichen, gebohren den 23. Febr. Anno 1685.....
Und zwo Töchter, namentlich
I. Dorothea Sophia, so gebohren den 6. Octobr. Ao.1687.....
II. Johanna Christiana, gebohren Ao. 1690 den 10. Jan.«
Das Söhnlein wurde nach damaliger Sitte bald, und zwar schon am folgenden Tage getauft. Auf nachstehende Weise ist das Ereigniß in das Kirchenbuch eingetragen:
»1685.
Die Woche Sexagesimae.
Febr. Vater Täuffling. Pathen.
24 Hr. Georg Georg Herr Philipp Fehrsdorff,
Händel, Friederich Hochfl. Sächs. Verwalter
Cammerdiener zu Langendorff,
und Jungfer Anna, Herrn Georg
Amts Tauftens, gewesenen Pfarrers
Chirurgus. zum Giebichenstein S.
nachgel. Jgfr.Tochter, und
Hr. Zacharias Kleinhempel,
Amtsbarbier auffm
Neumarckt allhier.«6
bezeichnet den Dienstag, also ist Händel am Montage geboren. Von den Pathen war Fehrsdorff oder Pferstorff sein Schwager, Kleinhempel ebenfalls, Anna Tauft war seine Tante, Schwester der Mutter. Die Namen Georg Friedrich hat er also nicht von seinen Pathen erhalten. Man sieht auch, daß der alte Pastor Georg Tauft, der Großvater, nicht mehr unter den Lebenden weilte. Er war vor einigen Wochen gestorben. Die Worte des Leichenredners, auch er habe über den zweiten Sohn seiner Tochter Freude empfunden, sind daher etwas zu weit gegriffen. Aus Trauer über den Großvater konnte sich bei der Taufe Georg Friedrich's wohl nur eine gedämpfte Freude kund geben.
Bisher galt Händel als der erstgeborne und einzige Sohn zweiter Ehe, von einem älteren Bruder wußte auch Förstemann nichts. Und sehr sonderbar hat man über Tag und Jahr seiner Geburt hin und her gerathen. Allein richtig ist die Angabe bei Walther7, dem ersten welcher von Händel's Leben öffentlich etwas bekannt machte, und darnach bei Dreyhaupt8, der hier aber keineswegs, wie Förstemann meint, selbständig forschte, sondern einfach das musikalische Lexicon ausschrieb. Acht Jahre nach Walther verwirrte Mattheson das Jahr, indem er auf 1684 hinwies9; und dann 1761 aus reiner Fahrlässigkeit auch den Geburtstag, da er mit Mainwaring10 diesen auf den 24. Hornung setzte.11 Durch die Inschrift auf Händel's Denkmal in der Westmünsterabtei wurden diese Irrthümer sanctionirt. Seit dieser Zeit gerieth die Zeitangabe in Händel's Leben vollständig in Verwirrung. Burney vermißt Genauigkeit und Uebereinstimmung bei den Nachrichten über Händel's Jugend, schließt sich aber den genannten Gewährsmännern einfach an indem er meint, darüber mindestens sei man einig, daß er zu Halle am 24. Februar 1684 geboren wurde.12 Eschenburg, Burney's Uebersetzer, kann sich hierbei nicht beruhigen, da er Walther's abweichende Angabe gewahr wird, schreibt nach Halle, und verkündet die glückliche Entdeckung: »aus dem Kirchenbuche der lieben Frauenkirche zu Halle, und dem mir von dem würdigen Prediger an derselben, Herr Pockels, mitgetheilten Auszuge daraus, ergiebt sich itzt der Umstand mit Gewißheit, daß Händel 1685 den 24. Februar geboren sey.«13 Auf diese Weise war Burney berichtigt und Walther berichtigt, war den Engländern bewiesen, daß sie mit der großen Feier des Jubiläums um ein Jahr zu früh gekommen, und überhaupt alles in Ordnung gebracht. Einige Zeit nachher hieß es plötzlich wieder, Händel sei schon 1684 in die Welt getreten: man vergleiche die einschlagende musikalische Literatur der letzten fünfzig Jahre. Förstemann schreibt zum zweiten Male das Kirchenbuch aus, zieht das Jahr 1685 wieder hervor, muß aber wegen des Geburtstages im Ungewissen bleiben, da im Kirchenbuche nur gesagt ist: getauft am 24. Februar. Eschenburg's Entdeckung ist zur Hälfte wieder dahin. Doch mit großer Wahrscheinlichkeit glaubt Förstemann den Tag der Geburt auf den 23. legen zu dürfen, weil damals noch die Sitte bestanden, das Kindlein gleich am andern (oder dritten) Tage zu taufen: welche Vermuthung C. v. Winterfeld indeß nicht abhalten konnte, wieder den 24. als Geburtstag zu bezeichnen.14 Mutter und nächste Verwandte werden es doch wohl gewußt haben. Daher denke ich, in diesem Punkte habe der Irrthum seinen Cirkelgang nunmehr vollendet, und sei uns endlich gestattet, wieder auf das Richtige zurück zu kommen.
Auch an Händel's Vater hat man auszusetzen gehabt. Besonders die Deutschen wollten ihn an Stand und Gesinnung niedriger haben, als er wirklich war. So sagt Rochlitz, um zu beweisen, daß Händel gleich Bach »in niederm Stande und in kümmerlichen Verhältnissen aufgewachsen« sei: »Die neuesten Biographen Händel's haben seinen Vater einen Arzt genannt: doch wohl, um des herrlichen Mannes Abkunft zu heben. Ich aber glaube ihn selbst zu heben, wenn ich der Wahrheit gemäß sage: Händel's Vater war, nach damaligem Ausdruck, ein Bader, nach jetzigem ein Barbier, zu Halle, der höchstens dann und wann in die Chirurgie hineingepfuscht haben mag. Auch seine Gedanken vom Sohne, seine Gesinnungen gegen ihn, seine Art, ihn – nicht sowohl zu erziehen, als zu handhaben, waren ganz die eines gewöhnlichen Barbiers.«15 Wo Rochlitz diese »Wahrheit« gefunden, sagt er nicht. Leicht müßte es für ihn gewesen sein, hier das Rechte zu erfahren, da von Leipzig nach Halle so gar weit nicht ist. Rochlitz gehört zu den Geistreichen, die geschichtliche Einsicht verachten und doch aller Orten mit ihrem historischen Wissen großthun. Auch der Schluß von den Erziehungsgrundsätzen auf den Stand ist verkehrt genug: ein gewöhnlicher Bader, noch dazu ein hochbejahrter, hätte sich mit der Aussicht, sein Sohn werde einmal zu einem angesehenen Musiker aufsteigen, gewiß zufrieden gegeben, nicht so ein fürstlicher und amtlicher Diener von ansehnlicher Verwandtschaft und in behäbigen Vermögensumständen. Den Vater des Sohnes wegen heben, ist noch immer viel edler, als ihn und seine Handlungsweise nach willkürlichen Einfällen schlecht machen. Aber hier ist auch das erste nicht nöthig: man bleibe einfach bei der Wahrheit, sie ist sich selber Schmuck genug und zeigt Händel's Verhältniß zu seinen Eltern in einer Schönheit, welche demselben durch keine Ausschmückung verliehen werden könnte.
Daß Georg Friedrich auch seines alten Vaters, nicht bloß der Mutter Liebling gewesen, setzen die Erzählungen unbestimmt voraus. Den sicheren Beweis lieferte mir eine Thatsache, die mich sehr überraschte: den noch lebenden Herrn Otto Hendel, Buchdruckereibesitzer zu Halle, fand ich auf den ersten Blick dem großen Manne ähnlicher, als viele Kupferstiche. Was sich so lange, und zwar bei einer Nebenlinie die sich schon um 1620 abzweigte, gleichmäßig erhielt, ist gewiß als das ächt Händelsche Familiengesicht anzusehen. So ist kein Zweifel: beide, Vater und Mutter, fanden sich in ihm wieder. Kenner menschlicher Natur wissen, welch ein eheliches Glück ein solches Kind voraussetzt und fortdauernd erhält. Und wie wir hervorstechende Gemüthsneigungen sowie den ehrbar bürgerlichen Sinn bei der Mutter vorgebildet fanden, so zeigt der Lebensgang des Vaters, daß dieser etwas besaß von dem kühnen Drange nach außen und aufwärts, von dem unbeugsamen Willen und der bis in das höchste Alter ungeschwächten Kraft, von jenen Eigenschaften also, durch welche der Sohn die Bewunderung seiner Zeitgenossen erregte und seinen Genius nach langem Kampfe zum Siege verhalf. Der Genius, der Tongeist ist Gottes Gabe, die Geistes- und Körperformen sind ein Ueberkommniß der Familie, bei gewöhnlichen Menschen durch allerlei Vorurtheile gebunden, bei hervorragenden Naturen zu individueller Freiheit, zum Charakter ausgebildet: und die Beschreibung eines solchen Lebens höherer Begabung muß bestrebt sein, jeden Schritt seiner Entwickelung, von der traulichen engen Umfriedung der Familie aus bis zum Höchsten aufsteigend, verständlich darzulegen.
Fußnoten
1Critica Musica.Hamburg 1725. 4. II, 211.
2 G.F. Händel's Stammbaum von Karl Eduard Förstemann. Leipzig 1844. Fol. Taf. I.
3 J. Gf. Olearius, Coemeterium Saxo-Hallense. Wittenberg 1674. 4. p. 152.
4 J. Chr. von Dreyhaupt, Beschreibung des Saal-Creyses. Halle 1755. Fol. II, 900–901.
5 Dreyhaupt II, 893–94.
6 Taufregister der Oberpfarrkirche zu Unser Lieben Frauen in Halle a. S. von 1607–1686 p. 663.
7 Musikalisches Lexicon. Leipzig 1732. S. 309.
8 Beschreibung des Saal-Creyses II, 625.
9Ehren-Pforte. Hamburg 1740. 4. S. 93.
10Memoirs of the Life of the late George Frederic Handel.London 1769. p. 1.
11 G.F. Händel's Lebensbeschreibung. Uebersetzet von Mattheson. Hamburg 1761. S. 1.
12»It is however generally agreed, that the great musician, George Frederic Handel, was born at Halle the 24th of February, 1684.«Sketch in Commemoration of Handel. London 1785. 4. p. 2.
13 Burney's Nachricht von Georg Friedrich Händel's Lebensumständen und der ihm zu London 1784 angestellten Gedächtnißfeier. Uebersetzt von J.J. Eschenburg. Berlin 1785. 4. S. IV.
14
2. Kindheit.
Die Stadt Halle im Bisthum Magdeburg gehörte früher zum Churfürstenthum Sachsen. Bei dem Friedensschlusse 1648 wurde das Bisthum dem Churfürsten von Brandenburg zugesprochen, doch sollte dieser erst nach dem Tode des sächsischen Prinzen Augustus, dem es zur Verwaltung überwiesen war, davon Besitz ergreifen. Herzog Augustus hatte seinen Hofhalt zu Halle in der berühmten und alterthümlich schönen Moritzburg; er war es, der Händel's Vater zum geheimen Kammerdiener ernannte. Durch den Administrator kam fürstlicher Glanz in die Stadt und Festlichkeit einer Residenz. Was diesem Hofe an Größe abging, ersetzte die Verwandtschaft mit dem weitverzweigten sächsischen Fürstenhause; reicher Verkehr zwischen Brüdern und Schwähern und Vettern trat an die Stelle königlicher Pracht. Zu einem solchen Hofe, der durch seine zufällige Existenz ein mehr bürgerliches Ansehen gewann, nehme man eine Stadt wie Halle. Nicht groß noch durch einen besonderen Berufszweig, wie z.B. Leipzig, bedeutend genug, um rein auf sich selbst zu stehen, mußte das Bürgerthum sich einem solchen Hofe leicht anschließen, um so mehr als es demselben viele vergnügte Tage und zum Theil seinen Wohlstand verdankte. Diese gemüthliche Zeit reichte nicht bis in Händel's Kindheit herab, wohl aber das frische Aufblühen der Stadt und das rege Leben, das sie im Gefolge hatte. Der Administrator starb 1680. In dem nächsten Jahre fand sich der große Churfürst in Halle ein, um die Huldigung aller Stände des Herzog- oder Bisthums Magdeburg zu empfangen. Seit der Zeit steht das ganze Gebiet unter preußischer Verwaltung. Händel, dessen Vorfahren aus Schlesien und Böhmen nach Niedersachsen wanderten, ist also ein geborner Preuße.
In Halle wohnte Georg Händel »am Schlamme« in einer trotz des bösen Namens doch recht reinlichen Stadtgegend. Sein Wohnhaus, die Geburtsstätte seines Sohnes, kann nicht mit völliger Sicherheit angegeben werden. Doch vereinigen sich die Angaben dahin, es sei das jetzt dem Kaufmann F.W. Rüprecht gehörende Haus, Großer Schlamm Nummer 4, gewesen; die Richtigkeit dieser Annahme vorausgesetzt, hat er ein werthvolles Besitzthum gehabt. Von hieraus führen einige Schritte rechts die Straße hinauf zur Moritzburg, und einige links auf den belebten Markt vor der Hauptkirche zu U.L. Frauen.
Hier verlebte Georg Friedrich die Tage seiner Kindheit und ersten Jugend. Alle, die sich seiner Geburt gefreut hatten, konnten ihn bald herrlich heranwachsen sehen. Nach bekannten Erzählungen war auch seine Kindheit voll merkwürdiger Begebenheiten und bestimmter Hinweise auf die nachherige Laufbahn. Die Berichte hierüber sind uns aus England zugegangen und zwar erst nach Händel's Tode, Mainwaring (1760) macht daraus eine recht umständliche Geschichte. Den Kern dieser Nachrichten halte ich für wahr, sie stimmen vortrefflich zu Händel's Natur, sind auch sicherlich von ihm selber in Umlauf gesetzt. Einiges läßt sich berichtigen; im übrigen bilden sie die Hauptquelle etwa über die zwölf ersten Lebensjahre. Im Anschlusse an diese Ueberlieferungen ist das Folgende erzählt.
Er lebte und webte von Kindesbeinen an in den Tönen, horchte darauf, lief ihnen nach, und fing selber an zu musiciren, als er kaum seiner Gliedmaßen mächtig war. Tuthorn, Trompete, Pommer und Flöte, Trommel und Maultrommel und was der Weihnachtsmann Alles zu bescheren pflegt, bildete anfänglich sein Orchester. Zuerst war es der Sippschaft nur eine Merkwürdigkeit mehr an dem merkwürdigen Kinde; als aber die Musik immer ärger und besonders immer ernster betrieben wurde, gerieth man in Unruhe. Der Vater hatte seine früheren Kinder, namentlich die Söhne, nicht höher bringen können, als er selber gekommen war; dieser spätgeborne Liebling aber sollte von dem nach und nach erlangten Wohlstande Nutzen haben, um so mehr, als sich eine große Lernbegierde kund gab. Er sollte die Rechte studiren. Die Liebe zur Musik mußte gedämpft, sein Thätigkeitstrieb in andere Bahnen gelenkt werden. Daher hieß es: die Klimperei wolle man nicht mehr hören, musikalische Häuser seien fortan zu vermeiden, und so weiter! Es fiel ihm schwer aufs Herz; nach dem erzürnten Gesicht der Eltern mußte er sich schuldig fühlen, und wußte doch nicht wie. Für den Augenblick war es ihm wohl, als dürfe er sogar den Musikanten eines Ehrbarn und Hochweisen Raths, wenn sie des Abends vom Thurm der Liebfrauenkirche (wie noch geschieht) »die Nacht ist kommen« »Nun ruhen alle Wälder« »Wo Gott der Herr nicht bei uns hält« »Vater unser im Himmelreich« und derlei fromme Gesänge abbliesen, nur verstohlen zuhören. Des Vaters Wille änderte sich nicht, Georg Friedrich's Neigung auch nicht: wie sollte es werden? Aber leiden mochte ihn nun einmal Jedermann, so fanden sich leicht Helfer und Hehler. Es war das erste Mal, daß ihm Freundesbeistand von Nöthen war, und er entging ihm auch nicht. Ob es die Tante Anna gewesen ist, oder wer sonst noch mit dabei war, läßt sich nicht sagen: genug, ein kleines Clavichord wußte sich unbemerkt ins Haus zu stehlen und nahm oben unter dem Dache Platz. Dies ist eine Art von Clavier, aber nur so groß, daß es ein behender Mann unter dem Arme forttragen kann; auch sein Ton ist so, daß er nur so eben die Mäusemusik überragt und muß Einem, der heimlich spielen will, äußerst erwünscht sein. Der Knabe konnte dreist daran gehen, wenn die Andern zu Bette waren, konnte sich bis zum Fortissimo aufschwingen: es hörte Niemand. Die ersten Früchte dieser nächtlichen Uebungen waren nur für ihn allein, in den Theegesellschaften durfte er sein Licht nicht leuchten lassen. Doch läßt sich annehmen, daß dem Vater bedeutet worden, ein wenig Kunstübung schade auch einem Studirten nichts, die Zeiten hätten sich hierin schnell geändert, da nun so viele Kinder etwas Musik trieben, von denen doch die wenigsten gedächten ihr Brod daraus zu ziehen. Der Knabe hatte unterdessen gezeigt, daß er auch noch für andere Dinge Lust und Fähigkeit besaß, also konnte der alte Vater ein Uebriges thun und die Musikübung freigeben. In diesem heimlichen Spielwerk bemerkt man die Neigung, eine Weile still in sich zu beharren; aber auch die ersten Spuren jener Kühnheit, die der innern Kraft vertraut und zur Selbständigkeit hindrängt.
Eine Reise nach Weißenfels sollte weiteres offenbaren. Der Vater hatte dort beim Herzoge zu thun. Sein Sohn wollte mitgenommen sein, um den Neffen Georg Christian, nicht den Halbbruder wie allgemein erzählt wird, zu besuchen; aber der Vater schlug es ab. Der Reisewagen setzte sich in Bewegung, der Knabe sah leider, daß für ihn kein Platz bereitet wurde: da machte er in der Noth und in der Eile einen neuen Plan. Er wußte sich so zu halten, daß ihn Niemand beachtete, und dann lief er zu Fuße hinterdrein bis er endlich den Wagen wieder einholte. Den Vater setzte der Streich in Erstaunen, die Strafpredigt begann. Aber der kühne Trotz lag nur in der That, das Mitkommen durchzusetzen, er war plötzlich gebrochen, als sich der Vater vernehmen ließ. Die Vorwürfe erwiederte der Knabe mit Bitten und Flehen, weinte heftig, wollte es auch nie wieder thun, aber sollte ihn doch nur mitnehmen, und redete sehr beweglich. Was war zu thun? nach einigen väterlichen Erwägungen mußte er aufsitzen. Zuerst wurden noch allerlei ehrenrührige Anmerkungen gemacht, und was die Mutter wohl denken werde, auch ein Plan ersonnen ihr nur recht schnell den Sachverhalt mitzutheilen; dann kamen fremde Gegenden und andere Menschen vor's Auge, es gab zu fragen und zu antworten, man sprach von kleinen Städten und großen Kirchdörfern, und langte vergnügt in Weißenfels an. Vier bis fünf Meilen waren es nur.
Nach Mainwaring stand Georg Friedrich im siebenten Jahre, als er diese heroische Fußtour unternahm. Das ist eine willkürliche Annahme; zu den weiteren Reiseerlebnissen paßt es besser, wenn wir ihn uns etwas älter denken. Dortigen guten Freunden legte Georg Händel seinen Erziehungsplan vor, setzte auch hinzu, seine Grundsätze vermöchten der großen Musikliebe des Kleinen nur so eben die Waage zu halten. Unter den Freunden waren verständige Männer, die bemerkten: wo sich die Natur so stark erkläre, da habe man einen göttlichen Fingerzeig, Widerstand werde nicht nur fruchtlos, sondern vielleicht gar mit Schaden ablaufen. Es ist nicht zu verwundern, wenn man in Weißenfels von der Würde der Tonkunst etwas richtigere Gedanken hatte, als in Halle. Hier lebte ein edler Fürst, der für diese Kunst viel aufgehen ließ und täglich zeigte, wie werth ihm die Musiker waren; außer der Musik in den Kirchen fand auch das früheste deutsche Singspiel bei ihm eine besondere Pflegestätte. Ja was mehr ist, hier war der Vater der deutschen Musik, Heinrich Schütz geboren, Sohn des Bürgermeisters, und war hier bis in sein hohes Alter, das er auf 87 Jahre brachte, ein- und ausgegangen. Obwohl schon vor 20 Jahren verstorben (1585–1672), mußten sie ihn doch noch alle kennen und voll sein von seinen Verdiensten, auch von seinem Ruhm und Ansehen bei deutschen und auswärtigen Fürsten. Der sollte ebenfalls die Rechte studiren, that es auch, schrieb schon an seiner lateinischen Dissertation, als ihn höhere Bestimmung doch wieder davon wandte. Sie konnten kein besseres Beispiel finden. Weil indeß die Beweisführung von einem Freunde, dem früheren Capellmeister in Halle Joh. Philipp Krieger und dessen Gesellen, also von Musikern ausging, mußte sie für Georg Händel immer noch etwas parteiisch klingen; sie wurde aber nicht wenig bestärkt durch das, was sich bald darauf ereignete.
Die Capelle nahm den Knaben mit in ihre Uebungen, eines Sonntags auch mit aufs Orgelchor. Man hatte sich schon überzeugt, daß er sattelfest war, also hob ihn der Organist am Schluß des Gottesdienstes auf die Orgelbank, damit er zum Ausgang etwas loslassen könne. Der Fürst bemerkte das Experiment, hörte zu, fragte darauf seinen Kammerdiener, wer der kleine Organist gewesen, der sich eben so wacker gehalten. Dieser antwortete: »der kleine Händel aus Halle, meines Großvaters jüngster Sohn.« Die Verwandtschaftsverhältnisse lagen in dieser Familie so närrisch, daß er hätte mit Fug und Recht sagen können: »es war mein Onkel;« der Neffe war hier volle zehn Jahre älter als der Onkel. Hierauf wurde der Knabe gerufen sammt dem Vater. Einige Vorfragen leiteten bald auf das was schon erzählt ist. Der Fürst hielt der Musik eine Lobrede, die damit endete: es müsse zwar ein jeder am besten wissen, wozu er seine Kinder anführen wolle, doch seines Erachtens wäre es eine Sünde wider das gemeine Beste und die Nachkommen, wenn man die Welt eines solchen anwachsenden Geistes gleich in der Jugend berauben und dem nicht folgen wolle, wozu bereits Natur und Vorsehung die Bahn gebrochen. Fügte hinzu: er sei weit entfernt, das musikalische Studium Jedermann so ausschließlich anzupreisen, daß bürgerliches Recht und Sprachen darunter litten, wo die Möglichkeit vorhanden, müsse man alles dieses glücklich zu verbinden suchen; sein Wunsch ziele nur dahin, daß den Kindern in der Wahl des Berufs keine Gewalt angethan und insonderheit gegenwärtigem Knaben die Freiheit gelassen werde, dem natürlichen Hange seines Geistes zu folgen, es treibe ihn derselbe auch zu welchem guten Zwecke er immer wolle. Dem Sohne füllte er hierbei die Taschen mit Geld an und verhieß bei fortgesetztem Fleiße weitere Aufmunterung. Alles miteinander machte großen Eindruck. Die Musik sollte nun gewiß geduldet werden, und noch mehr, der Vater wollte bei seiner Zurückkunft nach Halle sich nach einem guten Lehrer umsehen und auch in diesem Zweige eine geordnete Unterweisung beginnen lassen. Der Vater wollte nicht dafür und auch nicht dagegen sein: er wollte der Natur ihren Lauf lassen, wenn auch ohne sonderliches Behagen. Ein Doctor der Rechte blieb nach wie vor das Ziel seiner Wünsche. Er bedachte nicht, wie sehr solche Vorfälle des Sohnes Geist entflammen und ihn in seiner angebornen Neigung befestigen mußten.
Hiermit ist die Erzählung über die Kindheit und diese selbst zu Ende, wenn auch noch in sehr kindlichen Jahren. Ich muß diesen Abschnitt mit einer allgemeinen Bemerkung beschließen. Der Gegensatz: wunderbarer Trieb zur Tonkunst beim Kinde und Hemmung desselben beim Vater, zieht sich durch Alles was aus der Kindheit zu berichten war. In diesem Grundgedanken haben die Geschichtchen ihre höhere Bedeutung; das eben ist es, was sie über das Gebiet zufälliger Begebenheiten hinweg zu historischen Merkzeichen erhebt. Denn den Widerwillen Georg Händel's gegen die »Profession der Musik« theilten damals Viele, besonders in Deutschland. Als hübschen Zeitvertreib ließ man die Musik wohl gelten, fand es auch ganz nett, wenn sich die Jugend damit zu schaffen machte, was in den ruhigen schlaffen Zeiten nach dem 30jährigen Kriege schnell Mode wurde; aber ein Hauptwerk des ganzen Lebens sollten nur diejenigen daraus machen dürfen, deren Eltern solches gethan und die es überhaupt nicht weiter zu bringen vermöchten. Sei doch außer Zweifel, daß die Musik im Vergleich zu andern Wissenschaften nur geringen Nutzen stifte, bloß zur Luft und Ergötzlichkeit diene; selbst in der Kirche komme es immer mehr aus dem Gebrauch, daß ein Diener des göttlichen Wortes mit der Musik beginne und mit der Predigt aufhöre, nämlich die Wirksamkeit als Cantor anfange und als Pastor sein Leben beschließe: lauter Beweisthümer gegen diese Kunst, wie man meinte. Dergleichen Gedanken gingen nirgends stärker um, als eben in Deutschland. Und doch war hier der Tonkunst in aller Stille schon ein fester Grund gelegt auf dem viele geschäftige Hände geräuschlos weiter bauten und Alles soweit bereiteten, daß Händel und Bach die Vollendung bringen konnten. Es war der schon genannte Heinrich Schütz, welcher für deutsche Musik wirkte wie ein Heiliger für die Kirche; doppelt verdienstlich, da es in dem schrecklichen 30jährigen Kriege geschah. Er zügelte den eignen Geist, daß er nicht unstät wurde noch verzagte; erschöpfte die Kunst und verkündigte sie in erhabenen Werken, die der Unsterblichkeit gewiß sind, obgleich man sie heut zu Tage fast vergessen hat; saß in der Heimath fest so lange es die Umstände gestatteten, dachte aber auch in der Fremde immer zunächst an das Vaterland und die heimischen Kunstgenossen: ein fester großer Mann, der sicher stand als Alles wankte, und durch sechzig Jahre! Man bedenke auch die Eigenthümlichkeit dieser Kunst. Der Krieg konnte ihr weniger anhaben, als irgend einer anderen Kunst oder Wissenschaft; ich meine sogar, daß er befreiend für sie gewirkt hat. Ihre Grundlagen sind unscheinbar, aber für eine fremde Hand auch unerreichbar, äußere Mißgeschicke können sie nicht zerstören, es muß, mehr als bei andern Künsten, wesentlich von innen, durch die Musiker selbst geschehen. Was man in anderen Fällen beklagt hat, gereichte dieser Kunst damals ebenfalls zum Gewinn: die Inhaber derselben gehörten großentheils zum geringeren Stande. Ihre sonstigen Fähigkeiten waren nicht weit her;' das einzige, was sie zu allgemeiner Zufriedenheit verstanden, war ihre Profession, also mußte man sie wohl dabei lassen. Gegen Saitenspiel, Orgelkunst und den Contrapunkt der Cantoren hatte Niemand etwas einzuwenden. Selbst die berüchtigten Länderverwüster hegten gegen die Tonkunst nur friedliche Gesinnungen; und wessen Länder das Spiel des Krieges in Ruhe ließ, den erfreute das Spiel der Töne, so Dänemark, Braunschweig-Lüneburg, zu Zeiten auch Chursachsen und andere Höfe. War sie bei dem allgemeinen Zwiespalt doch Jedem willkommen, diese erwünschte Verständigung ohne rechtskräftige Verpflichtungen, diese durch ein paar Schafdärme, hohle Stangen, Trichter und Metalldrähte plötzlich herzustellende Harmonie! Musik müsse sein, in diesem Satze wenigstens waren alle Kriegsparteien und alle Glaubensgenossen einig.
In eine solche Zeit stelle man einen Mann wie Heinrich Schütz, und das Ergebniß ist begreiflich. Ueberall kümmerliche Verödung beim Friedensschlusse 1648, einzig und allein in der Musik prangende Gesundheit, reiche Fülle, tagtägliche Vervollkommnung und Aussicht auf eine herrliche Zukunft. Auf diese Weise war es möglich, die nach und nach wieder erstarkenden besseren Kräfte unseres Volkes zunächst um diese Kunst zu versammeln und an ihr zu weltgeschichtlicher Bedeutung emporzuheben. Wir konnten nun, und zwar durch die Tonkunst, den umwohnenden Nationen wieder beweisen, daß in uns noch Kräfte eines höheren Lebens vorhanden waren. Es ist der schönste Segen stiller Arbeit und einer durch mehrere Geschlechter erhaltenen guten Schule, daß sie den rechten Geistern die Stätte bereiten, die Handhaben darbieten und also dem Großen vorarbeiten kann; ohne solche Grundlagen ist keine Erhebung möglich, die Kräfte zerarbeiten sich nutzlos, oder flüchten in ein anderes Gebiet. Da aber die bisher gepflegte, mitunter auch etwas handwerksmäßig betriebene Kunst etwa seit 1670 anfing sich an einen falschen Geist zu verlieren, so war es nun wirklich hohe Zeit, daß wieder große Männer erstanden, die ihr besseres Theil retteten.
An den geringschätzigen Vorurtheilen des damaligen deutschen Bürgerstandes über Musik und Musiker hat man wieder ein recht lehrreiches Beispiel, wie ein Volk es nur zu häufig liebt, über seinen eigentlichen Werth sich so gänzlich zu täuschen. Was damals Vorurtheil war, gestaltete sich hernach zum richterlichen Kunsturtheil, und so sehen wir mit Händel zugleich sein späteres deutsches Publikum heranwachsen.
3. Studiosus der Musik und der Rechte und Schloßorganist zu Halle. Der Lehrer Fr.W. Zachau.
Bald nach seiner Zurückkunft von Weißenfels ging Georg Händel zu dem anerkannt tüchtigsten Musiklehrer in Halle, zu dem Organisten Zachau und besprach mit ihm seines Sohnes musikalische Lectionen. Die andern Studien hatten dabei ihren ungestörten Fortgang. Der Knabe kam rechtzeitig in die lateinische Schule und durchlief alle Klassen.
Von Friedrich Wilhelm Zachau's Compositionen ist soviel auf die Nachwelt gekommen, daß wir in den Stand gesetzt sind, seine Kunst beurtheilen zu können. Weil er der einzige eigentliche Lehrer war, den Händel gehabt hat, ist das sehr erwünscht, zur Abwehr von Irrthümern fast nothwendig, denn man stößt auf Aeußerungen, welche ihm eine höchst übertriebene Bedeutung beilegen. Als Mainwaring Händel's Verdienste abschätzte und ihn in den Chören mit Instrumentalbegleitung, überhaupt in der vollstimmigen Kirchenmusik über Alle erhaben nannte, fügte Mattheson hinzu: »Dieses hat seine Richtigkeit; es rührte aber Alles vom Zachau und vom Orgelschlagen her«1. In vielen Büchern wird seiner mit Ehren gedacht, er stand wegen seiner Kunst und vielleicht noch mehr wegen seiner Lehrgeschicklichkeit in großem Ansehen.
Was über sein Leben bekannt geworden ist, hat Walther überliefert, dessen kurze Mittheilung ich hier erneuere. »Zachau war gebohren Anno 1663 den 19. November in Leipzig, woselbst und nachgehends in Eilenburg sein Vater Stadt-Musicus gewesen, erlernete, nebst Abwartung der Schule, sowohl die Organisten- als Stadt-Pfeiffer-Kunstex fundamento; wurde Anno 1684 zum Organisten an die L. Frauen-Kirche in Halle vociret, welche function er auch, bis an sein An. 1721 den 14. Augusti plötzlich erfolgtes Ende, mit großem Ruhm verwaltet hat, indem er nicht nur viele Kirchen- und Clavier-Stücke gesetzet, sondern auch verschiedene brave Leute, und unter solchen insonderheit den weltberühmten Capellmeister, Hrn. Hendel, gezogen.«2 Hier ist alles richtig bis auf die Angabe des Todesjahres. Zachau starb nicht 1721, sondern schon im August 1712. Bei Walther wird ein bloßer Druckfehler zu Grunde liegen, den später Dreyhaupt mit denselben Worten wiederholte3, ein neuer Beweis, daß dessen Angaben über Halle'sche Musiker nicht auf eigener Forschung beruhen. Auch die Zahl 1714 bei Gerber4 und bei Winterfeld5 bedarf der Berichtigung.
Walther's Druckfehler hat besonders in Bach's Leben eine kleine Verwüstung angerichtet, ich lege daher den Sachverhalt aus den Acten der Liebfrauenkirche kurz dar, ohne mich bei den unrichtigen Angaben der Bach'schen Biographen weiter aufzuhalten. Es handelt sich um die Zeit, wann Bach eine Berufung nach Halle erhielt, und die Umstände unter denen es geschah. Als Zachau starb, war die große Orgel dem Einsturz nahe. Der »berühmte Orgelmacher« Christoph Cuntzius baute für 6300 Thaler in drei Jahren eine neue; Bach in Weimar machte die Disposition. Diesem wurde die Stelle zuerst angetragen. Die in Aussicht stehende Musterorgel erweckte ihm Luft dazu. Gegen Ende des Jahres 1713 reiste er nach Halle, machte den Leuten seine Aufwartung, ließ sich auf den vorhandenen Orgeln hören und componirte auf »höfliches anhalten« des Hauptpastors eine Kirchencantate, vermuthlich das Stück »Ich hatte viel Bekümmerniß in meinem Herzen«6. Dann reiste er heim, bekam im Januar 1714 die Vocation nachgesandt, schickte sie indeß wieder zurück, hatte darüber noch einen kleinen Strauß mit den Kirchenältesten, aus dem er sich aber, wie zwei Briefe von ihm beweisen, aufs schönste herauswickelte. Die Dienstverhältnisse sagten ihm nicht zu, besonders war das Einkommen – 140 Thlr. Sold, 24 Thlr. zur Wohnung, 171/2 Thlr. für Holz, »vor die Composition der Catechismus-Musique jedesmahl 1 Thlr.,« für jede Brautmesse auch 1 Thlr. – mindestens nicht höher als in Weimar. Sein Fürst verlieh ihm jetzt den Titel Concertmeister und behielt ihn dafür noch mehrere Jahre in seinen Diensten. Trotz dieser Erörterungen hatten die Hallenser doch so vielen Respect vor Bach's Kunst und Unparteilichkeit, daß sie ihn 1716 nebst Kuhnau aus Leipzig und Rolle aus Quedlinburg zur Revision der neuen Orgel einluden. Gottfried Kirchhoff war inzwischen (1714) Organist geworden, nachdem auch Valentin Hausmann und Melchior Hofmann, weil sie »das Fixum sehr schwach« fanden7, die Stelle ausgeschlagen hatten. Die näheren Verhandlungen nebst den Bach'schen Briefen werde ich gelegentlich an einem passenden Orte mittheilen.
Auch in Lübeck lebte um diese Zeit angeblich ein Musikus Namens Zachau, Schüler von Theile und Rathsmusikant daselbst8. Ein Vorname ist nirgends angegeben, man wäre versucht beide für eine Person zu halten, was u. A. Hawkins auch gethan hat9, wenn nicht Moller ausdrücklich bemerkte: »Petrus Zachou, Musicus Cornicen Senatorius Lubecensis.«10 Also nicht Zachau, sondern Zachon, mithin auch kein Bruder.
Zachau hatte kaum das 30ste Lebensjahr überschritten, als ihm Händel zugewiesen wurde. Dieses muß man wohl beachten. Ein anderes ist es, ob der Lehrer mit Allem abgeschlossen hat, oder ob er selber noch rüstig an seiner Durchbildung arbeitet. Von Zachau's Werken machte Winterfeld in den Nachträgen zum letzten Bande seines Evangelischen Kirchengesanges fünf Cantaten namhaft und besprach drei davon mit Rücksicht auf die Behandlung des Chorals ein wenig. Seit der Zeit hat sich mehr finden lassen, besonders an Compositionen für die Orgel über den Kirchenchoral. Diese wollen wir uns zunächst etwas näher ansehen.
Choralbehandlungen für die Orgel.
Die Sätze über sieben verschiedene Choräle hat uns der unermüdliche Lexicograph, Organist Walther zu Weimar erhalten. Dieser schrieb sich von seinen Vorgängern und Zeitgenossen zusammen, was ihm der Aufbewahrung werth schien, ordnete es nach den Chorälen und fügte schließlich seine eigenen Productionen bei. Die handschriftliche Sammlung, jetzt nebst allen übrigen Werken Zachau's in der Berliner öffentl. Bibliothek, ist dieser vergleichenden Zusammenstellung wegen ungemein lehrreich.
Das Adventslied »Nun komm, der Heiden Heiland« hat Zachau in drei Sätzen behandelt. Der erste (in der Handschrift der zweite) benutzt den ganzen Choral und setzt dazu einen bewegteren Contrapunkt. Der zweite macht aus der ersten Melodiezeile ein Fugenthema, das aber nur zweimal die vier Stimmen durchläuft. Der dritte Satz ist eine »Choralveränderung« nach damaligem Ausdruck, spielt den Gesang einmal in der Oberstimme durch und macht darüber drei Variationen, in denen sich zwar keine starke Phantasie, aber auch kein wildes Draufeinhauen kundgiebt. Wie viel reicher an Ton und Erfindung sind die Sätze von Buxtehude und Bach! Schon die kleine Aenderung, welche Bach gleich zu Anfang mit dem Thema vornimmt, setzt ein tieferes Musikgefühl voraus, als Zachau besaß.
Es folgen drei Weihnachtsgesänge. »Vom Himmel hoch da komm ich her« ist ein kleines dreistimmiges Präludium mit der Melodie in der Oberstimme und, von kleinen Vorandeutungen der Melodie in den unteren Stimmen abgesehen, freier Begleitung; scheinbar kunstlos, doch recht ansprechend. Bach und Walther gaben ihrem Vorspiel hier einen ähnlichen Bau, aber bei dem ersten waltet ein freudigerer Geist. Auch hier ist ein zweiter Satz oder Vers vorhanden: die Melodie ist in den Baß verlegt, jede Choralzeile wird von den begleitenden Stimmen vorgedeutet, doch ist die Arbeit um so viel steifer geworden, als sie künstlicher erscheint. »In dulci jubilo« kommt dem von Buxtehude durchaus nicht gleich, obwohl in der Form Verwandtschaft herrscht. Die erste Zeile des Gesanges »Wir Christenleut habn jetzund Freud« ist fugenartig behandelt und recht weit ausgeführt; das Thema und dessen Umkehrung erscheinen einmal zu gleicher Zeit, aber kühne Gedanken sind nirgends zu finden.
Die erste Zeile von Simeon's Gesang »Mit Fried und Freud ich fahr dahin« veranlaßte den Tonsetzer zu einer vierstimmigen Fuge, die als solche nicht übel ist, aber keine Spur von Geist offenbart. Bei tieferem Eingehen auf diesen herrlichen Choral muß man schon die Anlage, den Bau des Ganzen für ungeeignet halten, denn nur bei Benutzung der vollen Melodie läßt sich die Versenkung in den Gedanken des Abscheidens genügend ausdrücken. Das wußte niemand besser als Bach.
Für das Pfingstfest setzte Zachau das Präludium »Komm heiliger Geist Herre Gott.« Der Choral liegt in der Oberstimme und hat einen recht schönen, ebenmäßig fortfließenden freien Contrapunkt. Buxtehude's Vorspiel ist geistreicher, funkelnder. Der kurze Satz über »Komm Gott Schöpfer heiliger Geist« hat eine ähnliche Anlage, auch hier ist durchgehends Achtelbewegung vorhanden; den Sätzen von Walther und Bach gegenüber erscheint er steif und kunstlos. Besonders Bach stellt hier wieder alle Andern in Schatten, bei reichster Mannigfaltigkeit weiß grade er das Grundgefühl der (mixolydischen) Tonart wie keiner neben ihm zur Geltung zu bringen. Bach, gleich Händel 22 Jahre jünger als Zachau, ist freilich mehr sein Nachfolger als sein Zeitgenosse, aber auch mit den eigentlichen Zeitgenossen Buxtehude Pachelbel Kuhnau und Reinken konnte sich Zachau in der Orgelkunst nicht messen.
Missa über: »Christ lag in Todesbanden.«
Diese Composition geringen Umfanges besteht aus 6 Sätzen. Für ein Meisterstück kann man sie nicht ausgeben. Schon die Benutzung des deutschen Chorals für diesen lateinischen Text scheint nicht glücklich zu sein, noch weniger die Art wie er benutzt ist; denn er zieht sich durch die verschiedenen Sätze, so daß Kyrie eleison und Et in terra pax hominibus und Laudamus te benedicimus te und Quoniam tu solus sanctus alle nach derselben Melodiezeile abgesungen werden. Man kann in diesem Stücke eher eine Versteinerung des Palestrina-Styls, als eine lebendige Wiedergabe oder berechtigte Weiterbildung desselben erkennen. Auch gegen den Contrapunkt an sich wäre einzuwenden musikalisch, daß er nicht klingt, technisch, daß er nicht von untadeliger Correctheit ist, und ästhetisch, daß Geist und Schönheit fehlen. Die Abschrift ist von neuerem Datum, Zachau's Urheberschaft ist also nicht sicher beglaubigt; doch sehe ich auch keinen Grund, weßhalb er diese Choralmesse nicht könnte gemacht haben. Bei den Kirchencantaten müssen wir etwas länger verweilen.
Kirchencantaten.
Das Stück in Amoll oder vielmehr in der äolischen Tonart »Herr wenn ich nur dich habe« für 4 Singstimmen, Saiteninstrumente, Orgel und Harfe scheint mir von den erhaltenen das älteste zu sein. In der Abschrift erkennt man eine jugendliche Hand und – Händel's Züge. So mag dieser etwa in seinem dreizehnten Jahre geschrieben haben, es ist die älteste Handschrift, welche wir von ihm besitzen. Bei vollkommener Ueberzeugung von den Mängeln dieser Cantate läßt sich doch wohl begreifen, daß sie unserm Händel damals werth war. Sie trägt alle Spuren einer frühen Zeit an sich, nicht eben wegen besonderer Unreife, sondern wegen ihres Styls. Die Melodiebildung, die Behandlung der Tonart, die Accordfolge, die Instrumentation, Alles zeigt noch starke Spuren von einer Weise des Tonsatzes, über die man seit 1700 schnell hinausschritt. Die Betonung der Worte bietet manche Blößen dar, so ist gleich der Anfang »Herr wenn ich nur dich – Pause – Herr wenn ich nur dich – Pause – nur dich – Pause – nur dich habe« ungeschickt genug. Indeß ist der Anfangschor bei der Abwechslung contrastirender Klangmassen einigermaßen befriedigend, besonders wenn man nicht zu genau das Einzelne und nicht zu oft das Ganze hört. Der Tonwechsel erscheint etwas hart und unbeholfen: ein Erbe aus früherer Zeit, welches aber doch nur von denen angetreten wurde, die sich nicht anders zu helfen wußten. Eine Stelle in der Mitte des Chores ist ihrer zarten, ruhend-harmonischen Haltung wegen von sehr guter Wirkung:
Mit der Behandlung der Worte »so bist du doch Gott allezeit meines Herzens Trost« wird man hier am wenigsten einverstanden sein können; diese Versicherung, auf der die geistige, die religiöse Wirkung des ganzen Gesanges beruht, hätte doch eindringlicher, erhabener, fester ausgesprochen werden sollen. Auf den Chor folgt Einzelgesang, »Aria,« in vier Absätzen: zuerst für Cantus, dann für Baß, hierauf für Tenor, und endlich für Alt. Der Organist mußte den hervorragenden Sängern in jeder Stimme etwas geben, um die Herren Gymnasiasten bei Laune zu erhalten. Die vier Arien bilden vier Strophen, an Text und Melodie ein Mittelding zwischen dem alten deutschen Liede und der neuaufkommenden Arie. Gegen Ende der ersten Strophe fällt die Harfe ein, bei den folgenden haben die Geigen ein kleines Vorspiel, alles übrige besorgt der Orgelbaß allein. Der Ausdruck ist weich, mehr gemüthlich als gemüthvoll, der Melodie gehen noch alle Feinheiten ab, die ihr bald in Italien und in Deutschland zu Theil werden sollten. Am Schlusse der Arien folgt eine Bemerkung, derzufolge der Anfangschor in seiner ganzen Länge wiederholt wurde. Auf diese Weise ist der Einzelgesang in den Chor gleichsam eingewickelt, die ganze Cantate erhält die Gestalt der späteren Aria da capo oder (wie ich diese musikalische Form deutsch nennen werde) Rundstrophe, wobei man den Chor als den zu wiederholenden Haupttheil und die Einzelgesänge als die schwächere Mittelpartie ansehen muß. Hier haben wir das Urbild jener »schier unendlichen Cantaten und langen langen Arien,« mit denen Händel Anno 1703 dem weisen Mattheson in Hamburg seine Aufwartung machte. Daß dem Zachau diese Art des Tonsatzes besonders gefiel, zeigt ein anderes Stück von ganz gleicher Anlage:





























