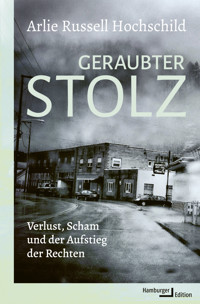
26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hamburger Edition HIS
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Pikeville, Kentucky. Der Niedergang des Kohlebergbaus, erdrückende Armut, eine sich zuspitzende Drogenkrise: Der zweitärmste Kongressbezirk der Vereinigten Staaten befindet sich inmitten vielfältiger Krisen. Während in Pikeville vor dreißig Jahren noch mehrheitlich die Demokraten gewählt wurden, stimmten 2016 und 2024 mehr als achtzig Prozent der Bevölkerung des Bezirks für Donald Trump. Was passiert, fragt Arlie Russell Hochschild, wenn Menschen in einer schwer getroffenen Region nicht nur Sicherheiten, sondern auch ihren Stolz verlieren und von einem politischen Appell adressiert werden, der ihnen das Gefühl vermittelt, bestohlen zu werden? In diesem Buch konzentriert sich Hochschild auf Männer aus der Arbeiterschaft. Wir treffen sie in kleinen Kirchen, Bergdörfern, Lokalen, Wohnwagenparks und bei Zusammenkünften der Anonymen Drogensüchtigen. Ihre Lebensrealitäten geben Auskunft über eine sich verändernde politische Landschaft. Hochschilds brillante Untersuchung nimmt die Reaktion der Stadt auf einen Aufmarsch weißer Nationalisten im Jahr 2017 in den Blick und führt uns tief in eine zerrissene Gemeinschaft. Doch zugleich zeigt dieses Buch auch einen Weg nach vorne auf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Arlie Russell Hochschild
GERAUBTER
STOLZ
Verlust, Schamund der Aufstiegder Rechten
Aus dem Englischen vonUlrike Bischoff
Hamburger Edition
Für Joan Cole
Hamburger Edition HIS Verlagsges. mbH
Verlag des Hamburger Instituts für Sozialforschung
Mittelweg 36
20148 Hamburg
www.hamburger-edition.de
© der E-Book-Ausgabe 2025 by Hamburger Edition
ISBN 978-3-86854-882-2
E-Book Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde
© der deutschen Ausgabe 2025 by Hamburger Edition
ISBN 978-3-86854-875-4
© der Originalausgabe 2024 by Arlie Russell Hochschild
Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel
»Stolen Pride: Loss, Shame, and the Rise of the Right«
bei The New Press, New York.
Umschlaggestaltung: Lisa Neuhalfen, Berlin
Umschlagabbildung: © gettyimages / Corbis News / Andrew Lichtenstein
Inhalt
Cover
Titelei
Impressum
Inhalt
Motto
Teil I – Der Protestmarsch
Kapitel 1
Eine höfliche Stimme
Reise in die Kluft
Stolz und Scham
Aus allen Gesellschaftsschichten und politischen Lagern
Kapitel 2
»Wir sind hier gute Menschen«
Zufallsauswahl oder leichte Beute
Lokaler Touch, ferner Traum
Kapitel 3
Das Stolzparadox
Stolz und Scham: Eine Sichtweise
Das Stolzparadox
Von struktureller zu persönlicher Scham
Der prekäre Charakter des Stolzes
Arbeitsplatzverluste
Kapitel 4
»Gekommen, um euch zu helfen«
Matthew Heimbachs Message
Matthew hilft bei einer Wahlkampfveranstaltung Trumps
Widersprüchliche Ziele
Fremd im Ort
Ein Schutzschild gegen Scham
Die Schambeseitigungspolizei
Kapitel 5
Insider, Outsider
Zweigleisige Unterhaltung
Vom Holocaust nach Ostkentucky
Masjid Al-Farooq und 9/11
Teil II – Gesichter in der Menge
Kapitel 6
Stolz der Eigenverantwortlichen
Die Kunst der Improvisation: Mit Ja-klar in die 1990er
Selbstvorwürfe
Begegnung mit Margaret
Die Graspolizei
Sorge um Harry
Kapitel 7
Stolz der Outlaws
»Bürger« ohne Wahlberechtigung im Kongresswahlbezirk KY-5
»Ein wirklich schlimmer Rassist«
Gut, schlimm zu sein
Konfuse »Rassen«-Identität
Stolzhierarchien
Unwahrscheinliche Verbindungen
Kapitel 8
Stolz der Überlebenden: Ghetto und Bergdorf
Wenn du weiß und arm bist
Stationen ihrer Liebe: Schule, Bibliothek, Laden
Detroit-Ghetto und Moore’s Trailer-Park
Wie man »wirklich etwas darstellt«: Ein fehlendes Narrativ
»Ich bin ein falscher Rassist«
Die Hochzeit
Kapitel 9
»Ich hätte ein weißer Nationalist werden können«
Abstieg auf der sozialen Leiter
Schwarze in einer weißen Kindheit
Kaskade
»Wir alle haben unterschiedliche Tiefpunkte«
»Den Köder schlucken«
Die Transportameise
Kapitel 10
Am Rand des Grabes
Die nationale Stolzökonomie, von unten nach oben betrachtet
Zwei geheime Gründe für Scham
Unternehmensinvestitionen und regulierungsfeindliche Bundesstaaten
Schamzyklus
Verschiedene Arten von Stolz
Einwanderer und Schwarze: Wie unterschiedlich sind wir?
Vom Ghetto zum Bergdorf: Abwanderer und Bleiber
Eine Untergrundverbindung
Klettern
Teil III – Donnergrollen
Kapitel 11
Probelauf
Fehlende Gesichter in der Menge
Ein Showdown von Stolz und Scham
Kapitel 12
Fließende Politik
Was verändert sich: Der Gegenstand des Hasses oder der Hass?
Nach »links« rücken, während die Welt nach rechts rückt
Politisch heimatlos
Kapitel 13
Der Flaschenblitz
Hinter der Wut
Die Schönheit der Ordnung
Die Schande der Unordnung
Ein Haar im Keks
Die Tiefengeschichte: Guter Rüpel, schlechter Rüpel
Die Geschichte des Diebstahls: Von verloren zu gestohlen, von Scham zu Schuldzuweisung, vom Opfer zum Rächer
Das rothaarige Stiefkind
Von Verlust über Diebstahl zu Betrug
Verlust in Hollywoodfilmen
The Hunger Games
Das vierstufige Anti-Scham-Ritual
»Gestohlen«: Das Recht auf Verlorenes
Kapitel 14
Stolz: Ein gefährliches Auf und Ab
Talfahrt des Stolzes: Vom stolzen Patrioten zum gefährlichen Kriminellen
Der Umgang mit einer Talfahrt des Stolzes
Die Angeklagten: Patriotische Helden oder Verräter?
Am Rande: Das Geschundene-Wähler-Syndrom
Kapitel 15
Eine Empathiebrücke
Aufsteigen, zurückgeben, die Hand ausstrecken: Das Oberdeck
Den Tiefpunkt erreichen, aufstehen, die Hand ausstrecken: Das Unterdeck
Hinweise auf eine nationale Erzählung?
Kapitel 16
Abraum
Vom Lokalen zum Nationalen
Vom Nationalen zum Globalen
Die gespaltenen Vereinigten Staaten
Eine starke Persönlichkeit?
Den Berghang hinunter
Abschiede
Danksagung
Anhang 1
Recherche
Anhang 2
Unter- und Oberdeck der Empathiebrücke
Nachwort
Anmerkungen
Literatur
Zur Autorin
Extra Seite
Eine Geschichte zu erzählen, ist, wie in einen Getreidespeicher voller Weizen zu greifen. Es gibt immer mehr zu erzählen, als erzählt werden kann.
Wendell Berry, Jayber Crow
TEIL I
DER PROTESTMARSCH
Kapitel 1
Eine höfliche Stimme
Die Stimme war höflich, der Ton gemäßigt. Der Akzent klang nach jemandem, der nicht aus Appalachia stammte. Der Anruf ging an einem Morgen Anfang April 2017 ein, als die roten und weißen Knospen der Bergmammutbäume und des Blütenhartriegels allmählich um Pikeville, Kentucky, ein Fenster zum Frühling öffneten.
Das Telefon hatte im Büro des Stadtdirektors von Pikeville, Donovan Blackburn, geklingelt. »Meine Assistentin steckte den Kopf zu meiner Bürotür herein und fragte mich, was wir mit einer Anfrage machen sollten, eine Demonstration auf unserer Hauptstraße zu genehmigen. Der Name war Matthew Heimbach.« Blackburn, ein großer, schlanker Mann um die vierzig mit wachen blauen Augen, grau-blondem Haar und unerschütterlichen Manieren, erzählte mir später: »Also googelten wir Heimbach und stellten fest, dass er ein Neonazi war.« Donovan sagt häufig »wir«, wenn er von seinem wachsenden Team spricht, das später weithin für seine Belastbarkeit im Umgang mit allem, was passierte, gelobt wurde.
»Wo immer Heimbach auftaucht, hinterlässt er eine Spur der Gewalt«, erzählte Donovan. Tatsächlich hatte der Mann mit der höflichen Stimme erst neun Monate zuvor eine Demonstration weißer Nationalisten in Sacramento, Kalifornien, mit angeführt, bei der Menschen geschlagen, getreten und herumgestoßen und zehn mit Stichwunden ins Krankenhaus eingeliefert worden waren.1
Pikeville kauert am Fuß eines Berges in Kentuckys 5. Kongresswahlbezirk (KY-5), dem zweitärmsten der 435 Wahlbezirke und dem mit dem höchsten weißen Bevölkerungsanteil.2 Einst war der Ort das Zentrum eines florierenden Kohlereviers. »Wir haben dafür gesorgt, dass im ganzen Land das Licht brannte!«, hörte ich. »Wir haben den Brennstoff für den Zweiten Weltkrieg geliefert!« Tatsächlich waren früher viele Züge zischend und kreischend auf einer Bahntrasse mitten durch die Stadt gefahren und hatten das in den umliegenden Bergen abgebaute schwarze Gold in die offenen Schlünde des industriellen Amerika transportiert. Aber mittlerweile war die Kohleindustrie im Niedergang, Drogen hatten Einzug gehalten und die Region hatte zu kämpfen. »Die Leute kennen hier eigentlich keine schweren Zeiten«, erklärte mir jemand, »oder sie geben uns die Schuld daran«. In den letzten Jahren gehörte Pike County, dessen Wählerschaft früher für Demokraten wie Roosevelt, Kennedy und Bill Clinton gestimmt hatte, zu einem der fünf Wahlbezirke der USA, die am schnellsten zu den Republikanern gewechselt hatten.3
An vielen Orten in den USA war es zu Protesten weißer Nationalisten gekommen. In den drei Monaten vor jenem Anruf 2017 hatten solche Gruppen in Seattle, Washington und Lake Oswego, Oregon, demonstriert.4 In Minneapolis erschoss ein weißer Mann fünf Demonstranten der Black-Lives-Matter-Bewegung.5 In Harrison, Arkansas, veranstaltete die Knights Party, eine Vereinigung weißer Suprematisten, eine Kundgebung unter dem Motto: Love Your Heritage.6 In Berkeley, Kalifornien, kam es zu Zusammenstößen zwischen Anhängern des schillernden Alt-Right-Redners Milo Yiannopoulos und tausend Gegendemonstrantinnen.7 In Kalifornien ist es verboten, ohne entsprechende Genehmigung Schusswaffen in der Öffentlichkeit zu tragen, aber die staatliche Universität konnte Einwohnern, die nicht dort studierten, nicht den Zugang zum Campus untersagen und so zeigten Videoaufnahmen maskierte, schwarz gekleidete Demonstranten, die Fensterscheiben einwarfen, Brände legten und Schäden in Höhe von 800000 US-Dollar anrichteten.8
Registrierte das Southern Poverty Law Center im Jahr 2000 noch 599 Hassgruppen, so war deren Zahl zur Zeit von Heimbachs Anruf 2017 auf 954 gestiegen.9 Elf von ihnen hatten ihre Zentrale in Kentucky.10 Extremistische Medien wie Alt-Right TV, White Pride Radio und White Resistance News waren ebenfalls auf dem Vormarsch, berichteten über ihre Veranstaltungen und suchten Anhänger.
Unterdessen hatte sich Pike County wie nahezu alle 120 Countys Kentuckys zu einem Schutzgebiet für den zweiten Verfassungszusatz erklärt, in dem einschränkende Waffengesetze nicht galten.11 Heimbachs weiße Nationalisten und ihre Gegner durften also, sofern sie über 21 Jahre alt waren, bei Demonstrationen ohne weitere Hintergrundüberprüfungen oder Genehmigung unverhohlen geladene Schusswaffen tragen, auch Sturmgewehre ohne Beschränkung der Magazingröße.12 Als »Stand-your-ground«-Bundesstaat erlaubt Kentucky es Waffenbesitzerinnen zudem, zur Selbstverteidigung oder mutmaßlichen Verteidigung anderer zurückzuschießen.13 Seit 2010 ist die Zahl der durch Schusswaffengebrauch Getöteten in Kentucky gestiegen.14
Donovan Blackburn erklärte mir: »Ich glaube nicht an weißen Nationalismus. Ich bin hier in der Nähe in Greasy Creek aufgewachsen. Meine Vorfahren haben schon hier gelebt. Meine Familie lebt jetzt noch hier. Ich bin hier zur Schule gegangen. Meine Leute glauben an das Recht, zu leben, an den zweiten Verfassungszusatz und an menschlichen Anstand. Wenn jemand in deine Gemeinde kommt, begegnest du ihm mit Liebe, Würde und Respekt. Wir haben Minderheiten – Schwarze, Juden, Muslime – und sie verdienen es, sich genauso sicher zu fühlen wie alle anderen. Wir tun, was wir können, sie zu schützen. Aber wir sind ein freies Land. Wir achten die Meinungsfreiheit. Wir sind hier gute Menschen.«
Reise in die Kluft
Als ich nach Pikeville fuhr, war ich erfüllt von wachsender Sorge über die zunehmende politische Spaltung im Land und brachte großes Interesse an einem unbekannten Ort sowie eine gewisse Vorstellung von den Emotionen in der Politik mit, die meiner Ansicht nach den sich zusammenbrauenden Sturm erhellen konnte. In meinem letzten Buch, Fremd in ihrem Land, hatte ich mich an die Bayous und in die Umgebung der petrochemischen Industrieanlagen im Süden Louisianas begeben und mir Zeit genommen, Menschen auf der konservativen Seite jener Kluft kennenzulernen. Dort war ich auf eine halb vergrabene Geschichte – eine »Tiefengeschichte« – gestoßen und hatte festgestellt, dass viele das Gefühl hatten, Schlange zu stehen und darauf zu warten, dass sie dem amerikanischen Traum näher rückten. In dieser Schlange herrschte jedoch Stillstand, weil sich – nach ihrem Eindruck – Frauen, Afroamerikaner, Einwanderer und Geflüchtete »vordrängelten«. Um dieser wahrgenommenen Ungerechtigkeit ein Ende zu bereiten, wandten sich die Leute in der Schlange rechten politischen Kräften zu.
Damals ahnte ich nicht, dass die Wut auf »die andere Seite« kontinuierlich zu Hass und Gerede über »Rache« eskalieren würde.15 Ein Geschäftsmann aus dem Pike County und glühender Trump-Anhänger sagte voraus: »Bei der Wahl 2024 wird es Gewalt geben. Wir waren schon früher polarisiert, aber jetzt haben wir aufgehört, miteinander zu reden. Es ist wie 1861. Wir treiben auf einen Bürgerkrieg zu.« In ihrer Forschung zu Preppern – Amerikanern und Amerikanerinnen, die für eine eventuelle Katastrophe vorsorgen – stellte Kirstin Krusell fest, dass das Interesse an solchen Vorbereitungen jeweils nach den letzten Präsidentschaftswahlen anstieg, und zwar sowohl, als Barack Obama 2008 gewann, als auch nach Donald Trumps Sieg 2016.16 Ich wollte die Wut zurückverfolgen zu den Erfahrungen und Umständen, die sie schürten.
Eine Vorstellung hatte die amerikanische Rechte mit Macht erfasst und spaltete die Nation:17 die Vorstellung, die Wahlen 2020 seien »gestohlen« worden. Sechzig Prozent aller Amerikanerinnen und Amerikaner – und neunzig Prozent der Demokraten und 23 Prozent der Republikaner – glaubten, die Wahl sei fair gewonnen worden. Aber Trump erklärte sie für »gestohlen« und versprach Vergeltung.18
Ich wollte mein Augenmerk vom tiefen Süden nach Appalachia mit Schwerpunkt Ostkentucky verlagern.19 Jede Region hat ihre eigene politische Tradition, Geschichte, Wirtschaft und Folklore. Für Louisiana war es die der großen Plantagen; für Appalachia war es die der isolierten Siedlungen in einer zerklüfteten Berglandschaft. Dieser jeweilige Hintergrund sorgte dafür, dass diese »elektrisierende« Vorstellung etwas anders aufgenommen wurde.20
Louisiana war schon lange republikanisch – offenbar ein stabiles Zentrum der Rechten. Kentucky war gemäßigter, aber in letzter Zeit nach rechts gerückt. Laut einer Analyse des Cook Political Report von 2023 war der Kongresswahlbezirk KY-5 1996 beinahe genau in der politischen Mitte der USA angesiedelt, wobei 235 als liberaler und 200 als konservativer eingestuft wurden.21 Aber bis 2023 hatte er sich im Vergleich zu allen anderen der 435 Kongresswahlbezirke zum zweitkonservativsten entwickelt. Zusammen mit dem 2. Kongresswahlbezirk Oklahomas gewann Donald Trump dort sowohl 2016 als auch 2020 »mit einem Vorsprung, der zu den fünf größten auf lokaler Ebene gehörte«.22 Tatsächlich wählten im Bezirk KY-5 – und in Pike County – achtzig Prozent Trump erstmals 2016 und erneut 2020.23 Ich wollte nun erfahren, warum das so war.
Über weite Teile der amerikanischen Geschichte sprach die Republikanische Partei Wohlhabende an, die gegen Steuern und staatliche Wohlfahrtsprogramme waren, und das gilt nach wie vor. Aber heutzutage findet sie auch viele arme weiße Anhänger. Auf einem von Gallup und Healthways erstellten Well-Being Index (Index des Wohlbefindens) stand Kentuckys 5. Kongresswahlbezirk 2014 von allen Bezirken der USA an letzter Stelle.24 Bei Lebensbewertung, Arbeitsumfeld, emotionaler und körperlicher Gesundheit, gesundheitsbewusstem Verhalten und Zugang zu Gesundheitsversorgung rangierte die Region ganz unten. Zugleich profitierten 36 Prozent der Bevölkerung im Bezirk KY-5 vom staatlichen Gesundheitsfürsorgeprogramm Medicaid, das die Republikanische Partei traditionell ablehnt und einschränken will.25 Während der Covid-19-Pandemie erhielt nahezu die Hälfte der Bevölkerung von Pike County – einem der 31 Countys in Kentuckys Kongresswahlbezirk KY-5 – Medicaid.26 Der eher rechtsgerichtete Bundesstaat Kentucky bezog gut 38 Prozent seines Haushalts aus Bundesmitteln. Mein Bild von der Republikanischen Partei passte nicht zu den Menschen, die ich kennenlernen sollte, und ich fragte mich, was ich übersah.
In meiner früheren Arbeit hatte ich mich auf Frauen konzentriert, die Forschung zur rechten Politik führte mich zu Männern. Denn 2020 stimmten 58 Prozent der weißen Wählerschaft für Donald Trump – 61 Prozent der weißen Männer und 70 Prozent der weißen Männer ohne Bachelor-Abschluss.27
Hinter diesem Trend vermutete ich eine Krise weißer Männer. Wie Helena Norberg-Hodge in ihrer Studie zu ländlichen Kulturen Asiens feststellte, die unter Modernisierungsdruck stehen, treten die Belastungen dieser Tendenz am stärksten bei jungen Männern zutage. In den USA nahmen an Demonstrationen, wie Heimbach sie in Pikeville plante, sowie an militanten rechten Gruppen insgesamt praktisch ausschließlich Männer teil. Männer der Arbeiterschicht erwiesen sich am anfälligsten für sogenannte Verzweiflungskrankheiten – Drogensucht, Alkoholismus und Suizid –, eine Geißel, für die Appalachia sich leider zu einem Zentrum entwickelt hatte.28
Für manche linksgerichtete Menschen beschwören die vier Worte ländlich, weiß, Arbeiter und männlich ein Stereotyp herauf, das ich von innen erforschen wollte, statt es von der Ferne zu beurteilen. Denn ich dachte, dass ein genauerer Blick auf diesen anfälligen Teil der republikanischen USA – Kentuckys 5. Kongresswahlbezirk – Hinweise auf die gesamten republikanischen USA und sogar auf den Wind des weißen Nationalismus liefern könnte, der auf der ganzen Welt weht. Vor allem wollte ich mich eingehend mit Männern unterhalten, die an diesem Ort zu Hause waren, um zu verstehen, wie sie den Einfluss dieser Trends auf sich sahen, und ich wollte ebenso mit den weißen Nationalisten sprechen, die solche Männer zu rekrutieren hofften.
Ich konzentrierte mich also auf eine Kleinstadt in Appalachia und dort vornehmlich auf Männer. Zufällig stieß ich gerade in dieser Region und in seiner Bevölkerung auf eine äußerst kritische Lage – die Pike County mit einem Großteil der republikanischen Bundesstaaten gemeinsam hat. Seit den 1970er Jahren leiden sie unter den Globalisierungsfolgen:29 Produktionsverlagerung ins Ausland, Automatisierung und der Niedergang der Gewerkschaften machten republikanische Bundesstaaten ärmer als demokratische und hinterließen sie in schlechterer Verfassung mit weniger gut finanzierten Schulen, erhöhten Unfallgefahren und geringerer Lebenserwartung. Zu diesen Belastungen kamen weitere, neuere hinzu – Erkrankungen und Todesfälle durch Covid-19 und durch den Klimawandel bedingte Stürme.
Aber verglichen mit den übrigen republikanischen USA traf es Pike County besonders hart. Seine traditionellen Wirtschaftszweige befanden sich im Niedergang. Werkssiedlungen für Bergleute hatte man schon lange aufgegeben, aber ihre verlassenen Überreste blieben als Mahnung zurück. Rumpelnde Förderanlagen, die einst Kohle sortiert und gereinigt hatten, standen nun still wie gigantische langbeinige Grillen. Als die Arbeitsplätze schwanden, breitete sich eine Drogenkrise aus. Ein verbrecherisches Pharmaunternehmen, Purdue Pharma, nahm Ostkentucky und West Virginia ins Visier und verbreitete falsche Behauptungen über sein Schmerzmittel OxyContin, was zu Medikamentenabhängigkeit, Todesfällen durch Überdosierung und erheblichem Leid führte. Und nun stand eine Demonstration weißer Nationalisten in Pikeville bevor, als wollten sie diese beiden Schicksalsschläge nutzen und eine »Lösung« für die Probleme der Gemeinde bieten. Pikeville wirkte wie das Epizentrum einer größeren Krise.30
Wie kam die Bevölkerung, die Donovan Blackburn so liebevoll beschrieb, mit dieser kritischen Lage zurecht, fragte ich mich. Wandte sie sich vertrauensvoll an die Bundesregierung? Nur mit zwiespältigen Gefühlen.31 Gaben 1964 noch 77 Prozent der Amerikanerinnen an, sie vertrauten der Bundesregierung, »immer« oder »meistens das Richtige zu tun«, so waren es 2023 nur sechzehn Prozent.32 Ein zentraler Bestandteil der Botschaft Ronald Reagans in den 1980er Jahren war eine spöttische Kritik an staatlichen Dienstleistungen und Regulierungen, eine Kritik, die der republikanische Präsident George H.W. Bush und der demokratische Präsident Bill Clinton fortführten, was ein allgemeines Misstrauen gegenüber der Bundesregierung und ihren Behörden schürte.33 Mehr als die Hälfte der Republikaner, allerdings nur 18 Prozent der Demokraten, will mehr Machtbefugnisse für die Bundesstaaten, aber in beiden Parteien ist das Vertrauen in den Staat geschwunden.34
Manche Wähler favorisieren einen »starken Führer«, selbst einen, der sich über Wahlen »erhaben« fühlt. Auf die Frage der Democracy Fund Voter Study Group, ob sie einen »starken Führer [wollten], der sich um Kongress und Wahlen nicht kümmern muss«, antworteten 24 Prozent der Befragten mit Ja.35 Der Wunsch nach einer starken Führung kann selbstverständlich in rechtsgerichteten Kreisen ebenso entstehen wie in linksgerichteten, aber laut einer weltweiten Studie, die das Pew Research Center 2017 in zehn fortgeschrittenen Demokratien durchführte, waren Menschen, die sich für einen solchen »starken Führer« aussprachen, in rechten Kreisen zwei- bis dreimal häufiger.36 In den USA fordern derzeit 27 Prozent der Rechten und 14 Prozent der Linken einen solchen Führer.37 Donald Trump äußerte sich 2018, nach zweijähriger Präsidentschaft, lobend über den chinesischen Staatschef Xi Jinping: »Er ist jetzt Präsident auf Lebenszeit […]. Ich finde das großartig. Vielleicht versuchen wir das eines Tages auch.«38
»Präsident auf Lebenszeit« – sagte er das im Scherz oder im Sinne eines ernst gemeinten Versuchsballons, fragte ich mich. Falls es ernst gemeint war, welche Fragen warf das für Donovan Blackburns Gemeinde und für uns alle auf? Auch außerhalb der USA findet diese Frage Resonanz: Seit 2000 erleben die Demokratien der Welt erstmals nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine Welle von Rechtsradikalismus, wie der Politologe Cas Mudde feststellte.39 Etwa ein Viertel der Weltbevölkerung lebte 2020 in autoritären Regimen, eine Aussicht, die Matthew Heimbach Pikeville als Vision anbieten sollte: ein »starker Mann«, der über der Rechtsordnung, der Verfassung und der Gewaltenteilung steht. Viele Voraussetzungen für eine solche Welle existieren mittlerweile auch in den USA und in anderen Teilen des Westens – Misstrauen gegenüber dem Staat, Unmut über Einwanderung, wirtschaftliche Unsicherheit und Unzufriedenheit unter denjenigen, die außerhalb der industriell-finanziellen Machtzentren und der gewerkschaftlich organisierten Arbeiterschaft stehen. Ich fragte mich, ob die USA sich dieser Welle anschließen oder ihr widerstehen würden. Und ich fragte mich, wie die Menschen in Appalachia, die mich freundlicherweise in ihr Leben ließen, all das empfinden mochten.
Stolz und Scham
Ich brachte nach Pikeville ein großes Interesse an den Emotionen mit, die der Politik zugrunde liegen – und vor allem an den Gefühlen Stolz und Scham. Wenn eine Führungspersönlichkeit Anhänger anspricht, so geschieht das gewöhnlich über Emotionen. Sie sind kein zufälliges Beiwerk rationaler Auseinandersetzungen über politische Maßnahmen, als die wir uns Politik vorstellen. Im Gegenteil: Politik kann das Tablett sein, auf dem Emotionen serviert werden. Und um politisierte Emotionen zu verstehen, müssen wir begreifen, was Menschen durchgemacht haben und woran ihnen etwas liegt.40
Viele Menschen in Appalachia, die ich kennenlernte, waren in einem »Stolzparadox« gefangen. Einerseits waren Republikaner im ländlichen Kongresswahlbezirk KY-5 sehr stolz auf harte Arbeit und persönliche Verantwortung. Wenn man erfolgreich ist, empfindet man Stolz. Wenn man scheitert, empfindet man Scham. Andererseits senkte ihr bedrängtes Wirtschaftsumfeld ihre Erfolgsaussichten und ihre Anfälligkeitsschwelle für Scham erheblich. Das stellte die Opfer vor ein Dilemma: Wie sollten sie auf ungerechtfertigte Scham reagieren? Darauf entwickelten sie unterschiedliche Antworten: die Scham nach innen zu wenden, sie nach außen zu projizieren oder eine kreative Lösung für das Paradox zu finden.
Wenn ich mich mit Menschen aus Ostkentucky zu Interviews hinsetzte, stellte ich immer mein Aufnahmegerät zwischen uns auf den Tisch. Bevor ich den Aufnahmeknopf drückte, erklärte ich meine Absicht und bat um Erlaubnis, ihre Äußerungen aufzunehmen. »Wenn Sie mir aus irgendeinem Grund etwas sagen möchten, was nicht aufgezeichnet werden soll, lassen Sie es mich wissen. Dann schalte ich das Gerät ab«, sagte ich ihnen. Ich notierte die Fälle, in denen mir eine Person durch eine Geste oder ein Nicken in Richtung des Aufnahmegeräts zu verstehen gab, dass ich es ausschalten sollte. Dabei wollte der oder die Betreffende fast nie sich selbst, sondern nahezu ausnahmslos den Stolz eines geliebten Menschen schützen.
Häufig ging es in solchen Geschichten um Drogen. Eine Person erzählte bekümmert von ihrem Bruder, der ein Mädchen geschwängert hatte und fortgezogen war, um eine gut bezahlte Arbeit in einer Fabrik anzunehmen und die Alimente zahlen zu können. Unterdessen wurde die junge Mutter depressiv, wurde drogenabhängig und war schließlich gezwungen, ihr Baby in eine Pflegefamilie zu geben. Ein anderer Mann erzählte von seinem geliebten Vater, einem Bergmann, der von seinem Kohlebergwerk entlassen worden und auf Arbeitssuche per Anhalter zu anderen Bergwerken gefahren war, aber schließlich drogensüchtig wurde und an einer Überdosis starb. Das war eine schmerzliche Erinnerung daran, dass wir nicht nur unsere eigene Trauer und Scham empfinden, sondern auch die anderer mittragen.
Allmählich wurde mir klar, dass wir Amerikanerinnen außer in der materiellen Ökonomie in einer ebenso wichtigen Stolzökonomie leben. Denn auch, wenn Stolz und Scham sich immer persönlich anfühlen, liegen die Ursachen dieser Gefühle doch in umfassenderen gesellschaftlichen Umständen. Bei den Menschen, die ich traf, entdeckte ich viele Arten von Stolz – Regionalstolz, Stolz auf die Arbeitsethik, Stolz darauf, ein schlimmer Kerl zu sein, Stolz auf Genesung. Aber was passiert, wenn die vorrangige Quelle von Stolz einer Gemeinschaft – gut bezahlte Arbeitsplätze – verschwindet oder wenn alte Fertigkeiten oder Traditionen nutzlos und wertlos werden? Was passiert, wenn Gefühle von Verlust und Scham – mangels realer Lösungen für reale Probleme – zum »Erz« werden, nach dem Politiker schürfen?
Aus allen Gesellschaftsschichten und politischen Lagern
Ich wollte den »perfekten Sturm« von so vielen Blickwinkeln aus begreifen, wie ich nur konnte, aus dem aller Gesellschaftsschichten und politischen Lager. Dazu sprach ich mit Menschen, die ihre Gemeinde beschützen – wie Donovan Blackburn –, und mit Provokateuren wie Matthew Heimbach. Ich unterhielt mich mit potenziellen Opfern der bevorstehenden Demonstration – einer afroamerikanischen Einwohnerin, einem jüdischen Flüchtling aus dem nationalsozialistischen Deutschland und einem muslimischen Einwanderer, einem Arzt, der eine Moschee leitete. Ich sprach mit führenden Persönlichkeiten des Ortes – einem ehemaligen Gouverneur von Kentucky, einem Bürgermeister, einem stellvertretenden Bürgermeister, einem Richter –, mit einem Autohändler, einem Geschäftsmann, einem Lehrer, einem Gärtner, dem Leiter einer Road Crew, einem Forscher im medizinischen Bereich, einem Künstler, einem Pastor und anderen, mit Straftätern und mit genesenden Drogenabhängigen. Ich unterhielt mich mit Demokraten, Unabhängigen, Republikanern und politischen Aussteigern. Sie alle waren Gesichter in einer imaginären Menge, von denen ich erfahren wollte, was sie über die Demonstration, ihr Leben, Politik und Stolz dachten. Bei jeder Person, die ich kennenlernte, wollte ich ihre Geschichte von Stolz und Scham, also ihre Stolzbiografie, verstehen.
Außerdem hoffte ich, zu erfahren, wie diese Menschen dazu standen, mit Personen auf der anderen Seite unserer tiefer werdenden politischen Spaltung in Kontakt zu treten. Gegenwärtig gelingt es Amerikanerinnen – und, wie sich herausstellt, besonders weißen Liberalen – nur schlecht, über diese Kluft hinweg miteinander zu reden. Laut einer aufschlussreichen Pew-Umfrage von 2017 haben 45 Prozent der Befragten aufgrund der Äußerungen einer Person aufgehört, mit ihr über Politik zu reden.41 Dazu zählten 45 Prozent der konservativen Republikaner und 60 Prozent der liberalen Demokraten. Die Wahrscheinlichkeit, die Gespräche einzustellen, war zudem bei Weißen höher als bei Schwarzen: 50 Prozent zu 37 Prozent. Was können wir von denen lernen, die offen für eine Kommunikation bleiben, fragte ich mich.
Da ich als »Flachländerin« aus einem demokratischen Bundesstaat an der Westküste der USA die »Bergbewohner«, wie manche sich nannten, kennenlernen wollte, hatte ich vor, mir Zeit zu nehmen. Ich habe fast mein Leben lang in Küstenstädten gewohnt und hatte Kentucky bis dahin nur ein einziges Mal auf die Einladung einer Universität hin besucht. Aber das Landleben war mir durchaus nicht fremd, denn als Kind hatte ich manchen Sommer auf dem Bauernhof meiner Großmutter in Maine verbracht. Als ich geboren wurde, gab es dort schon keine Milchkühe mehr, aber die Scheune, der Milchschuppen, der Geruch, das Wissen, die Arbeitsethik und ein großer, verwilderter Garten waren noch da. Und mit diesen gemischten Erinnerungen machte ich mich 2017 auf den Weg ins Pike County, Kentucky.
In Pikeville treffen viele Traditionen amerikanischer Geschichte aufeinander. Es liegt 225 Kilometer von Lexington entfernt, einer Station auf einer wichtigen Route der Underground Railroad, jenes Netzwerks, das Sklaven bei der Flucht aus den Südstaaten in die Freiheit half. Fort Knox, das am besten gesicherte Stahlbetongewölbe der Welt, in dem mehr als die Hälfte der US-amerikanischen Goldreserven lagert, ist gut vierhundert Kilometer entfernt. Nur hundert Kilometer entfernt kam es einst am Blair Mountain zu den größten Aufständen seit dem Amerikanischen Bürgerkrieg, bei denen Kohleunternehmen aus Flugzeugen aus dem Ersten Weltkrieg Bomben auf streikende Bergarbeiter abwarfen – auf Schwarze, Weiße und Einwanderer, unter denen viele Kriegsveteranen waren. Und im etwa achtzig Kilometer entfernten Inez, Kentucky, erklärte Präsident Lyndon Johnson 1964 seinen berühmten Krieg gegen die Armut – woran sich die Leute häufig mit gesenktem Blick oder Kopfschütteln erinnerten, wie ich feststellte. Johnson hatte geschworen, die »Menschen dieser Region auf eine Schnellstraße der Hoffnung zu bringen«.42 Aber Jahrzehnte nach seinem Besuch hatten viele immer noch das Gefühl, dass dieses Versprechen nicht eingelöst worden war. Viele, die ich in der Region kennenlernte, warteten ungeduldig auf Fortschritte und hatten das Bedürfnis, eine dummschwätzende Außenwelt abzuwehren, die sie entweder ignorierte oder anprangerte. Außerdem lag Pikeville gut 350 Kilometer von der Sinking Spring Farm in Kentucky entfernt, dem Geburtsort Abraham Lincolns, dessen Appell zur nationalen und »rassischen« Einheit wie eine Botschaft an unsere Zeit wirkt.
Im April 2017 tauchten auf den Türschwellen der Häuser in Pikeville Flyer mit dem Bild eines großen, kräftigen Vaters auf, der ein strahlendes Kind in die Luft warf, an seiner Seite eine bewundernde Mutter.43 Der Flyer richtete sich an »weiße Arbeiterfamilien« und informierte die Einwohnerschaft über die bevorstehende Demonstration der weißen Nationalisten.
Donovan Blackburn war bereits aktiv geworden. »Nach Heimbachs Anruf rief ich den Justiziar des Ortes an, um mich über die Rechte der Demonstranten und die unserer Gemeinde zu informieren. Dann setzte ich mich mit unserem Polizeichef, mit dem Sheriff’s Department [des Countys] und mit der Polizei des Bundesstaates in Verbindung.« Währenddessen erreichten ihn noch schlechtere Nachrichten. »Ich erhielt einen Anruf vom Department of Homeland Security [dem US-Ministerium für innere Sicherheit, kurz Heimatschutzministerium]. Sie hatten Facebook-Seiten auf bestimmte Schlüsselworte hin beobachtet – KKK [Ku-Kux-Klan], NSM [National Socialist Movement, eine Neonaziorganisation], League of the South, das N-Wort. Das Heimatschutzministerium, das die weißen Nationalisten, Antifa und andere Demonstranten in Louisville gezählt hatte, sagte mir, ihrer Ansicht nach müssten wir uns auf zwei-, dreitausend bis zu sechstausend Protestierende einstellen. Wir haben hier in Pikeville lediglich siebentausend Einwohner. Ich will nicht behaupten, dass ich in Panik geriet.«
Als sich das herumsprach, trafen Hilfsangebote ein. Der Bürgermeister des Nachbarortes Coal Run erzählte mir: »Als ich von der Demonstration hörte, rief ich Donovan an und fragte: ›Wie kann ich dir helfen? Brauchst du zusätzliche Polizeikräfte?‹« Donovan bekam weitere Hilfsangebote: »Der Gouverneur bot an, die National Guard einsatzbereit zu halten. Die Staatspolizei [von Kentucky] stand bereit. Das FBI rief an. Sogar die [Naturschutzbehörde] Fish and Wildlife bot an, uns zu unterstützen.«
Donovan Blackburn erhielt auch ein beunruhigenderes Angebot: »Ein Bursche von den Proud Boys rief an. ›Wir haben den Ärger gesehen, den die Antifa in Berkeley gemacht hat‹, sagte er mir. ›Wir tragen Waffen und kommen rüber, um euch zu unterstützen.‹ Ich sagte ihm: ›Wir wissen Ihr Angebot zu schätzen, möchten aber nicht, dass Sie das tun.‹«
Donovan Blackburn wog alles gegeneinander ab – die Gewalt in Heimbachs Gefolge, den US-weiten Anstieg des Extremismus, die Waffengesetze Kentuckys, Pike Countys gastfreundliche Kultur, seine persönliche Verbundenheit zu seiner Heimat und seine Einstellung zur freien Meinungsäußerung – und traf eine Entscheidung.
»Ich atmete tief durch. Dann erteilte ich die Genehmigung.«
Kapitel 2
»Wir sind hier gute Menschen«
Mit seinen siebentausend Einwohnern schmiegt sich Pikeville wie ein Collier an einen Berg in einem hufeisenförmigen Tal, das der Big Sandy River in einer Schleife in die Berglandschaft Ostkentuckys mit ihren Kohlevorkommen gegraben hat. Mittlerweile waren die Arbeitsplätze im Kohlebergbau verschwunden und Drogen hatten Einzug gehalten. Weiße Nationalisten bereiteten gerade einen Protestmarsch im Ort vor.
Oberflächlich betrachtet, war von diesem »perfekten Sturm« kaum etwas zu sehen. Tatsächlich wirkte Pikeville ruhig und florierend. Im Juni hingen Körbe mit weißen und violetten Petunien an den Straßenlaternen der sauberen, von Läden gesäumten Hauptstraße und postergroße Fotos zeigten strahlende Highschool-Absolventinnen. Dank eines regionalen Krankenhauses und einer kleinen Universität bezeichneten manche aus den umliegenden »armen« Gebirgstälern Pikeville als »reich«. Fremdenführerinnen präsentierten die Dramen der einst tödlichen Hinterwäldlerfehde zwischen den McCoys und den Hatfields – über ein angeblich gestohlenes Schwein. Es gab Butcher-Holler-Schlüsselanhänger und DVDs des Films Nashville Lady zu kaufen, der die zum nationalen Star avancierte Country-und-Western-Sängerin Loretta Lynn würdigte.
Pikeville war offenbar eine Durchgangsstation zwischen größeren Städten – Louisville, Cincinnati und Detroit, in die Arbeitskräfte in schlechten Zeiten abwanderten – und den Bergweilern mit Häusern von Verwandten und Freunden an schmalen Straßen, die sich an den Hängen hinunter in den Talgrund schlängelten. Im Ort folgten gepflegte Einfamilienhäuser auf verrostete, leerstehende Trailer. Ein Pastor bezeichnete Pikeville als »höflich republikanisch«. Ein afroamerikanischer Verwaltungsangestellter, der aus New York nach Pikeville gezogen war, erklärte, es sei »sicherer als mein Viertel in Queens«.
Mit den gut bezahlten Arbeitsplätzen verließen auch manche Einwohner die Region. Laut Schätzungen würde die Bevölkerung von Pike County, die gegenwärtig 59000 betrug, bis 2040 auf 48000 schrumpfen.1 Aber die Schaufensterauslagen der Geschäfte appellierten offenbar an den Wunsch, zu bleiben. Neben Bridgett’s Quilting an der Second Street präsentierte ein Laden einen Kamin, ein großes Schild mit der Aufschrift HOME, einen weihnachtlichen Türkranz und ein Schild mit der Aufschrift »Where I Want to Be«. Eine talentierte Künstlerin schrieb in ihrem Schaukasten: »Inspiriert von meinen Uromas. […] Diese Ostkentucky-Frauen taten alles, vom Abfädeln der Gartenbohnen vor dem Einmachen bis zum Backen des Maisbrots, ohne zu klagen.« Richteten sich diese Auslagen an rastlose Abwanderer, an trotzige Bleiber oder an nostalgische Touristinnen, fragte ich mich. Der in Kentucky geborene Autor und Aktivist Wendell Berry erklärte bei einem Besuch:2 »Wenn Amerikaner vom Land abwandern, ziehen sie immer weiter und werden zu permanenten Migranten.« Aber die Schaufenster in Pikeville schienen zu sagen: »Vielleicht kommt ihr eines Tages zurück und bleibt.«
Führende Persönlichkeiten der Gemeinden gaben sich alle Mühe, gute Arbeitsplätze in die Region zu holen. Der Dekan der University of Pikeville – UPike, wie sie liebevoll genannt wird – hatte eine Reihe von Interviews mit Unternehmern veröffentlicht, die vorhatten, Betriebe in der Gegend anzusiedeln. Zwei prominente ehemalige Eigentümer von Kohlebergwerken, die fest entschlossen waren, entlassene Bergleute umzuschulen und weiterzubilden, gründeten in einem renovierten Coca-Cola-Abfüllwerk ein Schulungszentrum für Programmierung und Digitaldesign namens Bit Source. »Ein Bergarbeiter ist eigentlich ein Tech-Worker, der sich schmutzig macht«, erklärte mir einer von ihnen, Rusty Justice, strahlend.3 »Motivieren durch Aushungern«, stichelte einer der Entwickler von Bit Source.4 Das Schulungszentrum half einigen, aber die Gemeinde war ständig auf der Suche nach weiteren und besseren Jobs.
Zufallsauswahl oder leichte Beute
Inzwischen hatte die Bevölkerung angefangen, zu diskutieren: Warum beschloss ein Neonazi, hier im friedlichen Pikeville Ärger zu machen? Zwei Erklärungen kursierten. Es könnte erstens reiner Zufall gewesen sein. »Der Bursche hat eine Landkarte der USA auf ein Dartbrett geheftet und einen Pfeil geworfen«, vermutete ein Geschäftsmann. Ein Hotelangestellter aus dem Hampton Inn stimmte ihm zu: »Der Kerl ist das Alphabet durchgegangen und bei P gelandet.« Ein Sprengmeister, der für die Verbreiterung von Straßen Dynamitstangen in Berghängen positionierte, erklärte: »Wenn Extremisten in Minneapolis, Minnesota, Berkeley, Kalifornien, und jetzt in Ostkentucky marschieren, versuchen sie, die Rechte zu vereinen, und sie denken, dass die Rechten versprengt überall im Land sitzen.«
Die zweite Erklärung lautete, dass Ostkentucky leichte Beute war. Es war genau die Art von Region – arm, weiß, ländlich, vergessen –, in der weiße Nationalisten glaubten, Gehör finden zu können. »Ach, die Neonazis wollen einen Rassenkrieg, darum kommen sie an den weißesten Ort, den sie finden können, weil sie denken, dass wir Rassisten sind – aber das sind wir nicht«, erklärte mir ein Mann feierlich. Ein Mathematiklehrer an einer Mittelschule vermutete: »Die Neonazis suchen einen Ort, der verelendet ist, an dem gute Arbeitsplätze verschwunden sind und Drogen Einzug gehalten haben und niemand davon Notiz nimmt oder hilft. Das sind wir!«
Die Demonstranten sollten zwei Vorstellungen mitbringen: eine in Bezug auf race, die andere über undemokratische Machtausübung. Hätte Matthew Heimbach sich jüngere landesweite Studien angeschaut, hätte er einen Zusammenhang zwischen Pike Countys demografischem Profil (nahezu ausschließlich weiße, ältere, ländliche Einwohner mit Highschool-Abschluss, Opfer des wirtschaftlichen Niedergangs, gebürtige Amerikaner, Arme) und Ansichten zur weißen Identität festgestellt. Die American National Election Studies befragten gut sechstausend Weiße: »Wie wichtig ist es für Ihre Identität, weiß zu sein?«5 Die Antwortmöglichkeiten rangierten von »überaus« bis »gar nicht wichtig«. Von den Weißen mit Bachelor oder höherem Abschluss, die in der höchsten Einkommensgruppe waren, erklärten lediglich fünfzehn Prozent, ihre race sei »überaus« oder »sehr wichtig«. Von den Befragten mit Highschool-Abschluss oder niedrigerem Bildungsabschluss, deren Haushalte in die niedrigste Einkommensgruppe fielen, antworteten dreißig Prozent, ihnen sei es »überaus« oder »sehr wichtig«, weiß zu sein. Also selbst in einer demografischen Gruppe, die Matthew Heimbach für »vielversprechend« halten dürfte, hatten nach dieser Studie zwei Drittel der ärmsten und am wenigsten gebildeten Weißen nicht das Gefühl, ihre race sei für ihre Identität »überaus« oder »sehr wichtig«.
Selbst im Kongresswahlbezirk KY-5, dem weißesten der USA, war »weiß« keine einfache Kategorie. Wie der Historiker David Hackett Fischer in Albion’s Seed schreibt, betrachteten sich im 18. Jahrhundert viele Weiße in Appalachia als »Mischling« und manche als Nichtweiße.6 In früheren Zeiten bezeichnete die Kategorie »gemischt« eine Mischung aus irisch, schottisch, italienisch, deutsch, englisch und skandinavisch in unterschiedlichen Anteilen. Später bezog sie sich auch auf Menschen mit uramerikanischen und afrikanischen Vorfahren. Als ich Bürgermeister Andrew H. Scott aus Coal Run erstmals mein Projekt vorstellte, bot er mir freundlicherweise an, mich in meiner Forschung zu unterstützen, und erklärte stolz: »Tatsächlich bin ich ein Melungeon.« Dieser Begriff bezieht sich auf Menschen mit weißen, uramerikanischen und afroamerikanischen Vorfahren. »Hier in Appalachia gilt das für eine ganze Reihe von uns.«
Aber wirtschaftlicher Niedergang kann auch die Einstellungen der Menschen zur race verändern – zumindest für eine gewisse Zeit. In ihrem Aufsatz »Tides and Prejudice« untersuchten die Wirtschaftswissenschaftler Arjun Jayadev und Robert Johnson die Einstellungen zu race von 1979 bis 2014 – also vor und nach der Wirtschaftskrise 2008.7 Sie stellten fest, dass die Feindseligkeit Weißer gegenüber anderen »Rassen« in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit Weißer stieg. Wenn die Beschäftigungszahlen sich besserten, sank auch die Feindseligkeit, ein Befund, der hoffen lässt und faszinierend ist. Das deutet wiederum darauf hin, dass Ängste, die durch einen Faktor wie den Verlust von Arbeitsplätzen verursacht werden, Feindseligkeit in einem anderen Bereich wie race schüren können. Ebenso können Sorgen aufgrund von Massenschießereien, Covid-19 oder Klimawandel bereits bestehende Einstellungen zu race oder Demokratie anheizen. Republikanische Bundesstaaten generell und insbesondere Appalachia hatten unter vielen Formen von Widrigkeiten mehr zu leiden als der Rest der USA.8 Ich fragte mich, in welchem Maß geschickte Politiker große Mengen emotionalen Treibstoffs umlenken konnten. Das könnte bei einer fundierten Vermutung, wo weiße Nationalisten auf offene Ohren stoßen würden, durchaus eine Rolle spielen.
In der Vergangenheit hatten die US-Bundesbehörden notleidende Regionen des Landes unterstützt, mittlerweile waren sie jedoch zunehmend in die Kritik geraten – als zu groß, zu verschwenderisch, zu verdächtig, einen »deep state« hervorzubringen. Bei der bevorstehenden Demonstration wollten Matthew Heimbachs Leute am – 1940 von der Works Progress Administration (WPA, Arbeitsbeschaffungsbehörde) erbauten – Gebäude des Bundesbezirksgerichts vorbeiziehen,9 das einst mit guter Regierung assoziiert wurde und immer noch in Betrieb ist.
Das größte und bemerkenswerteste Beispiel der Region für Bundeshilfen ist der enorme Pikeville Cut-Through, ein riesiger Einschnitt durch einen Berg, den das US Army Corps of Engineers 1973 bis 1987 schuf.10 Immer wieder fragte man mich: »Kennen Sie den Cut-Through?« oder »Waren Sie schon auf dem Aussichtspunkt?« (der einen Ausblick darauf bietet). Als ein ehemaliger Bergwerksbesitzer mit Gemeinsinn erfuhr, dass ich neu im Ort war, bot er mir netterweise an, mich dorthin zu fahren. Auf einer Bronzeplakette wurde der Bergdurchbruch als »größte Ingenieursleistung der USA und weltweit als zweitgrößte nach dem Panamakanal« bezeichnet:11 »Er beseitigte die verheerenden Überschwemmungen durch den Big Sandy River, indem er einer vierspurigen Autobahn, einer Eisenbahntrasse und einem Fluss den Weg durch den Berg ebnete.« Eine Tourismus-Webseite beschreibt Pikeville als Gemeinde, die »es wagte, große Träume zu hegen«, und als »winzigen Ort, der einen Berg versetzte«.12 Heute ist Pikeville ein sauberes, trockenes, charmantes Regionalzentrum und der Cut-Through eine stolze Touristenattraktion. Aber jegliche Erinnerung, dass die Bundesregierung ihn finanziert hatte, war in Broschüren des Fremdenverkehrsbüros vergraben und fehlte in meinen Gesprächen mit den Ortsansässigen völlig.13
Lokaler Touch, ferner Traum
Als Donovan Blackburn sein Helferteam erweiterte, kam der adrette, einundachtzigjährige Paul Patton, der ehemalige demokratische Gouverneur von Kentucky und emeritierte Rektor der University of Pikeville, dazu. Er war im County geboren, war aus bescheidenen Verhältnissen zum Gouverneur aufgestiegen und hatte sich erfolgreich für bessere Schulen und Arbeitsplätze eingesetzt. Nun befand er sich im Ruhestand, saß auf seinem Ledersessel in einem eindrucksvollen Büro in der Universität von Pikeville, umgeben von Dutzenden Fotos, die seinen gesellschaftlichen Aufstieg dokumentierten – lächelnde Männergesichter, Händeschütteln mit anderen Gouverneuren, Senatoren und Präsidenten. Er stand agil auf, ging um seinen Schreibtischstuhl herum und deutete auf ein wandgroßes Ölgemälde von einer weiten Rasenfläche und einem Weg, der den Blick auf ein majestätisches Haus mit weißen Säulen lenkte: der Gouverneurssitz.
Zu Pattons Ehren steht am Fuß einer Treppe, die mit neunundneunzig Stufen zum Eingang der Universität und zu dem Büro, in dem wir saßen, führt, eine 2,75 Meter große Bronzestatue von ihm. In der beringten rechten Hand hält sie eine Tafel mit den Umrissen des Staates Kentucky. Über dem Anzug trägt sie eine Robe; in der anderen Hand hält sie ein dickes Buch. Die Bronzestatue richtet den Blick hinaus auf sein geliebtes Appalachia.
Patton, der in einem umgebauten Maissilo in Fallsburg, Kentucky, knapp 130 Kilometer nördlich von Pikeville, geboren wurde, erinnerte sich: »Wir ernährten uns von unserem Gemüsegarten und jagten Kaninchen, Eichhörnchen und Wildschweine. Wir bekamen einen Kühlschrank, als ich elf war, und ein Auto, als ich zwölf war. Ich besuchte eine Grundschule mit vier Klassenzimmern, gebaut von der [Arbeitsbeschaffungsbehörde] WPA.14 Ein Telefon bekamen wir erst, nachdem ich die Highschool abgeschlossen hatte.« Pattons Vater war Wanderlehrer, dessen eigene Schulbildung an einer örtlichen Baptistenschule er widerstrebend nach dem achten Schuljahr beendet hatte. »Unsere Familie folgte meinem Vater von Job zu Job. Um mehr Geld zu verdienen, arbeitete er später als Bauarbeiter bei der Eisenbahn.«
»Meine Mutter verließ die Schule ebenfalls nach der achten Klasse, aber sie las eifrig [die Zeitschriften] Women’s Home Companion und Good Housekeepingund kam auf die Idee, Blumen auf den Esstisch in unserem winzigen Haus zu stellen.« Seine spätere Ehefrau lernte Patton am College kennen. Ihr Vater besaß ein Kohlebergwerk, bezahlte ihm die beiden letzten Jahre seines Ingenieursstudiums und stellte ihn später in seinem Unternehmen ein. In den 1970er Jahren wurde Patton selbst Bergwerksbesitzer, Millionär und ein aufstrebender Politiker: Vom Landrat (Judge Executive) von Pike County stieg er zum Vizegouverneur und Wirtschaftsminister, Chef der Demokratischen Partei von Kentucky und schließlich zum Gouverneur von Kentucky auf.
»Ich bin als Kentuckys Arbeitsplatz-und-Bildungs-Gouverneur bekannt«, erzählte mir Patton strahlend. »Als ich 1995 das Amt übernahm, stand Kentucky bei der Bildung fast ganz unten. Gott sei gedankt für Mississippi«, kicherte er, »sonst wären wir die Allerletzten gewesen. Aber in meiner zweiten Amtszeit 2003 stiegen wir in die Mitte des Rankings auf.«15 Inzwischen rangiert Kentucky bei der Bildung unter den fünfzig US-Bundesstaaten auf dem 31. Platz.16 Patton hatte allerdings auch Rückschläge erlitten: einen Sexskandal, eine Scheidung, einen drogenabhängigen Sohn. Aber in einer der am schwersten getroffenen Region des Landes hatte Patton ebenso wie der in Kentucky geborene Abraham Lincoln seine eigenen neunundneunzig Stufen zum amerikanischen Traum erklommen.
Wie nahezu alle, mit denen ich sprach, missbilligte auch Patton die Neonazis, gestand ihnen aber ihr Demonstrationsrecht zu, wenngleich er den Makel des Extremismus für seine stolze Gemeinde fürchtete. Die Parlamentarier Kentuckys waren ebenfalls besorgt, dass sie Schande über ihren gesamten Bundesstaat bringen würden. Und so verabschiedeten sie einige Wochen vor der angekündigten Demonstration in Pikeville durch Abstimmung per Zuruf eine Resolution, in der sie die Traditionalist Workers Party verurteilten, jene Gruppierung unter der Führung von Matthew Heimbach, der die Genehmigung für die Demonstration beantragt hatte. Darin hieß es: »Während sie nach dem ersten Verfassungszusatz das Recht haben, ihren Hass zu vertreten, haben wir nach dem ersten Verfassungszusatz das Recht, aufzustehen und zu erklären, dass wir dies in unserer Gemeinschaft nicht akzeptieren werden.« Die Einstellung an der Spitze war klar.
Dennoch sollte diese Demonstration als eine Art Vorschau darauf dienen, wie weißer Nationalismus aussah, wenn und falls er in anderen Orten der Region auftauchen sollte: Brutal aussehende, schwer bewaffnete Männer in Stiefeln mit kurz geschorenem Haar, dunklen Brillen und finsteren, wild entschlossenen Mienen würden stramm aufmarschieren und die Erinnerung an einen berüchtigten deutschen Führer heraufbeschwören, der 1933 mit der Unterstützung von dreißig Prozent der deutschen Wählerschaft an die Macht gekommen war. Man hatte einer schwachen, isolierten Linken die Schuld an Deutschlands Niederlage im Ersten Weltkrieg gegeben und die Nationalsozialistische Partei hatte mit ihrem Versprechen, den verlorenen Stolz wiederzugewinnen, einen Aufschwung erlebt. Matthew Heimbachs Demonstration würde Erinnerungen an diesen Mann und diese Zeit wecken – und damit seltsam, fern und unamerikanisch erscheinen und der großen Mehrheit nicht willkommen sein. Schließlich waren die örtlichen Friedhöfe an den Berghängen übersät von kleinen amerikanischen Flaggen, Grabinschriften der Veterans of Foreign Wars und Blumensträußen. »Viele unserer Großväter und Urgroßväter haben gegen die Nazis gekämpft«, erklärte mir eine ehemalige Krankenschwester, die ich den Grabstein eines Vorfahren putzen sah, »und das haben wir nicht vergessen.«
Mittlerweile erhielt der amtierende Rektor der Universität Pikeville, der sich geweigert hatte, Demonstranten der weißen Nationalisten auf dem Campus zuzulassen, Morddrohungen. Von wem? Das wusste niemand. Auch der Stadtdirektor war gefährdet. »Das FBI warnte mich, dass mein Name auf Twitter kursierte«, sagte Donovan und fügte ruhig hinzu, »in negativer Weise«.
Donovoan bereitete sich auf den Einsatz massiver Gewalt vor, während er zugleich die öffentliche Alarmstimmung zu minimieren versuchte. »Wir planten, dass gepanzerte Einsatzfahrzeuge und Wasserwerfer und Einsatzkräfte der National Guard bereitstehen sollten, beschlossen aber, sie außer Sichtweite im Expo-Center des Ortes unterzubringen«, erzählte er. Dann kam ihm in letzter Minute eine Eingebung: »In anderen Städten hatten die Extremisten häufig ihre Identität kaschiert, darum verabschiedete der Stadtrat (City Commission) von Pikeville einen Dringlichkeitsbeschluss: ›In der Öffentlichkeit dürfen keine Masken oder Kapuzen getragen werden.‹ So können wir ihre Gesichter sehen und herausfinden, wer sie sind. Außerdem setzten wir für Fehlverhalten ein Bußgeld von bis zu 250 US-Dollar und eine Haftstrafe von maximal fünfzig Tagen fest.«
Der energische Geistliche der Universität Pikeville, Rob Musick, hatte eine Idee. Der einundvierzigjährige Mann mit strahlendem Lächeln, randloser Brille, Bart, schütterem Haar und Priesterkragen suchte den ehemaligen Rektor Patton in seinem geräumigen Büro auf.
»Pike County erlebt schwere Zeiten. Das Letzte, was wir brauchen, ist, dass Extremisten von außerhalb herkommen«, erklärte Musick ihm. »In den Nachrichten wird man uns dafür ein blaues Auge verpassen. Wir werden genauso schlecht dastehen wie Berkeley, das ist das Letzte, was wir brauchen.« Musick schlug vor: »Wir müssen unseren Studierenden beibringen, wie man mit Extremisten umgeht. Sonst wissen sie nicht, wie das geht. Sollten wir nicht Matthew Heimbach zu einem Gespräch auf den Campus einladen?«
Paul Patton stellte sich mit verschränkten Armen und der ganzen Autorität seiner zahlreichen hohen Ämter – als Kentuckys Gouverneur über zwei Amtszeiten, CEO eines Kohlebergwerks, Rektor und mittlerweile Kanzler der Universität – vor den jungen Kaplan. »Er wurde ganz ruhig und rot im Gesicht«, erinnerte dieser sich später.
Dann erklärte Patton:
»Freie Meinungsäußerung? Ja.«
»Gesitteter Austausch? Selbstverständlich.«
»Aber Hassreden von einem Neonazischläger auf dem Campus unserer eigenen Universität Pikeville?«
»Auf keinen Fall!«
Kapitel 3
Das Stolzparadox
That’s all right,
That’s okay,
You’re goin’ to work for us
One day!
»Ich erinnere mich, dass in meinem ersten Jahr an der Pikeville Independent High School das Football-Team der Lexington High kam, um gegen uns zu spielen. Die dachten, sie seien besser als wir. Sie waren Städter, wir waren Hinterwäldler. Sie waren reich. Wir waren arm. Sie waren sicher, dass sie uns niedermachen würden. Aber das war unser Hinterwäldlergesang gegen sie, denn in den 1980er Jahren waren wir mitten in einem Kohleboom. Viele meiner Klassenkameraden wurden über Nacht reich – man könnte sagen neureich. Auf unserem Schulparkplatz stand manch ein Mercedes.«
»Coal!« Andrew Scott hielt seine Dänische Dogge zurück, die mit dem ungestümen Australian Shepherd namens Chief rang (kurz für »Police Chief«, den er kaufte und zu Ehren der Polizeikräfte benannte, nachdem er erlebt hatte, wie Antifademonstranten in Portland, Oregon, die Polizei verunglimpft hatten). Scott, über zwei Amtszeiten ein beliebter Bürgermeister von Coal Run, saß in dem holzgetäfelten Arbeitszimmer seines geräumigen, auf einem Berg gelegenen Hauses, das von einer großen, grünen Rasenfläche umgeben war. An einer Wand hingen Wapiti- und Hirschköpfe. Neben dem Natursteinkamin stand ein dekorativer, 45 Zentimeter großer glänzender Kohlequader – in der Nähe seines Bestimmungsortes, aber als Ausstellungsstück. Auf dem Kaminsims waren Messingelefanten aufgereiht, die Andrews Großmutter väterlicherseits im Laufe der Jahre gesammelt hatte, ein Zeichen für die politische Ausrichtung der Familie seit den 1880er Jahren, als die Demokraten im Parlament des Bundesstaates eine Mehrheit im Verhältnis von drei zu eins besaßen.1 Scott stammte aus einer alteingesessenen Familie im Pike County, die Mitte der 1880er Jahre die Bergbauberechtigung für große Gebiete erworben hatte, um sie an Kohleunternehmen zu verkaufen – ein Ärgernis für Farmer, die das Recht erwarben, dasselbe Land an der Oberfläche zu bewirtschaften, und manchmal erlebten, dass Bergbauunternehmen ihre Gärten und sogar ihre Friedhöfe aufgruben. In den 1980er Jahren entschied Scotts Vater als Richter am Bezirksgericht zugunsten eines örtlichen Grundbesitzers gegen ein Tochterunternehmen von Bethlehem Steel – ein Fall, der in Berufung ging und schließlich am Obersten Gerichtshof gewonnen wurde.
Andrew Scott war ein großer Mann von Anfang vierzig mit braunen Haaren, Brille und einer jungenhaften, wissbegierigen Miene. Als Republikaner, der entschieden für niedrige Steuern und geringe Staatsausgaben war, kam er weitgehend durch ererbte Tradition zu seiner Unterstützung für den ehemaligen Präsidenten Trump. Er war Coal Run, einem Nachbarort von Pikeville, tief verbunden. »Wir bestehen im Grunde aus zwei Einkaufsmeilen auf jeder Seite der Route 23, aber wir haben hier den niedrigsten Grundsteuersatz des Bundesstaates, kein Dollar wird verschwendet«, fügte er stolz hinzu. Auf Andrews Twitter-Account war ein Video von einem Schneepflug zu sehen, dessen Scheinwerfer durch dichtes nächtliches Schneetreiben schienen, während er an Heiligabend schmale Bergstraßen räumte. »Steigende Preise für Kraftstoff, Eier und anderes treffen uns hart«, sagte Scott. »Im August haben wir kostenlose Schulranzen und Schulsachen an Kinder aus Coal Run verteilt und die brauchen sie.« An Halloween verteilte er Süßigkeiten an Kinder und an Weihnachten Spielzeug. »Ich finde, wir sind hier eine großartige Kleinstadt. Wir lieben Amerika, aber das County hat es schwer getroffen und ich tue, was ich kann, um zu helfen, und die Republikaner zu wählen, hilft uns hier.«
Stolz und Scham: Eine Sichtweise
Meine Gespräche mit Andrew Scott wie auch mit Donovan Blackburn, dem ehemaligen Gouverneur Paul Patton und anderen halfen mir, zu verstehen, wie solche führenden Persönlichkeiten die Bedürfnisse ihrer Stadt sahen. Aber wie sahen Menschen, die weiter außerhalb in Pike County lebten, ihren Platz in der Welt, und wie mochten sie auf die verschiedenen politischen Appelle reagieren, die an sie gerichtet wurden?
Meine Fragen erwuchsen aus einer Reihe von Vermutungen, die ich aus meiner früheren Forschungsarbeit zu rechtsgerichteten Einwohnerinnen von Louisiana in den Jahren vor der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten 2016 durchgeführt hatte. Ich ging von der Annahme aus, dass dem Reiz politischer Kandidaten fast immer Emotionen zugrunde liegen. Ein Mann erklärte mir: »Das Erste, was ein politischer Führer anspricht, ist Angst, dann Leid, dann Stolz und Scham.« Hier konzentriere ich mich jedoch auf Stolz und Scham, vor allem auf unberechtigte Scham.
Bevor ich fortfahre, möchte ich einige Prämissen umreißen, da sie den Hintergrund dieser Geschichte bilden. Stolz und Scham signalisieren die Verbindungsstelle zwischen der Identität, die wir der Welt präsentieren, und der Reaktion der Welt auf unsere Identität. Stolz fungiert sozusagen als emotionale »Haut des Selbst«;2 er signalisiert, wann unsere Identität sicher ist, akzeptiert und bewundert wird und wann wir Gefahr laufen, Zurückweisung zu erfahren. Er ist unsere innere Reaktion auf unser äußeres Erscheinungsbild. Auch Scham fühlt sich an wie eine »Haut« – eine, die wir ablegen wollen.3 Wir alle verspüren den Wunsch nach Stolz und die Furcht vor Scham. Das untersucht David Keen aufschlussreich in seinem Buch Shame: The Politics and Power of an Emotion. Seine Vorstellungen fügen sich nahtlos in die im vorliegenden Buch dargelegten ein (und beziehen sich auch auf mein vorhergehendes Buch Fremd in ihrem Land, so wie ich mich nun auf Erkenntnisse aus seinem Buch beziehe).4 In die Reaktion auf Stolz und Scham fließen selbstverständlich noch andere Emotionen ein, so empfinden wir möglicherweise ein starkes Verlangen nach Stolz und Wut, wenn wir beschämt werden.
Aristoteles bezeichnet Stolz als »Krone der Tugenden« – ein Gefühl, das wir empfinden, wenn wir etwas Großes erreichen.5 (Im 13. Jahrhundert wurde Stolz oft mit Arroganz, »übermäßigem Selbstwertgefühl« oder »Eigendünkel« assoziiert, eine Konnotation, die ich hier beiseitelasse.) Ich konzentriere mich auf Stolz als ein Gefühl, »nützlich zu sein«. Das englische Wort für stolz, proud, leitet sich vom lateinischen prodesse, nützen, her – also einer Person, einer Gruppe oder einem gemeinsamen Ziel nützen.6 Als ich Andrew fragte, was ihn stolz mache, antwortete er, neben der Tatsache, ein Familienmensch zu sein, sei es, »Coal Run zu helfen«.
Ich verwende das Wort »Stolz« als Oberbegriff und Ehre, Respekt und Status als Subtypen. Scham ist das spiegelbildliche Gegenstück zum Stolz und ebenfalls ein Oberbegriff für eine ganze Bandbreite von Gefühlen wie Demütigung, Kränkung oder Peinlichkeit. Scham wird oft als unangenehmes Gefühl der Selbstverkleinerung empfunden. Häufig geht es mit Reue, Selbsterniedrigung oder Angst vor Strafe einher.7 Scham, wie ich sie verstehe, ist das Gefühl, in den Augen anderer etwas Falsches getan zu haben. Schuld ist das Gefühl, dass wir in unseren eigenen Augen etwas Falsches getan haben. Selbstverständlich können wir beides unabhängig voneinander oder auch zusammen empfinden. Was Scham besondere Bedeutung verleiht, ist, dass sie bereits bestehende Gefühle der Unzulänglichkeit, von denen wir uns befreien wollen, schüren und zudem als Grundlage für politische Anziehungskraft dienen kann.
Zusammen mit Stolz und Scham erleben wir sekundäre Einstellungen zu diesen Gefühlen.8 Wenn man mich beschämt, verdiene ich es, mich zu schämen? Oder verdiene ich es, stolz zu sein? Auf welcher Grundlage? Über solche Gründe für Stolz gibt es zwar gewisse Streitigkeiten, aber im Grunde – wenn die Gesellschaft zusammenhält – leben wir in einer nationalen Stolzökonomie. In meiner Studie zum Petrochemiegürtel um Lake Charles in Louisiana hatte ich einen gewissen trotzigen Stolz entdeckt, daher konnte ich Vermutungen über eine größere, ähnlich wählende Region im nach rechts tendierenden Süden anstellen. Allerdings fragte ich mich, wie die Bausteine des Stolzes sich zu einer Prädisposition der Menschen für die eine oder andere politische Ansicht zusammenfügten.
Als Kindern wird uns ein Platz in der materiellen Wirtschaft zugewiesen, in der wir unseren Weg machen. Das Gleiche gilt für unseren Platz in der Stolzökonomie. Wir werden in eine Region, eine Gesellschaftsschicht, eine race, eine Genderidentität hineingeboren – und sie alle erhöhen oder senken unseren Wert in der größeren Stolzökonomie. Jedes dieser Merkmale geht mit dem höchst umstrittenen Begriff des Privilegs einher. So hat die Kohleregion Appalachia, einst die Hauptquelle von Strom in den USA, einen Niedergang erlebt. Stolz auf den Beruf des Bergarbeiters und auf die moralische Stärke und die Kenntnisse, die er erfordert, und der Stolz, zu einer für die Nation so bedeutenden Region zu gehören – all das hat sich verändert.
In der Folge fühlten sich viele, die ich kennenlernte, gesellschaftlich angegriffen, weil sie einen Verlust an »strukturellem« oder »übertragenem« Stolz erlitten hatten. Die meisten Menschen sind Träger des Stolzes oder der Scham einer größeren Einheit – einer Region, einer Nation, einer Football-Mannschaft, einer Familie –, deren Stellung in der Stolzökonomie sich ihrer Kontrolle entzieht (also strukturell ist). Viele wie Bürgermeister Andrew Scott oder der Universitätsgeistliche Rob Musick sprachen, als müssten sie das »Hillbilly-Sein« vor einem nationalen urbanen Meinungsgericht verteidigen, in dem »Hillbillys« vom Diversitätskonzept ausgeschlossen seien. Eine Studentin namens Ashley erzählte mir: »Wenn du in eine größere Stadt fährst, finden sie, dass du falsch redest und deine Ansichten überholt sind. Leute bitten dich, zu wiederholen, was du gerade gesagt hast, weil sie dich nicht verstehen.«
Oder sie machen Witze. Ashley war mit Upward Bound, einem aus Bundesmitteln finanzierten College-Vorbereitungsprogramm, nach Boston gefahren und erinnerte sich an einen Besuch in einer Buchhandlung. »Nachdem ich mit dem Mann hinter der Theke gesprochen hatte, fragte er mich, wo ich aufgewachsen bin, und als ich sagte, in Ostkentucky, beugte er sich über die Theke, um nachzusehen, ob ich barfuß war. Es war ein Witz, aber es machte mir klar, dass man über mich Witze reißen konnte, die ich über ihn nicht machen konnte.« Mit Klischeevorstellungen konfrontiert zu werden, sorgte mitunter dafür, dass Fremde Gemeinsamkeiten entdeckten. Als ich beispielsweise einem Mann erzählte, dass mein Vater einen starken New-England-Akzent hatte und »yard« wie »yaaad« und meinen Namen Arlie wie »Ahlee« aussprach, grinste er mitfühlend und sagte: »Gott segne ihn.«
Das erinnert mich an eine Szene aus Barbara Kingsolvers hervorragendem Roman Demon Copperhead, in dem die Titelfigur in einer öffentlichen Toilette sagt: »Das ist es, was ich zu all diesen schlauen Leuten mit ihren Hillbilly-Witzen sagen würde, wenn ich könnte: Wir sind in der Kabine. Wir können euch hören.«9
Ohne sonderlich darüber nachzudenken, beziehen wir unseren Stolz aus unterschiedlichen Grundlagen – nationalen, regionalen, beruflichen, intellektuellen und moralischen – sowie aus kulturellen Werten, die unserer ethnischen Gruppe, unserem Geschlecht, unserer sexuellen Orientierung und unserem Körpertypus zugeschrieben werden. Manche dieser Grundlagen von Stolz entziehen sich eindeutig unserer Kontrolle. Dennoch lassen wir diese einzelnen Grundlagen alle zusammen in ein allgemeines Gefühl von persönlichem Stolz einfließen und verschwenden normalerweise kaum einen Gedanken darauf. Je höher die gesellschaftliche Stellung einer Person ist, umso weniger denkt sie tendenziell darüber nach.
Wir leben in einer materiellen Ökonomie und zugleich in einer Stolzökonomie, aber während wir genau auf Veränderungen der materiellen Wirtschaft achten, vernachlässigen oder unterschätzen wir häufig die Bedeutung der Stolzökonomie, die sich parallel zur Stellung in der materiellen Ökonomie des Landes entwickelt. So wie sich die wirtschaftliche Lage der Appalachen-Region Kentuckys mit dem Schicksal der Kohle verbesserte und wieder verschlechterte, veränderte sich auch ihre Stellung in der Stolzökonomie. Unsere Stellung in der materiellen Wirtschaft und in der Stolzökonomie ist oft auf eine Weise miteinander verknüpft, die wir kaum bemerken. Möglicherweise haben wir genug auf unserem Stolzkonto, das wir für Extras aufwenden können, oder wir haben keinen Penny übrig.
Häufig ist unser Platz in der materiellen Wirtschaft mit dem in der Stolzökonomie verknüpft. Wenn wir arm werden, haben wir gleich zwei Probleme: Erstens sind wir arm (ein materielles Problem), zweitens werden wir dazu gebracht, uns für unsere Armut zu schämen (eine Frage des Stolzes). Wenn wir unseren Arbeitsplatz verlieren, sind wir arbeitslos (ein materieller Verlust) und schämen uns, arbeitslos zu sein (ein emotionaler Verlust). Viele schämen sich zudem, staatliche Unterstützung zu bekommen, um diesen Verlust zu kompensieren. Wenn wir in einer ehemals stolzen Region leben, die schwere Zeiten durchmacht, erleiden wir zunächst einen Verlust und empfinden dann Scham über diesen Verlust – und häufig, wie wir sehen werden, folgt schließlich Wut auf diejenigen, die uns real oder imaginär beschämen.
Aber die Stolzökonomie hängt auch mit unserer Stellung in den kulturellen Hierarchien zusammen, die sich unabhängig von der Wirtschaft verändern. Ebenso wie die materielle Wirtschaft mit den Auswirkungen des Welthandels oder regionaler Konjunkturzyklen schwankt, verändert sich auch unsere Stellung in der Stolzökonomie mit den Veränderungen in der Kultur. In Appalachia drehten sich die Stolzgeschichten, die ich hörte, nicht nur darum, Reichtümer zu verdienen – trotz des frühen Football-Gesangs von Pikeville –, sondern auch um die Kraft und den Einfallsreichtum, den es erforderte, arm zu sein.
Dabei sind wir uns nur vage bewusst, wie stark jede Grundlage unseres persönlichen Stolzes Einflüssen unterworfen ist, die weit von unseren persönlichen Intentionen oder Wünschen entfernt sind. So ist der Stolz auf die Nähe zur Natur und zum Landleben dem Auf und Ab einer gemeinsamen kulturellen Einstellung zum Landleben ausgesetzt – die je nach breiten Kulturtrends schwankt. Auf Urlaubspostkarten wird das Landleben zwar romantisiert, aber in der öffentlichen Meinung ist es mit Dingen verknüpft, die langweilig, rückwärtsgewandt und rückständig sind, während die Stadt mit Neuem und Aufregendem assoziiert wird. So setzten Fernsehsender 1971 in der »Säuberung vom Ländlichen« viele Serien ab, in denen das Landleben im Mittelpunkt stand, wie Green Acres,Hee Haw,Lassie,Petticoat Junction und The Beverly Hillbillies und ersetzten sie durch Programme, die auf ein urbanes Publikum zielten.10 Stolz ist in ein öffentliches Narrativ eingebettet.
Einst galten Kohle- und Ölförderung als – in der Stolzökonomie hoch bewertete – nationale Schlüsselindustrien, später wurden deren Reviere nur noch als – in der Stolzökonomie niedrig eingestufte – Orte mit kontaminierten Flüssen und weggesprengten Berggipfeln gesehen. Ein junger Mann fuhr mich auf einen Berg in der Nähe seines Hauses, um mir den zerklüfteten Horizont zu zeigen. »Sehen Sie den Berg da? Und den da drüben? Sie sollten gar nicht abgeflacht sein, Ihre Gipfel hat man weggesprengt, das Land verunstaltet, den Abraum in den Bach gekippt. Für mich gibt es nichts Schöneres als unsere Berge. Aber Berge wegzusprengen ist eine verdammte Schande. Leute fragen, wie wir das zulassen konnten.«
Menschen beziehen ihren persönlichen Stolz noch aus vielen anderen Aspekten des Lebens, die Veränderungen unterworfen sind. Selbst in Bezug auf unseren Körper unterliegen manche Merkmale Modeschwankungen, gelten mal als mehr, mal als weniger wünschenswert und somit als Objekte des Stolzes. In den 1940er und 1950er Jahren waren große Brüste und breite Hüften ein Grund zum Stolz, in den 1960er Jahren wurden kleinere Brüste und längere Beine bewundert. Mal ist dünn und blond angesagt, andere Male vielleicht kurvig und dunkelhaarig. Eine Zeit lang mag weiß als Schönheitsideal gelten, zu anderen Zeiten vielleicht asiatisch oder schwarz. So sind viele, wenn nicht gar alle Grundlagen für Stolz auf unbemerkte Art mit kulturellen Veränderungen in der breiten Gesellschaft verbunden. Auf die gleiche Weise können wir zusammen mit allem, was unserer eigenen Kontrolle unterliegt, unter übertragener Scham leiden, die im Schicksal einer Region wurzelt – aufgrund von Entwicklungen wie Werksschließungen oder dem Verkauf von Medikamenten.
Das Stolzparadox
Die größte Bedeutung als Grundlage für Stolz besitzt unsere Nähe zum amerikanischen Traum. Dieser Begriff, den der Autor und Historiker James Truslow Adams 1931 prägte, beinhaltet die Vorstellung von einem Leben in der Mittelschicht – einem sicheren Arbeitsplatz, einem Haus, einem Auto – und die Vorstellung, sich hochzuarbeiten und mehr zu verdienen als der eigene Vater.
Dieser Traum beinhaltet jedoch ein verstecktes Paradox, das unterschiedliche kulturelle Welten schafft – eine Welt republikanischer Bundesstaaten mit geringeren Chancen und strikteren Erwartungen und eine Welt demokratischer Bundesstaaten mit besseren Chancen und weniger strikten Erwartungen. In der Welt der republikanischen Bundesstaaten sind diejenigen, die den amerikanischen Traum nicht erreichen können, anfällig für Scham, wie wir sehen werden. Wer in diesem Dilemma gefangen ist, hat drei Möglichkeiten, auf Scham zu reagieren.
Aber zunächst zu dem Paradox selbst. Es besteht aus zwei Teilen: aus dem Vorhandensein wirtschaftlicher Chancen in der eigenen Region und aus den eigenen kulturellen Überzeugungen über die Verantwortung, sie zu nutzen. Etwa ab 1970 entwickelte sich in den USA eine Spaltung zwischen zwei Wirtschaften – die der Gewinner und die der Verlierer der Globalisierung. Zunehmende Chancen boten wirtschaftlich diversifizierte Städte und Regionen, oftmals Standorte neuerer, weniger anfälliger Industrien, die typischerweise Arbeitskräfte mit College-Abschluss in Dienstleistungs- und Tech-Branchen einstellten. Abnehmende Chancen gab es in ländlichen und halbländlichen Gegenden mit Arbeitsplätzen für Arbeiter in älteren Fertigungsindustrien, die anfälliger für Verlagerung ins Ausland und für Automatisierung waren. Dazu gehören auch Regionen mit Arbeitsplätzen in der Förderung von Öl, Kohle und anderen Mineralien, bei denen die Nachfrage von den Schwankungen am Weltmarkt abhängt. Die urbane Mittelschicht, die zu den Demokraten tendiert, entwickelte sich zu einem sogenannten Mobilitätsinkubator,11 während viele ländliche, von Arbeitern dominierte Gegenden, die nun zu den Republikanern tendieren, zu Mobilitätsfallen wurden. Zwischen 2008 und 2017 stieg das mittlere Haushaltseinkommen in demokratischen Kongresswahlbezirken laut einer Studie von 54000 auf 61000 US-Dollar, während es in republikanischen Wahlbezirken von 55000 auf 53000 US-Dollar sank.12 In den letzten Jahren gab es in republikanischen Wahlbezirken höhere Raten von Covid-19-Erkrankungen als in demokratischen Wahlbezirken.13 Optimismusstudien spiegeln die Nähe oder Ferne einer Person zu den Chancen wider, den amerikanischen Traum zu erreichen – am wenigsten optimistisch sind arme Weiße auf dem Land, die pessimistischer sind als arme urbane Schwarze.14 In der Bevölkerung republikanischer Countys – besonders bei weißen Männern – ist zudem die Sterblichkeit höher als in demokratischen Countys. Im Laufe der Zeit ist die Sterblichkeit in demokratischen Countys stärker zurückgegangen als in republikanischen:15





























