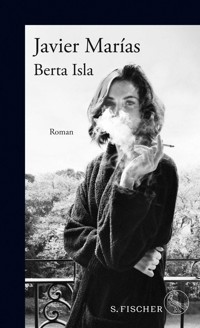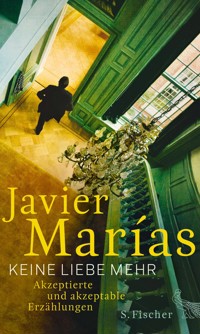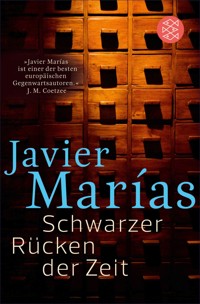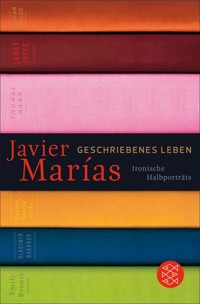
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eine amüsante Reise mit JAVIER MARÍAS durch die Weltliteratur in 26 Autorenporträts. Würde nicht jeder gern erfahren, was hinter den großen Schriftstellern steckt? Javier Marías erlaubt uns in 26 kurzweiligen Porträts von Faulkner bis Rimbaud, von Mishima bis Thomas Mann, von Isak Dinesen bis Emily Brontë einen vieldeutigen Blick hinter die Kulissen. Wir erfahren Intimstes und Erstaunliches über all die Helden der Literatur, die genauso bedürftig sind wie wir alle, manchmal ausgestattet mit einer ausgewachsenen Trunksucht, Eifersucht oder anderen menschlichen Schwächen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Javier Marías
Geschriebenes Leben
Ironische Halbporträts
Über dieses Buch
Würde nicht jeder gern erfahren, was hinter den großen Schriftstellern steckt? Javier Marías erlaubt uns in 26 kurzweiligen Porträts von Faulkner zu Rimbaud, von Mishima zu Thomas Mann, von Isak Dinesen zu Emily Brontë einen vieldeutigen Blick hinter die Kulissen. Wir erfahren Intimstes und Erstaunliches über all die Helden der Literatur, die genauso bedürftig sind wie wir alle, manchmal ausgestattet mit einer ausgewachsenen Trunksucht, Eifersucht oder anderen menschlichen Schwächen. Und damit wir die Weltliteraten auch vor Augen haben, während wir durch das Schlüsselloch schauen, enthält der Band Fotos der Protagonisten.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Javier Marías, 1951 als Sohn eines vom Franco-Regime verfolgten Philosophen geboren, veröffentlichte seinen ersten Roman mit neunzehn Jahren. Seit seinem Bestseller Mein Herz so weiß gilt er weltweit als beachtenswertester Erzähler Spaniens.
Sein umfangreiches Werk wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. mit dem Nelly-Sachs-Preis sowie dem Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur. Seine Bücher wurden in über vierzig Sprachen übersetzt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel Vidas escritas im Verlag Alfaguara
© 1992 Javier Marías
Die erweiterte Ausgabe:
© 2000 Grupo Santillana de Ediciones, S.A.
Lizenzausgabe mit freundlicher Genehmigung des
Klett-Cotta Verlag, Stuttgart
© J.G.Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart 2001
© 2017S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: buxdesign, München
nach einer Idee von Tom Bean/Rodrigo Corral Design Inc.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-401999-4
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Vorwort
Geschriebenes Leben
William Faulkner zu Pferde
Joseph Conrad zu Lande
Isak Dinesen im Alter
James Joyce und sein Habitus
Giuseppe Tomasi di Lampedusa und sein Unterricht
Henry James auf Besuch
Arthur Conan Doyle und die Frauen
Robert Louis Stevenson unter Verbrechern
Iwan Turgenjew und seine Trauer
Thomas Mann und seine Leiden
Vladimir Nabokov in Verzückung
Rainer Maria Rilke in Wartestellung
Malcolm Lowry in Nöten
Madame du Deffand und die Dummköpfe
Rudyard Kipling ohne Scherze
Arthur Rimbaud wider die Kunst
Djuna Barnes und das Schweigen
Oscar Wilde nach dem Zuchthaus
Yukio Mishima und der Tod
Laurence Sterne beim Abschied
Flüchtige Frauen
Lady Hester Stanhope, die Königin der Wüste
Vernon Lee, die Wildkatze
Adah Isaacs Menken, die reitende Dichterin
Violet Hunt, die schamlose Babylonierin
Julie de Lespinasse, die geliebte Geliebte
Emily Brontë, der schweigsame Major
Vollendete Künstler
Charles Dickens
Charles Dickens liest seinen Töchtern vor
Charles Dickens
Stéphane Mallarmé
Stéphane Mallarmé
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Charles Baudelaire
Charles Baudelaire
Henry James
Henry und William James
Laurence Sterne
Laurence Sterne
André Gide
André Gide
Joseph Conrad
William Faulkner
William Faulkner
Jorge Luis Borges
Rainer Maria Rilke
Edgar Allan Poe
Friedrich Nietzsche und seine Mutter
Friedrich Nietzsche
T. E. Lawrence
T. E. Lawrence
T. E. Lawrence
Djuna Barnes
Mark Twain
Vladimir Nabokov
Thomas Hardy
William Butler Yeats
T. S. Eliot
Herman Melville
Wladimir Majakowski
Samuel Beckett
Thomas Bernhard
William Blake
Anmerkungen zu den »Vollendeten Künstlern«
Bibliographie
Persönliches Verzeichnis
Meinem wahren Vater Juliánund meiner falschen Schwester und dem, der wartet
Vorwort
Die Grundidee zu diesem Buch geht auf ein anderes zurück, an dem ich mitgewirkt habe, und zwar auf die Anthologie höchst sonderbarer Erzählungen mit dem Titel Cuentos únicos, die ich 1989 bei Ediciones Siruela in Madrid veröffentlicht habe und in der jedem Text ein kurzer biographischer Abriss über die alles andere als bekannten Autoren vorangestellt war. Die meisten von ihnen waren so unbekannt, dass ich in einigen Fällen nur über spärliche, nicht nachprüfbare und freilich bruchstückhafte Informationen verfügte, die mitunter so wunderlich waren, dass mehr als nur ein Leser sie für erfunden hielt und folglich an der Wahrhaftigkeit der Erzählungen zweifelte. Dabei bilden diese Kurzbiographien, wenn man sie alle hintereinander liest, für sich wiederum eine Erzählung, die sicherlich nicht weniger einzigartig und gespenstisch ist als die anderen.
Ich bin heute wie damals der Ansicht, dass dies nicht allein an den ebenso versprengten wie augenfälligen Informationen liegt, die mir über die erfolglosen, rätselhaften Autoren zur Verfügung standen, sondern auch an der Art und Weise, wie ich mit ihnen umgegangen bin, und ich habe mir gesagt, dasselbe könnte man doch mit maßgeblicheren und berühmteren Schriftstellern tun, über die ein neugieriger Mensch in unserem Zeitalter der umfassenden und allzu oft unnützen Belesenheit, in dem wir seit nunmehr fast einem Jahrhundert leben, alles bis ins letzte Detail erfahren kann. Kurzum, ich hatte die Idee, allseits bekannte Literaten wie fiktive Gestalten zu behandeln, wobei dies vermutlich die Art und Weise ist, wie sich alle Schriftsteller insgeheim wünschen, behandelt zu werden, unabhängig von ihrem Ruhm oder dem Grad ihrer Vergessenheit.
Bei den hier vertretenen zwanzig Autoren handelt es sich um eine willkürliche Auswahl (drei Amerikaner, drei Iren, zwei Schotten, zwei Russen, zwei Franzosen, einen Polen, eine Dänin, einen Italiener, einen Deutschen, einen Tschechen, einen Japaner, einen – dem Geburtsort nach – Engländer aus Indien und einen Engländer aus England). Als einzige Bedingung habe ich mir auferlegt, dass sie allesamt tot sein müssen, und von vornherein die Möglichkeit ausgeschlossen, mich mit Spaniern zu befassen: Zum einen wollte ich nicht, nicht einmal ansatzweise, in das Territorium eindringen, das so vielen meiner fachgelehrten Landsleute den Broterwerb sichert; und zum anderen haben mir gewisse Kritiker und einheimische Kollegen bei den unterschiedlichsten Anlässen schon so oft mein Spaniertum abgesprochen (sowohl was meine Sprache als auch was meine Literatur, ja sogar meine Staatsbürgerschaft betrifft), dass ich mittlerweile, wie ich festgestellt habe, gewisse Hemmungen verspüre, wenn es darum geht, mich über die Schriftsteller meines Heimatlandes zu äußern, zu denen indes einige meiner Lieblingsautoren gehören (March, Bernal Díaz, Cervantes, Quevedo, Torres Villarroel, Larra, Valle-Inclán, Aleixandre – von den noch lebenden ganz zu schweigen) und zu denen ich mich, wie ich fürchte, trotz allem nach wie vor zähle. Aber es ist, als hätten sie mich davon überzeugt, dass ich kein Recht dazu habe, und man handelt nun mal nach seinen Überzeugungen.
In diesem Buch werden Menschenleben oder, strenggenommen, Versatzstücke aus ihrem Leben erzählt: Nur selten erfolgt eine Wertung ihres literarischen Werks, und die den Personen bezeugte Sympathie oder Antipathie lässt nicht unbedingt Rückschlüsse auf das Maß der Wert- oder Geringschätzung zu, die ich ihren Schriften entgegenbringe. Von der Heiligenverehrung und dem feierlichen Gehabe, mit denen begnadete Künstler so oft bedacht werden, weit entfernt, ist das vorliegende Buch Geschriebenes Leben meiner Ansicht nach vor allem mit einer Mischung aus Zuneigung und Spott erzählt. Letzterer ist sicherlich in allen Fällen vorhanden; erstere fehlt zugegebenermaßen bei Joyce, Mann und Mishima.
Es hätte wenig Sinn, aus den vorliegenden Porträts Schlussfolgerungen oder Regeln für das Leben von Schriftstellern im Allgemeinen ableiten zu wollen: Was ich hier zur Sprache bringe, ist sehr einseitig, doch gerade Ausgewähltes beziehungsweise Weggelassenes entscheidet mit über Gelingen oder Misslingen dieser Texte. Erdichtetes (also von Grund auf Erfundenes) gibt es in ihnen zwar kaum, doch habe ich manche Episoden oder Anekdoten sehr wohl »ausgeschmückt«. Eines springt bei der Lektüre in jedem Fall ins Auge, nämlich dass die Mehrzahl dieser Autoren vom Pech verfolgte Menschen waren, und auch wenn dies für sie bestimmt nicht in stärkerem Maß als für irgendjemanden sonst zutrifft, über dessen Leben wir etwas wissen, lädt ihr Beispiel nicht gerade dazu ein, die literarische Laufbahn einzuschlagen. Erfreulicherweise fällt aber auch auf – und dies ist unbedingt erwähnenswert –, dass sich die meisten von ihnen selbst nicht sehr ernstgenommen haben, abgesehen vielleicht von den vorhin genannten Ausnahmen, denen ich meine Zuneigung versagt habe. Allerdings frage ich mich, ob der mangelnde Ernst, der aus diesen Texten spricht, tatsächlich in den Personen selbst begründet liegt oder vielmehr im voreingenommenen Blick des selbsternannten Gelegenheitsbiographen.
Für den argwöhnischen Leser, der die eine oder andere Angabe überprüfen oder besagte »Ausschmückungen« aufspüren möchte, füge ich am Schluss eine Bibliographie an, doch dürfte er größte Schwierigkeiten haben, an die meisten Titel heranzukommen.
Die Essays mit dem Titel Geschriebenes Leben wurden in der Zeitschrift Claves de razón práctica (2. bis 21. Ausgabe) veröffentlicht, der Text Vollendete Künstler, der das Buch gleichsam als Negativ beschließt (in ihm geht es lediglich um Gesichter und Gesten), erschien in der Zeitschrift El Paseante (17. Ausgabe). Ich danke den Herausgebern der erstgenannten, Javier Pradera und Fernando Savater, für ihre Ermutigung und die sanfte Tyrannei, die sie auf mich ausgeübt haben und der die Niederschrift dieser Leben zweifellos zu einem Gutteil zu verdanken ist.
JM
Februar 1992
P.S. Sieben Jahre und sieben Monate später
Die vorliegende Neuausgabe von Geschriebenes Leben weist im Vergleich zu der bestehenden Fassung nur wenige Veränderungen auf, doch seien sie im Folgenden vermerkt:
Bei einigen der Leben wurden geringfügige Überarbeitungen oder Ergänzungen vorgenommen, die übrigen sind unverändert. Dagegen unterscheiden sich die meisten der den Texten vorangestellten Fotos von denen der Ausgabe aus dem Jahr 1992 (damals hatte sie der Herausgeber Jacobo Fitz-James Stuart ausgewählt, diesmal ich).
Es gibt einen neuen oder zumindest in diesem Buch neuen Teil (den ich seinerzeit, also 1993, dem Essayband Literatura y fantasma einverleibt hatte) mit dem Titel Flüchtige Frauen, den ich zwar erst nach der Veröffentlichung von Geschriebenes Leben im Jahr 1992 geschrieben habe, der jedoch im selben Geist gehalten ist. Insofern ist er hier in diesem Band mit Kurzbiographien am richtigen Platz. Ursprünglich sind die in ihm enthaltenen Texte in der Zeitschrift Woman (in den Ausgaben von Mai bis Oktober 1993) erschienen.
Was das vor sieben Jahren und sieben Monaten verfasste Vorwort betrifft, so möchte ich lediglich ergänzen, dass sich die darin erwähnte »Überzeugung« in der Zwischenzeit noch verstärkt und gefestigt hat. Und meinen – nicht mehr lebenden – spanischen Lieblingsschriftstellern wäre Juan Benet hinzuzufügen.
Im Lauf der Zeit ist mir eines bewusst geworden: Ich habe es genossen, jedes einzelne meiner Bücher zu schreiben, aber am meisten Spaß hatte ich mit diesem. Vielleicht weil diese Leben nicht nur geschrieben, sondern auch gelesen wurden.
JM
September 1999
Geschriebenes Leben
William Faulkner zu Pferde
William Faulkner, 1958 (Foto: Ralph Thompson)
Der kitschigen Legende nach hat William Faulkner seinen Roman Als ich im Sterben lag binnen sechs Wochen und unter widrigsten Umständen geschrieben, nämlich nachts bei der Arbeit in einer Mine im kümmerlichen Schein der Grubenlampe auf seinem staubigen Helm, die Blätter auf einer umgedrehten Schubkarre ausgebreitet. Ziel der kitschigen Legende ist es, Faulkner mit seinen armen, entsagungsvollen und proletarisch angehauchten Schriftstellerkollegen in eine Reihe zu stellen. Dabei stimmt allein das mit den sechs Wochen: sechs Wochen im Sommer, in denen er die schier endlosen Intervalle zwischen einer Schaufelvoll Kohle und der nächsten, mit der er einen Heizkessel in einem Elektrizitätswerk zu versorgen hatte, intensivst nutzte. Faulkners eigenen Worten zufolge störte ihn dort nämlich niemand, war der ständige Lärm des riesigen, betagten Dynamos besänftigend und der Ort selbst warm und still.
Kein Zweifel allerdings besteht hinsichtlich seiner Fähigkeit, sich in die Schriftstellerei oder Lektüre zu versenken. Zu der Arbeit im Elektrizitätswerk hatte ihm sein Vater verholfen, nachdem man ihm seine vorhergehende Stelle als Verwaltungsbeamter auf der Poststelle der Universität von Mississippi gekündigt hatte. Offenbar hatte ein Professor nicht ganz unbegründete Anschuldigungen gegen ihn erhoben: Der einzige Weg, an seine Post zu gelangen, bestünde darin, im Mülleimer am Hinterausgang danach zu wühlen, wo die in Empfang genommenen Postsäcke häufig ungeöffnet und ohne viel Federlesens landeten. Faulkner mochte es nämlich nicht, wenn man ihn bei der Lektüre unterbrach, und so ging der Briefmarkenverkauf alarmierend zurück: Seiner Familie gegenüber rechtfertigte er sich mit den Worten, er sei nicht bereit, immerfort aufzuspringen, um sich an den Schalter zu stellen und sich jedem dahergelaufenen Burschen gegenüber dankbar zu zeigen, der eine Briefmarke für zwei Cents kaufen wolle.
Vielleicht hat Faulkner dort seine unleugbare Abneigung und Abscheu gegen jegliche Art von Postsendung ausgebrütet. Nach seinem Tod fand man stapelweise ungeöffnete Briefe, Päckchen und Manuskripte von Verehrern. Er pflegte nämlich lediglich Kuverts aufzumachen, die ihm Verlage schickten, und dabei ging er überaus vorsichtig zu Werke: Er schlitzte sie an einer Stelle auf und schüttelte sie, um zu sehen, ob vielleicht ein Scheck herauslugte. War dies nicht der Fall, wanderte der Brief zu dem, was bis in alle Ewigkeit warten konnte.
Für Schecks hatte er sich schon immer sehr interessiert, doch darf man daraus nicht schließen, dass er ein geldgieriger oder geiziger Mensch gewesen wäre. Vielmehr war er ein Verschwender. Was er verdiente, gab er im Handumdrehen wieder aus, und anschließend lebte er so lange auf Pump, bis der nächste Scheck eintraf. Dann bezahlte er seine Schulden und gab erneut alles aus, vor allem für Pferde, Tabak und Whiskey. Eine große Garderobe besaß er nicht, doch was er besaß, war teuer. Mit neunzehn trug ihm sein affektiertes Äußeres den Spitznamen »der Graf« ein. Schrieb die Mode enganliegende Hosen vor, trug er die engsten Hosen von ganz Oxford (in Mississippi), der Stadt, in der er lebte. Er verließ sie 1916, um sich in Toronto beim britischen Royal Flying Corps ausbilden zu lassen. Die Amerikaner hatten ihn aufgrund seiner unzulänglichen Studien abgelehnt, und die Engländer wollten ihn anfangs auch nicht, weil er zu klein war – bis er damit drohte, für die Deutschen zu fliegen.
Einmal bekam Faulkner Besuch von einem jungen Mann, als er gerade eine erloschene Pfeife in einer Hand und in der anderen die Zügel des Ponys hielt, auf dem seine Tochter Jill saß. Um das Eis zu brechen, erkundigte sich der junge Mann, wie lange das kleine Mädchen schon reite. Faulkner antwortete nicht sofort. Nach einer Weile sagte er: »Seit drei Jahren«, und fügte hinzu: »Wissen Sie was? Es gibt nur drei Dinge, die eine Frau können muss.« Wieder machte er eine Pause, und dann schloss er mit den Worten: »Die Wahrheit sagen, reiten und Schecks unterschreiben.«
Jill war nicht die erste Tochter Faulkners und seiner Frau Estelle, die zwei Söhne aus einer früheren Ehe mit in die Beziehung gebracht hatte. Ihre erste gemeinsame Tochter war fünf Tage nach der Geburt gestorben. Sie hatten ihr den Namen Alabama gegeben. Da die Mutter vor Schwäche ans Bett gebunden war und Faulkners Brüder sich gerade nicht in der Stadt befanden und die Kleine außerdem nicht einmal gesehen hatten, sah Faulkner keine Veranlassung, eine Beerdigung abzuhalten, zumal das kleine Mädchen in den fünf Tagen lediglich Zeit gehabt hatte, zu einer Erinnerung zu werden, nicht jedoch zu einer Persönlichkeit. Also legte der Vater das Bündel in einen winzigen Sarg und brachte es auf seinem Schoß zum Friedhof, wo er es allein und ohne jemanden zu benachrichtigen bestattete.
Als Faulkner 1949 den Nobelpreis erhielt, sträubte er sich anfangs, nach Schweden zu reisen, aber am Ende fuhr er nicht nur doch, sondern bereiste im Auftrag des Außenministeriums zudem Europa und Asien. Die unzähligen Veranstaltungen, zu denen er eingeladen wurde, durchstand er mehr schlecht als recht. Beispielsweise ist überliefert, dass er auf einem Fest, welches seine französischen Verleger, das Ehepaar Gallimard, ihm zu Ehren gaben, auf die Fragen eines Journalisten nur knappe Antworten gab und dabei jedes Mal einen Schritt rückwärts machte. Auf diese Weise manövrierte er sich Schritt für Schritt mit dem Rücken gegen die Wand, und erst da erbarmten sich die Journalisten seiner oder gaben auf. Am Ende flüchtete er gar in den Garten. Ein paar Gäste verkündeten, sie wollten ein wenig mit ihm plaudern, und folgten ihm, doch sie kehrten kurz darauf erregt und mit Ausreden wie: »Kalt ist es da draußen!« in den Salon zurück. Faulkner war ein wortkarger Mensch, der die Stille liebte und in seinem ganzen Leben nur fünfmal ins Theater ging: dreimal in Hamlet und jeweils einmal in den Sommernachtstraum und Ben Hur. Freud hatte er nicht gelesen, zumindest behauptete er dies einmal: »Ich habe ihn nie gelesen. Auch Shakespeare hat ihn nicht gelesen. Ich bezweifle, dass Melville ihn gelesen hat, und ich bin sicher, dass Moby Dick es nicht getan hat.« Den Quijote dagegen las er alle paar Jahre von neuem.
Gleichzeitig gestand er jedoch, dass er nie die Wahrheit sage. Schließlich sei er keine Frau, mochte er mit dem weiblichen Geschlecht auch die Vorliebe für Schecks und das Reiten teilen. Und immer wieder beteuerte er, er habe Die Freistatt, seinen kommerziellsten Roman, des Geldes wegen geschrieben: »Ich brauchte es, um mir ein gutes Pferd zu kaufen.« Auch behauptete er, dass er große Städte mied, weil er nicht mit dem Pferd hinreiten konnte. Selbst als er schon nicht mehr der Jüngste war und ihm sowohl seine Familie als auch die Ärzte dringend davon abrieten, ritt er weiterhin aus und sprang über Hindernisse, wobei er ständig stürzte. Auch bei seinem letzten Ausritt ereignete sich ein Sturz. Seine Frau sah vom Haus aus Faulkners Pferd gesattelt und mit baumelnden Zügeln vor dem Gatter stehen. Als sie ihren Mann nirgends erblickte, rief sie Dr. Felix Linder an, und gemeinsam machten sie sich auf die Suche nach ihm. Gut eine halbe Meile entfernt fanden sie ihn: Er humpelte und schleppte sich mühsam dahin. Der Gaul hatte ihn abgeworfen, und Faulkner hatte im ersten Moment nicht aufstehen können, weil er auf dem Rücken gelandet war. Das Pferd hatte sich ein paar Schritt weit entfernt, war dann stehen geblieben und hatte zurückgeschaut. Als Faulkner sich schließlich aufrappelte, war das Pferd auf ihn zu getrottet und hatte ihn mit der Schnauze angestupst. Faulkner hatte versucht, nach den Zügeln zu greifen, sie jedoch verfehlt. Daraufhin war das Pferd nach Hause getrabt.
William Faulkner musste eine Zeitlang schwerverletzt und mit starken Schmerzen das Bett hüten. Er hatte sich noch nicht gänzlich erholt, als er in dem Krankenhaus verstarb, in das man ihn eingeliefert hatte, um die Entwicklung seines Zustands zu beobachten. Der Erzählung nach starb er jedoch nicht an den Folgen seines Sturzes, sondern an einer Thrombose, und zwar am 6. Juli 1962 im Alter von knapp fünfundsechzig Jahren.
Fragte man ihn, wen er für die besten amerikanischen Schriftsteller seiner Zeit halte, antwortete er, sie seien durch die Bank gescheitert, aber den besten Misserfolg habe Thomas Wolfe hingelegt und den zweitbesten William Faulkner. Das sagte er im Lauf der Jahre wiederholt, wobei man nicht vergessen darf, dass Thomas Wolfe bereits seit 1938 tot war, das heißt fast die gesamte Zeit, in der William Faulkner dies behauptete und selbst noch lebte.
Joseph Conrad zu Lande
Joseph Conrad, 1916
Da es von Joseph Conrad so viele unvergessene Bücher über die Seefahrt gibt, stellt man ihn sich stets an Bord eines Segelschiffes vor und vergisst, dass er die letzten dreißig Jahre seines Daseins an Land verbracht und ein erstaunlich sesshaftes Leben geführt hat. Im Grunde hasste er das Reisen wie jeder richtige Seebär, und nichts behagte ihm so sehr wie sich in seinem Arbeitszimmer einzuschließen, wo er unter unsäglichen Mühen etwas zu Papier brachte oder mit seinen engsten Freunden plauderte. Allerdings muss dazu gesagt werden, dass er nicht immer an Orten arbeitete, die per se dafür vorgesehen waren: Gegen Ende seines Lebens verkroch er sich in Kent in den entlegensten Winkeln seines Gartens, um Papierfetzen vollzukritzeln, und es gilt als verbürgt, dass er einmal eine ganze Woche lang ohne ein Wort der Erklärung das Badezimmer in Beschlag nahm, weshalb seine Familie diesen Ort in jenem Zeitraum nur sehr eingeschränkt nutzen konnte. Ein andermal war das Problem eher kleidungsmäßiger Natur, denn Conrad weigerte sich, etwas anderes anzuziehen als seinen verblichenen, ursprünglich einmal gelbgestreiften Morgenmantel, was sich durchaus als nachteilig erweisen konnte, etwa wenn ihm Freunde unangemeldet einen Besuch abstatteten oder amerikanische Touristen angeblich rein zufällig vorbeikamen.
Die größte Bedrohung für die Sicherheit der Familie stellte zweifellos Conrads eingefleischte Marotte dar, stets eine Zigarette in den Fingern haben zu müssen, die er jedoch meist schon nach wenigen Sekunden irgendwo liegenließ. Seine Frau Jessie fand sich notgedrungen damit ab, dass sowohl Bücher als auch Bettlaken, Tischdecken und Möbel mit Brandflecken übersät waren, doch sie lebte jahrelang in Alarmzustand, um zu verhindern, dass sich ihr Mann allzu schlimm verbrannte, denn obwohl Conrad schließlich ihrer Bitte nachkam und sich angewöhnte, die Zigarettenstummel in einen großen, eigens zu diesem Zweck bereitgestellten Wasserkrug zu werfen, widerfuhren ihm mit dem Feuer ständig Missgeschicke. Mehr als einmal hätte seine Kleidung um ein Haar Feuer gefangen, weil er sich allzu nah an den Ofen gesetzt hatte, und nicht selten begann das Buch, in dem er gerade las, urplötzlich zu brennen, weil es allzu lange mit der lichtspendenden Kerze in Berührung gekommen war.
Es erübrigt sich die Bemerkung, dass Conrad ein zerstreuter Zeitgenosse war, doch seine Hauptcharakterzüge waren widersprüchlicher Natur: Reizbarkeit und Gutmütigkeit – wobei sich beides möglicherweise gegenseitig erklärt. Sein Normalzustand lässt sich mit an Ängstlichkeit grenzender innerer Unruhe beschreiben, und seine Sorge um andere Menschen war so groß, dass einem seiner Freunde nur etwas zuzustoßen brauchte, damit er selbst wieder einen seiner Gichtanfälle bekam, ein Leiden, das er sich als junger Mann auf dem Malaiischen Archipel zugezogen hatte und das ihn den Rest seines Lebens plagen sollte. Während sein Sohn Borys im Ersten Weltkrieg kämpfte, wurde Conrads Frau Jessie eines Abends, nachdem sie den ganzen Tag unterwegs gewesen war, zu Hause von einem weinenden Dienstmädchen empfangen, das ihr Folgendes eröffnete: Mister Conrad habe dem Personal mitgeteilt, dass Borys gefallen sei, und sich vor Stunden im Zimmer seines Sohnes eingeschlossen. Dabei sei, wie das Mädchen hinzufügte, weder ein Brief noch ein Telegramm eingetroffen. Mit zitternden Beinen ging Jessie George Conrad nach oben zu ihrem leichenblassen Mann und fragte ihn nach der Quelle seiner Information, worauf dieser beleidigt erwiderte: »Darf ich etwa keine Vorahnungen haben, so wie du? Ich weiß, dass er tot ist!« Wenig später beruhigte sich Conrad jedoch und schlief ein. Mit seiner Vorahnung lag er zwar falsch, aber wenn die Phantasie mit ihm durchging, gab es offenbar kein Halten mehr. Stets stand er unter extremer Anspannung, was der Grund für seine kaum zu kontrollierende Reizbarkeit war, doch diese ließ, sobald wieder verflogen, keinerlei Spuren, ja nicht einmal Erinnerungen daran zurück. Während seine Frau mit ihrem Erstgeborenen, dem soeben erwähnten Borys, niederkam, drehte Conrad im Garten aufgeregt eine Runde nach der anderen. Plötzlich hörte er ein Kind plärren, worauf er entrüstet in die Küche stürmte und das damalige Hausmädchen anherrschte: »Tun Sie mir den Gefallen und schaffen Sie dieses Kind fort! Es stört Mrs. Conrad!« Doch dem Vernehmen nach schrie das Hausmädchen mit noch größerer Entrüstung zurück: »Das ist Ihr eigener Sohn, Mister!«
Conrad war so reizbar, dass er, wenn ihm der Füller zu Boden fiel, diesen nicht etwa sofort aufhob und weiterschrieb, sondern, gleichsam als Unmutsäußerung über den Zwischenfall, erst einmal mehrere Minuten lang ungehalten mit den Fingern auf den Tisch trommelte. Sein Wesen gab den Menschen in seinem Umfeld Rätsel auf. Mitunter führte seine innere Erregung dazu, dass er sich in hartnäckiges Schweigen hüllte und dies sogar in Gesellschaft von Freunden, die sodann geduldig abwarteten, bis er das Gespräch wieder aufnahm, wobei er übrigens ein höchst anregender Gesprächspartner und begnadeter Erzähler war, dessen Ton, wie besagte Freunde berichten, eher dem seiner Essaysammlung Spiegel der See als dem seiner Erzählungen oder Romane ähnelte. Meist kam ihm nach einer seiner schier endlosen Schweigephasen, während derer er über etwas nachzugrübeln schien, eine ungewöhnliche Frage über die Lippen, die nichts mit dem zu tun hatte, wovon bislang die Rede gewesen war, etwa: »Was haltet ihr eigentlich von Mussolini?«
Poesie mochte der Monokelträger Conrad nicht. Seiner Frau zufolge fanden zeitlebens lediglich zwei Gedichtbände Gnade vor seinen Augen, und zwar der eines jungen Franzosen, an dessen Namen sie sich nicht mehr erinnerte, und der seines Freundes Arthur Symons. Manche sagen, dass er Keats mochte und Shelley verabscheute. Der Autor jedoch, den er am meisten hasste, war Dostojewski. Er hasste ihn, weil er Russe und obendrein ein verrückter Wirrkopf war, und allein die Erwähnung seines Namens löste bei ihm einen Wutanfall aus. Bücher verschlang er geradezu, wobei Flaubert und Maupassant ganz oben auf der Liste seiner Favoriten standen, und die Prosa hatte es ihm so sehr angetan, dass er lange, bevor er der jungen Frau, die er später ehelichen sollte, einen Heiratsantrag machte (also zu einem Zeitpunkt, als zwischen ihnen noch keine große Vertrautheit herrschte), eines Abends mit einem Stapel Papier bei ihr aufkreuzte und ihr vorschlug, ihm ein paar Seiten aus seinem zweiten Roman vorzulesen. Jessie George kam seinem Wunsch gerührt, doch auch ängstlich nach, und der überaus nervöse Conrad machte es ihr alles andere als leicht: »Lass das weg«, sagte er zu ihr. »Das ist unwichtig. Fang drei Zeilen weiter unten an. Überspring die Seite, und die auch.« Ja, er rügte sie sogar wegen ihrer Aussprache: »Sprich klar und deutlich. Wenn du müde bist, sag es. Verschluck die Silben nicht. Ihr Engländer seid alle gleich, ihr macht bei allen Buchstaben dasselbe Geräusch.« Das Witzige daran ist, dass der so anspruchsvolle Conrad in der englischen Sprache, die er als Schriftsteller wie kein anderer seiner Zeit beherrschte, bis zum Ende seiner Tage einen starken ausländischen Akzent behielt.
Conrad heiratete erst mit achtunddreißig, und als er nach jahrelangem rein freundschaftlichem Umgang schließlich seinen Antrag machte, geriet dieser so pessimistisch wie einige seiner Erzählungen, denn er verkündete, er habe nicht mehr lange zu leben und nicht die geringste Absicht, Kinder in die Welt zu setzen. Der optimistische Teil folgte jedoch auf dem Fuße, denn er fügte hinzu, so, wie es um sein Leben bestellt sei, glaube er durchaus, dass Jessie und er ein paar glückliche Jahre miteinander verbringen könnten. Der Kommentar der Brautmutter nach dem Antrittsbesuch des Bewerbers fiel dementsprechend aus: Sie verstehe beim besten Willen nicht, warum dieser Mann heiraten wolle. Conrad entpuppte sich jedoch als aufmerksamer Ehemann: An Blumen fehlte es nie, und jedes Mal, wenn er ein Buch abschloss, machte er seiner Frau ein großzügiges Geschenk.
Obwohl er seine Eltern bereits in jungen Jahren verloren hatte und sich kaum an sie erinnern konnte, lagen ihm seine Herkunft und seine Vorfahren sehr am Herzen, und mehr als einmal äußerte er sein Bedauern darüber, dass sich ein unter dem Befehl Napoleons stehender Großonkel von ihm beim Rückzug aus Moskau, von Hunger geplagt, im Beisein zweier weiterer Offiziere auf Kosten eines armseligen litauischen Hundes einstweilige Linderung verschafft hatte. Dass einer seiner Ahnen Hundefleisch verzehrt hatte, empfand er als Schmach, für die er übrigens indirekt Bonaparte verantwortlich machte.
Conrad starb ziemlich unvermittelt am 3. August 1924 im Alter von sechsundsechzig Jahren in seinem Haus in Kent. Zwar hatte er sich tags zuvor unwohl gefühlt, doch nichts hatte seinen bevorstehenden Tod erahnen lassen. Deshalb befand sich Conrad, als dieser ihn ereilte, allein in seinem Zimmer, weil er ein wenig ruhen wollte. Seine Frau hörte ihn im Nebenzimmer »Hier …!« und noch ein zweites ersticktes Wort rufen, das sie jedoch nicht verstand, und gleich darauf vernahm sie ein Geräusch: Conrad war von seinem Sessel zu Boden gerutscht.
Ebenso wie er die litauische Episode im Leben seines Großonkels gern ungeschehen gemacht hätte, bestritt Conrad in seinen letzten Jahren, bestimmte Texte (Artikel, Erzählungen, in Zusammenarbeit mit Ford Madox Ford verfasste Kapitel) geschrieben zu haben, die jedoch zweifelsfrei von ihm waren und die er sogar unter seinem Namen veröffentlicht hatte. Trotzdem gab er vor, sich nicht an sie erinnern zu können, und leugnete seine Autorenschaft. Zeigte man ihm daraufhin Manuskripte und wies ihm nach, dass die fraglichen Seiten unbestreitbar aus seiner Feder stammten, zuckte er nur mit den Achseln – eine seiner charakteristischsten Gesten – und hüllte sich in sein typisches Schweigen. All jene, die mit ihm verkehrten, bescheinigten ihm einhellig, dass er ein sehr ironischer Mensch gewesen sei, doch sei seine Ironie von einer Art gewesen, für die seine Mitbürger in seiner Wahlheimat England nicht immer einen Sinn oder vielleicht Verständnis gehabt hätten.
Isak Dinesen im Alter
Isak Dinesen (Foto: Rie Nissen)
Isak Dinesen galt lange Zeit als geisterhafte, elegante und geheimnisumwitterte alte Dame, bis das Kino dieses Bild mit übertriebener Romantik durch das der etwas verzärtelten, duldsamen Kolonialherrin und Aristokratin ersetzte. Nicht, dass Baronin Blixen keine romantische und der Aristokratie zugetane Person gewesen wäre, doch richtiger ist wohl, dass sie diese Rolle nur spielte, zumindest seit sie Isak Dinesen war, also seit sie ihre Werke unter diesem und anderen Namen zu veröffentlichen begann und nach langen glücklosen Jahren in Afrika nach Dänemark zurückkehrte. »In Wirklichkeit tragen wir Masken, wenn wir älter werden, die Masken unseres Alters, aber die Jungen wissen nicht oder denken nicht daran, dass es Masken sind, wenn sie mit uns zusammen sind, glauben, dass wir sind, wie wir aussehen. Das sind wir ganz und gar nicht.«
Als sie 1959 zum ersten Mal nach Amerika kam, in das Land, in dem ihre Bücher den größten Erfolg und die meiste Anerkennung erfahren hatten, eilten ihrer Person unendlich viele Gerüchte und Geheimnisse voraus: Sie sei in Wirklichkeit ein Mann; er sei in Wahrheit eine Frau; Isak Dinesen seien zwei Menschen, nämlich Bruder und Schwester; Isak Dinesen habe 1870 in Boston gelebt; sie sei in Wirklichkeit Pariserin; sie lebe in Elsinore; sie verbringe die meiste Zeit in London; sie sei eine Nonne; er sei sehr gastfreundlich und empfange junge Schriftsteller; es sei schwierig, sie zu Gesicht zu bekommen, denn sie lebe wie eine Rekluse; sie schreibe auf Französisch; nein, auf Englisch; nein, auf Dänisch; nein, auf … Auf den unzähligen Festen, zu denen sie eingeladen wurde, und auf den öffentlichen Großveranstaltungen, bei denen sie ihre Erzählungen mit lebhafter Stimme vortrug, ohne ein Manuskript zu benötigen, war sie dann endlich zu sehen, und es stellte sich heraus, dass sie eine gebrechliche, extravagante und faltige alte Frau war, die Arme wie Streichhölzer hatte, sich schwarz kleidete, auf dem Kopf einen Turban, an den Ohren Diamanten und rund um die Augen dick aufgetragenen Lidstrich trug. Trotzdem lebte die Legende fort, doch nahm sie konkretere Züge an: Die Amerikaner behaupteten, Isak Dinesen ernähre sich ausschließlich von Austern und Champagner, was nicht stimmte, da sie sich gelegentlich auch Garnelen, Spargel, Weintrauben und Tee genehmigte. Als sie den Wunsch äußerte, Marilyn Monroe kennenzulernen, arrangierte die Romanschriftstellerin Carson McCullers eine Begegnung mit ihr, und bei dem mittlerweile berühmt gewordenen Mittagessen saßen die drei soeben erwähnten Frauen an einem Tisch mit Arthur Miller, dem Inbegriff des Ehemannes, der sich über die Essgewohnheiten der Baronin erstaunt zeigte und sich erkundigte, welcher Arzt ihr die aus Austern und Champagner bestehende Diät verordnet habe. Es heißt, noch nie sei in jenem Land ein so verächtlicher Blick gesehen worden wie der von Isak Dinesen. »Arzt?«, fragte sie zurück. »Die Ärzte sind entsetzt, aber ich liebe Champagner nun mal, und ich liebe Austern, und sie bekommen mir gut.« Miller verstieg sich anschließend noch zu einer Bemerkung über die Proteine, und ein so verachtungsvoller Blick wie der, den er damit wiederum erntete, ward auf amerikanischem Boden gewiss nicht so bald wieder gesehen. »Davon verstehe ich nichts«, lautete die Antwort, »aber ich bin alt, und ich esse, was ich will.« Mit Marilyn Monroe verstand sich die Baronin weitaus besser.
Tatsache ist, dass Isak Dinesen gewöhnlich im dänischen Rungstedlund in ihrem Elternhaus wohnte, wo sie ein sehr sesshaftes Dasein führte, nicht zuletzt ihrer diversen Gebrechen wegen, deren ältestes ihr stets präsent war und nichts mit dem Alter zu tun hatte, nämlich die Syphilis: Sie hatte sie sich im Jahr ihrer Eheschließung mit Baron Bror Blixen zugezogen, von dem sie sich beizeiten, wenn auch nach einigem Hin und Her, wieder scheiden ließ. Ihr Gatte war der Zwillingsbruder des Mannes, den sie in ihrer frühen Jugend geliebt hatte, und vielleicht sind die über eine Mittelsperson geknüpften Bande von allen am schwierigsten zu entflechten.