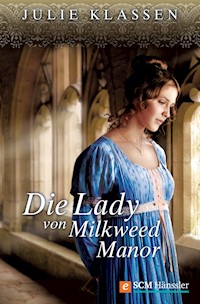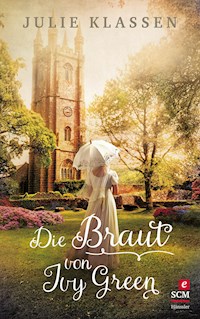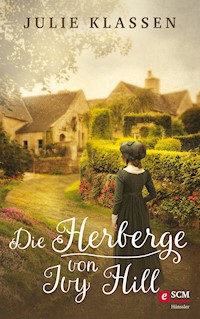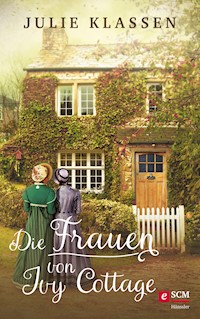Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: SCM HänsslerHörbuch-Herausgeber: Hänssler
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Regency-Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Roman über Heimat, Verlust und Wiedergewinn. Und die große Liebe. Cornwall 1813. Nach einem Schiffsunglück spült das Meer Überlebende an die Küste. Laura pflegt einen der Männer, Alexander, gesund - doch als sie bei den Überresten des Schiffes die Jacke eines französischen Kapitäns findet, stellt sie fest, dass Alexander nicht der ist, der er vorgibt zu sein. Bald ist klar: Noch immer befindet er sich in großer Gefahr. Als auch noch ihre eigene Vergangenheit und die Wahrheit über das Schicksal ihrer Eltern auf dem Spiel stehen, muss sie sich fragen: Wie weit wird sie gehen, um dem mysteriösen Mann zu helfen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
SCM Hänssler ist ein Imprint der SCM Verlagsgruppe, die zur Stiftung Christliche Medien gehört, einer gemeinnützigen Stiftung, die sich für die Förderung und Verbreitung christlicher Bücher, Zeitschriften, Filme und Musik einsetzt.
»Das vorliegende Buch ist ein historischer Roman, der natürlich auch vor einer gewissen historischen Kulisse spielt. Die auftretenden Personen entstammen jedoch der Fantasie der Autorin, und jedwede Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen ist rein zufällig und nicht beabsichtigt.«
ISBN 978-3-7751-7545-6 (E-Book)
ISBN 978-3-7751-6120-6 (lieferbare Buchausgabe)
Datenkonvertierung E-Book: Satz: Satz & Medien Wieser, Aachen
© der deutschen Ausgabe 2022
SCM Hänssler in der SCM Verlagsgruppe GmbH
Max-Eyth-Straße 41 · 71088 Holzgerlingen
Internet: www.scm-haenssler.de; E-Mail: [email protected]
Originally published in English under the title: A Castaway in Cornwall by Bethany House Publishers, a division of Baker Publishing Group, Grand Rapids, Michigan, 49516, U.S.A. All rights reserved. © 2020 by Julie Klassen.
Die Bibelverse sind folgender Ausgabe entnommen:
Neues Leben. Die Bibel, © der deutschen Ausgabe 2002 und 2006
SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH Witten/Holzgerlingen.
Alle Zitate im Buch wurden von der Übersetzerin ins Deutsche übertragen bis auf: »Warum wühlen wir dann die Vendée und die Bretagne auf? Warum setzen wir Frankreich in Brand?« (Honoré de Balzac: Die Chouans. Rebellen des Königs, Frankfurt a. M.: Insel Verlag 1996, 1. Aufl., S. 110)
Übersetzung: SuNSiDe
Lektorat: Anne-Julia Haupt, www.hauptlektorat.de
Cover design: Jennifer Parker.
Cover photography: Mike Habermann Photography, LLC.
Umschlaggestaltung: Stephan Schulze, Holzgerlingen
Titelbild: Baker Book House Company
Satz: Satz & Medien Wieser, Aachen
Für Marietta und Ted Terry,
Kämpfer im Gebet und Freunde,
in Liebe und Dankbarkeit.
Bei schwerem Wetter erlitten gestern drei Schiffe bei Trebetherick Point Schiffbruch. Sie sind in den Wellen zerschellt.
The West Briton, Februar 1818
Am Himmel stand finsterste Nacht,
darunter das brüllende Meer.
Es packte mich des Schicksals Übermacht
und mein Platz an Deck war leer.
Verloren, was Halt und Hoffnung gab,
von der schwimmenden Heimat ins Wellengrab?
William Cowper, The Castaway
Oder nehmt einmal an, eine Frau hätte zehn Drachmen und würde eine verlieren. Würde sie nicht eine Lampe anzünden und das ganze Haus auf den Kopf stellen, bis sie sie gefunden hätte? Und wenn sie sie gefunden hätte, würde sie nicht ihre Freundinnen und Nachbarinnen rufen, damit sie sich mit ihr freuen, dass sie ihre verlorene Münze wiedergefunden hat?
Lukas 15,8-9
Inhalt
Über die Autorin
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Epilog
Nachwort
Leseempfehlungen
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Über die Autorin
JULIE KLASSEN arbeitete 16 Jahre lang als Lektorin für Belletristik. Mittlerweile hat sie zahlreiche Romane geschrieben, von denen mehrere den begehrten Christy Award gewannen. Abgesehen vom Schreiben, liebt sie das Reisen und Wandern. Mit ihrem Mann und zwei Söhnen lebt sie in Minnesota, USA.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Prolog
Oktober 1813Nord-Cornwall, England
Treibgut oder Strandgut?
Laut Dr. Johnson’s Dictionary, dem dicken, alten Folianten im Arbeitszimmer meines Onkels, ist Treibgut alles, was auf dem Meer an der Stelle treibt, an der ein Schiff gesunken ist oder Schiffbruch erlitten hat. Dagegen ist Strandgut all das, was bei Seenot mit Absicht über Bord geworfen wird, um das Schiff durch das Abwerfen von Ballast leichter zu machen und so vielleicht zu retten.
Fast täglich wandere ich am Ufer entlang und suche nach dem einen oder dem anderen. Ich gehe oder springe von Fels zu Fels, vom Strand zur Düne hoch. Dort halte ich beharrlich Ausschau, den Blick nicht auf den unendlichen Horizont oder den Himmel gerichtet, sondern auf den Boden vor meinen Füßen. Dann wandere ich weiter den Strand entlang, über zerklüftete Felsen, trügerischen Sand und Schieferschelf, ohne zu zögern, ohne einen einzigen Fehltritt.
Und während ich gehe, umgibt mich die Melodie der See. Es ist kein Brüllen, sondern ein rhythmisches Rauschen, ein Summen des Wassers, wie ein vibrierender Akkord – gleich einem raschen Herzschlag. Der Atlantik rollt heran und schlägt rhythmisch gegen die Felsen, begleitet vom melancholischen Schrei der Möwen.
Sogar jetzt, da die Herbstkälte sich allmählich über alles legt, wachsen auf den kahlen Felsen zarte Blumen. Sie sind so fein und doch vollkommen unbeirrbar, ja unbeugsam. Hier zeigt sich Schönheit inmitten von äußerster Kargheit, Leben, wo eigentlich nichts gedeihen kann.
Kann ich dasselbe von mir behaupten? Blühe und gedeihe ich? Oder überlebe ich nur?
Manchmal frage ich mich, was mich hierher nach Cornwall verschlagen hat, so fern vom Zuhause meiner Kindheit. Ich fühle mich wie eine Schiffbrüchige, die durch den Tod der Eltern dem Auf und Ab der Gezeiten ausgesetzt wurde. Immer bin ich auf der Suche nach Antworten. Steht ein Plan hinter allem, was mir widerfahren ist? Hält Gott mein Schicksal in seinen Händen oder ist mein ganzes Leben nur das Ergebnis des Auf und Ab des Schicksals?
Ich gehöre nicht hierher und bin doch hier, angeschwemmt an die fremde Küste mit ihrer seltsamen, fremden Art. Hier betrachten sie jeden, der nicht in Cornwall geboren und aufgewachsen ist, mit Argwohn. Man bleibt ein ewiger Fremder. Acht meiner dreiundzwanzig Jahre lebe ich nun schon hier und gehöre doch noch immer nicht zu ihnen. Und manchmal denke ich, dass ich niemals mehr irgendwo hingehören werde.
Ich stehe auf einem Felsen, der Wind zerrt an meiner Haube und wieder einmal frage ich mich: Bin ich Treibgut oder Strandgut?
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Letzten Montag erlitt der Zweimaster Star of Dundee in der Nähe von Padstow Schiffbruch. Die fünfköpfige Mannschaft konnte sich ins Beiboot retten, das jedoch kurz darauf kenterte. Mit großer Trauer müssen wir vermelden, dass die gesamte Mannschaft ertrunken ist.
The West Briton, November 1811
1
»Laura!« Die einundzwanzigjährige Eseld stand auf dem oberhalb des Strandes verlaufenden Küstenpfad und rief sie. »Mama ist ärgerlich. Du sollst sofort nach Hause kommen. Du hast schon wieder irgendetwas in Wennas bestem Topf liegen gelassen und da fault es jetzt vor sich hin.«
Lauras Herz machte einen erschrockenen Satz. Wie hatte sie das nur vergessen können? Sie rief zurück: »Ich habe eine lederne Geldbörse eingeweicht, die ich gefunden habe. Mit der richtigen Behandlung wäre sie noch zu retten.«
»Für Mama ist die einzig gute Börse eine volle Börse. Das weißt du doch. Jetzt komm schon! Ich will nicht, dass sie auch noch auf mich ärgerlich wird.«
Laura seufzte und nahm ihren Korb. »Ich komme ja schon.«
Nebeneinander trotteten sie auf dem Fußweg nach Fern Haven, ihrem Zuhause. Eseld meinte vorwurfsvoll: »Ich weiß gar nicht, warum du jeden Tag hier rausgehst. Wenn du mal Gold oder irgendwas Wertvolles finden würdest, das wir verkaufen können, könnte ich es ja noch verstehen, aber so …«
Laura erinnerte sie nicht daran, dass sie tatsächlich schon mehrere kleine Sachen an den Antiquitäten- und Kuriositätenhändler in Padstow verkauft hatte. Sie hatte zwar kein Vermögen damit verdient, aber doch zu ihrem Unterhalt beigetragen und sogar angefangen, für eine Reise zu sparen, von der sie schon lange träumte.
Doch bevor sie irgendeine ihrer Fundsachen verkaufte, fühlte Laura sich verpflichtet, die vorgeschriebene Zeit, ein Jahr und einen Tag, zu warten, falls sich der Eigentümer doch noch melden und sein Eigentum zurückverlangen sollte. Eseld konnte nur den Kopf über diese Vorsicht schütteln und hielt ihr stets das Sprichwort entgegen: Was der Zoll nicht weiß, macht ihn nicht heiß.
Sogar Onkel Matthew, ein sanftmütiger Geistlicher, sah kein Unrecht darin, sich etwas anzueignen, das bei Fern Haven an den Strand gespült wurde. »Das ist eine Gabe von Gott, meine Kleine, das hat nichts mit Stehlen zu tun«, pflegte er zu sagen. »Die Kisten und Fässer kommen zu uns. Es sind Gaben vom Geber alles Guten.«
Zwischen dem heimtückischen Trevose Head, Stepper Point, Doom Bar und den Felsen vor Greenaway Beach, dem Strand vor ihrer Haustür, waren Schiffbrüche keine Seltenheit, bei denen regelmäßig Schiffe untergingen und viele Menschen starben. Von Trebetherick Point aus, ganz nah bei ihrem Haus, konnte Laura auf die Felsen hinunterblicken. Wie oft sah sie dann Wrackteile eines Schiffs, halb im Sand begraben wie Kadaver oder wie Wirbelsäule und Rippen riesiger altertümlicher Vögel. Viele Häuser hier waren aus geborgenem Schiffsgebälk erbaut.
Jetzt hatten sie Fern Haven erreicht, ein hübsches zweistöckiges, weiß getünchtes Haus mit Schieferdach und Mansardenfenstern. Sie gingen durchs Tor – auch das war aus geborgenen Schiffsplanken erbaut – und stiegen die wenigen Stufen zur überdachten Veranda hinauf.
»Putz dir die Schuhe ab«, ermahnte Eseld sie und klang dabei ganz wie ihre herrische Mutter.
Laura gehorchte und streifte den gröbsten Sand und Seetang von ihren abgetragenen Halbstiefeln.
Von drinnen hörten sie Stimmen. Zuerst sprach Eselds Mutter, Mrs Bray: »Vielen Dank für die freundliche Einladung, Mr Kent. Mr Bray und ich und Miss Eseld kommen gern zum Abendessen.«
Eine leise männliche Stimme erwiderte etwas. Laura meinte, ihren Namen herauszuhören.
»Nein, ich glaube nicht, dass Laura mitkommen will«, antwortete Mrs Bray. »Sie mag solche Familientreffen nicht, weil sie nicht zu uns gehört. Außerdem glaube ich, dass sie sich erkältet hat. Lassen wir sie lieber zu Hause, zumal es doch recht kalt geworden ist.«
Eseld verdrehte die Augen, warf Laura einen verschmitzten Blick zu und stieß die Tür auf. »Wir sind wieder da-ha, liebste Mama!« Sie blinzelte Laura zu und trat in das bescheidene Wohnzimmer, wo Mrs Bray mit zwei männlichen Besuchern plauderte, dem höchstattraktiven, goldhaarigen Treeve Kent und seinem jüngeren Bruder Perry.
»Da bist du ja, Eseld«, sagte Lamorna Bray mit einem Lächeln, das jedoch sofort erlosch, als sie sich an Laura wandte. »Laura, Kind, du siehst ja furchtbar aus. Dein Gesicht ist fast so rot wie dein zerzaustes Haar. Bist du wieder am Strand herumgestreift?«
»Ich, äh, ja.«
»Warum treibst du dich auch immer dort herum? Du siehst völlig verwildert aus – richtig schlampig!«
Laura spürte, wie sie rot wurde, doch Treeve Kent lächelte sie an. »Aber nein, Madam, ich finde im Gegenteil, dass ihre Augen und ihre Haut durch die Bewegung an der frischen Luft leuchten und ihr Haar sieht in meinen Augen überaus vorteilhaft aus.«
Ihr attraktiver Nachbar machte sich lustig über sie, dachte Laura. So musste es sein.
»Verzeihen Sie«, antwortete sie. »Ich wusste nicht, dass wir Besuch erwarten.«
»Wir sind unangekündigt gekommen«, gestand Treeve. »Unverzeihlich in den Augen einer Städterin, nehme ich an.«
Laura blinzelte. »Ich … ich weiß nicht.« Als Kind hatte sie in Oxford gelebt, nicht in London, doch die Cornwaller Jugend bezeichnete sie häufig als Festlandfratz oder Stadtpflanze, was durchaus als Beleidigung gemeint war.
Treeve wandte sich an seinen kleineren, zurückhaltenden Bruder. »Apropos Manieren, ich weiß nicht, ob Sie meinen Bruder Perran schon kennen. Er war fast die ganze Zeit, die Sie jetzt hier sind, nicht da. Er war auf der Universität und zur weiteren Ausbildung im Guy’s Hospital.«
Das Guy’s Hospital war, soweit Laura wusste, ein Londoner Lehrkrankenhaus. Ihr Vater war ebenfalls dort gewesen.
»Wir sind uns schon begegnet«, antwortete Laura, »aber er wird sich wohl kaum an mich erinnern.«
Der dunkelhaarige Mann lächelte sie schüchtern an. »Doch, ich erinnere mich an Sie, Miss Laura.«
»Und was ist mit mir?«, fragte Eseld und schüttelte kokett die blonden Locken, die ihr Gesicht höchst schmeichelhaft umrahmten.
»Natürlich erinnere ich mich auch an Sie, Miss Eseld.« Perry verbeugte sich.
Eseld lächelte ihr Grübchenlächeln und knickste.
Treeve fuhr fort: »Wir wollten Sie zum Abendessen einladen. Sie alle.«
Darauf folgte ein Augenblick verlegenen Schweigens, untermalt vom Ticken der großen Standuhr. Mrs Bray sagte nichts, sie schaute Laura nicht einmal an. Doch diese sah an ihrem verkniffenen Profil, dass sie verärgert war. Wahrscheinlich erwartete sie, dass Laura die Gelegenheit ergriff, sich über ihre Wünsche hinwegsetzte und an dem Essen bei einer der vornehmsten Familien der Gegend teilnahm. Doch Laura wusste nur allzu gut, dass Mrs Bray genau das unter allen Umständen verhindern wollte.
Deshalb antwortete sie: »Vielen Dank, Mr Kent, aber ich muss leider ablehnen. Ich spüre eine Erkältung kommen und nun hat auch noch das Wetter umgeschlagen. Es ist sehr kalt geworden.«
Treeves Augen glitzerten wissend. »Soweit ich es beurteilen kann, sind Sie bei bester Gesundheit.« Er wandte sich an seinen Bruder. »Was meinst du, Perran? Du bist der Arzt.«
»Ich kenne Miss Brays …«
»Miss Callaway«, unterbrach die ältere Frau ihn eilends. »Laura ist die Nichte meines Mannes. Verwandtschaft aus seiner ersten Ehe.«
»Ah, richtig. Das hatte ich vergessen.« Perry wand sich verlegen. Er war ganz rot geworden.
»Das macht doch nichts«, beschwichtigte ihn Eseld. »Das ist ein sehr naheliegendes Missverständnis. Außerdem ist Laura ja praktisch meine Cousine, nachdem wir jetzt schon so viele Jahre zusammenleben.«
Laura spürte, wie bei Eselds Worten beinahe Dankbarkeit in ihr aufstieg. Wahrscheinlich hatte sie sie nur gesagt, weil ihr an Treeve Kents guter Meinung gelegen war, aber Laura musste ihr zugestehen, dass sie sie eigentlich immer wie eine Cousine behandelt hatte und nicht wie unwillkommenen Familienzuwachs.
Denn wie Mrs Bray ganz richtig gesagt hatte, gehörte Laura tatsächlich nicht zur Familie. Sie war keine Blutsverwandte der anderen. Wenn Matthew Bray nach dem Tod ihrer Eltern und ihrer Tante nicht ihre Vormundschaft übernommen hätte, stünde sie jetzt ganz allein in der Welt.
Eseld und ihre Mutter kleideten sich für das Essen in Roserrow, dem Haus der Kents, an, und Laura half Wenna in der Küche. Das war die Strafe dafür, dass sie den Lieblingstopf der älteren Frau, die in Fern Haven Köchin und Haushälterin in Personalunion war, zum Reinigen ihrer Fundsachen benutzt hatte.
Jetzt klopfte Onkel Matthew an den Türrahmen und bat Laura in sein Arbeitszimmer. Er sah sie mit leicht gequälter Miene an und meinte: »Es tut mir so leid, mein Mädchen. Ich weiß, dass du auch gern einmal ausgegangen wärst. Du kommst viel zu wenig unter Leute.«
»Schon gut, es macht mir nichts aus. Ich werde stattdessen Miss Chegwin besuchen.«
Er sah sie beschämt an. »Ich habe dabei nicht an die Gesellschaft einer Frau in den Siebzigern gedacht.«
Sie streckte die Hände aus und richtete die Krawatte ihres Onkels. Dabei fielen ihr wieder einmal seine weicher gewordene Kinnlinie, die silbergesprenkelten Koteletten und die gütigen, immer ein wenig blutunterlaufenen Augen auf. Der Verlust, den er erlitten hatte, hatte ihn vor der Zeit altern lassen. Sie rückte den Kragen seines Überrocks zurecht und sagte: »Knöpf den Mantel zu. Es ist eine stürmische Nacht.«
»Ja, der Wind frischt auf. Wenn mich nicht alles täuscht, werde ich noch heute Nacht Tregeagle hören, der um seine verlorene Seele klagt …« Er räusperte sich. »Natürlich nur, wenn ich an solche Dinge glauben würde, was ich als Gelehrter und Mann Gottes nicht tue.« Er zwinkerte ihr zu. »Jedenfalls meistens nicht.«
Das war eine Anspielung auf die Legende von dem bösen Mann, der seine Seele verkauft hatte und seither über die Strände und durch die Moore wanderte und sein Schicksal beklagte. Wenn es richtig stürmisch war, klang das Heulen des Windes tatsächlich menschlich, geradezu ergreifend menschlich. In Cornwall, hatte Laura gelernt, gab es viele solcher Mythen, doch die tobenden Winde und todbringenden Stürme waren nur allzu real.
»Wenn Mrs Bray sich nicht in den Kopf gesetzt hätte, dass Eseld Mr Kent heiraten muss, würde ich mich liebend gern für heute Abend entschuldigen«, fuhr er fort, »aber davon will sie nichts hören. Ich kann nur hoffen, dass wir es nicht bereuen.«
»Sei vorsichtig«, bat Laura ihn. Onkel Matthew war, wenn man so wollte, alles, was sie noch an Familie besaß, und sie wollte ihn nicht auch noch verlieren.
»Das sind wir.« Er tätschelte ihre Hand und nahm seinen Hut, drehte sich aber noch einmal zu ihr um. »Wenn du heute Abend rausgehst, nimm Wenna oder Newlyn mit. Der Gedanke, dass du in einer solchen Nacht alleine draußen bist, gefällt mir gar nicht. Es ist nicht sicher.«
»Aber ich kann Miss Chegwins Cottage von hier aus sehen«, protestierte Laura.
»Bitte. Mir zuliebe, ja?«
»Na gut, aber Newlyn muss reichen. Ich traue mich nicht, Wenna zu fragen. Sie ist immer noch ärgerlich wegen ihres Topfs.«
»Sie ist doch laufend ärgerlich wegen irgendetwas.« Er lächelte. »Nur gut, dass sie eine so ausgezeichnete Köchin ist.«
Laura betrat das Brea Cottage wie immer, ohne zu klopfen. Ihre Nachbarin hatte schon vor langer Zeit gesagt, sie solle ihr Haus als ihr Zuhause betrachten. Außerdem hätte Miss Chegwin ein Klopfen in dem heftigen Heulen und Tosen des Windes gar nicht gehört.
Die kleine, unscheinbare Newlyn ließ sich entschlossen auf der kleinen Bank auf der Veranda nieder und weigerte sich, auch nur einen Schritt weiterzugehen.
»Du kannst mit reinkommen, das weißt du doch«, sagte Laura. »Sie beißt nicht.«
»Nein, aber Jago vielleicht.« Das siebzehnjährige Hausmädchen schauderte.
»Sei nicht albern. Er ist völlig harmlos.«
»Das ist mir egal. Ich warte hier.«
»Nun gut, wie du willst.«
Laura trat in das Wohnzimmer. Die alte Frau, die im Sessel saß, blickte auf. Bei Lauras Anblick strahlte ihr zerfurchtes Gesicht vor Freude.
»Guten Abend, mein Liebling. Wie geht es dir?«
»Sehr gut, Mamm-wynn.« Laura nannte sie Großmutter, aus Zuneigung und Respekt und weil sie wusste, dass es sie freute.
Mary Chegwin lächelte. Dabei wurden die scharfen Linien unter ihrem weißen Haar weich. »Meur ras, mein Liebling. Aber was führt dich in einer so abscheulichen Nacht nach draußen?«
»Ich wollte Sie besuchen. Die anderen sind nach Roserrow gegangen.« Sie sah sich in dem bescheidenen Wohnzimmer um. »Wo ist Jago?«
»Draußen, er sucht Feuerholz.« Es gab kaum Bäume hier in der Gegend und Feuerholz war teuer.
»Ah ja.« Laura setzte sich neben das Feuer, das am Verglühen war, und wickelte sich fester in ihren Umhang.
Die Frau beobachtete sie. »Und du wolltest nicht mit nach Roserrow?«
»Ich … ich wollte lieber zu Ihnen.«
Die blauen Augen, noch immer klar und scharf, glitzerten wissend, doch Miss Chegwin bedrängte sie nicht weiter.
»Ich habe Ihnen etwas mitgebracht.« Laura streckte die Hand aus.
»Was denn?«
»Ein Geldbörse. Sehen Sie die Stickerei?«
Die alte Frau blinzelte. »Sehr hübsch. Wenn ich nur auch einen Viertelpenny hätte, den ich hineintun könnte!« Mary kicherte wie ein junges Mädchen. »Hast du sie heute gefunden?«
»Nein. Die von heute ist noch nass. Diese hier habe ich vor einem Jahr und einem Tag gefunden.«
Mary schenkte ihr ein schiefes Lächeln. »Du musst unbedingt an deiner Überkorrektheit arbeiten, wenn jemals ein kornisches Mädchen aus dir werden soll.«
»Wenn mir das bis jetzt nicht gelungen ist, werde ich es wohl nie werden.«
»Nun, es gibt Schlimmeres, auch wenn mir im Moment nichts einfällt.« Sie kicherte wieder.
»Hier, ein Stück Kuchen habe ich Ihnen auch mitgebracht.« Laura reichte ihr ein in eine Serviette eingeschlagenes Päckchen.
Marys Augen wurden groß. »Wenna schickt mir Kuchen?«
»Nein, ich habe mein Stück für Sie aufgehoben.«
»Ich kann dir doch nicht deinen Kuchen wegessen!«
»Natürlich können Sie das. Sie mögen ihn lieber als ich. Aber er wird Sie auch etwas kosten.«
Marys struppige Brauen hoben sich. »Ach ja?«
»Eine Geschichte.«
Die blauen Augen funkelten fröhlich. »Die Geschichte vom Fluch der Jungfrau habe ich dir schon erzählt, aber kennst du auch die von den neidischen Piskies?«
Laura schüttelte den Kopf. Sie war begierig, sie zu hören.
Die alte Frau wickelte den Kuchen aus, biss ein Stückchen ab und begann mit ihrer Geschichte: »Eines Nachts, im Erntemond, erblickte der Kapitän eines Schoners mit Namen Sprite Lichter, die auf dem Wasser tanzten, und folgte ihnen. Es war sein Untergang. Denn weißt du, die garstigen Piskies waren auf die schöne Galionsfigur des Schiffs neidisch gewesen. Sie hatten ein großes Glas voller Glühwürmchen gesammelt und lockten die ahnungslosen Seeleute damit zum Doom Bar. Als der Morgen dämmerte, waren alle Seeleute ertrunken. Alles, was von ihrem Schiff übrig blieb, war die Galionsfigur. Doch zerkratzt und zerschrammt von den Felsen hatte sie all ihre Schönheit eingebüßt. Jetzt steht sie auf dem Grab derer, die mit der glücklosen Sprite untergingen.«
Als Mary geendet hatte, fragte Laura: »Ist das alles eigentlich wahr?«
»Natürlich ist es wahr! Hast du denn nicht das Grab an der Küste gesehen?«
Doch, Laura hatte es gesehen. Aber wie bei den meisten von Marys Geschichten war auch in dieser ein großzügiger Teil Fantasie mit den Fakten verwoben.
Laura erhob sich und setzte den Kessel auf. Etwas später, erfrischt von Tee und dem Kuchen, den sie sich geteilt hatten, bettelte sie: »Noch eine!«
Mary lächelte. »Was soll’s denn diesmal sein? Schmuggler? Piraten? Schiffbrüche?«
Laura nickte. »Ja, bitte. Von allen dreien etwas.«
Unter dem Lärmen des Windes, der immer stärker wurde, begann Mary eine weitere Geschichte.
»Eines Nachts wurde ein großer Dreimaster unter Trevose Head angetrieben. Das Schiff hatte alle Arten Kriegsgerät geladen, Musketen, Bajonette, Enterbeile und dergleichen mehr. Doch von der Besatzung waren lediglich drei Mann übrig. Niemand wusste, woher sie kamen.« Mary beugte sich vor und fuhr mit unheilvoller Flüsterstimme fort: »Man nahm an, dass sie Piraten waren und …«
Die Hintertür flog krachend auf und Laura fuhr erschrocken zusammen. Jago kam mit einer großen Ladung Treibholz im Arm herein.
»Meur ras, Jago«, sagte Mary. »Schließ doch bitte gleich wieder die Tür, es nieselt. Ich spüre die Feuchtigkeit bis hierher.«
Der große, breitschultrige junge Mann ließ das Holz vor dem Kamin fallen, ging zurück in die Küche und schloss die Tür. Dann kam er wieder herein und bückte sich, um das Feuer anzufachen.
»Begrüße unsere Freundin Laura«, soufflierte Mary.
Der große Mann mit dem ausgeprägten Kinn und der hohen Stirn blickte schüchtern in ihre Richtung. »’n Abend, unsere Laura.«
Manche behaupteten, Jago sei mit den alten kornischen Riesen verwandt. Andere, wie Newlyn, hatten Angst vor ihm, weil er so groß war, und noch andere machten sich über ihn lustig und hielten ihn für schwer von Begriff, weil er außer mit seinen Freunden mit niemandem ein Wort sprach. Doch Laura kannte ihn gut und wusste, dass er sanftmütig und nachdenklich war.
Sie lächelte ihn an. »Guten Abend, Jago.«
»Dein Abendessen steht auf dem Herd«, sagte Mary.
Er nickte und ging zu Küche. Bei der Tür musste er den Kopf einziehen, um nicht oben am Rahmen anzustoßen.
»Tut mir leid«, meinte Laura. »Habe ich euch beim Essen gestört?«
»Aber nein. Ich habe schon gegessen, als Jago draußen war. Er hat länger als sonst gebraucht, genügend Holz für die Nacht zu finden.« Sie wickelte sich fester in ihren Schal. »Es wird ein langer Winter werden dieses Jahr. Gott sei Dank habe ich Jago.«
Laura wusste, dass Jago nicht Miss Chegwins Sohn war. Mary hatte viele Jahre als Hebamme gearbeitet. Sie selbst hatte nie geheiratet und auch keine eigenen Kinder bekommen. Jago war ein Findelkind. Er war als Säugling auf dem Friedhof ausgesetzt worden.
Sie hatte es Laura einmal erzählt: »Ich weiß nicht, warum seine Mutter ihn verlassen hat. Vielleicht war sie nicht verheiratet und hatte Angst. Dr. Dawe meinte, dass ich nur meine Zeit verschwende und dass der Junge zu klein und schwach sei und nicht überleben würde. Er wäre nie auf den Gedanken gekommen, dass er stark und kräftig werden könnte. Umso mehr Spaß macht es mir, sonntags in der Kirche mit meinem großen, kerngesunden Jungen an ihm vorbeizuspazieren.«
Aus der Küche hatten sie anfangs nur das Geräusch einer über einen Teller kratzenden Gabel gehört, jetzt drang eine festliche Melodie herüber. Jago spielte seine Drehleier. Die Musik holte Laura in die Gegenwart zurück. Der Wind rüttelte heftig an den Fensterläden, die ersten Regentropfen schlugen gegen die Scheiben.
Sie stand auf. »Können Sie mir die Geschichte ein anderes Mal fertigerzählen? Newlyn und ich sollten lieber gehen, bevor der Regen noch schlimmer wird.«
Mary nickte. »Meur ras für deinen Besuch und den Kuchen. Nos dha.«
»Nos dha, gute Nacht«, wiederholte Laura. Sie verstand Kornisch besser, als sie es sprach, aber ihre Fähigkeiten waren in beidem beschränkt.
Draußen wickelte Laura sich fester in ihren Umhang, zum Schutz gegen den beißenden Wind. Die beiden Mädchen brachen auf. Newlyn schimpfte vor sich hin und hielt ihre Haube fest. Ein Windstoß heulte auf. Es klang wie ein geisterhaftes Klagen. Laura schauderte nicht nur vor Kälte.
»Das ist Tregeagle, Miss. Ich weiß es!«, schrie Newlyn. »Wir sind verloren!«
»Wir sind nicht verloren«, versicherte Laura ihr. Leider galt das inzwischen aber wohl für jedes Schiff, das sich jetzt noch auf dem offenen Meer befand, dachte sie. Offenbar war einer der gefürchteten Nordweststürme aufgekommen. In der Ferne hörte sie einen Gewehrschuss. Eine Stimme rief: »Schiff, ho!«
Newlyn packte Lauras Hand. »Das ist mein Vater.«
Häufig versuchten in Seenot geratene Schiffe den Hafen von Padstow zu erreichen, um Schutz vor dem Sturm zu finden. Dabei strandeten die meisten auf der Sandbank Doom Bar, worauf sie entweder in den erbarmungslosen Brechern oder an den Felsen von Greenaway Rocks zerschellten.
Laura rannte hinunter zum Trebetherick Point, Newlyn folgte ihr zögernd. Von dem Aussichtspunkt aus spähte Laura über das aufgewühlte Wasser. Vor den Felsen draußen war ein dunkler Schatten zu erkennen. Durch die Gischt konnte man zwar kaum etwas sehen, doch es schien ein Schiff zu sein, das von den Wellen hin- und hergeworfen wurde.
Lauras Magen hatte sich zusammengezogen, ihr Herz klopfte wild, in einer Mischung aus Angst und Entschlossenheit. »Komm. Wir gehen zum Strand.«
»Aber … Miss … ich glaube nicht, dass Ihr Onkel …«
»Doch. Komm.«
Laura drehte sich um und lief den schmalen Pfad hinunter. Mehrmals rutschte sie auf dem nassen Sand aus und stolperte an einem Kaninchenbau, doch sie fing sich jedes Mal wieder.
Unten am Strand hatte sich bereits eine kleine Gruppe eingefunden. Die Leute standen dicht beieinander und warteten, hielten Ausschau, hofften.
Von hier aus konnte sie das Schiff deutlicher sehen. Durch die Regenschleier drang schwach das Mondlicht, Blitze zuckten über den Himmel und warfen kurzzeitig helle Lichter auf das Schiff. Es mühte sich ein paar hundert Meter vor dem Strand in den hohen Wellen. Seine Segel hingen in Fetzen. Es wurde vor- und zurückgeworfen und hatte Schlagseite. Offensichtlich hatte es auf den Felsen aufgesetzt, und wenn es sich nicht bald hob, würden die Wellen es in Stücke reißen. Laura hatte das schon mehrmals beobachtet.
Newlyn sah einen stämmigen Fischer ganz in der Nähe. Sie lief zu ihm und griff nach seinem Arm. »Oh, Pa!«
»Ganz ruhig, mein Mädchen.«
Die meisten ortsansässigen Männer waren Fischer, wie Mr Dyer, oder Bootsbauer. Oder sie arbeiteten auf den Schaluppen, mit denen Schiffe beladen und entladen wurden, die in Padstow Handel trieben. Manche arbeiteten auch in den hiesigen Schiefer- oder Bleiminen.
Laura sah, wie zwei winzige menschliche Gestalten an Deck des Schiffes Kisten und Fässer über Bord warfen. Eine schmale Person kletterte auf der Flucht vor dem steigenden Wasser behände in die Takelage. Doch plötzlich ging eine riesige Welle über das Schiff hinweg, riss sie von der Toppsegelrahe und schleuderte sie ins Meer. Sie tauchte nicht wieder auf.
Hatte die Mannschaft die Boote zu Wasser gelassen oder hatte die See sie vorher losgerissen? Gab es Hoffnung für sie? Nur wenige, wusste Laura, konnten schwimmen, und selbst wenn, würden die Wellen und Felsen sie zermalmen, bevor sie den Strand erreichten.
»Lieber Herr Jesus, hilf ihnen«, rief Laura.
Wenn sie doch nur irgendetwas tun könnte! Wenn nur irgendjemand etwas tun könnte!
Die Gemeinde hier besaß kein Rettungsgerät und auch keine Rettungsboote. Oft fuhren mit erfahrenen Lotsen bemannte kornische Gigs zu den Schiffbrüchigen hinaus. Die Größe dieser wendigen Ruderboote erlaubte es, sie auch durch Untiefen zu steuern, sodass sie hin und wieder tatsächlich bis zu den Opfern vordringen konnten. Warum unternahmen die Lotsen heute nichts? War das Risiko in der aufgewühlten See zu groß? Schon viele hatten in der Vergangenheit ihren Mut mit dem Leben bezahlt. Oder hatten sie die Schreie nicht gehört? Die Schüsse des in Seenot geratenen Schiffs?
Als könnte er Lauras Gedanken lesen, sah John Dyer sich um. »Wo bleiben die verdammten Lotsen?«, brüllte er. Dann schrie er einer Gruppe Männer, die in der Nähe herumlungerten, zu: »Kommt, Jungs, wir versuchen, sie rauszuholen.«
»Pa, nein«, bettelte Newlyn. »Es ist zu gefährlich.«
Doch der kräftige Mann befreite sich aus dem Griff seiner ängstlichen Tochter. »Irgendjemand muss es wenigstens versuchen.«
Die meisten Männer blieben untätig stehen. Nur drei ganz Mutige stiegen zu Dyer ins Boot und griffen nach den Rudern.
Laura dachte an ihren Vater, der mit einem Schiff aufs Meer hinausgefahren und nie zurückgekehrt war, und ergriff Newlyns Hand.
Die Männer legten sich mit aller Kraft ins Zeug, doch die starke Brandung trieb sie immer wieder zurück. Als sie endlich etwa zwanzig Meter draußen waren, drehte eine Welle ihr Boot um, als sei es ein Spielzeug.
»Pa!«, schrie Newlyn auf und drückte verzweifelt Lauras Hand.
Die Männer verschwanden unter dem Boot, gingen in den Wellen unter. Laura hielt die Luft an und betete. Einer nach dem anderen tauchten die Köpfe wieder auf. Die Gekenterten kämpften darum, den Mund über Wasser zu halten und zurück ans Ufer zu gelangen. Ein paar der am Strand Stehenden, deren Bereitschaft, ihren eigenen Leuten zu helfen, ungleich größer war als die, unbekannten Seeleuten zu Hilfe zu kommen, nahmen ein Seil und der Mutigste von ihnen watete in die Brandung hinaus, um den um ihr Leben Kämpfenden zu helfen. Zum Glück schafften es alle vier zurück ans Ufer, erschöpft und lädiert, aber lebendig. Nur das Boot hatte Schaden genommen.
»Wie soll Pa jetzt zum Fischen hinausfahren?«, jammerte Newlyn. »Wie soll er für uns sorgen? Wir müssen doch leben!«
Immer mehr Menschen versammelten sich trotz des Sturms und des Regens am Strand. Sie hatten Lampen und Fackeln in den Händen. Manche trugen auch Spitzhacken. Laura sah die vom Licht der Fackeln erhellten Gesichter, hörte, wie sie gegen die Kälte mit den Füßen auf den Boden stampften, und beobachtete, wie sie sich begierig die Hände rieben.
Das erste über Bord geworfene Fass wurde an den Strand getrieben. Die Leute stürzten sich darauf, umringten es wie Ameisen einen Honigtropfen. Als Nächstes kam eine Kiste, dann noch eine. Sie brachen sie mit ihren Äxten auf und fanden Schätze wie Salzfisch, Feigen und Orangen. In einem der Fässer war sogar Wein. Mit Freudenrufen machten sie einander auf das kostbare Gut aufmerksam, manche fielen gleich an Ort und Stelle über den Wein her, andere füllten sich Taschen und Körbe mit Früchten und Fischen. Das Ganze mutete wie ein makabres Dorffest an.
Laura erblickte den goldhaarigen Treeve Kent unter den Feiernden. Was machte er hier?
Er wandte sich gerade zum Gehen, als er bemerkte, dass sie ihn gesehen hatte. Er kam zu ihr herübergeschlendert und meinte augenzwinkernd: »Wie ich sehe, kurieren Sie Ihre Erkältung zu Hause aus.«
»Und Sie unterhalten die Familie meines Onkels, wie ich sehe«, gab sie zurück.
Er schmunzelte. »Es wurde einfach zu langweilig ohne Sie. Ich wollte eigentlich nur ein Bier trinken gehen, da hörte ich den Schuss und bin runtergekommen, um zu schauen, was los ist.« Ihr fiel auf, dass er ihren Blick mied, während er sprach.
»Was meinen Sie, wann kommt der Schiffsmakler?«, fragte sie.
»Schneller, als uns lieb ist, denke ich.«
»Ihnen auch?«
Er deutete ein Achselzucken an. »Ja, wahrscheinlich.«
Laura schwieg und blickte wieder zu der sinkenden Brigg hinaus.
Nachdem einer von ihnen über Bord gegangen und ertrunken war, hatte der Rest der Besatzung offenbar beschlossen, an Bord zu bleiben. Laura zählte noch neun oder zehn Personen auf dem Schiff. Sie meinte ihre Hilfeschreie zu hören. Eine weitere Welle ergoss sich über das Deck und riss ein paar Seeleute mit ins Meer. Jetzt brach einer der beiden Masten des Schiffs und stürzte ins Wasser. Als er aufs Ufer zutrieb, sah Laura, dass ein Mann sich mit einem Arm daran festklammerte. Den anderen hatte er um einen Kameraden geschlungen, wobei er versuchte, dessen Kopf über Wasser zu halten. Doch dann kam die nächste Welle und die beiden Männer gingen unter. Ein paar Meter weiter tauchte der Vormast auf und kam gefährlich nah an einen der Männer heran, die im seichten Wasser standen.
Eine verzweifelte Hand winkte plötzlich über dem Wasser und ging wieder unter.
»Er ist ganz nah, Jungs. Holen wir ihn!«, rief Newlyns Vater. Er band sich das Seil um die Taille und kämpfte sich mutig erneut ins Wasser hinein. Die anderen hielten das Seil fest. Bei dem Mann angekommen, bückte er sich, streckte sich, so weit er konnte, packte ihn am Kragen und zog ihn in Richtung Ufer. Ein Fass trieb heran und traf die beiden, sodass sie untergingen, doch jetzt kamen die anderen John Dyer zu Hilfe und zogen die beiden Männer ans Ufer.
Mr Dyer rollte sich keuchend auf den Rücken. Newlyn kniete neben ihm. Der andere Mann lag reglos da.
Tom Parsons – ein weithin berüchtigter Strandräuber und Schmuggler – kam über den Strand auf sie zu. Sein gelbrotes Haar quoll in ungebärdigen Locken unter seiner Mütze hervor. Sein Gesicht war übersät mit verblassten Sommersprossen. Zwischen den zusammengezogenen Brauen standen tiefe Furchen. Als Kind musste er entzückend ausgesehen haben, doch jetzt – er war inzwischen etwa fünfzig Jahre alt – stellten sich Laura bei seinem Anblick die feinen Härchen im Nacken auf.
Tom blickte auf das regungslose Opfer hinunter, stieß ihn rücksichtlos mit der Stiefelspitze in die Seite und murmelte: »Recht so.«
Laura blickte sich hilfesuchend um. Wenn doch nur Dr. Dawe nicht zu seiner Schwester gegangen wäre …
»Dreht ihn um«, sagte sie.
Mr Dyer rührte sich nicht, er war zu erschöpft, und von den anderen wagte es keiner, an Tom Parsons vorbeizugehen.
»Jemand muss mir helfen!« Laura bückte sich und versuchte, den Bewusstlosen auf die Seite zu rollen. Doch der erwachsene Mann in seiner mit Wasser vollgesogenen Kleidung war schwerer, als er aussah.
»Lassen Sie ihn«, befahl Tom.
Sie blickte auf und sah den Strandräuber drohend über sich gebeugt, einen Knüppel in der Hand.
Entsetzt von dem Gedanken, dass jemand auf einen hilflosen Menschen einschlagen könnte, sprang sie auf. Ihre Empörung war stärker als ihre Angst. »Nein, Sie lassen ihn in Ruhe!«
Früher hatten die Menschen das Recht, die Fracht eines »toten Wracks« – also wenn es keine Überlebenden gab –, für sich zu beanspruchen, doch dieses Gesetz war vor etwa dreißig Jahren geändert worden. Jetzt musste alles, was an den Strand gespült wurde, dem rechtmäßigen Eigentümer oder dem jeweiligen Herzogtum zurückgegeben werden. Es gab jedoch immer noch Leute, die es vorzogen, sich an die alte Ordnung zu halten, vor allem, wenn ihre Familien Hunger litten oder – sehr viel verwerflicher – wenn damit Profit zu machen war. Die Strafen für Strandraub reichten von Geldstrafen bis zur Todesstrafe, doch die Täter wurden nur selten gefasst und überführt.
Laura sammelte ihre ganze Kraft und rollte den Mann erst auf die Seite, dann auf den Bauch. Dabei ergoss sich ein Schwall Salzwasser aus seinem Mund und er begann, sich zu bewegen.
Toms Stimme blieb tödlich ruhig. »Geh weg, Mädchen.«
Mit einem wachsamen Blick auf den Knüppel beugte sie sich schützend über den Mann. »Nein.«
Er hob den kurzen, schweren Knüppel.
Treeve Kent trat zwischen sie. »Ist alles in Ordnung, Miss Callaway? Ach, guten Abend, Tom.«
Parsons zögerte. »Was wollen Sie hier, Kent?«
Treeve schenkte dem Mann ein etwas bemühtes Lächeln. »Dasselbe wie Sie, nehme ich an.«
»Wohl kaum. Das hier geht Sie nichts an.«
Das Opfer des Schiffbruchs tat einen blubbernden Atemzug und streckte eine Hand aus. Sie fand nur Sand.
»Newlyn!«, rief Laura. »Schnell, hol Jago und sag Miss Chegwin, sie soll nach Fern Haven kommen.«
»Aber …«
»Auf der Stelle!«
Laura war noch nie einem anderen Menschen gegenüber so autoritär aufgetreten, doch in diesem Moment scheute sie nicht davor zurück, sich als Herrin des ängstlichen Dienstmädchens zu geben. Sie würde diesen hilflosen Mann keine Minute länger als nötig am Strand liegen lassen. Wenn sie nichts unternahm, würde der Mann nicht mehr lange leben. Er wäre dem grausamen Atlantik, der kalten Nachtluft und vor allem Tom Parsons Knüppel ausgeliefert.
Ob es nun an ihrer Entschlossenheit, bei dem Verunglückten zu bleiben, oder an der Gegenwart eines Angehörigen einer der führenden Familien der Gemeinde lag, wusste sie nicht. Tom Parsons zog sich widerwillig zurück und wandte sich den Fässern und Kisten zu, zweifellos entschlossen, so viel wie möglich an sich zu raffen, bevor der Makler oder ein Zollbeamter auftauchten.
Kurz darauf kam Jago in seinem schwerfälligen Gang über den Strand auf sie zu. Dabei zog er so manche neugierigen und auch missbilligenden Blicke der Umstehenden auf sich. Doch zum Glück waren die meisten viel zu beschäftigt damit, die Kisten oder die Taschen der Ertrunkenen zu durchwühlen, um groß auf ihn zu achten.
»Jago, trag ihn bitte nach Fern Haven.«
Der große Mann nickte, kniete nieder und hob den Seemann auf, als wäre er ein Kind.
Laura folgt ihm über den Strand, doch zuvor wandte sie sich noch einmal an Treeve. »Dr. Dawe ist zu seiner Schwester gegangen. Könnten Sie Ihren Bruder bitten, so schnell wie möglich zu kommen?«
»Sie glauben, Perran kann helfen?« Seine Brauen flogen überrascht hoch. »Es wäre mir aber lieber, wenn Sie mich bitten würden zu kommen.«
»Sind Sie Arzt?«
»Nein. Aber wenn Sie mich brauchen, fragen Sie einfach.« Ihr attraktiver Nachbar trat näher, ein lausbubenhaftes Glitzern in den Augen. »Ich stehe stets zu Ihrer Verfügung.«
Laura zögerte. Treeve mochte mit ihr flirten, doch sie konnte sich nicht vorstellen, dass seine Absichten ernst waren. Sie sah ihm gerade in die Augen. »Das bezweifle ich«, schnaubte sie und eilte Jago nach.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Der Kapitän, fast ertrunken und bewusstlos, wurde in ein nahe gelegenes Haus getragen. Man hoffte, ihn dort wieder zu Bewusstsein zu bringen.
Bella Bathurst, The Wreckers
2
In Jagos Armen hatte der Mann eher schmächtig gewirkt. Jetzt, wo er auf dem bescheidenen Gästebett lag, sah er sehr viel größer aus. Seine Schultern waren ein gutes Stück breiter als seine schlanke Taille. Er mochte um die dreißig sein, hatte dickes, welliges braunes Haar und eine schmale Nase. Bartstoppeln, eine Nuance dunkler als sein Haar, warfen Schatten auf die untere Hälfte seines Gesichts. Er trug Kniehosen, Strümpfe und ein Batisthemd. Falls er Schuhe, einen Hut oder einen Mantel gehabt hatte, hatte das Meer sie behalten. Nichts an seiner Kleidung gab einen Hinweis auf seine Identität. Allenfalls das Hemd aus dem feinen Stoff konnte das Kleidungsstück eines Gentlemans sein.
»Ziehen wir ihm die nassen Sachen aus«, sagte Miss Chegwin.
Mit Jagos Hilfe streifte die alte Frau dem fremden Mann die Kleidung ab und fing an, den Sand und das Blut abzuwaschen. Laura brachte die nassen Kleidungsstücke hinunter in die Waschküche.
Bevor sie die Kleidung in die Wanne legte, durchsuchte sie sie noch. Doch weder im Hemdkragen noch im Taillenbund der Hose fand sich irgendetwas, anhand dessen man den Träger hätte identifizieren können.
Die Hose besaß wie üblich einen geknöpften Tuchlappen vor dem Hosenschlitz. Diese breite Patte verdeckte eine Hüfttasche, in der sie drei Goldguineas und eine silberne Taschenuhr fand. Das Zifferblatt zeigte die üblichen römischen Ziffern, weiter nichts.
Laura weichte die Kleidung ein und kehrte ins Gästezimmer zurück.
Dort war Miss Chegwin im Begriff, den Mann behutsam und methodisch zu untersuchen. Sein Unterleib war von einem Laken bedeckt.
Nach vielen Jahren als Hebamme hatte Mary Chegwin als Pflegerin in der Praxis von Dr. Dawe mitgearbeitet und seine Patienten in der Genesungszeit oder auf deren Reise in die Ewigkeit begleitet. Vor ein paar Jahren hatte Dr. Dawe dann jedoch darauf bestanden, dass sie wegen ihres hohen Alters in den Ruhestand ging. Aber sie wusste viel und hatte auch Erfahrung mit den Opfern von Schiffbrüchen.
Die Tatsache, dass sie wieder gebraucht wurde, schien Mary förmlich zu beflügeln. Als sie sich jetzt über den Patienten beugte und seinen Körper auf Verletzungen untersuchte, wirkte sie mit einem Mal sehr viel jünger, als sie war.
»Der Knöchel ist geschwollen, da ist auch ein Bluterguss. Ich glaube nicht, dass er gebrochen ist, aber ich bin nicht sicher. Er hat Seilverbrennungen an den Handgelenken. Vielleicht hat er versucht, sich an ein Wrackstück zu binden. Eine Abschürfung am Hinterkopf. Vielleicht wurde er vom Mast oder einem anderen Wrackteil getroffen.«
Ein Schnitt in seiner Seite ließ sie innehalten. »Oh, das ist bis jetzt das Schlimmste. Es geht sehr tief. Wir müssen den Schnitt säubern und verbinden. Gut, dass er bewusstlos ist, Salzwasser brennt fürchterlich.«
Mary öffnete ihre alte Arzneikiste und fing an, die Wunden mit Lauras Hilfe mit geheimnisvollen Tinkturen und übel riechenden Salben zu behandeln. Laura war damals noch zu jung gewesen, um ihrem Vater wirklich bei Behandlungen helfen zu können. Doch sie war ihm zur Hand gegangen und hatte ihm oft genug zugesehen, sodass ihr alles, was jetzt geschah, ganz natürlich vorkam.
Newlyn klopfte und sagte: »Mr Kent, Miss.«
Perran Kent trat ein, eine Ledertasche in der Hand, so neu, dass sie förmlich schimmerte. Laura stellte ihn Miss Chegwin vor.
»Ich kenne Sie gut, mein Junge. Hab Sie vor vielen Jahren durch den Krupphusten gebracht. Hab nie einen Jungen gesehen, der so viel geweint hat. Da sind Sie hoffentlich rausgewachsen.«
Perry räusperte sich. »Das bin ich.«
Er untersuchte den Patienten genauso, wie Miss Chegwin es gemacht hatte, und betrachtete die Blutergüsse, die Abschürfungen und den geschwollenen Knöchel. »Bisher habe ich keine Schiffbrüchigen untersucht, deshalb weiß ich nicht, welche Verletzungen üblich sind und welche nicht.«
Mary nickte. »Nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe, könnte es schlimmer sein.«
»Dann danken wir Gott für kleine Gaben.« Als er die tiefe Wunde in der Seite des Mannes sah, runzelte auch er die Stirn. »Das muss genäht werden. Ich bin leider kein Chirurg, habe aber am Guy’s von allem ein bisschen gelernt.«
Er legte dem Mann die Hand auf die Stirn. »Er ist sehr kalt. Wir sollten besser auch das Feuer schüren.«
Laura beeilte sich, doch Jago war schneller, er bückte sich schon zum Kamin. Newlyn trödelte noch in der Tür herum, deshalb sagte Laura zu ihr: »Bitte Wenna, die Bettflasche zu wärmen.«
»Ja, Miss.« Newlyn lief fort. Wahrscheinlich war sie froh, ein wenig Abstand zwischen sich und Jago und auch den Fremden legen zu können.
Perry nahm ein paar Instrumente aus seiner Tasche. Als er zögerte, den ersten Einstich zu machen, griff Miss Chegwin beherzt nach der Nadel und fing an, die Wunde zu nähen. »Frauen können besser mit Nadeln umgehen, finde ich. Wir haben mehr Übung.«
Perry nickte erleichtert. »Es ist eine Gnade für ihn, dass er das Bewusstsein noch nicht wiedererlangt hat. Wenn das allerdings nicht bald geschieht, geschieht es vielleicht gar nicht mehr. Kann sein, dass er zu lange ohne Sauerstoff war.«
O nein! Laura holte tief Luft und betete, dass dem nicht so war.
Die Finger der alten Mary waren gekrümmt und schwach, doch sie arbeiteten flink und geschickt. Nach ein paar Minuten schnitt sie den Faden ab.
Perry betrachtete ihr Werk. »Gut gemacht, Miss Chegwin. Falls ich beschließe, hierzubleiben und hier zu praktizieren, wäre es mir eine Ehre, Sie als Krankenschwester einzustellen.«
»Dr. Dawe sagt, ich sei zu alt.«
»Dann ist Dr. Dawe ein Dummkopf.«
Mary musste lachen, doch sie stimmte ihm weder zu, noch widersprach sie ihm.
Der junge Mann richtete sich auf. »Ich muss jetzt gehen. Meine Eltern machen sich bestimmt schon Sorgen. Aber ich komme morgen noch mal und gucke, wie es ihm geht.«
Laura begleitete ihn zur Tür. »Vielen Dank, Mr Kent.«
»Perry, bitte. Mr Kent ist mein Vater. Wenn Sie das sagen, komme ich mir so alt vor.«
»Nach heute Abend sollte ich Sie Dr. Kent nennen.«
Er sah sie unter den dichten, dunklen Locken, die ihm tief in die Stirn fielen, an und meinte bescheiden: »Damit wären Sie die Erste, die das ernsthaft meint. Die anderen sagen das nur im Scherz.«
Laura lächelte. »Sehr schön, Dr. Kent. Sie verdienen den Titel.«
»Danke.« Er warf noch einen letzten Blick auf den Patienten. »Halten Sie ihn warm. Wenn er die heutige Nacht übersteht, sehen wir weiter.«
Miss Chegwin blickte ihm nach. Als die Tür sich hinter ihm geschlossen hatte, schnalzte sie mit der Zunge und schüttelte den Kopf. »Dieser Junge ist doppelt so viel wert wie sein Bruder, aber er sieht leider nicht halb so gut aus.«
»Es gibt Wichtigeres«, meinte Laura.
»Ganz meine Meinung, aber ich bin überrascht, das von einer jungen Dame zu hören. Nun gut. Du hast gehört, was der Arzt gesagt hat. Halten wir die arme Seele warm.«
Laura holte ein Nachthemd aus der Kleidertruhe ihres Onkels. Mit Jagos Hilfe gelang es den dreien, es ihrem Schützling über den Kopf zu streifen, seine Arme in die Ärmel zu stecken und es über seinen Körper nach unten zu ziehen. Laura trat zurück, als Mary das Laken zurückschlug, und erhaschte nur einen flüchtigen Blick auf die muskulösen, behaarten Beine, dann waren sie auch schon wieder bedeckt. Jago ging hinaus.
Mary schüttelte den Kopf. »Du meine Güte, er zittert ja wirklich furchtbar. Wo bleibt das Mädchen mit der Wärmflasche?«
Sie breiteten dicke Wolldecken und eine weitere Bettdecke über das Laken, dennoch steigerte sich das Zittern des Mannes zu Zuckungen.
»Wir könnten ihn auf die ganz altmodische Art wärmen«, sagte Laura. »Haben sich die Diener früher nicht zu ihren Herren ins Bett gelegt, um sie zu wärmen?«
»Ja, so war es. Und – es ist erst ein paar Jahre her, da hat eine arme Witwe nach einem Schiffbruch einen halb toten Kapitän aufgenommen. Sie versuchte ihn mit Brandy wiederzubeleben und als das misslang, wärmte sie ihn in ihrem eigenen Bett. Das alte Hausmittel wirkte. Als er wieder gesund war, sagte er, dass er ihr sein Leben verdanke, und belohnte sie reich mit zwanzig Goldguineas. Aber das solltest du nicht nachmachen. Du bist eine junge Dame und, schlimmer noch, eine pudelnasse.«
Ja, der Regen und die Gischt hatten ihre Kleidung durchnässt. Sie schlotterte beinahe selbst.
Zum Glück kam jetzt Newlyn mit der kupfernen Bettpfanne, die mit Glut vom Herdfeuer gefüllt war.
»Gut, dass du da bist. Schieb sie unter die Bettdecken ganz nah an seine Beine und Füße, aber pass auf, dass du ihn nicht verbrennst.«
Newlyn tat es und schon nach wenigen Minuten ließ das Zittern des Mannes nach.
Onkel Matthew und Mrs Bray tauchten in der Tür auf, noch in Hut und Mantel von ihrem Ausgang. Hinter ihnen lauerte Eseld und versuchte, ihnen über die Schulter zu spähen, doch ihre Mutter scheuchte sie fort. »Geh in dein Zimmer, Eseld. Das ist kein Anblick für dich.«
Eseld seufzte dramatisch, gab aber nach.
»Wenna hat uns erzählt, dass du einen Überlebenden des Schiffbruchs hierhergebracht hast«, sagte ihr Onkel.
»Ja. Hoffentlich ist euch das recht.«
»Recht?«, wiederholte Mrs Bray. »Ich bin alles andere als glücklich, plötzlich einen Fremden in meinem Haus vorzufinden. Warum hast du so eigenmächtig gehandelt, ohne uns um Erlaubnis zu fragen?«
Laura war nicht überrascht, dass Mrs Bray zögerte, einen Fremden aufzunehmen. Die Frau hatte sie zwar, als sie gerade frisch mit Matthew Bray verheiratet war, freundlich aufgenommen, doch die Freundlichkeit hatte sich im Laufe der Jahre ziemlich abgenutzt, vor allem, seit Laura zur jungen Frau herangewachsen war und die Aufmerksamkeit von Treeve Kent geweckt hatte.
»Ihr wart nicht da«, verteidigte sich Laura. »Und der Mann brauchte sofort Hilfe.«
Ihr Onkel beschwichtigte. »Es ist nur recht und billig, dass die arme Seele im Haus eines Geistlichen Zuflucht findet.« Als Onkel Matthew von Truro nach Nord-Cornwall gezogen war, um Lamorna Mably zu heiraten und die hiesige Pfarrei zu übernehmen, hatte der Bischof ihm gestattet, in dem größeren, helleren Haus seiner neuen Gattin zu wohnen, statt in dem feuchten alten Pfarrhaus in St. Minver.
»Aber wir wissen rein gar nichts über ihn«, beharrte Mrs Bray. »Er könnte eine fremdartige Krankheit haben oder ein Verbrecher sein.«
»Aber, aber. Kein Grund, voreilige Schlüsse zu ziehen. Ich muss jetzt gehen und mich um die Toten kümmern, aber der arme Kerl ist bewusstlos und völlig hilflos.«
»Nun gut.« Sie schnaubte. »Du schaffst das hoffentlich allein, Laura. Ich gehe jetzt nämlich zu Bett. Und ich möchte auch nicht, dass Eseld dieses Zimmer betritt. Komm ja nicht auf die Idee, sie bei der Pflege eines fremden Mannes helfen zu lassen. Hast du mich verstanden?«
Damit wandte sie sich zum Gehen, bemerkte aber noch über die Schulter: »Nach allem, was wir wissen, könnte er gefährlich sein.«
Da sie im Moment nichts weiter für den Mann tun konnten, schickte Laura Miss Chegwin nach Hause, damit sie ein wenig Schlaf bekam, und bat Newlyn, bei dem Patienten zu bleiben. Sie wollte inzwischen ihrem Onkel helfen, die Leichname für die Beerdigung vorzubereiten. Sie versprach, das Mädchen in ein paar Stunden abzulösen.
Newlyn erklärte sich widerwillig bereit, rückte ihren Stuhl aber näher ans Feuer, fort von dem Mann. Sie beäugte ihn misstrauisch, als könnte er ihr jeden Moment an die Kehle springen.
Unten am Strand gab ihr Onkel dem Küster und einigen ortsansässigen Männern ein paar Münzen, damit sie halfen, die Toten auf einen Karren zu laden und nach St. Enodoc zu bringen.
Die kleine Kapelle war eine der drei Kirchen in der Gemeinde. Sie lag dem Unglücksort am nächsten. Im Laufe der Jahre war sie teilweise von den Sanddünen bedeckt worden. Sie wurde nicht mehr für die regulären Gottesdienste benutzt. Begräbnisse fanden dort jedoch weiterhin statt. Auf den Friedhof gelangte man durch ein überdachtes Tor, unter dem sich ein einzeln stehender Sockel mit einer Platte zum Abstellen des Sargs befand. Dort bahrte man den Leichnam vor dem Begräbnis auf. Doch im Fall eines Schiffsunglücks, wenn viele Seeleute begraben werden mussten, trug man die Leichen der Ertrunkenen stattdessen zum Küsterschuppen hinter der westlichen Hecke.
Im Schuppen angekommen, hängten sie eine Laterne an einen Haken unter dem Dach, um den Ort zu erhellen, sodass sie besser arbeiten konnten. Dann ließen sie die Helfer die armen Seelen nebeneinander auf den Boden legen und schickten sie nach Hause.
Manche der Opfer hatten schwere Verletzungen von den Felsen, andere sahen aus, als schliefen sie. Mehrere von ihnen hatten ihre Schuhe und Mäntel verloren – oder vielleicht waren sie ihnen auch von Strandräubern abgenommen worden.
Vor Jahren, als Laura zum ersten Mal gesehen hatte, wie eine Frau einem Ertrunkenen die Stiefel auszog, war sie entsetzt und abgestoßen gewesen, doch ihr Onkel hatte sie beschwichtigt: »Da, wo er hingeht, braucht er sie nicht mehr. Und sie hat sechs Söhne und nicht genug Geld, um auch nur einem gutes Schuhwerk zu verschaffen, geschweige denn einem halben Dutzend.«
Doch dann war es an Onkel Matthew gewesen, überrascht zu sein, als Laura aus freien Stücken anbot, ihm nach einem Schiffbruch zu assistieren. Überarbeitet, wie er ständig war, hatte er nachgegeben. Laura fand die Arbeit traurig, aber nicht so, dass sie sich ihr nicht gewachsen gefühlt hätte. Der Grund dafür war vielleicht, dass sie die Tochter eines Arztes war und als Kind häufig Verletzte und Tote gesehen hatte, vielleicht aber auch, weil sie das Gefühl hatte, ihrem Onkel und in gewisser Weise auch dem Verstorbenen wirklich eine Hilfe zu sein.
Obwohl sie wusste, dass man dem Toten alles, was auch nur von geringstem Wert war, bereits abgenommen hatte, suchte sie jedes Mal nach irgendwelchen Besitztümern oder besonderen Merkmalen, die zu seiner Identifizierung beitragen konnten. Wenn es Überlebende gab, die die Toten identifizieren konnten, schrieb sie die Namen der Opfer auf. Die Schreibkenntnisse ihres Onkels ließen leider sehr zu wünschen übrig. Wenn keine Überlebenden da waren, hielt sie die wichtigsten körperlichen Merkmale der Toten schriftlich fest, falls später Angehörige kommen und nach den Begrabenen fragen sollten.
Bei Schiffen der Marine konnten die Offiziere häufig anhand ihrer Uniformen identifiziert werden. Und auch auf einem Handelsschiff trug der Kapitän meist einen besonderen Übermantel mit Epauletten. Der Maat, die Zimmerleute und die gewöhnlichen Matrosen waren schwieriger zu unterscheiden.
Sie kniete sich der Reihe nach neben jeden Mann, durchsuchte noch einmal seine Kleidung und seine Taschen und verfasste eine kurze Beschreibung:
Mann, 40–45 Jahre alt. Graues Haar. Grüne Augen. Beleibt. Trägt eine Schürze. Der Koch?
Mann, 25–30 Jahre alt. Schwarzes Haar. Braune Augen. Erdbeerfarbenes Muttermal an der linken Braue. Der Hosenbund und der Kragen seines blauen Hemds tragen die Initialen T. A.
Laura hielt inne. T. A.? Die Buchstaben erinnerten sie an irgendetwas. Waren es seine Initialen oder die eines anderen? Da war etwas, aber sie kam einfach nicht darauf. Auf jeden Fall bedeutete es ganz sicher nicht das, was ihr durch den Sinn schoss. Sie schob ihren Verdacht erst einmal beiseite und ging weiter.
Junge, 13–15 Jahre alt. Rotes Haar. Blaue Augen. Sommersprossen.
Tränen trübten ihre Sicht, während sie die Worte niederschrieb. So jung. Wenn sie an seine Mutter dachte, wo immer sie sein mochte, tat ihr das Herz weh. Behutsam schloss sie dem Jungen die Augen.
Als die Liste endlich fertig war, stand Laura auf und gab sie ihrem Onkel.
»Danke, meine Liebe.« Er betete für die Männer und bat Gott um Gnade für ihre Seelen. Dann breiteten sie zusammen ein Tuch über jeden Leichnam. Diese Tücher bewahrten sie für ebendiesen Zweck im Küsterschuppen auf. Sie waren schon mehrmals benutzt worden.
»Acht Männer und ein Junge.« Zwei weniger, als sie auf dem Schiff gesehen hatte, aber vielleicht hatte sie sich ja verzählt.
Onkel Matthew nickte. »Der Leichentuchnäher wird morgen viel zu tun haben.«
Er verschloss den Schuppen, um die Leichen vor weiteren Übergriffen zu schützen. Dann machten sie sich auf den Heimweg.
Unterwegs dachte Laura an ihren ersten Sonntag in der Gemeinde. Sie wusste noch, wie erstaunt sie gewesen war, als sie sah, wie ihr Onkel sich durch das Dach in die teilweise verschüttete Kirche hinunterließ, und an ihr Missfallen über das lärmende Betragen der auf dem nahe gelegenen Erdhügel Versammelten. Es hatte nichts mit der andächtigen Atmosphäre eines Gottesdienstes zu tun, wie sie sie erwartet hatte. Mrs Bray hatte ihr vorgeworfen, sie hätte geguckt, als hätte sie gerade in eine Zitrone gebissen. Und sie hatte sie davor gewarnt, Bräuche zu kritisieren, die sie nicht verstand.
Doch Eseld hatte ihre Hand genommen und ihr freundlich den fremden Brauch erklärt: Der Pfarrer musste mindestens ein Mal im Jahr einen Gottesdienst in der Kirche halten, damit die Zehntenrechte und die Weihung nicht verfielen.
Während sie nun im Wagen nach Hause fuhren, empfand Laura beinahe so etwas wie Scham, wenn sie daran dachte, wie naiv und – ja – wie voreingenommen sie als junges Mädchen gewesen war.
Noch heute fiel es ihr manchmal schwer, ihre Nachbarn hier in Cornwall zu verstehen, doch viele von ihnen waren ihr inzwischen richtig ans Herz gewachsen. Ihr Onkel war, als sie hierherzogen, zwar auch neu in der Gemeinde von Minver gewesen, doch er war in Cornwall geboren und aufgewachsen und galt deshalb nicht als Außenseiter. Er hatte die eigenartigen neuen Erfahrungen mit seinem gewohnten, nachsichtigen Gleichmut getragen. Lieber Onkel Matthew. Er war immer so freundlich und geduldig, auch mit ihr. Bei diesem Gedanken schlug eine Welle der Zuneigung über Laura zusammen und sie legte für den Rest der Fahrt ihren Kopf auf seine Schulter.
Als sie vor Fern Haven hielten, kam ein ihr vage bekannter Mann die Straße heraufgeritten. »Geh schon mal rein, Laura«, sagte ihr Onkel, »ich muss noch kurz mit Mr Hicks sprechen.«
Laura nickte, zu mitgenommen, um zu widersprechen.
An Leib und Seele völlig erschöpft, ging sie in ihr Zimmer, legte den feuchten Umhang ab, öffnete ihr vorn geknöpftes Kleid und streifte es über die Hüften. Dann löste sie zuerst ihren feuchten Unterrock und trat heraus, danach bückte sie sich und zog ihre Halbstiefel und ihre durchnässten Strümpfe aus. Zum Schluss, sie trug nur noch ihr weitgehend trocken gebliebenes Unterhemd und das Mieder, schlüpfte sie in ihren Morgenrock und ging auf Zehenspitzen ins Gästezimmer, um Newlyn zu bitten, ihr Mieder aufzuschnüren, und um nachzusehen, wie es ihrem Patienten ging.
Sie öffnete behutsam die Tür. Newlyn hatte sich im Sessel zusammengerollt und schlief. Im Kamin war nur noch ein wenig Glut. Ihr Gast zitterte wieder, seine Lippen schimmerten im Kerzenlicht blau.
Unter den Decken lag noch immer die kalt gewordene Wärmflasche. Sie trug sie rasch zum Feuer und füllte sie mit schwelender Glut. Dann schob sie sie zwischen das Laken und die Decken, in sicherer Entfernung von den Beinen des Mannes, und bückte sich, um Holz nachzulegen und das Feuer wieder in Gang zu bringen.
»Newlyn«, flüsterte sie und rüttelte das Mädchen sanft an der Schulter. Die murmelte etwas und schlief weiter.
Laura gab auf. Sie beobachtete den Mann ein paar Minuten, doch er hörte nicht auf zu zittern. Sie dachte an die Geschichte, die Miss Chegwin ihr erzählt hatte, über die arme Witwe, die einem Kapitän das Leben gerettet hatte. Kurz entschlossen schlug sie die Bettdecke ein Stückchen zurück, stieg vorsichtig ins Bett und legte sich neben ihn.
So lange sie sich erinnern konnte, war sie noch nie mit jemand zusammen im Bett gewesen. Was tat man, um einen kalten Leib zu wärmen? Genügte die Nähe oder war dazu körperlicher Kontakt nötig?
Sie rutschte näher an ihn heran, bis ihre Schulter seinen Arm berührte und ihre Hüfte sein Bein. Sie war ja angezogen, sagte sie sich, und er war ebenfalls bedeckt – nun ja, bis auf ihrer beider Beine. Und er war nicht bei Bewusstsein, also war, so redete sie sich selbst gut zu, nichts Skandalöses an ihrem Tun.
Sein furchtbares Zittern ließ ein wenig nach, hörte aber nicht ganz auf. Sie rollte sich auf die Seite. Ihr Gesicht war jetzt ganz nah an seiner Schulter. Dann hob sie zögernd den Arm und legte ihn über seinen Oberkörper. Erleichtert stellte sie fest, dass seine Brust sich regelmäßig hob und senkte. Sie spürte die festen Muskeln seiner Arme unter dem Nachthemd und seine schlanke Taille. Ihr ganzer Körper erglühte vor Verlegenheit angesichts ihrer intimen Stellung. Hoffentlich hatte ihre Nähe eine ähnlich wärmende Wirkung auf ihn.
Als sei er sich vage ihrer Gegenwart bewusst, wandte der Mann ihr den Kopf zu und murmelte etwas in ihr Haar. Einen Namen? Honora? Es waren drei Silben, zu leise und schnell ausgesprochen, als dass sie etwas hätte verstehen können. Dann entspannte er sich wieder und sagte nichts mehr.
Müde, wie sie war, und wunderbar gewärmt, wurden Laura schon bald die Lider schwer. Sie beschloss, sie nur ganz kurz zu schließen.
Einige Zeit später hörte sie ein Aufkeuchen und war mit einem Schlag hellwach. Durch die Fensterläden drang Morgenlicht.
Newlyn stand neben ihr und starrte sie mit hochgezogenen Brauen und kreisrunden Augen an. »Miss, was machen Sie da? Was würde Ihr Onkel sagen?«
Was würde Mrs Bray sagen, ist die viel furchterregendere Frage, dachte Laura. Sie flüsterte: »Er hat wieder gezittert. Der Arzt hat doch gesagt, wir sollen ihn warmhalten.«
Dann schlug sie, weil sie aufstehen und die Wärmflasche neu füllen wollte, die Decke zurück, setzte sich auf und griff nach der Glutpfanne.
In diesem Moment ging die Tür auf.
Ihr Onkel und Mrs Bray blieben wie angewurzelt stehen, als sie Laura auf dem Bett des Mannes sitzen sahen. Hinter Mrs Brays Schulter lugten die weit aufgerissenen Augen von Eseld hervor.
»Was geht hier vor?«, wollte Mrs Bray wissen.
Gott sei Dank waren sie nicht ein paar Minuten früher erschienen.
Ihr Onkel zog die Brauen zusammen. »Trägt er mein Nachthemd?«
»Tut mir leid, Onkel«, sagte Laura kleinlaut. »Wir mussten doch tun, was der Arzt sagte, und ihn warmhalten. Newlyn, tu bitte noch ein wenig Glut in die Pfanne.« Laura wandte sich ab, um ihr brennendes Gesicht zu verbergen, und steckte die Decken um ihren Patienten fest.
»Arzt? Ich dachte, Dr. Dawe ist noch fort?«
»Das ist er auch. Ich meinte Perry Kent.«
»Ah … ein Junge hat gestern Abend eine Nachricht überbracht und Perry ist ohne ein Wort der Erklärung weggegangen.«
»Ein Junge? War es nicht sein Bruder, der ihn benachrichtigt hat?«
»Treeve?« Mrs Bray runzelte die Stirn. »Warum sollte es Treeve gewesen sein? Er hat das Haus schon früher verlassen, wegen einer wichtigen Sitzung des Gemeinderats, sagte er. Unser Abend war jedenfalls gründlich ruiniert, als zuerst Treeve und dann auch noch Perry gegangen waren. Ein wahrlich trübseliger Abend für Eseld.«
Wichtige Sitzung? Das bezweifelte Laura.
»Du hast Treeve gesehen?«, fragte Eseld gespannt.
Laura wollte sie nicht kränken und ihr vor allem keinen Grund zur Eifersucht geben, deshalb sagte sie: »Nur kurz. Er … wahrscheinlich hat er die wichtige Sitzung verlassen, als das Schiff die Gewehre abfeuerte. Die Leute kamen ja aus allen Richtungen gerannt.«
»So wie du.«
»Ja.«
Mrs Brays missbilligender Blick flog von dem ruhig daliegenden Mann zu Laura. »Wie auch immer, es schickt sich jedenfalls nicht, dass du im Morgenmantel hier ganz allein mit einem Mann im Zimmer bist.«
Laura deutete auf das stumme Mädchen, das in einer Ecke kauerte. »Newlyn war die ganze Zeit bei mir.«
Ihr Onkel trat näher ans Bett. »Gibt es noch kein Anzeichen, dass er das Bewusstsein wiedererlangt hat?«
Laura schüttelte den Kopf. »Er hat im Schlaf etwas gemurmelt, mehr nicht.«
Mrs Bray hielt Eseld mit einer warnenden Handbewegung zurück, folgte ihrem Mann ins Zimmer hinein und starrte auf den Fremden hinunter. »Er gefällt mir gar nicht. Er sieht aus wie ein Pirat. Oder ein Fremder. Er könnte ein Spion sein. Wir wissen ja gar nichts über ihn.«