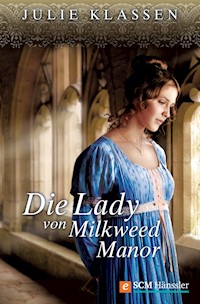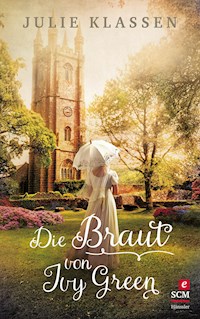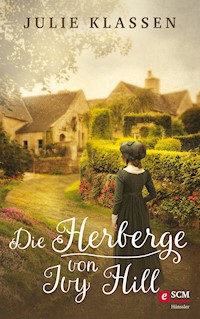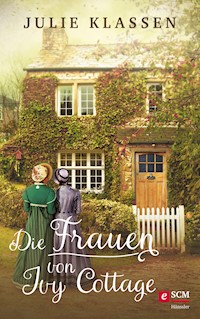Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: SCM HänsslerHörbuch-Herausgeber: Hänssler
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ivy Hill
- Sprache: Deutsch
Als seine Mutter ihm den Geldhahn zudreht, bleibt Richard nichts anderes übrig, als sein spannendes Leben als Schriftsteller in London zurückzulassen und in sein Heimatdorf zurückzukehren: Ivy Hill. Widerwillig lässt er sich darauf ein. Mit der Zeit beginnt er sich dort wohlzufühlen, woran die junge, hübsche Arabella nicht ganz unschuldig ist ... Er beschließt, zu bleiben, und zieht in sein eigenes Cottage, wo er sich wunderbar zum Schreiben zurückziehen kann. Doch Arabella folgt ihrem Traum und geht nach London. Kann es eine gemeinsame Zukunft für sie geben?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
SCM Hänssler ist ein Imprint der SCM Verlagsgruppe,die zur Stiftung Christliche Medien gehört, einer gemeinnützigen Stiftung,die sich für die Förderung und Verbreitung christlicher Bücher, Zeitschriften,Filme und Musik einsetzt.
»Das vorliegende Buch ist ein historischer Roman, der natürlich auch vor einergewissen historischen Kulisse spielt. Die auftretenden Personen entstammenjedoch der Fantasie der Autorin, und jedwede Ähnlichkeit mit lebendenoder verstorbenen Personen ist rein zufällig und nicht beabsichtigt.«
ISBN 978-3-7751-7539-5 (E-Book)ISBN 978-3-7751-6103-9 (lieferbare Buchausgabe)
Datenkonvertierung E-Book: Satz & Medien Wieser, Aachen
© der deutschen Ausgabe 2021SCM Hänssler in der SCM Verlagsgruppe GmbHMax-Eyth-Straße 41 · 71088 HolzgerlingenInternet: www.scm-haenssler.de; E-Mail: [email protected]
Originally published in English under the title: An Ivy Hill Christmasby Bethany House Publishers, a division of Baker Publishing Group,Grand Rapids, Michigan, 49516, U.S.A.All rights reserved.Copyright 2020 by Julie Klassen.
Übersetzung: SuNSiDeLektorat: Rahel Dyck, BonnCover design: Jennifer ParkerUmschlaggestaltung: Sybille KoscheraTitelbild: © Mike Habermann Photography, LLCKarte von Ivy Hill: © Bek Cruddace Cartography & IllustrationSatz: Satz & Medien Wieser, Aachen
Für Michelle Griep,Verfasserin mitreißender Romane undNovellen und treffsicherster Kritiken.In Liebe und Dankbarkeit.
Ich wünsche dir fröhliche, hin und wieder vielleichtsogar ausgelassene Weihnachten.
Jane Austen in einem Brief an ihre Schwester, 1808.
Denn der uns errettet hatdurch sein wertes Leiden, Sterben,alles für uns Sünder tat,damit wir Erlösung erben.Ihm sei ewig Ruhm und Ehr.Jesu Namen sei uns, amen;halte uns bei dieser Lehr.Sei gelobt der Weihnachtstag,den nichts übertreffen mag.
frei übersetzt aus: Gilbert Davies, »God’s Dear SonWithout Beginning«, Weihnachtslied, 1822.
Inhalt
Über die Autorin
Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Kapitel Neun
Kapitel Zehn
Kapitel Elf
Kapitel Zwölf
Kapitel Dreizehn
Kapitel Vierzehn
Kapitel Fünfzehn
Kapitel Sechzehn
Epilog
Nachwort der Autorin
Honeycroft-Honig-Gewürz-Kekse
Leseempfehlungen
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
Über die Autorin
JULIE KLASSEN arbeitete 16 Jahre lang als Lektorin für Belletristik. Mittlerweile hat sie zahlreiche Romane geschrieben, von denen mehrere den begehrten Christy Award gewannen. Abgesehen vom Schreiben, liebt sie das Reisen und Wandern. Mit ihrem Mann und zwei Söhnen lebt sie in Minnesota, USA.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
KAPITELEins
Dezember 1822London
Als Richard Brockwell an einem Tuchhändlergeschäft vorüberging, musterte er wohlgefällig sein Spiegelbild im Schaufenster. Er machte in der Tat eine gute Figur – auch wenn er sich mit diesem Gedanken selbst lobte. Er erhaschte einen Blick auf eine hübsche Debütantin, die ihm vor Kurzem auf irgendeinem Ball vorgestellt worden war. Sie hatte mit ihm geflirtet und er hatte auch mit ihr getanzt, allerdings nur einen einzigen Tanz, und sie auch nicht an einem der folgenden Tage zu Hause aufgesucht. Auch jetzt blieb er nicht stehen, um ihre Bekanntschaft zu erneuern. Sie war zu jung und zu … heiratsfähig.
Er ging weiter. Vor der schmucklosen kleinen Kapelle an der Ecke stand eine streng blickende ältere Frau. In der Hoffnung, unbemerkt zu bleiben, überquerte er die gepflasterte Straße. Zu spät. Ihre Stimme packte ihn im Genick wie eine Katzenmutter die Halsfalten ihrer eigensinnigen Nachkommenschaft.
»He, Sie! Sir! Darf ich Sie um eine kleine Spende für unsere höchst förderungswürdige Stiftung bitten?« Einer vorbeifahrenden Droschke ausweichend, kam sie über die Straße auf ihn zu.
Richard drehte sich um und setzte ein Lächeln auf. Seine Erziehung mochte zwar nicht tadellos gewesen sein, doch er hatte gelernt, mühelos Höflichkeit vorzutäuschen.
Als sie vor ihm stand, setzte sie ihren Appell fort. »Ich bin Miss Arbuthnot, die Direktorin des St.-George-Waisenhauses. Wir retten Waisenkinder davor, ihre Zuflucht in der Laufbahn als kleine Gauner und Betrüger zu suchen, wie es so oft geschieht, und ermöglichen ihnen eine Lehre, sodass sie in einer Druckerei, als Buchbinder oder in einer Spinnerei arbeiten und sich auf ehrliche Weise ihren Lebensunterhalt verdienen können.« Sie hielt ihm einen Korb hin. »Unsere Einrichtung finanziert sich durch freiwillige Spenden.«
Freiwillige oder erzwungene?, fragte sich Richard, doch er antwortete nichtsdestotrotz in freundlichem Ton: »Meine liebe Dame, ich freue mich wirklich, wenn Sie oder eine Ihrer Mitstreiterinnen mich fast jedes Mal, wenn ich hier vorüberkomme, ansprechen. Ihre … Ausdauer ist bewundernswert. Sie machen wahrlich den Athleten in einem griechischen Fünfkampf Konkurrenz.«
Sie kniff die Augen zusammen, doch er fuhr mit seinem gewinnendsten Lächeln fort: »Ich bewundere Ihre Menschenliebe. Wirklich. Und wie Sie spende ich alles, was ich erübrigen kann, an eine gute Sache meiner Wahl. Mein Lieblingskaffeehaus und meine liebste Buchhandlung nehmen den ersten Platz in meinem Herzen – und in meiner Börse ein.«
Damit verneigte er sich ironisch, drehte sich um und ging, während sie noch nach Worten suchte, hochzufrieden mit sich selbst weiter.
Richard war, das wusste er wohl, ein Egoist. Doch ein Mensch konnte sich nicht wirklich ändern, oder? Bestimmt nicht.
Vor dem Kaffeehaus grüßte er den Bettler, der dort stand, mit einem leichten Tippen an seinen Hut, dann betrat er das geliebte Geschäft, wo ihn sogleich der Duft von Kaffee, Pfeifentabak, Zeitungen und Büchern begrüßte. Sein Blick fiel auf seinen bebrillten Verleger, der, über eine Zeitung gebeugt, an ihrem üblichen Tisch saß. Er trat zu ihm.
»Murray. Schön, dich zu sehen, alter Junge.«
David Murray hob seinen dunklen Lockenkopf und erhob sich, um Richard die Hand zu geben. »Wie geht es dir, Brockwell?«
»Wenn man den Zeitungen glauben darf, bin ich ein attraktiver Wüstling mit einem einzigen Lebenszweck: sämtliche Witwen von Mayfair zu verführen.« Doch er lächelte bei dieser Übertreibung und setzte sich. Früher hatte er diesen zweifelhaften Ruf wahrscheinlich verdient, doch jetzt nicht mehr.
»Da geht’s dir immerhin besser als mir«, knurrte Murray. »Der heutigen Morgenzeitung zufolge droht mir eine Beleidigungsklage und außerdem stehe ich kurz vor dem Bankrott.«
Richard grinste seinen Freund an, der nur zwei Jahre älter war als er. »Wir beide haben wahrlich unser Kreuz zu tragen. Vielleicht hilft das ja.« Er nahm ein paar Papiere aus seiner Mappe. »Hier ist der Artikel, um den du gebeten hast. Den nächsten Teil muss ich dir aus Wiltshire schicken.«
Der andere zog seine buschigen Augenbrauen über den Brillenrand hoch. »Ich dachte, du willst in der Stadt bleiben und über Weihnachten arbeiten.«
»Das wollte ich auch, aber meine Mutter besteht darauf, dass ich dieses Jahr nach Hause komme. Mir graut davor, aber eine Absage wird sie nicht akzeptieren.«
»Weihnachten im Kreis deiner dich liebenden Verwandten?«, meinte Murray trocken. »Eine grauenhafte Vorstellung.«
Sein Verleger hatte, soviel Richard wusste, keine Familie. Ihm kam eine Idee. Die Ablenkung durch einen Überraschungsgast konnte sich als durchaus nützlich erweisen. »Warum kommst du nicht einfach mit? Vorausgesetzt, du erträgst den Gedanken an Weihnachten auf dem Land.«
»Wann fährst du?«
»Am Neunzehnten.«
Der Mann zögerte. »Fahr ruhig. Ich hoffe aber, du wirst mir die nächste scharfzüngige Satire wie immer pünktlich zum Zehnten des nächsten Monats schicken! Oder werden die Annehmlichkeiten eines ländlichen Weihnachtsfestes deinen Geist benebeln und dich milde und nachsichtig machen?«
»Niemals. Aber es wäre vielleicht wirklich besser, du kommst mit und sorgst dafür, dass ich nicht den Kopf verliere.«
Er erzählte seinem Freund nicht, dass er an einem zweiten Roman arbeitete. Der erste war bereits von zwei Verlegern abgelehnt worden. Thomas Cadell von dem angesehenen Londoner Verlag Cadell & Davies hatte ihm lediglich eine brüske Notiz zukommen lassen: zurück an den Absender. Richard wartete noch auf die Antworten eines dritten und vierten Verlags. Leider gab Murray keine Bücher heraus; er zog es vor, sich auf seine Zeitschrift zu konzentrieren.
»Hätte deine Familie denn nichts gegen einen Hausgast einzuwenden?«, fragte Murray.
»Aber nein. Sie laden immer Gäste zu Weihnachten ein.«
»Kann ich noch ein, zwei Tage darüber nachdenken?«
»Natürlich. Sag mir einfach, wie du dich entschieden hast.«
Richard selbst verbrachte so wenig Zeit wie möglich in Brockwell Court. Er zog das Leben im Londoner Stadthaus der Familie vor, fern von den Verkupplungsversuchen seiner Mutter und dem Schuldgefühl, das das Wissen, seine Mutter immer wieder zu enttäuschen, in ihm hervorrief. Letztlich war er auf diese Weise der Herr in der schönen Londoner Residenz mit ihrer kleinen, aber durchaus ausreichenden Dienerschaft.
Er war froh, die Verantwortung für das Landgut seinem älteren Bruder, dem pflichtbewussten Sir Timothy, überlassen zu können. Und warum auch nicht? Timothy, nicht er, war schließlich der Erbe.
Richard war alles andere als glücklich, aufs Land, nach Wiltshire, fahren zu müssen. Dort musste er in die Kirche gehen und an Festlichkeiten teilnehmen, Leute, an die er sich kaum erinnerte, höflich begrüßen und die schmerzlichen Seufzer seiner verwitweten Mutter ertragen. Die verwitwete Lady Brockwell war immer düster und reserviert gewesen, doch jetzt, nachdem Timothy und seine hübsche Frau ihr erstes Kind bekommen hatten, war sie hoffentlich etwas heiterer gestimmt und würde ihm nicht mehr mit dem Wunsch, er möge doch endlich heiraten, auf die Nerven fallen.
Auf eine Person aber freute er sich wirklich: auf seine jüngere Schwester Justina. Die eine Londoner Saison, die sie bei ihm im Haus gewohnt hatte, hatte er richtig genossen. In Justinas Augen konnte er überhaupt nichts falsch machen und er hatte ihre jugendliche Anbetung und ihr bereitwilliges Lachen über seine Scherze genossen. Außerdem hatte seine Aufgabe als ihr Beschützer während der Saison etwas mehr Geld als sonst in seine Kasse gespült, was ihm sehr zupassgekommen war – Geld, das leider schon lange wieder ausgegeben war.
Zum Glück war seine Mutter bisher immer bereit gewesen, ihm Geld zu geben, wenn er sie darum bat. Bis jetzt. Jetzt schlug sie allerdings eine härtere Gangart ein. Sie hatte damit gedroht, ihm, wenn er Weihnachten nicht nach Hause kam, keine Wechsel mehr auszustellen.
Abends setzte Richard sich zu einem bescheidenen Abendessen, bestehend aus Roastbeef und Kartoffeln. Nach einem missvergnügten Blick auf sein halb gefülltes Glas Claret hob er es auffordernd in Richtung Pickering.
»Das war die letzte Flasche, Sir«, antwortete sein alter Kammerdiener, der ihm auch bei Tisch aufwartete. »Es ist kein Geld mehr da.«
Richard seufzte und sah aus dem Fenster. Mit der Dunkelheit war ein Gewitter aufgekommen, das gut zu seiner Stimmung passte. Der Regen prasselte gegen die Terrassentür und die Zweige eines dicht am Fenster stehenden Buschs schlugen gegen das Glas.
Im Licht eines Blitzes leuchtete ein Augenpaar vor dem Fenster hell auf. Neugierig sah Richard genauer hin. Vor der Tür saß ein völlig durchnässter Hund. Bei Richards Anblick erhob sich das bedauernswerte Geschöpf auf seine kurzen Hinterbeine und legte die Pfoten gegen das Glas. Mit großen, bittenden Augen blickte er sehnsüchtig in Richards gemütliches Zimmer und das warme Feuer – oder vielleicht auch nur auf seinen Teller mit dem Roastbeef.
Wieder zuckte ein Blitz über den Himmel. Plötzlich hatte Richard sich selbst als Jungen vor Augen, wie er ganz allein vor einem Cottagefenster stand und auf eine heimelige Szene schaute – ein Außenseiter, der hineinblickte und dazugehören wollte. Der geliebt und akzeptiert werden wollte.
»Ignorieren Sie ihn, Sir«, sagte Pickering gleichgültig, »dann wird er sich schon verziehen.«
Richard stand auf und ging zur Tür. »Geben wir ihm wenigstens etwas zu fressen.«
Der ältere Mann schüttelte den Kopf. »Ich gehe da jetzt nicht raus. Und außerdem – wenn Sie einen Streuner füttern, werden Sie ihn nie wieder los.«
Das wusste Richard nur allzu gut. Und doch regte sich – ein seltenes Gefühl – Mitleid in seinem Herzen. Er entriegelte und öffnete die Tür und lockte den ängstlichen Hund mit leiser, beruhigender Stimme und einem Stückchen Fleisch ins Zimmer. Pickering schüttelte den Kopf. »Mrs Tompkins wird das gar nicht gefallen. Sie kämpft im Moment sowieso mit einer nur noch spärlich gefüllten Vorratskammer.«
Er wusste, dass Pickering recht hatte, aber er tat es trotzdem.
Eine Woche später bereitete Richard sich auf die gefürchtete Reise nach Ivy Hill vor. Wenigstens würde Weihnachten auf dem Land ein festlicheres Ereignis sein als in der Stadt, tröstete er sich, mit gutem Essen und Zugang zu Brockwell Courts gut bestücktem Weinkeller. Und schließlich waren es ja nur ein paar Wochen. Er würde das Beste daraus machen.
Doch sobald das Fest vorüber und der Dreikönigskuchen gegessen wäre, würde er sich in die Kutsche nach London setzen und in sein sorgloses Junggesellenleben zurückkehren.
Er warf einen letzten Blick auf sein Spiegelbild. Dann bückte er sich und zog seinem Hund eine kleine Weste an. Sein sturer Kammerdiener hatte sich geweigert, das zu tun.
»Schlimm genug, einen jungen Stutzer anzukleiden«, sagte Pickering. »Aber dieses Schlitzohr anzuziehen, ist nun wirklich unter meiner Würde.«
»Schon gut, Sie alter Griesgram. Ich mache es selbst.« Er knöpfte die Weste zu und band dem Hund ein kleines Halstuch um; beides hatte sein Schneider, wenn auch widerwillig, angefertigt.
Richard mochte den Hund schon jetzt sehr viel lieber, als er Pickering mochte. Eigentlich sogar lieber als die meisten Menschen.
Die Abstammung des Hundes mochte zweifelhaft sein, doch er erinnerte Richard an die Terrier in Guy Mannering. In dem Roman besaß ein schottischer Bauer namens Dandie Dinmont sechs pfeffer- und senffarbene Terrier, die genauso zäh und freundlich waren wie er selbst. Richard hatte den Streuner Scotty nennen wollen, doch dann erschien ihm das allzu offensichtlich. Also hatte er ihn stattdessen Wally getauft, in neidvoller Bewunderung für Sir Walter Scott. Die literarische Welt hielt ihn für den Autor des Romans, auch wenn im gedruckten Werk nur stand Vom Autor von Waverly. Guy Mannering war vierundzwanzig Stunden nach seinem Erscheinen vergriffen gewesen. Einmal nur einen Bruchteil des Erfolgs dieses Autors zu haben!
Stattdessen hatte er jetzt Wally. Der Hund verdiente sich bereits jetzt seinen Lebensunterhalt. Direkt nach seinem Einzug hatte er den Keller von Mäusen befreit, womit er das Herz von Richards Haushälterin erobert hatte. Zudem zog der in eine Miniversion von Richards Kleidung gewandete elegante Hundeknabe die Aufmerksamkeit auf sich, wo sie auch hingingen.
Heute würden Richard, Pickering und Wally nach Wiltshire fahren. Murray hatte beschlossen mitzukommen; sie wollten sich an der Herberge der Poststation mit ihm treffen.
Wally sah flott und verwegen aus in seiner grünen Weste; sein flauschiges, hellbraun-rötliches Fell war für die Reise frisch gewaschen worden. Das Hausmädchen war nach diesem Bad völlig durchnässt gewesen. Er hatte ihr eigentlich ein paar Extraschillinge für diese Unannehmlichkeit geben wollen, doch leider hatte seine Börse das nicht mehr hergegeben.
Da Wally klein genug war, um auf seinem Schoß zu sitzen, hatte Richard ihm nicht einmal einen zweiten Platz in der Kutsche zu kaufen brauchen. Mr Murray hatte seinen Platz selbst bezahlt. Und zu Richards Überraschung hatte sein alter Kammerdiener sich einen Innenplatz statt des günstigeren Außenplatzes geleistet.
»Der Lohn, den Sie mir zahlen, ist armselig genug, aber ich bin es nicht«, sagte Pickering hochnäsig. »Im Gegensatz zu Ihnen, Master Richard, gebe ich nicht jeden Penny, den ich bekomme, aus, solange er noch warm von der Hand seines Gebers ist.«
»Bewundernswert!«
Pickering war schon der Kammerdiener von Richards Vater gewesen und war nach Sir Justins Tod zu ihm nach London gekommen. Er war wahrscheinlich der einzige Mann, der bereit war, für den unzeitgemäßen Lohn, den Richards begrenztes Budget erlaubte, zu dienen – wobei »dienen« wahrscheinlich eine Übertreibung war. Immerhin genoss Pickering freie Unterkunft und Verpflegung, auch wenn sein Lohn unter dem Standard lag. Wahrscheinlich war er aus Treue zu seinem alten Herrn, den er wie einen Heiligen verehrte, geblieben. Richard musste unwillkürlich lächeln. Der heilige Sir Justin. Zum Totlachen! Er wusste es besser.
Da ihm die bärbeißigen Bemerkungen des alten Mannes meistens auf die Nerven gingen und er wusste, dass seine Mutter einen Diener für ihn abstellen würde, hatte Richard Pickering nicht gebeten, ihn nach Brockwell Court zu begleiten. Doch der alte Störenfried hatte sich selbst eingeladen.
Er hatte gesagt: »Ich bin seit Jahren nicht mehr über Weihnachten zu Hause gewesen und werde mir diese Chance nicht entgehen lassen. Wer weiß, wann mein rücksichtsloser Herr wieder hinfahren wird?«
Richard hatte nur geschmunzelt über diesen despektierlichen Kommentar und nichts weiter dazu gesagt. Doch dann hatte er, ehrlich neugierig, gefragt: »Sie betrachten Ivy Hill also noch immer als Ihr Zuhause, Pickering? Obwohl Sie schon fast zehn Jahre mit mir in London leben?«
»Daran brauchen Sie mich nicht zu erinnern«, hatte der Mann trocken geantwortet. »Ich bin aber nun einmal dort geboren und habe noch zwei Nichten dort – ja, ich werde es immer als meine Heimat betrachten.«
Richard schüttelte den Kopf. »Mein Zuhause ist London.«
Ebenfalls ein wenig überrascht war er über Mrs Tompsons Begeisterung, als er ihr sagte, dass er Weihnachten nicht da sein würde. Die Haushälterin hatte ihn gebeten, den wenigen Dienstboten über Weihnachten freizugeben, damit sie das Fest bei ihren Familien verbringen konnten. Er hatte zögernd zugestimmt.
Im anderen Fall hätte er Wally in seinem Stadthaus lassen können, in der Obhut des Hausmädchens oder Billys, der eine Art Mädchen für alles war. Jetzt nahm er ihn stattdessen mit nach Brockwell Court. Nun ja. Wallys Begleitung würde die geringe Unannehmlichkeit wert sein, die es bedeutete, jedes Mal wenn sie hielten, um die Pferde zu wechseln, mit ihm auszusteigen. Außerdem war es Zeit, dass der verwöhnte Mops seiner Mutter mal einen Dämpfer bekam.
Die Kutsche kam. Sie nahmen ihre Plätze ein. Während sie warteten, dass das Gepäck verstaut wurde und der Kutscher die letzten Vorbereitungen traf, schaute Richard aus dem Fenster. Dabei fiel ihm ein älterer Mann auf. Er stand mit einem jüngeren Mann, offenbar seinem Sohn, im Hof und nahm diesen zum Abschied liebevoll in den Arm.
Murray neben ihm murmelte: »Was soll das denn?«
Keine Ahnung, dachte Richard. Doch er bemerkte nur scherzhaft: »Man hat eine Familie, damit sie einen in Verlegenheit bringt. Sei froh, dass du allein bist.«
Murray warf ihm einen Seitenblick zu. »Mir kannst du nichts vormachen.«
Richard wurde rot vor Überraschung. »Nicht? Dann sollte ich an meiner Performance arbeiten.«
Die Kutsche war voll beladen mit Weihnachtsreisenden, Paketen, Gänsen und mehreren Jungen in Schuluniform, die auf dem Kutschendach saßen und in die Ferien nach Hause fuhren. Den letzten freien Sitzplatz nahm eine ältere Matrone ein, mit einem Korb, den sie auf dem Schoß behielt. Pickering berührte grüßend seinen Hut und Wally beschnüffelte interessiert den Korb.
Schon bald ratterten sie durch die Straßen und aus der Stadt hinaus. Als sie schließlich die offene Straße entlangrumpelten, öffnete Richard seine Mappe und fing, einen Stift in der Hand, an, ein Kapitel seines zweiten Romans zu überarbeiten. Doch schon bald wurden ihm die Lider schwer. Er blickte schläfrig aus dem Fenster auf die vorübergleitende Landschaft und war kurz davor, einzunicken, als ein kleiner Körper an seinem Fenster vorbeifiel. Einer der Passagiere auf dem Kutschendach war heruntergefallen. Wally bellte aufgeregt.
Doch noch bevor er reagieren konnte, griff Murray nach Richards Spazierstock und klopfte gegen das Dach. »Anhalten! Halten Sie an!«
»Vorsicht – das ist Elfenbein«, wandte Richard höflich ein.
Der Kutscher hielt an, fluchend über die Verzögerung, und Murray stieg über die Beine der Frau und Richards, um nachzusehen, ob er helfen konnte. Er kehrte mit einem etwa zwölfjährigen Jungen zurück, der eine dicke Beule am Kopf hatte, sonst aber unverletzt schien.
Murray half dem Jungen in die Kutsche. »Hier, du kannst meinen Platz haben und dich ausruhen. Ich setze mich aufs Dach.«
»D-danke, Sir«, murmelte der Junge. Er wirkte ein wenig verwirrt.
Richard bewunderte seinen Freund insgeheim für diese Geste – und um seinen flanellgefütterten Mantel. Er selbst würde nicht für einen Fremden auf seinen Platz verzichten. Nicht bei diesem kalten, feuchten Wetter. Mit einem entschuldigenden Blick auf seinen zitternden kleinen Hund rechtfertigte er sich: »Wally könnte sich erkälten.«
Pickering verdrehte die Augen. »Und ob.«
Die Frau sprach beruhigend auf den Jungen ein und gab ihm einen Apfel und etwas Käse aus ihrem Korb. Auch von ihrer Selbstlosigkeit war Richard beeindruckt. Er hätte ebenfalls mit dem Jungen geteilt, doch weder der noch Wally hätten das Angebot zu schätzen gewusst, das Hundefutter zu teilen, und etwas anderes hatte er nicht dabei.
Er betrachtete die Verletzung des Jungen, der ihm gegenübersaß – es war keiner der Schuljungen, sah er. Der Kleine trug einen dunklen Mantel und eine dunkle Hose, beide mit Grasflecken nach seinem Sturz, und eine flache Wollmütze.
Aus purer Langeweile begann Richard ein Gespräch mit ihm.
»Du reist allein?«
Der Junge warf ihm einen unbehaglichen Blick zu. Einen viel zu misstrauischen, welterfahrenen Blick für einen so jungen Menschen.
Richard wechselte die Taktik. Er sah seinen Hund an und sagte: »Wally und ich fahren zu Weihnachten nach Hause. Du auch?«
Der Junge schüttelte den Kopf.
»Nein? Dann bist du klüger, als ich dachte.«
Wally strampelte in Richards Griff. Er wollte den Jungen kennenlernen.
»Er möchte zu dir kommen und dich begrüßen. Hast du etwas dagegen?«
»Nein, Sir. Ich mag Hunde.«
Richard ließ ihn los. Wally sprang dem Jungen auf den Schoß und leckte ihm die Wange. Zu schade, dass er ihm nicht auch gleich die laufende Nase leckte, wo er schon mal dabei war. Mit einem bedauernden Blick auf sein makelloses Taschentuch reichte Richard es dem Jungen und deutete dabei auf seine eigene Nase.
Der Junge schnäuzte kräftig in das Taschentuch, dann streckte er es ihm wieder hin.
Richard winkte ab. »Behalte es. Ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk.«
Er hatte es scherzend gesagt, doch der Junge strahlte. »Danke, Sir!«
»Wie heißt du?«, fragte Richard.
»Jamie Fleming.«
»Und wo willst du heute hin?«
Der Junge erzählte ihm, dass er im Begriff sei, eine Lehre bei einem Drucker in Wiltshire anzutreten. Sie würde sieben Jahre dauern.
Richard hob das Kinn. »Du wirst also ein Druckerteufel, ja?«
»Ja, Sir. So nennt man es wohl.«
»Mach dir keine Sorgen. Mich bezeichnet man auch häufig als Teufel. Du wirst dich daran gewöhnen. Wo ist denn dieser Drucker?«
»In Wishford, bei Salisbury.«
»Ah. Das kenne ich. Es ist ganz nah an dem Ort, an dem meine Familie wohnt.«
Hoffnung leuchtete in dem jungen Gesicht auf. »Dann werde ich Sie vielleicht irgendwann wiedersehen.«
Richard zögerte. »Möglich. Aber jetzt ist Schluss mit dem Herunterfallen von Kutschen. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft.«
Die Augen des Jungen erloschen wieder. »Ja, Sir.«
Die ältere Frau beugte sich mit gerunzelten Brauen vor. »Deine Eltern müssen sehr bedauert haben, dass du fortgehst, gerade jetzt, vor Weihnachten.«
Jamie schüttelte den Kopf. »Nein, Ma’am.« Er wandte den Blick ab, streichelte eingehend den Hund und murmelte: »Meine Eltern sind beide tot.«
»Das tut mir leid zu hören.«
Nach einem respektvollen Moment des Schweigens fragte Richard: »Ich bin neugierig. Was kostet eine Lehre heutzutage?«
»Zwanzig Pfund.«
»Du liebe Güte! Wie hast du das geschafft?«
»Das St.-George-Waisenhaus hat die Gebühr und auch meinen Platz in der Kutsche bezahlt. Kennen Sie das Heim?«
Richard antwortete trocken: »Ich habe von der Einrichtung gehört, ja. Sie bitten mich des Öfteren um Geld.«
Der Junge meinte ernst: »Dann muss ich auch Ihnen danken.«
»Du lieber Himmel, nein. Danke mir nicht«, beeilte sich Richard zu entgegnen.
Pickerings buschige Brauen hoben sich. »Sie, Sir? Ich habe Sie nie für einen Philanthropen gehalten.«
»Das bin ich auch nicht. Ich habe gesagt, dass sie mich gefragt haben. Ich habe nicht gesagt, dass ich etwas gespendet habe.«
Danach schwieg er, leicht gereizt von diesem Gang der Ereignisse. Dass ihm ausgerechnet ein Waisenjunge aus der Einrichtung dieser Frau gegenübersaß! War hier womöglich ein ironisches Schicksal am Werk … oder Gott? Ein Schauder überlief ihn. Das ist nur die Kälte, sagte er sich und zwang sich, sich wieder auf sein Buch zu konzentrieren.
[ Zum Inhaltsverzeichnis ]
KAPITELZwei
Lady Brockwell, vormals Miss Rachel Ashford, küsste ihren Mann und rückte ihm die Krawatte zurecht. »Komm, mein Liebster. Wir wollen doch nicht zu spät zum Abendessen kommen und deine Mutter verärgern.«
»Du bist jetzt die Dame des Hauses, meine Liebe, und die Frau, an deren Glück mir am meisten gelegen ist.«
»Ich weiß. Und doch hoffe ich, dass Richard sie nicht wieder enttäuschen wird.«
Sir Timothy küsste sie auf die Wange. »Ich auch.«
Sie gingen nach unten zu den anderen Familienmitgliedern, die sich im Wohnzimmer eingefunden hatten: Lady Barbara und Justina. Kein Richard.
Die Witwe hob ihr spitzes Kinn. »Es ist wie immer. Er hat mir wieder getrotzt. Aber dieses Mal mache ich Ernst. Ich habe nie verstanden, warum Justin sich darauf eingelassen hat, seinen Lebensunterhalt in London zu finanzieren. Richard ist fast dreißig und ich gedenke, einige Änderungen vorzunehmen. Es wäre etwas anderes, wenn er verheiratet wäre oder wenn wir die Saisons dort verbringen würden, aber wir fahren ja so gut wie nie in die Stadt.«
Justina ergriff Partei für ihren missratenen Bruder. »Wir hatten eine so schöne Zeit, als ich in meiner Saison bei ihm war, Mama. Richard war einfach ein Schatz als Gastgeber und Begleiter; er ist mit mir zu sämtlichen wichtigen Bällen und Opernvorführungen gegangen. Wir hatten so viel Spaß zusammen.«
»Das mag ja sein, aber seither haben wir ihn kaum zu Gesicht bekommen. Und – ehrlich gesagt – vorher auch nicht. Du bist jetzt das Oberhaupt der Familie, Timothy; sag mir, wenn du anderer Ansicht bist. Leider fürchte ich, dass die lange Abwesenheit von seiner Familie, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass er Zugang zu anscheinend unerschöpflichen finanziellen Mitteln hat, Richard ganz und gar nicht gutgetan hat.«
»Ich bin nicht anderer Ansicht. Aber wollen wir nicht erst einmal Weihnachten genießen, bevor wir uns über all das ärgern?«
Seine Mutter verzog das Gesicht. »Ich versuche es. Aber ohne Richard … ach, ich wusste ja, dass er nicht kommt!«
»Wieder falsch, Mama. Hier bin ich.«
Lady Barbara drehte sich um und schnappte hörbar nach Luft. »Richard! Mein lieber Junge! Ich wusste, dass du kommst!«
Rachel sah, wie ihr Schwager bei diesen Worten ungläubig die Augenbrauen hochzog.
Lady Barbara machte eine wegwerfende Handbewegung. »Ach, du weißt doch, dass ich immer vom Schlimmsten ausgehe, um mich gegen eine Enttäuschung zu wappnen. Aber jetzt bist du da!«
Sie streckte ihm beide Hände hin. Er ergriff sie und küsste sie pflichtbewusst auf die Wange.
Rachel kannte Timothys Bruder kaum, obwohl sie sich in den letzten Jahren mehrmals gesehen hatten. Er war gut aussehend, charmant und ein paar Jahre jünger als Timothy. Beide Männer waren groß, mit hohen Wangenknochen und dunklem Haar, doch Richard hatte blaue Augen, während Timothys braun waren.
Ein kleiner Hund kam ins Zimmer getapst. Ein Terrier mit hellbraun-rötlichem, wuscheligem Fell. Er trug eine Weste und Krawatte.
Lady Barbara runzelte die Stirn, als sie ihn sah. »Wer hat denn diese Kreatur hereingelassen?«
»Er gehört mir, Mama«, antwortete Richard. »Ich dachte, du hast sicher nichts dagegen.«
»Ich hoffe, er ist ans Haus gewöhnt und belästigt nicht meinen Mops.« Sie deutete auf das mollige Geschöpf, das auf dem Sofa schlief. Wie zur Antwort knurrte der Mops pflichtbewusst, dann schloss er wieder die Augen.
»Du wirst sehen, im Gegensatz zu mir ist er ein perfekter Gentleman«, sagte Richard. Dann sah er sich um. »Ich hatte Pickering gebeten, ihn zu halten, bis ich dich angemessen begrüßt habe, aber …«
Der Mann steckte sein silbernes Haupt durch die Tür und sagte in leicht indigniertem Ton: »Ich möchte Sie mal sehen, wie Sie diesen Köter halten, wenn er nicht gehalten werden will.«
Lady Barbara schien beim Anblick des älteren Mannes fast genauso überrascht wie beim Hereinkommen des Hundes. »Pickering? Sie leben noch?«
»In der Tat. Auch wenn es kaum vorstellbar erscheint, Mylady.«
»Du meine Güte, Sie sehen gealtert aus!«
»Freut mich ebenfalls, Sie zu sehen« – er deutete eine Verbeugung an – »Witwe Brockwell.« Damit setzte der bärbeißige Kammerdiener, schwer beladen mit Koffern und Reisetaschen, seinen Weg die Treppe hinauf fort.
Doch vor der Tür stand noch ein zweiter Mann, verlegen wartend, den Hut in der Hand. Lady Barbara blickte von ihm zu Richard, die Brauen fragend hochgezogen.
Richard sah ihren Blick und sagte: »Verzeih mir! Komm rein, Murray, komm rein. Mama, erlaube mir, dir meinen Freund, Mr David Murray, vorzustellen. Murray, das ist meine Mutter, Lady Barbara.«
»Erfreut, Sie kennenzulernen.«
Richard stellte weiter vor: »Mein Bruder, Sir Timothy, und seine Frau, Lady Brockwell.«
»Rachel«, warf sie lächelnd ein.
»Und du erinnerst dich bestimmt noch an meine Schwester Justina.«
Justina knickste. »Wir sind uns in London begegnet. Schön, Sie wiederzusehen, Mr Murray.«
»Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite, Miss Brockwell.«
Richard wandte sich wieder an seine Mutter. »Ich habe Mr Murray eingeladen, Weihnachten bei uns zu verbringen. Ich war sicher, dass du nichts gegen einen weiteren Gast hast.«
Seine Mutter zögerte. »Oh. Ich …«
Der andere Mann sagte ernst: »Ich hoffe, es ist keine allzu große Zumutung. Richard hat einfach nicht lockergelassen.«
Richard klopfte ihm auf die Schulter. »Murray hat keine Familie, bei der er Weihnachten verbringen könnte. Ich wusste, dass du ihn mit Freuden aufnehmen würdest.«
»Ich … verstehe. Nun denn. Wir werden recht zahlreich sein, wie es scheint.«
Rachel fügte freundlicher hinzu: »Seien Sie herzlich willkommen, Mr Murray.«
Richard warf einen Blick auf die große Standuhr und zog eine Grimasse. »Tut mir leid, dass wir so spät dran sind. Unsere Kutsche hatte Verspätung. Ein Junge ist vom Dach gefallen und der Kutscher hielt es für nötig, seinetwegen anzuhalten.«
»Das hoffe ich doch!«, sagte Justina mit einem entrüsteten Lachen. »Ist er so weit in Ordnung?«
»Bemerkenswert unversehrt. Er hat lediglich eine Beule, etwa so groß wie ein Kricketball.«
Seine Mutter fragte: »Es ist doch hoffentlich niemand, den wir kennen?«
»Ist das ein Grund, sich weniger Sorgen zu machen? Nein – er ist ein Lehrling, unterwegs nach Wishford.«
Carville, der Butler, trat ein und verkündete: »Es ist angerichtet.«
»Sollen wir hochgehen und uns umziehen, Mama?«, fragte Richard. »Oder nimmst du mit uns vorlieb, wie wir sind?«
Wieder zögerte sie. »Ich will nicht, dass das Essen leidet, deshalb machen wir dieses Mal eine Ausnahme, was das Umkleiden zum Essen betrifft, zumal unsere Hausgäste erst morgen eintreffen. Carville soll eure Mäntel und Hüte nehmen und vielleicht möchte Mr Murray sich ein wenig … erfrischen?«
Richard sah seinen Freund an. Erst jetzt fielen ihm dessen zerzaustes Haar und seine aufgesprungene Gesichtshaut auf.
»Mr Murray war die Güte selbst und hat seinen Platz im Innern der Kutsche dem heruntergefallenen Jungen gegeben«, erklärte er.
»Das war mehr als recht, Mr Murray«, meinte Timothy beifällig.
Richard ging mit seinem Freund zur Tür. »Gib uns fünf Minuten.«
Als die Männer fort waren, seufzte Rachels Schwiegermutter tief auf. »Typisch für Richard, nicht nur einen, sondern zwei Streuner mitzubringen.«
»Mama!«, sagte Justina mit leisem Vorwurf. »Mr Murray ist sehr liebenswürdig und ein erfolgreicher Verleger. Und der Hund ist einfach süß.«
»Nun, wir werden das Beste daraus machen.« Lady Barbara deutete mit Nachdruck auf die Tür. »Aber wenn er meinen Mops ärgert, muss er gehen.«
Justinas Grübchen erschienen. »Der streunende Hund oder der streunende Mann?«
»Beide, falls nötig!«
Kurz darauf kehrten Richard und sein Freund zurück und man setzte sich zum Essen.
Seine Schwägerin sagte lächelnd zu ihrem Gast: »Mr Murray, erzählen Sie uns etwas über sich.«
Der Mann zuckte bescheiden die Achseln. »Ich wünschte, es gäbe etwas zu erzählen. Ich betreibe eine kleine Druckerei und Verlagsgesellschaft in London, so wie Hunderte andere.«
»Sie verlegen Bücher?«, fragte Rachel, ein begeistertes Leuchten in den Augen. Richards Schwägerin hatte, als Inhaberin von Ivy Hills Leihbücherei, ein ganz besonderes Interesse an Lesestoff.
»Nein. Eine Zeitschrift und andere kleinere Publikationen.«
»Ah ja. Nun, die sind ebenfalls wichtig.«
Lady Barbara blickte von Murray zu Richard. »Und wie haben Sie beide sich kennengelernt?«
Murray begann: »Richard ist einer meiner …«
Richard trat ihm unter dem Tisch fest auf den Fuß. Er hatte Murray gebeten, seine Schreiberei nicht zu erwähnen. Die Artikel, die er verfasste, wurden anonym veröffentlicht.
»… Freunde«, stammelte Murray. »Und ein leidenschaftlicher Leser.«
»Und Mr Murray ist die Bescheidenheit in Person«, fügte Richard hinzu. »Seine Zeitschrift erfreut sich in London einer sehr interessierten Leserschaft.«
»Bei einer bestimmten Klientel, ja, aber ich wünsche mir trotzdem mehr Abonnenten … und Einnahmen.«
Richards Mutter lächelte kühl. »Vielleicht sollten wir geschäftliche Erörterungen hintanstellen, bis die Damen sich zurückgezogen haben.«
»Mich stört das nicht«, meinte Rachel. »Ich finde das Verlagsgeschäft höchst interessant.«
»Meine Frau hat die Leihbücherei hier im Ort gegründet«, erklärte Sir Timothy.
»Sehr löblich, Lady Brockwell. Ich ziehe meinen Hut vor Ihnen.«
»Danke. Ich hatte anfangs sehr viel Hilfe. Ich gehe die Berichte und Abonnentenlisten noch immer regelmäßig durch und vertrete die Leiterin jede Woche für ein paar Stunden, aber ich bin nicht mehr so ins Tagesgeschäft involviert wie vor der Geburt unseres Kindes.«
Richard spürte, dass Murray ihn überrascht ansah. Hatte er den Familienzuwachs etwa vergessen zu erwähnen? Anscheinend.
Er räusperte sich. »Dabei fällt mir ein … wie geht es … meinem kleinen Neffen?« Er wand sich förmlich. Wie hieß der Kleine noch mal? Seine Mutter hatte es ihm geschrieben, doch das war Monate her.
Seine Mutter antwortete: »Mein Enkel erfreut sich bester Gesundheit.«
Wollte ihm denn keiner den Namen des Jungen sagen?
Rachel lächelte, anscheinend hatte sie Mitleid mit ihm. »Frederick wird bald schlafen, wenn Schwester Pocket sich durchsetzt, aber ich werde ihn dir morgen vorstellen.«
Frederick! Genau! Immerhin hatten sie ihn nicht Justin nach ihrem Vater genannt. Richard lächelte ebenfalls. »Ich freue mich darauf, ihn kennenzulernen.«
Das Essen nahm seinen Gang. Beim Dessert fragte Justina: »Schreibst du eigentlich noch, Richard? Ich erinnere mich – als ich bei dir in London war, hast du jeden Morgen etwas hingekritzelt. Einen Roman, nicht wahr?«
Richard zuckte die Achseln, ihm wurde ungemütlich warm. »Wahrscheinlich meine Wäscheliste.« Er wollte seine schriftstellerische Tätigkeit geheim halten, bis sein Buch veröffentlicht wurde – wenn das jemals der Fall sein sollte.
Seine Mutter hatte eine zweifelnde Miene aufgesetzt. »Einen Roman? Also wirklich, Justina. Dein Bruder hat bisher immer nur zu seinem Vergnügen gelebt.«
»Ganz richtig, Mama«, sagte Richard, »bis jetzt.«
Sir Timothy wandte sich an ihren Gast, vielleicht in der Hoffnung, vom Thema und der unterschwelligen Spannung in der Familie abzulenken. »Wie heißt denn Ihr Magazin? Vielleicht kenne ich es ja.«
Murray antwortete.
»Ah! Politische Satire, nicht wahr?«
»Zum Teil, ja. Und andere Artikel, die interessant für Gentlemen sind.«
»Gentlemen, die Ihre politische Überzeugung teilen?«
»Nun – ja. Wir bemühen uns selbstverständlich, fair und objektiv zu sein.«
»Fair und objektiv?«, lachte Richard auf. »Entschuldigung, das ist mir so rausgerutscht.«
Lady Barbara erhob sich. »Wenn das Gespräch sich der Politik zuwendet, ist es unzweifelhaft Zeit, dass die Damen sich zurückziehen. Verzeih mir, Rachel, ich weiß, dass ich damit deinen Platz einnehme, aber ich muss darauf bestehen.«
»Aber natürlich.« Rachel erhob sich ebenfalls und Justina tat es ihr nach.
Als die Frauen den Raum verlassen hatten, unterhielten die drei Männer sich noch ein Weilchen. Dann versuchte Richard, seinen Bruder zu einem Kartenspiel zu bewegen, doch Sir Timothy lehnte höflich ab mit der Entschuldigung, dass er am nächsten Morgen schon sehr früh aus den Federn müsse. »Außerdem kommen morgen die Gäste.«
Schon? Richard stöhnte innerlich.
Sein Bruder ging, um den Damen eine gute Nacht zu wünschen. Murray meinte wehmütig: »Wenn ich eine Frau hätte, die so schön ist wie Lady Brockwell, würde ich den Abend auch nicht mit ein paar Gesellen wie uns verbringen.«
Richard antwortete nicht. Er hatte schließlich die größte Mühe darauf verwandt, am Ende eben nicht mit einer Frau dazusitzen.
Er und Murray blieben noch ein Weilchen bei Portwein und Pfeife sitzen und sprachen über das Parlament, die letzten Neuigkeiten und ein paar Ideen für künftige Artikel.
Schließlich meinte sein Freund, er sei todmüde, und zog sich in das Gästezimmer zurück, das man ihm zugewiesen hatte.
Richard ging zu den anderen ins Wohnzimmer, doch dort war nur noch Justina. Sie setzten sich zu einer Partie Dame.
»Was habe ich verpasst?«, fragte er. »Mama hat mir geschrieben, dass du Sir Cyril hast sitzenlassen. Gut gemacht!«
»Freut mich, dass du meiner Ansicht bist. Meine Freundin Miss Bingley hat ihn stattdessen geheiratet. Hat Mama dir auch geschrieben, dass ich jemand anderen bewundere?«
»Nein.«
»Das überrascht mich nicht. Sie findet, er sei nicht gut genug für mich, was natürlich Unsinn ist. Ich finde ihn wundervoll und hoffe, dass du meiner Ansicht sein wirst. Ich warte schon sehnlichst darauf, ihn dir vorzustellen.«
»Wenn es Horace Bingley ist, den kenne ich schon besser, als mir lieb ist.«
»Nein, nicht Horace. Er ist neu in Ivy Hill. Nicholas Ashford.«
»Ashford?«
»Ja, ein entfernter Verwandter von Rachel. Er hat Thornvale geerbt, als ihr Vater starb.«
»Ah ja, ich erinnere mich. Ich habe von ihm gehört. Was hat Mama denn gegen ihn?«
Sie zuckte die Achseln. »Er hat keinen Titel. Kein Geld. Arbeitet für seinen Lebensunterhalt …«
Richard feixte. »Diese verflixten Männer, die einen Beruf ausüben. Wie langweilig. Sie lassen uns Müßiggänger so schlecht dastehen.«
Ihre dunklen Augen sahen ihn amüsiert an. »Oh, Richard!«
»Gehört Mr Ashford auch zu unseren Hausgästen?«
»Ja. Zum Glück hat Rachel die Gästeliste geschrieben und nicht Mama.«
»Gut, dann freue ich mich auf ihn. Allerdings wird es mir schwerfallen, irgendeinen Mann gut genug für dich zu finden, Justi.«
Er streckte die Hand über den Spieltisch und kniff sie ins Kinn.
Sie musste lachen. »Und was ist mir dir, Richard? Wann wirst du jemand kennenlernen und dich verlieben?«
»Ich tue beides regelmäßig, glaub mir. Aber wenn du vom Heiraten sprichst – ich habe nicht die Absicht, in diese Falle zu tappen.«
Sie legte den Kopf schräg. »Warum Falle?«
»Na ja, wir hatten nicht gerade das beste Vorbild für eine glückliche Ehe vor Augen.«
Sie riss die Augen auf. »Nicht?«
Seine kleine Schwester wirkte ehrlich überrascht. Sie war so jung gewesen, zu jung, um zu verstehen.
»Egal. Ich bin einfach nur ein eingefleischter Junggeselle, das ist alles.«
»Das glaube ich keine Sekunde. Du hast nur noch nicht die richtige Frau getroffen. Vielleicht verliebst du dich bei der Hausparty. Wäre das nicht mal eine großartige Überraschung?«
»Eine Überraschung, in der Tat, zumal ich glaube, schon alle Gäste zu kennen.«
»Stimmt. Und wir sind sogar noch weniger, als wir gedacht hatten. Sir Cyril und seine Braut wollten nach ihrer Hochzeitsreise dazustoßen, aber sie haben uns benachrichtigt, dass ihr Schiff Verspätung hat.«
»Glück für uns!«
Das überhörte sie. »Aber seine Schwestern werden beide hier sein – Penelope und Arabella Awdry. Beide sind wunderbare Frauen und noch ungebunden. Ich glaube allerdings, dass Horace Penelope verehrt.«
»Apropos große Überraschungen …«, murmelte Richard.
Justina fuhr fort: »Ihre Mutter, die verwitwete Lady Awdry, kommt auch mit, weil sie sonst an Weihnachten ganz allein wäre. Horace Bingley wird da sein, aber seine Eltern erwarten selbst Gäste, Verwandte, deshalb bleiben sie zu Hause. Zum Neujahrsabend haben wir dann allerdings alle zu uns eingeladen.«
»Ah ja. Dann wage ich die Voraussage, dass die einzigen Romanzen, die sich dieses Weihnachten anbahnen, die zwischen Horace und Penelope und dir und Mr Ashford sein werden.«
Ihre Grübchen blitzten auf. »Oh, ich hoffe so, dass es eine Romanze geben wird. So sehr!«