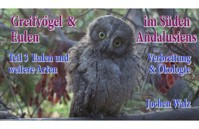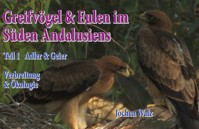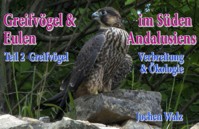8,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Das vorliegende Buch erzählt die wahren Geschichten von gestrandeten Vogelpfleglingen, ihrer Vorbereitung auf ihr Leben in Freiheit und dem z.T. langfristigen Prozess der Auswilderung. Mittels Radiosender wurden die Vögel während ihrem neuen Leben in der Natur begleitet und ihre schönen, wie auch schwierigen Momente dokumentiert. Dabei wurde der Schwerpunkt auf diejenigen Vögel gelegt, die sich schwer taten, sich von ihrem Pflegevater abzulösen, mit all den emotionalen Momenten. Da gab es Vögel, die erst gar nicht die vertraute Sicherheit ihres Pflegeheims verlassen wollten, andere kehrten täglich zurück und wieder andere flogen ihren Ziehvater nach Monaten des Lebens in Freiheit unvermittelt an, um mit diesem ein "Schwätzchen" zu halten, oder siedelten sich gleich in dessen Naturgarten an, obwohl sie diesen zuvor gar nicht kannten. Die liebevollen Tiergeschichten stellen uns ein fundamental anderes Bild von Wildvögeln dar, wie wir es meinen zu kennen. Denn in Wahrheit sind diese sehr sensibel, einfühlsam und jeder mit einer eigenen Persönlichkeit und sie stehen auf Musik. Das Problem ist nur, wir verstehen sie nicht, oder haben, wenn überhaupt nur ein oberflächliches Interesse an ihnen. Das Buch kulminiert im letzten Kapitel mit einem ungewollten aber "erfolgreichen" Brutversuch des Autors an den Eiern eines Schwarzmilanpaares in Indien, deren Nest zerstört wurde. Dabei wird verständlich, dass auch das Vogelleben bereits vor dem Schlüpfen beginnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Gestrandete Vogelkinder und ihr Weg in ein neues Leben
Einleitung
Jedes Jahr stranden zahllose Jungvögel in unseren Gärten aus den verschiedensten Gründen, häufig allerdings infolge Mitschuld des Menschen, da viele Gärten ausgeräumt sind und daher den Vögeln nur unzureichend Brutplätze und zu wenig Nahrung bieten. Diejenigen welche gefunden werden, werden zumeist bei Tierkliniken, Tierheimen oder sonstigen Tierschutzinstitutionen abgegeben und gelegentlich selbst bei der Polizei. Da viele dieser Einrichtungen selbst überfordert sind, werden die Vögel häufig an vertrauenswürdige und fachkundige Privatpersonen weiter gegeben, so auch an den Autor.
Das vorliegende Buch erzählt einige Geschichten dieser Vogelpfleglinge, ihrer Vorbereitung auf ihr Leben in Freiheit und dem z.T. langfristigen Prozess der Auswilderung. Mittels Radiosender wurden die Vögel während ihrem neuen Leben in der Natur begleitet und ihre schönen, wie auch schwierigen Momente dokumentiert.
Dabei wurde der Schwerpunkt auf diejenigen Vögel gelegt, die sich schwer taten, sich von ihrem Pflegevater abzulösen, mit all den emotionalen Momenten. Da gab es Vögel, die erst gar nicht die vertraute Sicherheit ihres Pflegeheims verlassen wollten, andere kehrten täglich zurück und wieder andere flogen ihren Ziehvater nach Monaten des Lebens in Freiheit unvermittelt an, um mit diesem ein „Schwätzchen“ zu halten, oder siedelten sich gleich in dessen Naturgarten an, obwohl sie diesen zuvor gar nicht kannten.
Die liebevollen Tiergeschichten stellen uns ein fundamental anderes Bild von Wildvögeln dar, wie wir es meinen zu kennen. Denn in Wahrheit sind diese sehr sensibel, einfühlsam und jeder mit einer eigenen Persönlichkeit und sie stehen auf Musik. Das Problem ist nur, wir verstehen sie nicht, oder haben, wenn überhaupt nur ein oberflächliches Interesse an ihnen. Das Buch kulminiert im letzten Kapitel mit einem ungewollten aber „erfolgreichen“ Brutversuch des Autors an den Eiern eines Schwarzmilanpaares in Indien, deren Nest zerstört wurde. Dabei wird verständlich, dass auch das Vogelleben bereits vor dem Schlüpfen beginnt.
Das Buch wird von einem Film begleitet, der das Geschehen ebenso spannend dastellt.
Vorwort
Ich war eigentlich nie besonders scharf darauf, Jungvögel groß zu ziehen, oder verletzte Altvögel in Pflege zu nehmen. Das hat sich einfach so ergeben. Zunächst mit einem gestrandeten Bergfinken, den ich im Wald fand und der nur wieder hoch gepäppelt werden musste. Dann, mit den ersten Jungvögeln, die ich aus der Nachbarschaft bekam, kamen bald darauf die ersten Vögel von Tierärzten, welche die vorangegangenen Vögel behandelt hatten (Tierärzte dürfen bei Wildtieren kein Honorar verlangen). So sprach sich das langsam herum, bis zum Tierheim und Vogelinformationszentrum und selbst die Polizei schickte gelegentlich
zwei Wachmänner, die einen Pflegefall eskortierten. Anfangs waren das sehr schöne Erfahrungen, jedoch verbunden mit dem Problem der Auswilderung, da es sich häufig um Einzelvögel gehandelt hatte, die deshalb schwer an ihre Artgenossen sozialisierbar waren. Später stellte sich dieses Problem nicht mehr, da genügend Vögel einer Art, oder einer ähnlichen Art vorhanden waren. Dafür wurde es deutlich anstrengender.
Da mir die Vögel aber einfach leid taten und ich genau wusste, dass, wenn ich nicht helfe, es keiner tut, sei es aus Zeitmangel, Bequemlichkeit, oder Unvermögen, einen Vogel groß ziehen zu können (wobei ich das ja auch einfach so gelernt hatte), nahm ich auch alle Vögel auf. Und da ich sie auch gut großziehen und sozialisieren konnte, war es für die Vögel auch besser, wenn sie bei mir landeten, als dass sie als Einzelvogel bei einer Familie aufwachsen. Insbesondere Kinder stehen einer späteren Auswilderung zumeist kontraproduktiv gegenüber, wenn sie eine engere Bindung zu den Vögeln aufbauen wollen. Und da mir schnell bewusst wurde, dass auch Tiere eine Persönlichkeit haben und leiden, konnte ich gar nicht anders, als ihnen zu helfen.
Wie gesagt, es sprach sich allerdings immer mehr herum, wo man gestrandete Vögel hinbringen konnte und so stieg die Anzahl an Pflegefällen in den kommenden Jahren stark an und in den „besten“ Jahren waren das über 100 Vögel. Insbesondere im späten Frühjahr, wenn sehr viele Jungvögel ausfliegen, hatte ich dann phasenweise um die 10 Jungvögel stündlich zu füttern, mit Höchstzahlen bis zu 20 Schnäbel. Sind dann noch Problemfälle mit dabei, wurde das richtig stressig. Man ist dann kaum mit einer Fütterungsrunde durch und kann schon fast die nächste beginnen. Allerdings handelte es sich dabei um die zwei bis vier extremsten Jahre. Aber auch in den weniger belastenden Jahren musste ich mir die Zeit schon gut einteilen, da es ja auch noch andere Dinge zu tun gab.
So allerdings hatte ich das nicht kommen sehen und dies endete auch immer wieder in großem Stress. Insbesondere deshalb, da es in vielen Fällen um Leben oder Tod ging und es mich nicht selten schwer belastete, wenn die kleinen Pfleglinge starben. Und es starben alljährlich viele. Bei manchen war der Tod von vorneherein absehbar, bei anderen war der Kampf lange und bei vielen entstand immer wieder die Frage, ob ich nicht hätte mehr tun können. Dahingegen schaffte ich es doch, die große Mehrheit wieder in die Natur zu entlassen. Doch der ständige und sehr enge Kontakt zu Wildvögeln änderte mein Naturverständnis, sowie meine Einstellung zu Leben und Tod fundamental. Zum einen erkannte ich, dass selbst Vögel dem Menschen viel ähnlicher sind, als die Menschen sich das eingestehen möchten, sie müssten ja ihren Umgang mit Natur und Tieren neu überdenken. Zum anderen erkannte ich, wie wertvoll das Leben ist und wie schnell dies zu Ende sein kann. Und ich erkannte die Ignoranz der Menschen, die genau dies verdrängen und deshalb auch die Konsequenzen ihres Handelns.
Am meisten interessiert mich allerdings, wilde Tiere in ihrem Lebensraum zu beobachten. Dies ließ ich mir auch von den Pflegefällen nicht nehmen und so arbeitete ich mich
insbesondere in die beiden Milanarten ein und beobachtete diese systematisch in ihrem Lebensraum, sowie auch andere Vogel- insbesondere Greifvogelarten. Nicht selten hatte ich dabei noch eine kleine Anzahl von Pflegefällen mit dabei, die ich stündlich fütterte. Viele gewöhnten sich dabei bereits ein wenig an ihren zukünftigen Lebensraum. Es ging eben auch nur so und die Vögel waren später dennoch gut auswilderbar, da ich zumeist mehrere Vögel von einer Art hatte. Und als sie selbständig Nahrung aufnehmen konnten, siedelte ich sie in das Vogelzimmer um, wo sich die meisten sehr schnell von mir ablösten im Kontakt zu ihren Artgenossen. Dort konnten sie nach Belieben toben und experimentieren und viele wurden dabei richtig gehend scheu vor mir, was die spätere Auswilderung für sie sehr erleichterte.
Am interessantesten und emotionalsten war stets die Auswilderung. In wie weit können Tiere in der Natur überleben, wenn sie dort nicht aufgewachsen sind? Wie schnell finden sie ihre natürlichen Nahrungsquellen und wie schnell finden sie Kontakt zu ihren wilden Artgenossen? Dadurch lernte ich sehr viel über die verschiedenen Vogelarten, wie sie leben, ihr Territorial- oder Sozialverhalten, wenn sie z.B. im Herbst/ Winter gemeinsame Schlafplätze nutzen. Wo befinden sich diese Schlafplätze und wie verteilen sich die Vögel am nächsten Tag?
Hinzu kam die ständige Ungewissheit, ob die kleinen Pfleglinge nicht abgewandert waren, oder ob sie noch lebten und wie lange es dauern würde, bis sie sich an ihre neue Freiheit gewöhnt hatten. Denn manche scheiterten, aber einigen unter diesen konnte ich einen Neustart ermöglichen. Die absolute Mehrheit meisterte den Start in die Freiheit allerdings verblüffend gut und schnell. Doch die Angst vor einem Scheitern war ein ständiger Begleiter. Die schönen Momente, in welchen ersichtlich wurde, wie glücklich sich die ausgewilderten Vögel in ihrem wahren Zuhause fühlten, überwog aber alles. Allerdings gab es auch Kandidaten die hierzu lange benötigten und sich zunächst sehr unwohl in ihrer neuen Freiheit fühlten. Ihnen war anzusehen, dass sie sich nach dem Schutz des Vogelzimmers sehnten. Das konnte schon richtig weh tun, da ich es ja war, der sie in diese Situation gebracht hatte. Die meisten schafften es trotzdem. Andere konnte ich wieder aufnehmen, wenn sie wirklich gescheitert waren, bei manchen blieb das Schicksal jedoch ungewiss, aber nur wenige überlebten die Auswilderung nicht.
Zur Kontrolle versah ich etwa 45 Vögel mit Radiosendern, womit ich sie mehrmals am Tag orten konnte. Anders hätte ich die ausgesetzten Vögel kaum wieder gefunden. Als ich die Schlaf- und Sammelplätze der verschiedenen Vogelarten kennen gelernt hatte, konnte ich auch viele Vögel ohne Sender, nur mit einem Ring versehen, fliegen lassen, um sie dann dort gezielt aufzusuchen. Im Verlauf der Jahre bekam ich dabei einen guten Blick dafür, ob ein Vogel draußen überlebensfähig ist oder nicht. Die meisten Vögel waren es, aber die wichtigste Voraussetzung war, neben einer körperlichen Fitness, dass die Vögel sich vom Menschen abgelöst und stattdessen intensiven Kontakt mit Artgenossen hatten, bevor sie
ausgewildert wurden. Hatten sie dies nicht, gestaltete sich die Auswilderung als sehr schwierig, da sie dann immer den Menschen als Ansprechpartner suchten. Und diese zeigen ihnen nicht, wo es geeignete Nahrungsquellen gibt. Diese Vögel können dann nur sehr langsam, quasi sukzessive, vom Haus aus ausgewildert werden, in der Hoffnung, dass sie zurück finden und dort, wo sie groß gezogen wurden, noch zusätzlich Nahrung, Schutz und Nächtigungsmöglichkeiten erhalten. Diese Art der Auswilderung ist deutlich gewagter, kann aber funktionieren, wenn man den Vögeln stets eine Rückzugsmöglichkeit offen hält.
Da ich schnell registriert hatte, dass gut abgelöste Vögel, am richtigen Platz und zur richtigen Zeit freigesetzt, sehr gute Überlebensaussichten haben, konzentrierte ich meine Aufmerksamkeit insbesondere auf die, welche schlechter sozialisiert waren und deshalb Probleme bekommen könnten. Diese Auswilderungen waren aber nicht nur deshalb emotionaler, sondern auch, weil man an diese Vögel natürlich auch viel mehr sein Herz verloren hat. Und von einigen wenigen dieser Auswilderungen handeln dann auch die nachfolgenden Geschichten.
Sehr wichtig bei Auswilderungen ist aber generell, dass die Vögel die besten Chancen haben, wenn sie an Lokalitäten frei gesetzt werden, wo auch viele ihrer Artgenossen nächtigen und nach Nahrung suchen. So bekommen sie sogleich Anschluss und Schutz in der Gruppe. In bestehenden Vogelrevieren hingegen ist es problematisch, da die Revierinhaber sie zumeist vertreiben. So kommt der Zeitpunkt ins Spiel. Der ist am günstigsten im Spätsommer/ Herbst. Das Territorialverhalten lässt mit dem selbständig werden der Jungen stark nach. Zudem sind dann zahlreiche gleichaltrige Jungvögel unterwegs, die bei vielen Arten auch Trupps bilden. Zudem ist für die meisten Arten die Nahrungssituation dann am besten, da in der Agrarlandschaft die Flächen mittels Mahd und Ernte entsiegelt wurden und dort dann viel Nahrung frei gelegt wurde, wie Mäuse, Regenwürmer, Insekten, aber auch Erntereste, wie Weizen, Mais und anderes Getreide. Daneben gibt es Obst und Beeren.
Die intensivsten Momente mit den freigesetzten Pflegefällen waren allerdings die, wenn diese sich bereits gut in der Natur zurecht gefunden und Anschluss an ihre Artgenossen hatten, aber plötzlich in meiner unmittelbaren Nähe erschienen und mir zeigten, wie glücklich sie sich fühlten. Der Extremfall war eine Wachholderdrossel, die sich bereits über einen Monat in Freiheit befand und von deren Verbleib ich überhaupt nichts wusste. Eines Tages flog sie mich gezielt an, landete einige Meter entfernt auf einer etwa 3 Meter hohen Stromleitung und quapscherte fröhlich. Nach einem Verdacht, bekam ich erst durch den Blick in das Fernglas die Bestätigung, dass sie meinen Ring trug. Das war schon sehr bemerkenswert.
Andere ehemalige Pflegefälle suchten nach geringeren Zeiträumen meine Nähe, und zeigten mir, durch Laute und Körpersprache, dass sie sich ausgesprochen wohl fühlten. Dabei quapscherten sie nicht selten leise, als ob sie mir etwas zu sagen hatten und nach einigen Minuten flogen sie wieder ab. Dies waren extrem intensive Momente und ich fände es wünschenswert, wenn auch andere Menschen diese Erfahrung machen würden. Vielleicht würde das die Empathie für die vergessenen Mitbewohner auf unserem Planeten ein wenig vergrößern?
Der kleine Krah
Meine tiefste Beziehung, die ich bisher zu einem Vogel hatte, war wohl die zu einem kleinen Eichelhäher. Wie ernsthafte Beziehungen sich nun einmal aufbauen, fand dieser Prozess nicht etwa von heute auf morgen statt, sondern im Verlaufe mehrerer Wochen. Vielleicht war es von mir aus gesehen auch schon Liebe auf den ersten Blick, hätte ich doch immer mal gerne einen dieser cleveren und verspielten Racker groß gezogen. Der kleine Eichelhäher war allerdings bereits ausgewachsen. Er war von einer Katze geschnappt worden und ein Flügel war im Gelenk gebrochen, so dass er nie wieder fliegen und in die Freiheit entlassen werden konnte.
Jungvögel in diesem Alter haben zumeist bereits Scheu vor dem Menschen entwickelt, wenn sie nicht durch diese aufgezogen wurden und selbst die meisten Zöglinge beginnen in diesem Alter auf Distanz zu gehen. So war auch der kleine Häher zunächst nicht besonders zutraulich, aber er war auch nicht gerade scheu. So hielt er sich anfänglich noch etwas auf Distanz, doch es dauerte nur wenige Tage, bis er langsam immer zutraulicher wurde.
Doch beginnen wir der Reihenfolge nach:
Anfang Juni 1996 klingelte abends um acht Uhr das Telefon. Eine Frau aus der Nachbarschaft meldete sich und berichtete aufgeregt, dass sie einen Eichelhäher aufgegriffen hatte, der nicht mehr richtig fliegen könne. Jetzt wisse sie nicht, was damit zu machen sei. Es handle sich um einen flüggen Jungvogel, der mit seiner Familie in der Siedlung unterwegs war und den sich offensichtlich eine Katze gegriffen hatte.
So sah ich mir den kleinen Patienten an und es stellte sich heraus, dass ein Flügel gebrochen war. So blieb mir nichts weiter übrig, als ihn mit nach Hause zu nehmen. Da sich die Nacht bereits näherte, bekam er nur noch etwas zu trinken und darauf wurde der Käfig verdunkelt, damit er sich zunächst einmal von seinem Schock erholen konnte. Der nächste Tag würde alles Weitere zeigen.
Bereits am frühen Morgen meldete sich der kleine Häher, er schien hungrig zu sein. Und obwohl der kleine Kerl noch recht scheu war, nahm er doch nach kurzer Zeit bereits die angebotenen Nahrungshäppchen vorsichtig aus den Fingern. Dazwischen gab er sanfte „Krah“ – Laute von sich. Eben diese Rufe waren es auch, die uns bereits so früh geweckt hatten. Und da er diesen Laut ständig von sich gab, je nach Gemütslage mal sanfter oder mal härter, hatte er auch schon seinen Namen: „Der Kleine Krah“.
Der Käfig, in dem er sich noch befand, wurde ihm sogleich zu eng, so dass er ständig gegen das Gitter flatterte. Also setzte ich den Kleinen Krah auf einem Board unterhalb des Fensters ab, wo früher einmal Kakteen wuchsen. Jetzt befand sich hier auf der ebenen Sandfläche meine Steinsammlung. Diese musste natürlich dem Vogel weichen, im Falle, dass er diesen Platz als sein neues Zuhause akzeptiert. Und tatsächlich schien ihm der Platz zu gefallen und sogleich unternahm er von hier aus seine Unternehmungen in die nähere Umgebung: Die umfasste das benachbarte Regal, eine Yukapalme, die benachbarte Heizung, sowie einen Gummibaum, der unterhalb der Zimmerdecke quer durch das Zimmer wuchs. Er wurde in der Folgezeit zu seinem bevorzugten Schlaf- und Ruheplatz. Damit waren die möglichen Aufenthaltsorte zunächst ausgeschöpft. Da sich seine Aktivitäten auch später im wesentlich auf diese Orte beschränkten, wurden diese mit Zeitungspapier gegen den anfallenden Kot abgesichert. Zu seiner Sicherheit wurden zudem alle Bereiche, wo die Gefahr eines Absturzes bestand, mit alten Decken und Kissen weich ausgepolstert.
So konnte der kleine Vogel in relativer Freiheit hier in Zukunft leben, ohne jedoch allzu viel Chaos anzurichten. Infolge seiner Flügelverletzung konnte sich der Vogel natürlich nur hüpfend fortbewegen, ansonsten hätte sich sein Aktionsraum mit Sicherheit auch sehr schnell vergrößert.
Noch war der Eichelhäher scheu und so war es erstaunlich, wie schnell er uns in nächster Nähe duldete, wobei er eine Fluchtdistanz von etwa einem Meter einhielt. Außerhalb dieser Zone konnten wir allerdings erstaunlich schnell auch hektischere Bewegungen durchführen. Auch die erste Fütterung in „Freiheit“ klappte verblüffend gut. Langsam näherte ich mich mit der Hand seinem Schnabel und reichte ihm auf diese Weise ein Hackfleischkügelchen entgegen, in welches kleine Daunenfedern eingearbeitet waren. Die Daunenfedern sind wichtig um die Bildung von Gewöllen in dem Vogelmagen anzuregen. Wie Greifvögel, so bilden auch die Krähenvögel, wozu auch der Eichelhäher zählt, Gewölle aus den unverdauten Nahrungsresten der Beute. Das können aber auch Chitinteile von Käfern etc. sein.
Anfangs zögerlich, begann der Kleine Krah schnell zu verstehen, dass diese Nahrung für ihn bestimmt war und so übernahm er Happen für Happen. Dabei nahm er die Stückchen in den Schnabel und rieb sie dann an einem Ast oder anderem Gegenstand. So blieb oftmals mehr als die Hälfte daran kleben. Später pickte er aber dann auch diese Reste auf, so dass letztendlich nichts verloren ging. Das Verhalten war natürlich bei den Hackfleischbällchen sinnlos, es ist aber dadurch zu erklären, dass die Nahrung des Eichelhähers häufig aus Raupen und anderen Insekten besteht. Indem die Vögel die Insekten an einem Gegenstand reiben, leeren sie den unappetitlichen Darminhalt der Beute und bei Stechimmen wird zusätzlich so der giftige Stachel aus dem Tier gequetscht.
Nachdem er die Fleischbällchen ausgequetscht hatte, schmiss er sie in die Luft, fing sie mit dem Schnabel wieder auf und schluckte sie. Auch mit den dargebotenen Mehlwürmern führte er diese Prozedur durch. Nach beendigter Mahlzeit wurde der Schnabel an einem Gegenstand geputzt, indem er ihn daran wetzte. Andere Vogelarten machen das nicht anders.
So hatte der kleine Vogel bereits am ersten Tag etwas Vertrauen zu uns gewonnen. Hunger und Neugierde begannen schon jetzt gegenüber der Furcht die Oberhand zu gewinnen.
Ein kleines Schälchen mit Wasser durfte selbstverständlich auch hier nicht fehlen. Dieses ignorierte er zwar zunächst, bis er durch Zufall hinein hüpfte. Nach einem kurzen Schreck bemerkte er offensichtlich, dass der Kontakt mit dem Wasser sehr angenehm ist. So verharrte er darin und begann mit den Flügeln im Wasser zu planschen. Dabei spritzte er das Wasser in hohen Bögen um sich herum. Nach einem ausgiebigen Bad und einigen großen Schluck Wasser, begann er sorgfältig sein Gefieder mit dem Schnabel zu pflegen.
Nach einer weiteren Fütterung ging es dann zum Tierarzt. Dieser stellte fest, dass der Flügel genau am Gelenk zwischen Hand- und Armflügelknochen gebrochen war. So war es fraglich, ob der kleine Vogel jemals wieder fliegen, und damit in die Freiheit entlassen werden konnte. Um den Flügel zu fixieren, musste der Vogel gegen seinen Wiederstand etwas härter angefasst werden und dieser Schreck saß ihm auch zu Hause noch in den Gliedern. Zudem konnte er jetzt den Flügel überhaupt nicht mehr bewegen, was ihm zunächst auch Gleichgewichtsprobleme bescherte. So wollte er zunächst nichts mehr fressen und gab sich scheu. Erst langsam beruhigte er sich wieder und am Abend ließ er sich dann auch wieder füttern.
Am frühen Morgen um 5:00 Uhr war die Nacht für den Kleinen Krah zu Ende. Er begann sogleich mit seinen üblichen Krah – Bettelrufen und so war auch für uns die Nacht zu Ende. Bei der anschließenden Fütterung fraß er mit großem Appetit und er hatte nur noch geringe Scheu vor uns. Zudem verzichtete er jetzt auch auf das sinnlose Reiben der Nahrung an Gegenständen, weshalb die Fütterung auch deutlich zügiger verlief.
In der Folgezeit wurde er dann zunehmend verspielter und begann mit allerlei Dingen zu experimentieren. So nahm er Steine, Federn, Wolle oder kleine Zweige mit dem Schnabel auf, ließ sie wieder fallen, begutachtete sie erneut mit schiefem Blick und nahm sie erneut auf. Das wiederholte sich so mehrere Male. Darauf gab er ein sanftes „krah“ von sich. Dann suchte er sich einen weiteren Gegenstand und die Experimente begannen aufs Neue.
Später nahm er dann sein erstes richtiges Bad. Wir hatten jetzt eine große Schüssel aufgestellt und begannen mit den Fingern im Wasser zu planschen, um den kleinen Krah aufmerksam auf dieses zu machen. Mit schief geneigtem Kopf sah er sich unser Handeln sehr genau an und mit einer zeitlichen Verzögerung von etwa zwei Minuten, hüpfte er dann zielstrebig auf den Rand der Schüssel. Zunächst spritzte er mit dem Schnabel das Wasser mehrmals in die Höhe, dann hüpfte er in das Wasser und spritzte mit dem Schnabel das Wasser rückwärts auf seinen Körper. Darauf intensivierte er das Bad, indem er mit dem verbliebenen Flügel in das Wasser schlug und so das Wasser auf sich spritzte. Er planschte so eine ganze Weile und es war ihm anzusehen wie wohl er sich dabei fühlte. Anschließend unternahm er dann ausdauernd die übliche Gefiederpflege. Die meisten Vogelarten baden häufig und gerne, wenn sie die Möglichkeit dazu haben und fast immer merkt man ihnen an, welchen Spaß sie dabei haben oder zumindest, wie sehr sie das Bad genießen.
Abends, mit Einsetzen der Dämmerung wurde der kleine Vogel dann unruhig. Es war die Zeit, als auch die Elstern draußen unruhig zu werden begannen. Wie hypnotisiert sah Krah immer wieder nach oben und aus dem Dachfenster hinaus und seine Aufmerksamkeit war kaum noch auf etwas anderes zu lenken. Darauf hüpfte er hektisch hin und her und visierte irgendwelche weit entfernten Punkte im Zimmer an, so als ob er diese jeden Moment anfliegen wollte. Und dann flatterte er tatsächlich los, wobei sein „Flug“ bereits nach kurzer Strecke und einem Absturz endete. Der kleine Vogel war durch nichts mehr zu beruhigen und hüpfte weiter hektisch umher. Schließlich verdunkelte ich das Fenster und sogleich begab sich der ängstliche Vogel an Ort und Stelle zur Ruhe.
An den beiden folgenden Abenden wiederholte sich dieses Spektakel, wobei er am dritten Abend den Gummibaum entdeckte, der bis zur Zimmerdecke rankte. Und als Krah oben angekommen war, beruhigte er sich sogleich. Hier wähnte sich der Vogel offensichtlich in Sicherheit. Auch bei vielen weiteren Pfleglingen hatte ich dieses Phänomen häufig beobachtet. Die Vögel wollen eben nun mal in sicherer Entfernung zum Boden nächtigen und suchen sich deshalb einen möglichst hoch gelegenen Platz, der aber auch Deckung bieten muss. In der Natur ist ein sicherer Schlafplatz schließlich überlebensnotwendig und auch vielen Wildvögeln merkt man selbst in ihrer natürlichen Umgebung eine gewisse Unruhe an, wenn es Zeit wird, den Schlafplatz zu wählen.
Der Kleine Krah hatte jetzt seinen optimalen Schlafplatz gefunden und von nun an hüpfte er diesen zielstrebig an, ohne nochmals in Panik zu geraten. Oben angekommen, brachte ihn anschließend nichts mehr aus der Fassung.
Am nächsten Tag begann ich die Steine von seinem Regalbrett zu entfernen und auf dem Boden neu zu ordnen. Krah beobachtete mich wie immer sehr genau und begann sich darauf ebenfalls für die Steine zu interessieren. Wie üblich fixierte er zunächst einen Stein mit schräg gehaltenem Kopf. Darauf versuchte er den Stein mit dem Schnabel hoch zu heben, was ihm aber nur bei den kleineren Steinen gelang. So transportierte er die Steine eine kurze Strecke, um sie darauf wieder fallen zu lassen. Eine geraume Zeit „unterstützte“ er mich so bei der Arbeit, bis er die Lust verlor und sich anderen Dingen zuwendete. So entdeckte er eine Fliege, die um seinen Kopf schwirrte. Aufmerksam folgte er mit dem Kopf jeder Flugbewegung des Insekts, was ziemlich komisch aussah, vor allem dann, wenn die Fliege schnelle Kreise vor seinem Kopf vollzog, so dass er kaum mehr zu folgen vermochte. Dann folgte er ihr zu Fuß, aber als ob er genau wüsste, dass er das flinke Insekt eh nicht fangen konnte, machte er keine Anstalten, sie zu schnappen. Anders verhielt sich das später mit Grashüpfern. Krah mochte sie nicht nur geschmacklich besonders gerne, auch die Jagd auf sie schien ihm sichtlich Vergnügen zu bereiten. Er war an fast allem Genießbaren interessiert, nahm aber alles, was er noch nicht kannte, zunächst vorsichtig in den Schnabel, legte es wieder ab und nahm es erneut, um es dann zunächst vorsichtig zu zerlegen. Darauf testete er den Geschmack um es anschließend zu verspeisen.
So bot ich ihm einen toten Mehlkäfer an, den er ebenfalls zunächst skeptisch auf die beschriebene Weise behandelte. Als er ihn dann endlich gefressen und bemerkt hatte, wie vorzüglich dieser schmeckt, hüpfte er erwartungsvoll auf mich zu und sah mich interessiert und erwartungsvoll an. Ich hatte aber keinen weiteren zur Verfügung und so bot ich ihm ein Apfelstückchen an, für das er allerdings nur wenig Interesse zeigte, wenngleich Eichelhäher durchaus auch gerne Obst fressen.
Wenn er sich nicht gerade ausruhte, war der kleine Kerl eigentlich immer aktiv und machte dabei einen ausgesprochen selbstzufriedenen Eindruck. Ihm schien es fast nie langweilig zu werden und immer fand er etwas Neues, mit dem es sich zu experimentieren lohnte. Zumeist beschränkten sich seine Tätigkeiten darauf, die Gegenstände zu nehmen und irgendwo hin zu tragen und wieder abzulegen. Oder er versuchte sie auseinander zu pflücken und selbstverständlich auch immer auf ihre Genießbarkeit zu prüfen. Währenddessen gab er glucksende und leise zwitschernde Laute von sich, die den vergnüglichen Eindruck noch unterstrichen.
Als ich darauf ebenfalls leise zwitschernd zu pfeifen begann, legte er seinen Kopf in die übliche, interessierte Schieflage und sah mich an. Er hielt ganz ruhig inne, hielt den Kopf mal auf die eine, dann auf die andere Seite, sah mich weiter an und hörte dabei aufmerksam zu. Es schien ihm sichtlich zu gefallen und zu interessieren. Dann plusterte er sich ganz allmählich immer stärker, und ging in die Hocke. Das Plustern ist bei Vögeln immer ein untrügliches Zeichen, dass sie sich wohl fühlen, wenn es im Zusammenhang einer Interaktion vollzogen wird. Und so schloss er nach einiger Zeit des stillen Sitzens in meiner unmittelbaren Nähe langsam die Äuglein und schlief für kurze Zeit ein. Als er wieder erwachte, gab er einige zaghafte Laute von sich.
In den Nachmittagstunden brachten wir aus dem Wald ein Stückchen Haarmützen-Moos, Eicheln und Buchäcker mit und sogleich kam der kleine Kobold interessiert an und pickte an dem Moos herum. Die Samenstände hatten es ihm zunächst besonders angetan. So pickte er an ihnen und überprüfte ihre Genießbarkeit. Darauf inspizierte er die Blattzweige. An diesen konnte er das Moos auch sehr schön hochheben. So hob er, wie üblich, das Moos mehrere Male hoch und ließ es wieder fallen. Dann trug er das Moos zum Rande seines Boards, ließ es fallen und sah neugierig hinter her – plumps machte es beim Aufschlag auf den Boden. Darauf wiederholte er das Experiment mit dem zweiten Moosballen und wieder sah er dem fallenden Objekt neugierig hinter her. Dann war ein vertrockneter Pflanzenstengel, ein Blatt und ein Kiefernzapfen an der Reihe. Und jedes Mal der neugierige Blick hinterher. Es schien als experimentiere er mit dem Gesetz der Schwerkraft. Waren es nun die unterschiedlichen Flugeigenschaften der Objekte, die ihn interessierten oder das unterschiedliche Geräusch des Aufschlags, oder beides? – Jedenfalls war die Variation der Gegenstände und der äußerst interessierte Blick des Vogels, bis zum Aufschlag, nicht zu übersehen. Darauf beförderte er ein Apfelstück in die Tiefe und zu guter Letzt noch einen Mehlwurm.
Dann inspizierte er den Margarinebecher, in dem die Kartoffelstücke aufbewahrt waren. Als er daran klopfte, gab dieser ein schönes resonantes Geräusch von sich. Interessiert blickte er den Becher an, dann wiederholte er mehrmals das Klopfen an dem Becher.
Auch begann der Kleine Krah jetzt Nahrungsdepots anzulegen, wie das ja für Rabenvögel allgemein bekannt ist und so versteckte er während der Fütterungen immer wieder einige Fleischbrocken. Vor allem, wenn er bereits einigermaßen satt war, begann er eine ausgeprägte Bunkertätigkeit zu entwickeln. Generell dauerten die Fütterungen des Kleinen Krah ausgesprochen lange und erforderten nicht wenig Geduld, es sei denn, er war sehr hungrig. Das Spiel mit der Nahrung darf allerdings nicht nur als bloßes Spiel angesehen werden, sondern war eben für den heranwachsenden Vogel auch ein notwendiger Lernprozess, um den Umgang mit der Nahrung zu erlernen und vor allem auch genießbare Nahrung von ungenießbarer unterscheiden zu lernen.
Als ich mich etwas später hinlegte um ein bisschen auszuruhen, begab er sich neben mir zur Ruhe, plusterte sich, zog seinen Kopf in das Gefieder und döste, bis ich mich streckte, um wieder aufzustehen. Sogleich streckte auch der Kleine Krah seinen gesunden Flügel und stand ebenfalls auf. Langsam schien der, normalerweise in der Geselligkeit von Artgenossen lebende Vogel, offensichtlich uns als seine Gruppe anzusehen.
In den Abendstunden kam es dann erstmals zu einem Austausch von Zärtlichkeiten: Als Astrid sich bückte um dem Kleinen Krah geriebene Nüsse schmackhaft zu machen, indem sie so tat, als wolle sie diese verzehren, kam der Kleine Krah sogleich hinzu und verzehrte seinerseits sogleich die bislang für ihn unbekannte Kost, ohne zunächst damit zu spielen. Dann interessieren ihn ihre Augenwimpern, die sich immer wieder bewegten. Ganz vorsichtig zupfte er mehrmals an diesen und darauf an den Haaren.
Etwas später wiederholte er das Gleiche bei mir, wobei ihn hier noch zusätzlich die Brille interessierte.
Am 11. Juni, der Kleine Krah war jetzt bereits sechs Tage bei uns, kam er das erste Mal bei einer Fütterung zu mir herunter auf den Boden und nahm direkt vor mir einen Mehlwurm auf. Und als ich mich zu ihm herunter beugte, zupfte er erneut an meinen Haaren und an meinem Sweatshirt.
Wenig später flog Lücke, das Rotmilanmännchen, an welchem ich seit diesem Jahr systematische Beobachtungen durchführte, tief über das Haus. Darauf sah der Kleine Krah wie gebannt nach oben und verhielt sich ganz ruhig. Auch die Warnrufe von den Spatzen und anderen Singvögeln um das Haus registrierte der Kleine Krah sofort und sah dann zumeist ganz erschrocken zum Fenster hinaus oder flüchtete in eine Ecke.
In den folgenden Tagen begann der Kleine Krah immer häufiger ausdauernd und mit zunehmender Lautstärke vor sich hin zu zwitschern, was wie ein leises Gequatsche klang. Vor allem und mit besonderer Intensität sang er immer dann, wenn eine Maschine dröhnte, so z.B. die Waschmaschine oder draußen ein Rasenmäher.
Der Kleine Krah war da kein Einzelfall, auch zahlreiche meiner weiteren Pfleglinge sangen immer dann mit besonderer Intensität und besonders gehäuft. Man konnte das bei vielen Vögeln schon mit absoluter Sicherheit vorhersagen und kaum begannen die Maschinen zu dröhnen, so ließ das vergnügliche Gequatsche des Kleinen Krah (wie auch vieler weiterer Pfleglinge) nicht lange auf sich warten. Dabei sah er verklärt in die Umgebung.
Seine Gesangsaktivitäten nahmen in der Folgezeit immer mehr zu und er sang dann nicht selten eine halbe Stunde und länger, ausdauernd und mit großer Intensität. Dabei entwickelte er einen unglaublichen Einfallsreichtum und eine ungemeine Variationsbreite, so dass keine Strophe der anderen glich. Auch baute er zunehmend Geräusche, die er hörte in seine Lieder ein. So konnte er verblüffend gut einen Hund aus der Nachbarschaft nachahmen, der ein ganz eigenartiges Bellen an den Tag legte. Der Kleine Krah imitierte dies so täuschend, dass ich oftmals auf ihn herein fiel.
Noch immer war eine seiner Lieblingsbeschäftigung das Fallenlassen verschiedener Gegenstände von seinem Board und das interessierte Beobachten des Fallvorgangs. So war der Bereich unter dem Board ständig übersät mit zahlreichen Dingen, wie Nüsse, Zweige, Federn, Mehlwürmer, Eicheln, Kieferzapfen, Papier, Apfelstückchen, etc.
Auch an Eicheln zeigte er ein besonderes Interesse und versuchte sie zu knacken. Als das nicht gelang, hämmerte er mit dem Schnabel auf sie ein, was aber auch nicht zum gewünschten Erfolg führte. Das Erkennen einer Eichel schien ihm angeboren zu sein, und ebenso wusste er instinktiv, dass er sie knacken musste. Die richtige Technik schien er dagegen erst erlernen zu müssen.
Nach etwa 10 Tagen fraß der Kleine Krah auch selbständig und so konnten wir ihn hin und wieder auch etwas länger alleine lassen. Allerdings erschien er, nach längerer Abwesenheit jedes Mal auf das Neue, zunächst auffällig scheu. Er hüpfte dann bei unserer Rückkehr aufgeregt auf seinem Board hin und her, wobei er sich auch wieder schnell beruhigte, vor allem wenn er gefüttert wurde. Obwohl er jetzt selbständig fraß, ließ er sich noch immer gerne füttern. Sein Appetit war inzwischen unglaublich angewachsen und so verzehrte er an einem Tag etwa 150 Mehlwürmer und einen kleinen Hackfleischklumpen. Oder etwa dieselbe Menge adäquater Nahrung. Seine neueste Erfindung war jetzt, die bereits gefressenen Nahrungshappen wieder hervor zu würgen – was ihm keine besondere Anstrengung abverlangte - um nochmals damit zu spielen, bis er sie endgültig verschlang. So tauchten auch immer wieder Mehlwürmer auf, die infolge der starken Magensäure natürlich längst tot, aber äußerlich noch unversehrt waren.
Seine Exkursionstätigkeiten hatten inzwischen etwas zugenommen und zwei Mal war er mir bereits hüpfend in das Wohnzimmer gefolgt. Allerdings bewegte er sich auf dem Boden nur ungern und suchte dann schnell wieder eine erhöhte Position einzunehmen. Dabei erklomm er dann erstmals meinen Rücken, als ich am Boden saß und mich bückte und arbeitete sich flatternd bis auf die Schulter.
Anfang Juli, der Kleine Krah war jetzt etwa einen Monat bei uns, trat in seinem Verhalten ein auffälliger Wandel ein. Sein geschienter Flügel war wieder frei und so konnte er sich jetzt deutlich besser bewegen und auch kleine Strecken im flatternden Flug zurücklegen. Es war aber klar, dass er nie wieder würde richtig fliegen können. So durfte er sich jetzt ein wenig freier in der Wohnung bewegen, wobei er sich im Wohnzimmer zunächst noch ziemlich ängstlich verhielt. Zu neu war dieser Lebensraum für ihn. Und der Kleine Krah war, wie alle Vögel, darauf bedacht immer seine Fluchtpunkte zu haben, die er bei einer potentiellen Gefahr auch sogleich ansteuern konnte.
Dennoch zog es ihn zunehmend mehr in das Wohnzimmer, wenn auch wir uns dort aufhielten. Er hatte sich inzwischen sehr an uns gewöhnt, suchte immer häufiger unsere Gesellschaft und wollte immer weniger alleine sein. Bislang zeigte er uns gegenüber keine besonderen Präferenzen, er mochte uns beide etwa gleich gern, bis sich dann Anfang Juli folgendes zutrug:
Als mir der Kleine Krah wieder einmal aus seinem Zimmer in das Wohnzimmer folgte, setzte ich mich zu ihm auf den Boden, sah ihn an und pfiff in der Art und Weise, wie er es auch immer tat, allerlei improvisierte zwitschernde und flötende Strophen, ähnlich einer singenden Amsel. Der Kleine Krah sah mich aus unmittelbarer Nähe mit schiefem Blick an, plusterte zunehmend sein Gefieder und nahm allmählich eine sitzende Haltung ein. Behaglich sah und hörte er mir zu, wie er das auch schon zuvor hin und wieder getan hatte. Da mein Gesicht nur wenige Zentimeter von seinem Gesicht entfernt war, registrierte ich seinen lieben, ja ich möchte fast sagen, verliebten Blick mit besonderer Intensität. So ließ auch ich mich auf den kleinen Vogel ein, wie selten zuvor. Ich war ganz im Moment und bei der Sache, bzw. bei dem Kleinen Krah und verspürte vielleicht zum ersten Mal, wie tief man sich auf Tiere einlassen kann, wenn einmal alle Gedanken zum Erliegen kommen und man nur noch im hier und jetzt ist. Erst dann, wenn der Kopf ganz leer ist, beginnt sich ein wirkliches Verständnis seinem Gegenüber einzutreten und man beginnt ihn so zu sehen wie er wirklich ist. Mir wurde, wie noch nie bewusst, welch sensibles und fühlendes Wesen mir da gegenüber saß und mich mit verklärtem Blick ansah. So saßen wir eine lange Zeit, während der ich ununterbrochen improvisierte Melodien und Strophen zwitscherte. Und je sanfter der Blick des Vogels wurde, desto sanfter wurden auch meine Melodien. Das war tatsächlich einer der ergreifendsten Momente in meinem Leben und erstmals hatte ich wirklich das Gefühl Einblick in die Psyche eines Vogels zu erhalten. Ab da änderte sich nicht nur mein Verhältnis zu dem Kleinen Krah fundamental, sondern auch allgemein zu Vögeln. Mir wurde schlagartig bewusst, dass Vögel eine ebensolche Psyche und ebensolche Emotionen haben, wie auch Hunde oder Katzen. Nur sind Vögel uns viel fremder und von daher auch schwerer zu verstehen, weshalb sich ihre Psyche uns auch viel seltener offenbart.
Nach diesem Erlebnis begann der Kleine Krah sich sehr schnell auf mich zu fixieren. Wenn ich nur kurz das Zimmer verließ, begann er sogleich mit dem üblichen Krah nach mir zu rufen. Und kehrte ich nicht zurück, so folgte er mir. So wurde er jetzt auch sehr schnell mit dem anderen Zimmer vertraut, wo er am liebsten auf meiner Schulter saß. Wenn ich dann den Standort wechselte, so blieb er einfach sitzen oder hüpfte auf meinen Kopf und ritt auf mir durch die Wohnung. Zwar wurde er jetzt auch zu Astrid vertrauter und verweilte hin und wieder auf ihrer Schulter, doch bevorzugte er ganz eindeutig meine Person. Und so rief er mir auch nach, wenn ich das Zimmer verließ, während Astrid ihm noch Gesellschaft leistete. Ihr rief er hingegen nur selten hinterher. Auch stellte sich in der Folgezeit heraus, dass er insgesamt eine größere Präferenz für Männer entwickelte, als für Frauen. Ob er ein Männchen oder Weibchen war, konnten wir unterdessen nie feststellen.
So verbrachte er jetzt auch viel Zeit auf meiner Schulter, was mir die Sache sehr erleichterte, da ich mich frei bewegen konnte und der Kleine Krah dennoch zufrieden war, da in meiner Gesellschaft. Von meinem Rücken aus unternahm er dann kleine Exkursionen in die Umgebung um bald wieder auf die sicheren Schultern zurückzukehren. Dort spielte er mit meinen Haaren und verbunkerte dort oder in meinem Pullover allerlei Dinge. Oder er inspizierte meine Ohren und alles andere, was so auf meinem Kopf wuchs. Dabei ging er stets ganz sanft und vorsichtig vor. Natürlich musste er auch alles testen, was ich so zu mir nahm. Dies erweiterte sein Nahrungsspektrum natürlich ungemein, bis hin zu weniger gehaltvoller Nahrung, wie Nippen an meinem Kaffee.
Insbesondere der Kaffedampf, bei noch heißem Kaffee hatte es ihm angetan. Dann setzte er sich vor die Tasse, öffnete die Flügel und beugte sich mit ausgestrecktem Körper über den Kaffedampf, was stets sehr lustig aussah. Aber ebenso suchen die wilden Eichelhäher die Haufen der Waldameisen auf, um in gleicher Haltung sich von den Ameisen mit Säure bespritzen zu lassen. Ich glaube man nennt dies Emsen. Jedenfalls tötet die Ameisensäure die Parasiten ab, die sich im Gefieder der Vögel aufhalten können. Der Kaffeedampf hat wahrscheinlich nicht die gleiche Wirkung, da müsste er schon sehr heiß sein, doch hatte der Kleine Krah in der Wohnung auch keine Parasiten.
Natürlich konnte ich den Kleinen Krah auch stets ein wenig liebevoll ärgern, aber als kleiner Schalk verstand er das auch. Immer öfters musizierten wir zusammen, wobei wir abwechselnd oder gemeinsam zwitscherten, oder einer dem anderen einfach nur zuhörte. Immer noch reagierte er genauso intensiv und mit verliebtem Blick, wenn ich ihm ausdauernd aus nächster Nähe sanfte Melodien vorzwitscherte. Unser beider Repertoire an improvisierten Strophen wuchs dabei schnell an, auch ahmten wir uns gegenseitig verschiedene Strophen immer wieder nach.
Eichelhäher sind ja dafür bekannt, dass sie hervorragend Laute und Melodien nachahmen und der Kleine Krah war ein Meister darin. Besonders eine schnelle, erst absinkende und dann ansteigende Tonabfolge, die ich erfunden hatte, hatte es ihm angetan und diese zwitscherte er, auch wenn er alleine sang, immer wieder, eingebettet in seine sonstigen Melodien. So konnte er sich jetzt bis zu einer Stunde und länger mit Singen beschäftigen, wenn er alleine war undsein Konzert wurde auch dann nicht langweilig. Ständig erfand er neue Elemente oder baute irgendwelche Melodien ein, die er irgendwann einmal gehört hatte. So konnte von einem typischen Eichelhäher- Gesang nicht mehr die Rede sein, denn immer wieder tauchten auch kurze Strophen von Kinderliedern oder sonstige, dem Menschen nachgeahmte Geräusche auf und sein Gesang oder Gezwitscher muteten ungemein sanft und manchmal fast ein bisschen melancholisch an. Mitunter lag das sicherlich daran, dass auch ich gerneMelodien in Moll verwendete, wenn ich ihm sanfte „Liebesliedchen“ vortrug.
Der kleine Vogel behielt seinen verspielten Charakter, auch als er als ausgewachsen gelten durfte. Wir hatten ihm inzwischen ein großes Board unter dem Fenster gebastelt, bzw. das alte Board, in dem früher ja einmal die Steine lagen, beträchtlich erweitert. Hier hatte er jetzt Äste zum klettern und hüpfen. Es war mit allerlei Blättern, Zweigen und sonstigen interessanten Materialien angefüllt, so dass er noch mehr Beschäftigung finden sollte, als zuvor. So fühlte sich der kleine Kerl auch hier sehr schnell wohl und in erhöhter Lage auch in Sicherheit, so dass er sich auch gerne in der Voliere aufhielt, obwohl diese fast nie geschlossen war.
Am frühen Morgen weckte er mich stets mit intensiven Gesang, der schnell lauter wurde,