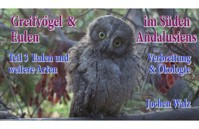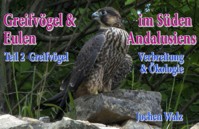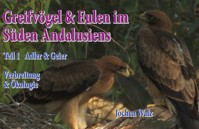
8,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Der Autor hat in weiten Bereichen der Provinz Málaga und in Teilbereichen der Provinz Cádiz die verschiedenen Greifvogelarten systematisch kartiert. Mit den Resultaten, die in den folgenden drei Bänden dargestellt wurden, kann der naturinteressierte Beobachter sich ein ernsthaftes Bild darüber machen, wie die Greifvögel, Geier und Eulen heute in den Provinzen Málaga und Cádiz verbreitet sind und in welcher Siedlungsdichte. Oftmals handelt es sich dabei nicht um die stets angepriesenen Naturgebiete, sondern um extensiv genutzte Kulturlandschaften, die zumeist wenig Beachtung finden. Neben der Verbreitung der Greifvögel, Geier und Eulen befassen sich die drei Bände kritisch mit deren Bestandsentwicklung und Gefährdung. Daneben informieren die Bände ausführlich über die Lebensräume und Lebensweise, Verhalten, Nahrung/ Jagdweise, Jagdrevier/ Aktionsraum, Balz/ Balzflüge, Interaktionen, Zug/ Überwinterung und Leben im Verlauf des Jahres/ Brut und Nachwuchs. Neben der Recherche aus der Literatur, wurden auch die Erkenntnisse eigener Beobachtungen und Untersuchungen angeführt, die an zahlreichen Greifvogel- und Eulenarten durchgeführt wurden. Daneben wurden Daten und Erkenntnisse aus Deutschland berücksichtigt. Entsprechend sind die drei Bände auch für all diejenigen von Interesse, die mehr über Greifvögel wissen möchten, unabhängig von Landesgrenzen. Zahlreiche Fotografien von den Greifvögeln/ Eulen sowie von ihren Lebensräumen, illustrieren anschaulich die Artkapitel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Greifvögel, Eulen und einige weitere bemerkenswerte Vogelarten in den Provinzen Málaga und Cádiz, ein Vergleich mit Mitteleuropa/ Baden Württemberg
– Teil 1 Adler und Geier
Kapitel
Einleitung
Die Untersuchungsbereiche
Fischadler (Pandion haliaetus)
Schmutzgeier (Neophron percnopterus)
Gänsegeier (Gyps fulvus)
Mönchsgeier (Aegypius monachus)
Schlangenadler (Circaetus gallicus)
Zwergadler (Hieraaetus pennatus)
Spanischer Kaiseradler (Aquila adalberti)
Steinadler (Aquila chrysaetos)
Habichtsadler (Aquila fasciata)
Literatur
Einleitung
Noch immer gibt es in der Literatur und Internet keine weiterführende Informationen über die Natur Süd- Andalusiens mit den dort vorkommenden Greifvogelarten, wie sie leben, ihre Verbreitung, Siedlungsdichte oder Bestandentwicklung.
Die vorliegenden drei Bände wollen diese Lücke schließen, indem der Autor in weiten Bereichen der Provinz Málaga und in Teilbereichen der Provinz Cádiz die verschiedenen Greifvogelarten systematisch kartiert hat. Mit den Resultaten, die in den folgenden drei Bänden dargestellt wurden, kann der naturinteressierte Beobachter sich ein ernsthaftes Bild darüber machen, wie die Greifvögel, Geier und Eulen heute in den Provinzen Malaga und Cadiz verbreitet sind und in welcher Siedlungsdichte. Oftmals handelt es sich dabei nicht um die stets angepriesenen Naturgebiete, sondern um extensiv genutzte Kulturlandschaften, die leider in enormer Geschwindigkeit entwertet und in Intensivkulturen umgewandelt werden, welche Tieren keinen Lebensraum mehr bieten. Entsprechend haben auch viele Greifvogel- und Eulenarten in ihren Beständen teils drastisch abgenommen. Andere Arten, wie Schlangen- oder Zwergadler haben hingegen von dem Jagdverbot profitiert und stark zugenommen.
Neben der Verbreitung der Greifvögel und Eulen befassen sich die drei Bände kritisch mit deren Bestandsentwicklung und Gefährdung. Daneben informieren die Bände ausführlich über Ökologie, Lebensraum und dessen Nutzung, Jagdreviere/ Aktionsräume, Nahrung, Verhalten, Zug/ Überwinterung und Brutgeschehen im Verlauf des Jahres. Neben der Recherche aus der Literatur, wurden auch die Erkenntnisse eigener Beobachtungen und Untersuchungen angeführt, die innerhalb der letzten 12 Jahre an vielen Greifvogel- und Eulenarten durchgeführt wurden.
Daneben wurden auch Daten und Erkenntnisse aus Deutschland berücksichtigt. Entsprechend sind die drei Bände auch für all diejenigen von Interesse, die mehr über Greifvögel wissen möchten, unabhängig von Landesgrenzen.
Die Artkapitel fallen in unterschiedlicher Länge aus, je nachdem, wie häufig eine Art in Süd- Andalusien anzutreffen ist und wie umfassend Erkenntnisse über die Art gewonnen werden konnten. Zahlreiche Fotografien von den Greifvögeln und Eulen sowie von ihren Lebensräumen, illustrieren anschaulich die Artkapitel. Daneben wurden im dritten Band noch weitere interessante Arten angeführt, wie einige Rabenvogel- Arten, Rothals- Ziegenmelker, Kraniche, Flamingos, etc.
Die Untersuchungsbereiche
Das Untersuchungsgebiet wurde in drei unterschiedlich intensiv bearbeitete Bereiche untergliedert. Am intensivsten wurden die beiden Flächen von 154 km² und 250 km² westlich Málaga untersucht, wobei letztere nur eine Erweiterung der 154 km² Fläche darstellt. Sie wurden bei vielen Arten flächendeckend kartiert. Bei manchen, sehr häufig vorkommenden Arten, wurden auch geringere Bezugsflächen gewählt, die dann gesondert angegeben wurden. Der zweite, weniger intensiv untersuchte Bereich umfasst einen großen Teil der Provinz Málaga mit 1500 km². Zerstreut siedelnde Arten, mit geringer Siedlungsdichte, wie z.B. Gänsegeier, Habichts- oder Steinadler wurden hier intensiv kartiert, während häufiger vorkommende Arten, wie z.B. Schlangen- oder Zwergadler hier eventuell nicht vollständig erfasst wurden und unauffälligere Arten, wie z.B. Turmfalke, mit Sicherheit nicht vollständig erfasst wurden.
Die dritte Untersuchungseinheit stellt Flächen dar, die punktuell außerhalb der dargestellten Untersuchungsfläche liegen. Sie wurden bislang nur für einige ausgewählte Arten intensiver untersucht, mit der Absicht Tendenzen darzustellen.
Die Haupt- Untersuchungsfläche von 250 km²
Die Untersuchungsfläche umfasst 250 Km² und liegt westlich Málaga, im Bereich zwischen Coín, Monda, Tolox, Yunquera und Alozaína. Der Bereich des Untersuchungsgebietes umfasst im Wesentlichen extensiv genutzte Oliven- und Mandelbaumhaine. Die Bäume stehen weitständig, zum Teil handelt es sich um sehr alte Bäume. Der Unterwuchs ist zum Teil licht und niedrigen Wuchses, kann aber im Verlaufe des Frühlings eine stattliche Höhe erreichen. Doch die meisten Parzellen werden zuvor gepflügt und so ist ein Großteil der Parzellen bereits im Frühjahr ohne Bewuchs. Dieser wächst bei der darauf folgenden Dürre bis zum Herbst auch nicht mehr nach. Daneben gibt es überall kleine Bereiche mit Felsen und Geröllen, sowie Gebüsche und Wildwuchs. Die häufigen Hangrunzen sind dicht mit Bäumen und Gebüschen bewachsen. Einzelstehende Kork-, Steineichen und Kiefern, oder auch Baumgruppen, bieten zusätzlichen Lebensraum. Die ökologische Vielfalt wird dadurch ungemein erhöht.
Auf den schlechteren Böden werden Mandelhaine kultiviert. Die licht stehenden Bäume geben den Greifvögeln genügend Raum zur Jagd. Die Unterkultur besteht aus artenreichen Halbtrockenrasen, die kurz beweidet werden und im Mai absterben, so dass auch hier potentielle Beute aus der Luft gut sichtbar ist. Dennoch gibt es für diese genügend Strukturen, die Deckung und Lebensraum bieten, wie ausgedehnte Gebüsche oder aufgelassene und verbrachte Mandelbaumhaine, sowie Maccien, bzw. Matorral.
Die Vorberge nördlich der südlichen Küstengebirge sind zumeist bewaldet. Hier nisten zahlreiche Greifvogelarten, die im nördlich anschließenden, reich strukturierten Kulturland jagen.
Am westlichen und südlichen Rand der Untersuchungsfläche steigt das Relief an und auf den Vorbergen der Sierra Alpujata und Sierra Blanca im Süden und der Sierra de las Nieves und Sierra Prieta im Westen, wachsen ausgedehnte Pinienwälder und darunter häufig (zumeist dichte) Maccie. Darauf folgen die Hochgebirgsketten der Sierra Alpujata, S. Blanca, S. Tolox, S. Nieves und S. Prieta, die aus sehr harten, metamorphen Gesteinen gebildet wurde, im Süden aus Peridoditen und Marmor und im Westen aus Kalksteinen und Marmor, bewachsen mit Maccie und einigen Kiefernwäldern, sowie weiter oben Garigue.
Dunkelgrün: die bewaldeten Gebirge in Süden und Westen. Grau: unbewaldete Felsbereiche der Gebirge. Hellgrün: die daran anschließenden Hügel, die zumeist extensiv mit Oliven- und Mandelbaumhainen kultiviert wurden, mit zahlreichen Wildwuchsflächen und eingestreuten Eichen- und Kiefernbeständen (u.a. als Nistbäume von Greifvögeln genutzt). Daneben in der Bildmitte bis obere Bildmitte die Flussaue des Rio Grande mit einem großen Vorkommen an Zwergadlern (ZA). Braun: Acker- und Wiesenlandschaft). Gelbe Linien: wichtige Straßen. Rote Punkte mit Namen: Ortschaften.
Die Verbreitung der Greifvogelarten wurde mittels der Methode der Revierkartierung durchgeführt. Dabei wurde mittels zahlreicher Übersichtspunkte der gesamte Bereich nach revieranzeigenden Greifvogelarten abgesucht, zumeist in 2- 3 oder mehr Durchgängen. Eulen wurden mittels akustischer Wahrnehmung (Revierrufe) kartiert, in 2- 3 Durchgängen, wobei der Bereich so gut wie flächendeckend kartiert wurde.
Die Kartierungsergebnisse wurden in eine Karte übertragen, mittels Verkleinerung der bestehenden Google Datei gingen in der dargestellten Karte allerdings einige Reviere verloren, die verbliebenen Standorte nur vage angegeben. Sinn der Darstellung ist aber auch nur, das Verbreitungsmuster der verschiedenen Arten darzustellen und dem Vogelbeobachter oder Naturschützer ein Gefühl über die Verbreitung der Arten zu geben.
In den Artenkapiteln wird nicht weiter auf die Verbreitungskarten verwiesen, aber für folgende Arten kann es sinnvoll sein, sich die Karten näher zu betrachten: Schlangenadler (SA), Zwergadler (ZA), Habichtsadler (HA), Steinadler (STA), Uhu (UH), Mäusebussard (MB), Habicht (HB), Sperber (SP), Wanderfalke (WF), Turmfalke (TF), Rötelfalke (RF), Kolkrabe (R), Alpenkrähe (AK), Gänsegeier (GG), Schmutzgeier (SG).
Die erweiterte Untersuchungsfläche von 1500 km²
Die Grenzen der erweiterten Untersuchungsfläche folgen im äußersten Südosten dem Hauptkamm der Monte Mijas, so dass deren Südflanke nicht mit inbegriffen ist. Nach Westen verläuft diese entlang des Hauptkamms der Sierra Alpujata, wobei in der gesamten Südabdachung keine Greifvögel mehr horsten können, da sie vollständig abgebrannt ist. Dafür ist die Siedlungsdichte in den nördlich anschließenden Vorbergen umso höher. Darauf verläuft die Grenze nach Süden, dem Tal von Ojén folgend, bis zu den Fußhängen der Sierra Blanca und diesen folgend nach Westen, bis zum Tal des Rio Verde bei Istán. Dort dem Tal folgend nach Nord, zwischen Sierra Blanca und Sierra Real und dann nach NNW, dem Tal des Rio Verde folgend, bis zum Torrecilla. Dort in gedachter Linie folgend, bis zum Gipfel und nach Nord, weiter der Gipfellinie folgend, bis zum Rio Turón und Ostflanke der Sierra Blanquilla. Von dort in gedachter Linie nach Nord, bis zum westlichen Ende der Sierra Ortegicar. Von deren Nordende nach NO bis Teba und von dort in gedachter Linie nach Ost, bis zur El Torcal Nordwand und dieser folgend bis zum Ostende. Dann bis Villa Nueva de la Concepción und von dort in gedachter Linie bis Valle de Abdalajis. Von dort der Strasse folgend, bis Álora. Von dort in gedachter Linie bis Cártama Estación Ostende und von dort nach Süd, bis Alhaurín de la Torre Westende und gerade weiter, bis zur Montes Mijas mit dem Castillejo. Von dort den Gipfeln folgend wieder nach West.
Innerhalb der erweiterten Untersuchungsfläche ist das durchschnittliche Vorkommem an Greifvögeln pro Fläche insgesamt geringer, da weite Bereiche von dichten Wäldern, hochwüchsiger Maccie, oder in der Ebene monotone Ackerlandschaften, sowie weite Bereiche ohne Vorkommen an potentiellen Nistbäumen eingenommen werden. Ausnahmen bilden Arten wie Steinadler, Habichtsadler, Wanderfalke oder Gänsegeier, die hauptsächlich oder ausschließlich in den Gebirgen nisten und z.T. große Jagdreviere bearbeiten. Ihr Brutbestand erstreckt sich entlang der Gebirge im Süden, Westen und Norden des Untersuchungsbereiches. Der Uhu, ebenfalls überwiegend ein Brutvogel der Felswände, hat seine größten Vorkommen hingegen im Hügelland. Dort befindet sich auch insgesamt die größte Greifvogel- und Eulendichte, an den Gebirgsrändern, wo die oben beschriebenen Mandelbaum- und Olivenhaine für viele Arten günstige Jagdhabitate darstellen. Häufig grenzen daran oberhalb, in den unteren Lagen der Gebirge, ausgedehnte Kiefernwälder, die von zahlreichen Greifvogelarten, wie Habicht, Sperber, Mäusebussard, Zwergadler oder Schlangenadler als Bruthabitat genutzt werden, in hoher Siedlungsdichte entlang der südlichen und westlichen Gebirgszüge.
Entlang des nördlichen Gebirgszuges von El Chorro bis El Torcal fehlen letztgenannte Arten hingegen weitgehend. Die Gebirge sind in weiten Bereichen entwaldet und bieten nur gebietsweise Nistmöglichkeiten. Nördlich und in weiten Bereichen auch südlich an das Gebirge grenzen überwiegend monotones Ackerland oder Olivenplantagen, die potentieller Beute kaum Lebensraum bieten. Nördlich des Gebirges wird Ackerbau in großem Stil betrieben. Daneben dominieren Oliven- Plantagen, größere Bäume, die Horste tragen könnten, fehlen in weiten Bereichen.
Der Bereich südlich von El Chorro bis El Torcal ist weitgehend frei von größeren Bäumen, weshalb hier kaum Greifvögel siedeln.
Südlich des Gebirges, in Richtung Almogía ist das Vorkommen an Greifvögeln ebenfalls gering. In dem nur extensiv genutzten Hügelland, das überwiegend mit Mandelbaumhainen kultiviert ist, wären zwar günstige Jagdflächen und Beute für zahlreiche Greifvogelarten vorhanden, doch fehlen hier größere Bäume und Wälder, aber auch Felsen, die als Niststandort in Frage kommen könnten. In diesem ausgedehnten Bereich könnte der Greifvogelbestand mit geringem Aufwand, durch Pflanzung einiger Pinien langfristig stark angehoben werden. Dies unterstreicht das Beispiel der östlich angrenzenden Montes Málaga. Diese ausgedehnte Waldinsel liegt inmitten der östlichen Fortsetzung dieses überwiegend mit Mandelbäumen kultivierten Hügellandes und Schlangen- wie Zwergadler haben dort eine der größten Siedlungsdichten innerhalb der Provinz Málaga, da in dem angrenzenden Kulturland mit Mandelbaumhainen, das sie als Jagdgebiet nutzen, weitere Nistmöglichkeiten fehlen.
Auch in der Ackerbauebene nördlich Coín, bis in den Bereich um Álora und östlich Caserabonela, ist die Greifvogeldichte sehr gering, infolge ausgedehnter Ackerlandschaften, mit nur wenigen stattlichen Bäumen.
Große Vorkommen an Greifvögeln und Eulen siedeln hingegen innerhalb der Auen von Rio Grande und Rio Guadalhorce, häufig in den Eukalyptusbaumreihen der Auen, inmitten des extensiv, mit alten Oliven- und Mandelbaumhainen bewirtschafteten Kulturlandes. Wenngleich die Auen, mit Ausnahme des unmittelbaren Nahbereichs der Flüsse, die zumeist mit Wildwuchs bewachsen sind, intensiv mit Citrusplantagen kultiviert werden, ist dort der Bestand an Kleinvögeln, sowie an Mäusen und Ratten als potentielle Beute besonders hoch. Im nördlichen Teilbereich des Rio Guadalhorce, siedeln hingegen kaum noch Greifvögel. Dieser Abschnitt ist weitgehend von monotonem Ackerland umgeben.
Während östlich El Burgo, am Nordrand der Sierra de las Nieves, der Bestand an Greifvögeln relativ hoch ist, ist er nördlich El Burgo, westlich der Sierra Alcaparaín gering. Hier dominieren ausgedehnte Pinienwälder, mit wenig alten Bäumen und daneben klein parzelliertes Ackerland und intensiver genutzte Olivenhaine vor. Auf den schrofferen Kuppen wächst häufig dichte Maccie.
Im Bereich westlich der Sierra Alcaparain, nördlich El Burgo herrscht Ackerland vor, ohne größere Bäume. Das Vorkommen an Greifvögeln ist entsprechend gering.
Im Inneren des ausgedehnten Hochgebirgsblocks der Serranía de Ronda, zwischen Ronda im Westen und der Westabdachung der Sierra de las Nieves im Osten, ist die Greifvogeldichte gering, infolge fehlender Bäume und dem rauhen Klima in einer Höhe um die 1000 Meter. Gelegentlich können hier Stein- und Habichtsadler beobachtet werden, daneben aber zahlreiche Gänsegeier, Alpenkrähen und gelegentlich Kolkraben.
Im Inneren der Serrania de Ronda in über 1000 Meter Höhe, leben nur noch Spezialisten.
In den südlichen Küstengebirgen, die weniger hoch und ausgedehnt sind, mit einem mediterranem Klima und einem Nebeneinander aus Wäldern und offenen Grasflächen, ist die Greifvogeldichte entsprechend höher, insbesondere in der Sierra Blanca.
Sierra Blanca mit einem großen Vorkommen an verschiedenen Adlerarten. Auch einige Paare an Schlangenadlern nisten hier in einer Höhe um 1000 Metern, infolge der reichen Strukturen.
Das größte Siedlungsdichte an Greifvögeln, Eulen, aber auch Raben, zieht sich unterdessen entlang der nördlichen Vorberge und Unterhänge der südlichen Küstenkordilliere/ S. Mijas, S. Alujarra und S. Blanca und dem Ostrand der Serranía de Ronda/ Sierra de las Nieves, S. Prieta und S. Alcaparaín, mit den bereits oben beschriebenen Landschaftselementen der 250 km² umfassenden Untersuchungsfläche.
Die höchste Siedlungsdichte an Greifvögeln, insbesondere an Zwerg- und Schlangenadlern befindet sich an der Nordseite der südlichen Küstengebirge. Die Greifvögel nisten dort in den ausgedehnten Wäldern und jagen in dem strukturreichen, mit vielen Bäumen bestandenen, extensiv genutzten Kulturland. Gleiches trifft auch für die Ostflanke der Sierranía de Ronda/ Sierra de las Nieves, Sierra Prieta und Sierra Alcaparaín zu.
Rechte Bildhälfte: Die 1500 km² umfassende Untersuchungsfläche, ohne Montes Málaga (ganz rechts). Unten die südlichen Küstengebirge von Montes Mijas bis Sierra de Tolox und nach NO (oben) Sierra de las Nieves bis Sierra Alcaparaín (dunkelgrün, da bewaldet). Am oberen Bildrand El Chorro/ Sierra Valle de Abdalajis bis El Torcal (rechts). Linke Bildhälfte, ab Ronda: Punktuelle Untersuchungsflächen, mit Sierra Grazalema (ganz links). Signaturen wie oben.
Bereiche weiterer, unvollständiger Stichprobe- Kartierungen
In diesen Bereichen wurden abseits der Untersuchungsfläche, innerhalb der Provinzen Málaga und Cádiz zeitlich und räumlich begrenzte Stichprobenkartierungen durchgeführt. Zum Teil umfassen sie Teilausschnitte einer Landschaft oder Naturraumes, z.T. wurden sie linear, mit Übersichtspunkten entlang der Strassen durchgeführt. Diese Kartierungen haben demnach keinen Anspruch auf Vollständigkeit, zeigen jedoch Tendenzen auf. Zumeist wurden insbesondere die Arten Schlangen- und Zwergadler, Habichtsadler, Steinadler und Gänsegeier berücksichtigt.
Folgende Bereiche wurden entsprechend kartiert: Das Hügelland zwischen Pizarra im Westen und den Montes Málaga im Osten, El Torcal im Norden und Almogía im Süden. Östlich anschließend, die Montes Málaga. Der Bereich um Montejaque, der Bereich der Nordabdachung und Vorland der Sierra Grazalema, die Sierra Bermeja, Sierra Crestellina und S. Utrera, der Estrecho, die Sierra La Plata und die Agrarsteppe von La Janda.
Hauptuntersuchungsfläche in Bildmitte oberhalb W4.7 und N36.3. Östlich (rechts) Montes Málaga, oberhalb W4.3. Links oben: Bereich um Ronda und Sierra Grazalema (ganz links). Oberhalb Estepona: Sierra Bermeja und S: Crestellina/ S. Utrera. Oberhalb Gibraltar: Südostende von Los Alcornocales. Zwischen Gibraltar und Tarifa: Estrecho.
Die Greifvogelarten
Fischadler (Pandion haliaetus)
Vorkommen in Andalusien nach Literatur
Der Fischadler siedelte in Andalusien an fischreichen Seen, Lagunen, insbesondere an der Küste, im Westen Andalusiens, in den Provinzen Huelva und Cadiz. Bis in die 70er Jahre des vorherigen Jahrhunderts war er ausgestorben, infolge Vernichtung der Lebensräume und Bejagung. Seit einigen Jahren findet ein Wiederansiedlungsprojekt statt, in den Provinzen Huelva und Cádiz, wobei der Bestand inzwischen auf etwa 20 Paare angestiegen ist. Im Winter steigt der Bestand infolge Überwinterer auf über 100 Individuen (García 2019).
Der Bestand des Fischadlers östlich der Serranía de Ronda und in der Provinz Málaga
Im Bereich östlich der Serranía de Ronda kann der Fischadler nur gelegentlich auf dem Durchzug beobachtet werden. Insbesondere auf dem Herbstzug im September und Oktober, mit Höhepunkt zwischen Mitte und Ende September, sowie von Februar bis April, mit Höhepunkt im März bis Anfang April, wobei der Zug aber zumeist in größerer Höhe stattfindet.
Am Stausee bei Istán, westlich der Sierra Blanca, soll sich regelmäßig ein Überwinterer aufhalten. Ebenso in dem Feuchtgebiet der Guadalhorce Mündung.
In der Provinz Cádiz wurde eine erfolgreiche Brut am Stausee des Guadalcacín in jüngster Zeit registriert, auf einer künstlichen Horstplattform. Daneben wird der Fischadler in der Provinz Cádiz und Huelva wieder angesiedelt und es gibt dort bereits einige Brutpaare (Oñate García & Oñate Gutiérrez 2009).
Der Stausee bei Istán. Hier überwintert alljährlich ein Fischadler.
Bestandsentwicklung
Der Fischadler ist in Andalusien, sowie in ganz Spanien, mit Ausnahme der Inseln, bis in die 70er Jahre des vorherigen Jahrhunderts ausgestorben.
Ebenso verschwand er in allen Küstenprovinzen Andalusiens, infolge der Vernichtung seiner Lebensräume, durch die Infrastrukturerschließung für den Tourismus und der häufigen Störungen durch Touristen an der Küste und den Lagunen. In der Provinz Málaga verschwand Mitte der 70er Jahre des vorherigen Jahrhunderts, eines der drei letzten, direkt an der Küste brütenden Paare in Spanien. In Gibralter brütete 1936 das letzte Mal ein Paar und am Tajo de Barbate 1960 (Sánchez et al. 1997).
Inzwischen findet ein Wiederansiedlungsprojekt im Westen Andalusiens statt, in den Provinzen Cádiz und Huelva, so dass der Bestand langsam ansteigt, auf mittlerweile etwa 20 Paare (García 2019).
Mit wenigen Ausnahmen findet in ganz Europa wieder ein Bestandsanstieg statt, nachdem die Art im vorherigen Jahrhundert stark dezimiert wurde und vielerorts zum Aussterben gebracht wurde, so in ganz Westeuropa. Daneben finden Wiederansiedlungsprojekte in Spanien, England, Italien, Portugal und Frankreich statt. Gezielte Schutzmaßnahmen haben die natürliche Ausbreitung vielerorts unterstützt (Rothermund- Schmidt et al. 2021).
Überwinterungsbereich in der Guadalhorcemündung.
Habitat
Der Fischadler benötigt Gewässer, die reich an Fischen sind und geeignete Brutmöglichkeiten, zumeist in Form von starken Bäumen. Er jagt sowohl an den Küsten von Meeren, an Seen, Lagunen, Teichen, an naturnahen, wie an begradigten Flüssen, wobei die Größe der Gewässer kaum und die Ausgestaltung der umliegenden Landschaft keine Rolle spielt. Niststandort und Jagdgewässer können viele Kilometer auseinanderliegen, oder sich in unmittelbarer Nachbarschaft befinden, je nach naturräumlichen Begebengeiten.
Zum Nisten benötigt er starke, alleine stehende Bäume, in Wäldern, Lichtungen oder auf Einzelbäumen, wobei er auch auf Hochspannungsmasten oder gelegentlich an Felsen seine Nester errichtet.
Revier/ Aktionsraum
Die Größe der Aktionsräume ist abhängig von dem Vorkommen fischreicher Gewässer und beträgt zwischen 23 km² und 55 km², mit häufig bejagten Aktionsraumzentren von 10- 20 km². Die bejagten Teichflächen umfassten dabei allerdings nur 2,7 km²- 4,3 km². Dabei überschnitten sich die Aktionsräume benachbarter Männchen z.T. stark Mebs & Schmidt 2006). Fremde Artgenossen werden aus dem Bereich des Nistplatzes mittels ritualisierter „Balzflüge“ vertrieben, oder verfolgt. Direkte Auseinandersetzungen kommen nur sehr selten vor (Glutz von Blotzheim et al. 1971). Fischadler können in nahrungsreichen Gebieten in nur geringen Distanzen siedeln. So nisteten in Brandenburg in einem Seengebiet auf vier hintereinander stehenden Hochspannungsmasten je ein Paar, in Distanzen von jeweils etwa 300 Metern.
Nahrungserwerb
Fischadler jagen entweder aus dem Ansitz oder aus dem wenig hohem Suchflug über den Gewässern. Sie rütteln häufig und stoßen bei gesichteter Beute in das Wasser, wobei sie völlig untertauchen können, um den Fisch zu greifen, worauf sie mit diesen in den Fängen abfliegen.
Nahrung
Der Fischadler jagt fast ausschließlich Fische. Nur selten werden tote Fische aufgenommen, oder andere Kleintiere erbeutet. Zumeist werden Fische in einer Größe von 20- 40 Zentimetern gefangen, mit einem Gewicht von 300g im Mittel, selten werden Fische mit einem Gewicht von über 500g gefangen (Mebs & Schmidt 2006, Rothermund- Schmidt et al. 2021).
Winter/ Zug
Der Fischadler ist in Europa Zugvogel, der im tropischen Westafrika, südlich der Sahara überwintert. Das Hauptüberwinterungsgebiet der Nord- Mittel- und Westeuropäischen Populationen liegt in der Küstenregion Westafrikas, an der Küste, an den großen Seen und Flüssen und weiter nördlich auch am Niger. Nur die Populationen im Mittelmeerraum sind Standvögel, bzw. Teilzieher, entsprechend auch die in Südwestandalusien und auf den Balearen. Der Abzug beginnt in Mitteleuropa Anfang bis Mitte August, mit Höhepunkt in der ersten und zweiten Septemberdekade, im wesentlichen bis Ende September. Die Weibchen ziehen 2- 3 Wochen früher ab, als die Männchen und Jungvögel. Die Masse der Fischadler zieht den direkten Weg von NO nach SW über Südfrankreich und entlang der Küste Spaniens, bzw. etwas im Landesinneren, bis Gibraltar, die gleiche Zugroute, wie auch die Schwarzmilane. In Südspanien ist der Höhepunkt des Zugs zwischen Mitte und Ende September. Von Gibraltar ziehen sie weiterhin geradewegs die SW Richtung einhaltend, nach W Afrika. Zahlreiche Individuen und insbesondere die Jungvögel, ziehen hingegen auch direkt über das offene Meer, über Italien oder Südfrankreich, aber auch in Spanien, östlich der Meerenge, weshalb die Anzahl der Sichtungen in Südspanien, bzw. an der Meerenge, nur begrenzt sind. Seit einigen Jahren überwintern allerdings zunehmend mehr Fischadler in Spanien, Portugal und Südfrankreich. Gelegentlich ziehen auch Fischadler nach Israel oder bis zur Südspitze Afrikas. Junge Fischadler bleiben in Afrika und ziehen erst mit Eintritt in die Geschlechtsreife zurück nach Europa. Zwischen Mitte März und Mitte April kehren die meisten Brutvögel zurück nach Europa, nachdem sie Anfang März bis Anfang April Südspanien durchquerten. Wobei die Altvögel vor den immaturen Vögeln zurückziehen (Glutz von Blotzheim et al. 1971, Mebs & Schmidt 2006, Rothermund- Schmidt et al. 2021).
Balz
Die Brutreife erreicht der Fischadler im dritten Lebensjahr, wobei manche Vögel bereits früher erfolgreich brüten. Selten versorgt ein Männchen zwei brütende Weibchen. Während der Balz kann es häufiger zu Partnerwechseln kommen. Gelegentlich kommt es noch während der Brut zu Partnerwechseln. Balzflüge können bei eingespielten Paaren sehr gering ausfallen, oder ganz ausbleiben. Die Horstbindung ist sehr stark, auch bei erfolglosen Paaren. Der Horst umfasst im Verlauf der Jahre bis zu 1,2 Meter im Durchmesser und bis zu 2 Meter Höhe (Glutz von Blotzheim et al. 1971, Mebs & Schmidt 2006, Rothermund- Schmidt et al. 2021).
Brut
Im Mitteleuropa wird die Brut zwischen Mitte März und Ende Mai aufgenommen, in Andalusien ebenfalls ab Mitte März. Es werden zumeist 2- 3 (4) Eier gelegt. Der Legeabstand beträgt 1- 3 Tage, es wird ab dem ersten oder zweiten Ei gebrütet. Die Brutzeit beträgt (35)- 38- (41) Tage. Es brütet überwiegend das Weibchen und wird vom Männchen nur kurz, u.a. nach Beuteübergaben abgelöst. Das Männchen erwirbt bis zum Ausfliegen der Jungen alleine die Nahrung (Glutz von Blotzheim et al. 1971, Sánchez et al. 1997, Mebs & Schmidt 2006).
Nestlingszeit
Die Nestlingszeit beträgt 50- 54 Tage, gelegentlich bis 60 Tage. Die Jungen werden etwa 10 Tage vom Weibchen gehudert, darauf noch morgens, abends und in der Nacht. Mit etwa 28 Tagen, verbringt das Weibchen auch Zeit außerhalb des Horsts, auf benachbarten Ästen. Im Alter von 5- 6 Wochen beginnen die Jungen mit Trockenflugübungen. Bis dahin werden sie noch häppchenweise gefüttert, bevor sie selbständig beginnen an einem Fisch zu picken. Häufig fliegen die Männchen nur 2- 3 Mal am Tag auf Jagd (Glutz von Blotzheim et al. 1971, Sánchez et al. 1997, Mebs & Schmidt 2006).
Flugzeit/ Familienverband
Befindet sich der Horst in der Nähe eines Sees, so bleibt die Familie auch nach dem Ausfliegen noch längere Zeit am Horst, wo auch die Beuteübergabe an die Jungen stattfindet. Das Männchen bringt noch immer den Großteil der Beute. Bei größeren Distanzen zu einem Gewässer, fliegen die Jungen zunehmend häufiger weitere Strecken dem Männchen entgegen und lösen sich schneller von dem Brutplatz. Die ersten Jagdversuche sind noch sehr unbeholfen und führen kaum zum Erfolg. Die Jungadler konzentrieren sich zunächst ganz auf Fische, die an der Oberfläche schwimmen. Die Jungen bleiben noch bis zu 2 Monate bei der Familie, bevor sie sich ablösen. Nach der Überwinterung in Afrika, bleiben die Jungen weiterhin dort, bevor sie mit Erreichen der Brutreife wieder in die Nähe ihres Geburtsorts zurückkehren. Die Männchen siedeln sich in einer mittleren Distanz von 20 Kilometern zum Geburtsort an, die Weibchen im Mittel 120 Kilometer (Glutz von Blotzheim et al. 1971, Mebs & Schmidt 2006).
Bruterfolg
Die Brutgröße beträgt in Mitteleuropa 2,3 Junge pro erfolgreicher Brut und 1,7 Junge pro begonnener Brut. Etwa 40% der flüggen Jungvögel überleben das erste Jahr. Die Sterberate von Altvögeln beträgt etwa 15%- 20%. Das bislang festgestellte Höchstalter beträgt 26 Jahre (Mebs & Schmidt 2006).
Gefährdungsursachen
In Mitteleuropa liegen zur Zeit kaum ernsthafte Gefährdungen des Fischadlers vor. Auf dem Zug werden noch immer Fischadler illegal in den Mittelmeerländern geschossen, so z.B. in Malta. Ungesicherte Strommasten, wie sie häufig noch in Spanien vorkommen, stellen eine ernsthafte Gefährdung dar, ebenso die Kollision mit Windkraftanlagen. Intensive Störungen durch Forstwirtschaft und Tourismus können zu Brutaufgaben führen.
Schmutzgeier (Neophron percnopterus)
Vorkommen des Schmutzgeiers in Andalusien nach Literatur
Der Schmutzgeier hat seinen Verbreitungs- Schwerpunkt in der Provinz Cádiz. Das Verbreitungsmuster ist dort ähnlich, wie das des Gänsegeiers. Er kommt verstreut im gesamten östlichen Bergland der Provinz vor, nach Osten bis in die Serranía de Ronda, im Westen der Provinz Málaga.
Nach Westen fehlt der Schmutzgeier in den Ebenen von West Cádiz, weshalb die Art erst wieder an der Küste, in den kleinen, aber schroffen Küstengebirgen vorkommt. In der Provinz Sevilla fehlt der Schmutzgeier, wobei er auch im Norden, in der Sierra Morena fehlt. In Huelva kommt der Schmutzgeier nur im Doñana Nationalpark vor, sogar das gesamte Jahr über, obwohl der Schmutzgeier Zugvogel ist. Daneben kam er zumindest bis 1994 im Nordosten der Provinz, in der Sierra Pallada vor, einem Teilbereich der Sierra Morena. In der übrigen Sierra Morena/ S. Aracena ist er nur noch gelegentlich zu sehen.
Im Süden der Provinzen Huelva und Sevilla lässt sich das Fehlen des Schmutzgeiers erklären, da Siedlungsraum für die Art fehlt, infolge landwirtschaftlich intensiver Nutzung und dem Fehlen von Gebirgen und somit Nistmöglichkeiten. In der Sierra Morena hingegen sind geeignete Biotope noch genügend vorhanden. Warum die Art hier fast ausgestorben ist, ist unklar. Nur im östlichen Teilbereich, der Sierra Morena de Jaén, gibt es offenbar aktuell noch lokal begrenzte Vorkommen.
Im Osten, im östlichen Teilebreich Provinz Málaga, östlich der Serranía de Ronda, ist kein Brutvorkommen bekannt. Das einstige Vorkommen an der Felswand von Teba, nördlich Ardales, ist erloschen. Und auch im gesamten Bereich der Küstengebirge fehlt die Art.
Weiter östlich kommt der Schmutzgeier nur noch vereinzelt in der Sierra Subbética (Provinz Córdoba), Hoya de Guadix und Sierra de Baza (Provinz Granada) vor, wobei die Daten veraltet und von 1994 sind. In den übrigen Gebirgen der Provinz Granada, sowie generell in der Provinz Almería, kommt der Schmutzgeier offensichtlich nicht mehr vor. Nur im äußersten Nordosten Andalusiens, in der Provinz Jaén, in der Sierra Carzola und Segura gibt es noch aktuelle Vorkommen.
Die Bestände des Schmuztgeiers haben in den letzten Jahren extrem abgenommen und in Andalusien leben aktuell nur noch 23 Paare, überwiegend in der Provinz Cadiz. Alleine für die Sierra Grazalema wurden noch 12 Paare angegeben und für die gesamte Serranía de Ronda 3-4 BP.
Schmutzgeier vor seiner Bruthöhle
Vorkommen innerhalb der 1500 km² umfassenden erweiterten Untersuchungsfläche