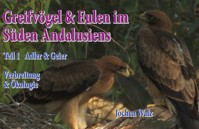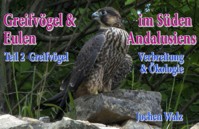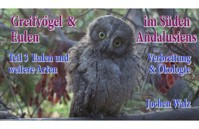
8,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Greifvögel und Eulen im Süden Andalusiens
- Sprache: Deutsch
Der Autor hat in weiten Bereichen der Provinz Málaga und in Teilbereichen der Provinz Cádiz die verschiedenen Greifvogelarten systematisch kartiert. Mit den Resultaten, die in den folgenden drei Bänden dargestellt wurden, kann der naturinteressierte Beobachter sich ein ernsthaftes Bild darüber machen, wie die Greifvögel, Geier und Eulen heute in den Provinzen Málaga und Cádiz verbreitet sind und in welcher Siedlungsdichte. Oftmals handelt es sich dabei nicht um die stets angepriesenen Naturgebiete, sondern um extensiv genutzte Kulturlandschaften, die zumeist wenig Beachtung finden. Neben der Verbreitung der Greifvögel, Geier und Eulen befassen sich die drei Bände kritisch mit deren Bestandsentwicklung und Gefährdung. Daneben informieren die Bände ausführlich über die Lebensräume und Lebensweise, Verhalten, Nahrung/ Jagdweise, Jagdrevier/ Aktionsraum, Balz/ Balzflüge, Interaktionen, Zug/ Überwinterung und Leben im Verlauf des Jahres/ Brut und Nachwuchs. Neben der Recherche aus der Literatur, wurden auch die Erkenntnisse eigener Beobachtungen und Untersuchungen angeführt, die an zahlreichen Greifvogel- und Eulenarten durchgeführt wurden. Daneben wurden Daten und Erkenntnisse aus Deutschland berücksichtigt. Entsprechend sind die drei Bände auch für all diejenigen von Interesse, die mehr über Greifvögel wissen möchten, unabhängig von Landesgrenzen. Zahlreiche Fotografien von den Greifvögeln/ Eulen sowie von ihren Lebensräumen, illustrieren anschaulich die Artkapitel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Greifvögel und Eulen der Provinz Málaga Teil 3- Eulen und weitere interessante Vogelarten
Inhalt
Schleiereule (Tyto alba)
Zwergohreule (Otus scops)
Uhu (Bubo bubo)
Steinkauz (Athene noctua)
Waldkauz (Strix aluco)
Waldohreule (Asio otus)
Sumpfohreule (Asio flammeus)
Rothals- Ziegenmelker (Caprimulgus ruficollis)
Alpenkrähe (Pyrrohcorax graculus)
Dohle (Corvus monedula)
Kolkrabe (Corvus corax)
Weißstorch (Ciconia ciconia)
Schwarzstorch (Ciconia nigra)
Kranich (Grus grus)
Flamingo (Phoenicopterus ruber)
Schleiereule (Tyto alba)
Vorkommen in Andalusien laut Literatur
Die Schleiereule ist in Andalusien zwar verbreitet, aber mit einer sehr geringen Siedlungsdichte, selbst in günstigen Habitaten. So wird für das Vorland der Sierra Grazalema angegeben, dass sie nur selten in Dörfern und Bauernhöfen im Norden und Südosten vorkommt und für den gesamten Bereich der Serranía de Ronda werden vereinzelte Brutpaare in Städten und Bauernhöfen angegeben, z.B. in Ronda. Auch für die Sierra Morena werden nur wenige Bereiche angegeben.
Vorkommen innerhalb der 1500 km² umfassenden erweiterten Untersuchungsfläche
Innerhalb der Untersuchungsfläche wurde die Schleiereule im Offen- und Halboffenland nur gelegentlich festgestellt, wobei innerhalb des 145 km² umfassenden Teilbereichs, östlich Guaro, 2022 ein Individuum übersommerte und insbesondere im Oktober auch häufiger rief. Es verbrachte den Tag in einem verwilderten, dicht mit Eichen und Olivenbäumen bewachsenen, tief eingeschnittenen Tal, mit großen Vorkommen an Ratten, in unmittelbarer Nachbarschaft zu einer Zwergohreulenfamilie mit Jungen. In der Nacht jagte es in den angrenzenden Mandelbaumhainen und an einem Taubenschlag mit großem Vorkommen an Mäusen und Ratten. Im näheren Umkreis der Ortschaften wurde bislang nur unzureichend kartiert. Laut Literatur kommt die Schleiereule allerdings flächendeckend in mäßiger Anzahl vor. Da sie überwiegend in Gebäuden brütet, ist ihr Vorkommen zumeist an Siedlungen und Ruinen gebunden (Oñate Gutiérrez & Oñate García 2012).
Bestandsentwicklung
Während Sánchez et al. (1996) die Schleiereule noch als einen häufigen Brutvogel in der Provinz Málaga beschreibt, geben Oñate García & Oñate Gutiérrez (2009) den Bestand als nicht sehr verbreitet an. Offensichtlich hat der Bestand der Schleiereule alleine innerhalb der letzten Jahre extrem abgenommen. Für die jüngere Zeit wird eine Bestandsabnahme, infolge des Einsatzes von Pestiziden und dem Verschwinden von alten Gebäuden beschrieben (Oñate Gutiérrez & Oñate García 2012).
Habitat
Die Schleiereule kommt in Mitteleuropa nur in den tieferen Lagen vor, da sie fast ausschließlich auf Mäuse als Beute angewiesen ist und diese in schneereichen Wintern der höheren Lagen kaum verfügbar sind. In der Provinz Málaga kommt sie hingegen (selten) bis 1000 Metern vor. Wobei die Eulen zumeist im Umfeld von Siedlungen oder Gehöften und deshalb in tieferen Lagen nisten. Neben Dachböden und Scheunen, nistet sie in Kirchtürmen, Ruinen oder auch Fels- und Baumhöhlen (Sánchez et al. 1996). Während in Mitteleuropa Fels- und Baumbruten kaum eine Rolle spielen, kommen sie in den südlichen Ländern regelmäßig vor (Brandt & Seebaß 1994). Daneben werden sehr gerne Nistkästen an Gebäuden angenommen, die in Andalusien aber eher die Ausnahme darstellen dürften.
Die Schleiereule jagt im angrenzenden Halboffen- und Offenland, wobei das häufige Vorkommen an Ratten und Mäusen eine entscheidende Rolle spielt und ebenso auch deren Verfügbarkeit. Um die Beute am Boden zu erreichen, muss die Vegetation relativ kurz sein. Entsprechend der Dominanz von Mäusen und Ratten in Siedlungsnähe, auch im Bereich der Streusiedlungen (Fincas) und an Gehöften, dürften auch die Jagdhabitate der Eulen insbesondere dort liegen. Daneben sind Ratten häufig im Halboffenland (Mandelbaum- und Olivenhainen) anzutreffen. Dort leben sie überwiegend in den eingestreuten Korkeichen.
Innerhalb der Untersuchungsfläche verbrachte ein Junggeselle den Tag in einem dichten Eichen- Olivenbestand, innerhalb eines abgelegenen, wenig frequentierten, tief eingeschnittenen und daher beschatteten Tälchens. Es bejagte die umliegenden Baumhaine, mit licht stehenden Mandel- und Olivenbäumen, mit zumeist kurzer bis mäßig hoher, lichter Bodenvegetation. Sowie an einem Taubenschlag, mit großem Vorkommen an Echten Mäusen und Ratten. Dieser Bereich wurde bereits in den Jahren zuvor gelegentlich von Schleiereulen frequentiert.
Ideale Schleiereulenbiotope sind demnach kleine Ortschaften, mit kleinbäuerlichen Strukturen, wie Baumhaine, kleinparzellierte Äcker, Wiesen, Weiden, Brachen, Hecken, Raine, Bäche und Flüsse, mit bachbegleitenden Gehölzen, und extensiv genutzte Bauerngärten an den Ortsrändern (Hölzinger & Mahler et al. 2001).
Jagdrevier einer Schleiereule und potentieller Brutplatz eines Junggesellen.
Aktionsräume
In Niedersachsen wurden Aktionsraumgrößen von 8 besenderten Schleiereulen ermittelt. Sie betrugen während der Brutzeit zwischen 90 ha und 369 ha und nach der Jungenaufzucht bis Ende November von 363 ha bis 465 ha, wobei die tatsächlichen Jagdbereiche deutlich kleiner waren. Dabei überschnitten sich die einzelnen Aktionsräume nicht oder nur unwesentlich. Die Eulen jagten in unterschiedliche Richtungen. Die Nistplätze lagen peripher innerhalb der Aktionsräume. Die Aktionsräume wichen im Sommer und Herbst stark voneinander ab, was bedeutet, dass die Eulen die Flächen nutzten, die gerade bewirtschaftet wurden, bzw. die das höchste Nahrungsangebot lieferten. Dabei spielte das Grünland die wichtigste Rolle, da hier das Vorkommen an Mäusen am höchsten ist, gefolgt von Ökotonen (Saumbiotope). Hier spielen insbesondere Feldhecken eine große Rolle. Siedlungen und Gärten wurden vor allem im Herbst bejagt. Die Eulen jagten dann verstärkt auch in offenen Scheunen, wo sie vor allem im Winter bei Schnee leicht Mäuse greifen können. Getreidefelder wurden während der Jungenaufzucht kaum bejagt, da das Getreide dann hoch im Wuchs steht, so dass Beute kaum erreichbar ist (nach Brandt & Seebaß 1994). Warum nach der Ernte allerdings die Äcker kaum bejagt wurden bleibt unklar, da durch das Pflügen Mäusenester frei gelegt werden und dann Beute im Überfluss verfügbar ist. Mäusejagende Taggreifvögel nutzen diese Nahrungsquelle dann sehr intensiv.
Inwieweit die Schleiereule sich in ihrem Jagdrevier territorial verhält, ist nicht klar. Jedenfalls können Paare nahe beieinander nisten, was aber nicht zwangsläufig bedeutet, dass sie auch die gleichen Jagdflächen nutzen. Zumindest in der unmittelbaren Nestumgebung verhält sich die Eule territorial. Nach Brandt & Seebaß (1994) können Schleiereulen in relativ geringen Distanzen jagen, ohne dass es zu Auseinandersetzungen kommt. Die großen Aktionsräume sind nach Auffassung der Autoren auch nur schwer zu verteidigen, im Gegensatz zu den kleinen Revieren von Wald- und Steinkauz.
Im Winter können jedoch auch fremde Männchen im Tageseinstand zugelassen werden und gelegentlich auch der Waldkauz (Brandt & Seebaß 1994, Mebs & Schmidt 2012)
Dem stärkeren Waldkauz weicht die Schleiereule ansonsten, so gut es geht, aus. Mit ihm konkurriert sie insbesondere um Brutplätze und Tageseinstände, aber auch um Jagdflächen. Dabei erweist sich die Schleiereule als deutlich mobiler, sowohl dem Waldkauz gegenüber, als auch der Waldohreule, die beide deutlich weniger mobil sind, häufiger Ansitzjagd betreiben und entsprechend kleine Jagdreviere bearbeiten (Brandt & Seebaß 1994).
Jagdweise
Die Schleiereule sucht ihre Beute zumeist aus dem niedrigen Flug bis 4 Meter Höhe und sucht unter Flügelschlägen und gleitend die Landschaft unter sich ab, immer wieder auch systematisch. Daneben rüttelt sie häufig gegen den Wind, wobei die Beute aus dem Sturzflug geschlagen wird. Verfehlte Beute verfolgt sie auch zu Fuß. Daneben betreibt sie Ansitzjagd, insbesondere in nahrungsknapperen Zeiten und nach Beendigung der Jungenaufzucht, wobei sie häufig die Warten wechselt. Daneben werden Sperlingsvögel von den Schlafplätzen aufgeschreckt und gelegentlich Fledermäusen an ihren Ausflugsöffnungen aufgelauert (Mebs & Schmidt 2012).
Nahrung
In Mitteleuropa ernährt sich die Schleiereule fast ausschließlich von Mäusen, überwiegend von Feldmäusen. Davon abgesehen, kommen in den Beutelisten alle Arten von Mäusen vor, auch gelegentlich Ratten und Maulwürfe. Häufiger kommen auch Spitzmäuse vor. Daneben werden noch etwas häufiger Sperlingsvögel geschlagen, insbesondere der Haussperling. Amphibien und Insekten werden ebenfalls erbeutet und immer wieder auch Fledermäuse. Entsprechend ist die Schleiereule nicht ausschließlich auf Mäuse angewiesen, wobei diese stets die Hauptmasse der Beute darstellen, auch in anderen Regionen. (Hölzinger & Mahler et al. 2001, Mebs & Schmidt 2012). In der Literatur wird die Schleiereule für die Provinz Málaga als flexibel in der Nahrungswahl angegeben, die jeweils die am häufigsten und am leichtesten verfügbare Beute schlägt. Das sind vor allem Ratten, Mäuse und andere Kleinsäuger, Kleinvögel, Reptilien, Amphibien, Fische und Insekten (Sánchez et al. 1997, Oñate García & Oñate Gutiérrez 2009). Es fehlen allerdings quantitative Angaben und so ist es sehr wahrscheinlich, dass auch hier der Anteil an Ratten, Echter Mäuse und Spitzmäuse dominiert. Diese sind überall innerhalb der Siedlungen und deren Umfeld häufig vertreten. Sie kommen aber auch häufig im Kulturland (Mandelbaumhaine) mit eingestreutem Eichenbewuchs vor. Insbesondere die Ratten halten sich häufig in Eichen auf, nisten dort in Höhlen und ernähren sich zu einem großen Teil von Eicheln und Mandeln. Nach Brandt & Seebaß (1994) spielen in Spanien anstatt der deutlich seltener vorkommenden Wühlmäuse, Echte Mäuse und Spitzmäuse die wichtigste Rolle als Beute. Kleinsäuger, die größer und schwerer sind als Ratten, werden nicht geschlagen. In Südostspanien ernähren sich die Schleiereulen überwiegend von Ratten (Mebs & Schmidt 2012), wobei eine Kombination dieser drei Artengruppen für die Provinz Málaga als sehr wahrscheinlich betrachtet werden kann.
Überwinterung
Die Brutpaare überwintern gemeinsam in ihrem Revier und sind standorttreu. Die Jungvögel verstreichen ungerichtet z.T. in Distanzen von unter 50 Kilometern und z.T. auch mehrere hundert Kilometer (Mebs & Schmidt 2012).
Balz
Die Schleiereule ist vor Beendigung des ersten Lebensjahres geschlechtsreif. Sie führt eine monogame Dauerehe und ist extrem brutort-treu. Die Besetzung des Brutplatzes ist stark abhängig vom Nahrungsangebot und der Witterung. Sie findet in der Regel ab Anfang März statt (Hölzinger & Mahler et al. 2001). Unverpaarte Männchen locken zunächst ein Weibchen herbei, indem sie immer wieder unter lautem Kreischen um den Brutplatz fliegen. Hat sich ein Weibchen eingefunden, so muss zunächst die innerartliche Aggression überwunden werden. Dabei versucht das Männchen das größere Weibchen zu beschwichtigen u.a. mit Fütterungen, um es zum Brutplatz zu locken. Dabei gibt es immer wieder Verfolgungsflüge und das Weibchen attackiert auch nicht selten das Männchen. Auch wenn das Weibchen den Brutplatz angenommen hat, kommt es noch zu aggressiven Handlungen. Erst nach einiger Zeit, unter zahlreichen ritualisierten Verhaltensweisen, lässt sich das Weibchen auf das Männchen ein und es kommt zu regelmäßigen Beuteübergaben und Begattungen. Ab da sitzen die Brutpartner im Tageseinstand dicht nebeneinander und kraulen sich auch gegenseitig das Gefieder. Die Phase der Paarfindung dauert bei neu gebildeten Paaren rund einen Monat und vor der Zweitbrut 15- 20 Tage. Die Eulen bauen kein Nest, bzw. bringen kein Nistmaterial ein. Das Weibchen legt lediglich eine Nestmulde an, in den zahlreichen Gewöllen, die sich am Boden des Brutplatzes angesammelt haben (Brandt & Seebaß 1994, Mebs & Schmidt 2012).
Neben Zweitbruten, können in nahrungsreichen Jahren auch Schachtelbruten stattfinden. Dann versorgt das Männchen den Nachwuchs alleine, während das Weibchen an einem weiteren Brutstandort ein weiteres Gelege ausbrütet. Schachtelbruten sind allerdings häufig mit einem Partnerwechsel verbunden, wobei sich ein weiteres Männchen dem Weibchen anschließt. Dabei wurden Entfernungen bis zu 8 Kilometern zum ursprünglichen Brutplatz beobachtet.
Daneben können Männchen ein weiteres Weibchen anwerben, während ihr eigenes Weibchen brütet und mit diesem eine weitere Brut groß ziehen. Dann muss das Männchen die Jungen von zwei Bruten versorgen, bis sich die Weibchen an der Versorgung beteiligen. Ebenso liegen Nachweise vor, dass ein Weibchen eine Brut alleine groß ziehen musste, das offensichtlich von einem bereits verpaarten Männchen begattet wurde, aber ansonsten nicht weiter unterstützt wurde (Brandt & Seebaß 1994).
In nahrungsarmen Jahren wiederum kann es vorkommen, dass sich zwei Männchen an der Versorgung der Jungen beteiligen. Offensichtlich hatte das Weibchen sich zuvor von zwei verschiedenen Männchen begatten lassen, die sich dann gegenseitig tolerierten. Wobei es für beide besser war, einen Kompromiss einzugehen, als vollständig auf Nachwuchs zu verzichten (Brandt & Seebaß 1994).
Brut
Für die Provinz Málaga wird eine Brutaufnahme von Ende März bis Juni angegeben, überwiegend im April und Mai. Es werden 4- 7 Eier gelegt. Es findet eine oder seltener zwei Bruten pro Jahr statt. Die Brutdauer beträgt 33- 34 Tage (Sánchez et al. 1997).
Für Baden- Württemberg werden 3- 14 Eier pro Gelege angegeben. Die Größe der Gelege kann von Jahr zu Jahr stark variieren, je nach Witterung und Nahrungsangebot. Ebenso ist auch die Aufnahme der Brut stark abhängig von beiden Faktoren (Hölzinger & Mahler et al. 2001). Mebs & Schmidt (2012) geben für Mitteleuropa meist 4- 7 Eier und ausnahmsweise bis 15 Eier an und eine Brutdauer von 30- 34 Tagen. Es brütet alleine das Weibchen, das sich durch das Männchen mit Nahrung versorgen lässt. Je nach Nahrungsangebot finden eine oder zwei Bruten pro Jahr statt (u.a. Schachtelbruten). Gelegentlich findet auch Polygamie statt, indem ein Männchen zwei Weibchen versorgt (Glutz von Blotzheim et al. 1971, Brandt & Seebaß 1994, Hölzinger & Mahler et al. 2001, Mebs & Schmidt 2012).
Nestlingszeit
Während der ersten 10 Tage hudert das Weibchen fast ganztägig. Das Männchen übergibt die Beute an das brütende Weibchen und dieses zerlegt diese und füttert sie an die Jungen. Zumeist befinden sich auch Nahrungsdepots am Nest, so dass Fütterungen auch unabhängig vom Beuteeintrag stattfinden. Im Alter von 18- 20 Tagen müssen die Jungen nicht mehr gewärmt werden, sie wärmen sich allerdings noch gegenseitig. Da das Weibchen zunehmend häufiger angebettelt wird, hält es sich immer seltener im Nest auf. Die Altvögel halten sich ab da am Tage in ihrem Tageseinstand in der Nähe auf und fliegen das Nest nur noch zu Fütterungen, bzw. Beuteübergaben an. Entsprechend der unterschiedlichen Schlüpftermine herrscht ein großer Altersunterschied zwischen den Jungen größerer Gelege (Brandt & Seebaß 1994). Die Nestlingszeit dauert 40- 45 Tage. Darauf wandern die Jungen noch flugunfähig vom Nestplatz ab, wobei sie bereits weite Sprünge unternehmen können (Mebs & Schmidt 2012). Hölzinger & Mahler et al. (2001) geben eine Nestlingszeit von 62- 67 Tagen an, wobei die Jungen dann bereits kurze Distanzen fliegen können. Offensichtlich hängt der Abwanderungstermin vom Nistplatz insbesondere von dessen Lage ab. Bei Bruten in Nistkästen können die Jungen nicht abwandern, sondern müssen abfliegen, was entsprechend später ausfällt, als bei einem offenen Brutplatz in einer Scheune, wo die Jungen kletternd und springend abwandern können.
Führungszeit, Familienverband
Nach Brandt & Seebaß (1994) werden die Jungen im Alter von 9 Wochen (63 Tagen) flügge. Selbst bei 8 Jungen, deren Altersunterschied 14 Tage beträgt, verlassen alle Jungen innerhalb weniger Tage das Nest. Sie kehren aber in den Morgenstunden wieder zum Nest zurück, um dieses am nächsten Abend wieder zu verlassen. Später kehren die Jungen immer seltener zum Nest zurück und suchen sich einen Tageseinstand außerhalb.
Die Jungen erreichen die Selbständigkeit im Alter von 3 Monaten und wandern darauf ab, oder werden spätestens im Alter von 95- 100 Tagen zumeist vom Weibchen aus dem Nestbereich vertrieben und wandern darauf auch aus dem elterlichen Revier ab (Brandt & Seebaß 1994, Hölzinger & Mahler et al. 2001). Bei Zweitbruten kann die Brutzeit von März bis Januar andauern (Hölzinger & Mahler et al. 2001).
Bruterfolg
Der Bruterfolg ist stark abhängig vom Nahrungsangebot, insbesondere an Mäusen. Die Fortpflanzungsziffer schwankt zwischen 2,4 Junge pro Brutpaar in Mangeljahren und 7,4 Junge in Jahren mit Feldmausgradationen. Die Sterblichkeit der Jungen beträgt 68% im ersten Lebensjahr, 50% im zweiten Jahr und etwa 48% in den folgenden Jahren. Nur wenige Eulen erreichen das vierte Lebensjahr. Das bislang festgestellte Höchstalter in der Natur beträgt 29 Jahre (Mebs & Schmidt 2012). In Baden- Württemberg wurden Bruterfolge von 2,7 ausgeflogenen Jungvögel bis 5,3 Junge bei den Erstbruten festgestellt. In schlechten Mäusejahren fiel die zweite Brut aus (Hölzinger & Mahler et al. 2001).
Wanderungen und Überwinterungsgebiet
Die Brutpaare überwintern gemeinsam in ihrem Revier und sind standorttreu. Die Jungvögel verstreichen im Herbst ungerichtet z.T. in Distanzen von unter 50 Kilometern und z.T. auch mehrere hundert Kilometer (Mebs & Schmidt 2012). Bei Jungvögeln aus SW Deutschland ist allerdings eine Tendenz nach SW und NW bis zur Atlantikküste beobachtbar. Zwei Drittel der Jungeulen ziehen nicht weiter als 50 Kilometer. Bei Feldmausgradationen siedeln sich die Jungvögel näher am Geburtsort an, nicht selten in nächster Nähe. Nach dem Zusammenbruch von Mäusepopulationen können dann viele Jungvögel weite Strecken abwandern. Infolge Schachtelbruten können die Weibchen während der Brutzeit den Brutort wechseln und mit anderen Männchen eine Beziehung eingehen. Das erste Männchen übernimmt dann die Versorgung der Erstbrut alleine. In schneereichen Wintern können bei akutem Nahrungsmangel auch Schneefluchtbewegungen der Brutvögel stattfinden (Hölzinger & Mahler et al. 2001).
Gefährdungsursachen
Es bleibt zu hinterfragen, warum die Schleiereule im Untersuchungsbereich relativ selten ist, während sie z.B. in Süd Frankreich extrem häufig anzutreffen ist. Die Eule hat im äußersten Südwesten Europas keine Probleme über den Winter zu kommen, Nahrungsengpässe sind kaum zu erwarten. Dennoch hat ihre Anzahl in der Provinz Málaga offensichtlich stark abgenommen. Während Sánchez et al. (1996) die Eule noch als sehr häufig bezeichnet, wird sie von Oñate García & Oñate Gutiérrez (2009) als nicht sehr verbreitet bezeichnet.
Für die Provinz Málaga werden von Oñate Gutiérrez & Oñate García (2012) das Verschwinden alter Gebäude als Brutplatz, sowie der Einsatz von Pestiziden angegeben.
Da es kaum Bestrebungen gibt, den Verlust von Brutplätzen infolge Gebäudesanierungen oder deren Abbruch, durch Nistkästen zu ersetzen, wie dies in Mitteleuropa häufig erfolgte, dürfte die Eule inzwischen unter einem akuten Mangel an Nistplätzen leiden.
Da Hausmäuse, Ratten und Spitzmäuse, die Hauptbeutetiere der Schleiereule in der Provinz Málaga, hauptsächlich in der Nähe von Siedlungen, bzw. innerhalb dieser vorkommen und diese gerade dort intensiv mittels Gift dezimiert werden, dürfte die Mortalitätsrate der Schleiereule hier sehr groß sein. Die Mäuse sterben in der Regel nicht sogleich an dem Gift, sondern erst nach qualvollen Stunden oder Tagen, weshalb sie eine leichte Beute für die Eulen werden, die dann ebenso qualvoll sterben, bzw. eingetragen in den Nistplatz, ganze Familien auslöschen.
Die Intensivierung der Landwirtschaft nimmt den Eulen wichtige Jagdhabitate und der extreme Einsatz von Gift innerhalb der neu angelegten Plantagen tötet auch dort nicht nur die Beutetiere der Eule, sondern indirekt auch die Eulen, wenn diese sie aufnehmen.
Ungesicherte Strommasten, als Ansitzwarten von den Eulen genutzt, werden zu Todesfallen für die Eulen. Auch wenn diese hätten längst entschärft werden müssen, ist noch immer ein großer Teil der Mittelspannungsmasten völlig ungesichert.
Der stark zugenommene Strassenverkehr, auch infolge neuer oder gut ausgebauter Strassen, dürfte gerade im Nahbereich der Ortschaften zu zahlreichen Todesopfern unter den Eulen geführt haben. Da die Schleiereule häufig im Bereich von Säumen intensiv jagt, dürften Säume entlang von Strassen zu gefährlichen Fallen für die Eulen geworden sein, insbesondere bei den stark zugenommenen Fahr- Geschwindigkeiten.
Zwergohreule (Otus scops)
Verbreitung der Zwergohreule in Andalusien
Die Zwergohreule hat im mit Bäumen bestandenen Halboffenland eine ähnlich weite Verbreitung wie der Steinkauz, doch kommt sie in deutlich geringerer Dichte vor, u.a. auch deshalb, weil sie anspruchsvoller in der Wahl der Nistplätze ist.
Brutbestand
Verbreitung innerhalb der 250 km² umfassenden Untersuchungsfläche
Die Zwergohreule wurde nicht auf größerer Fläche kartiert, ist aber im Raum weit verbreitet, u.a. da in weiten Bereichen extensiv genutzte Baumkulturen im Charakter einer Baumsavanne vorherrschen, welche den idealen Lebensraum der Zwergohreule darstellen. Der Unterwuchs ist zumeist licht und kurz beweidet oder untergepflügt, so dass die Eulen ihre Beute in Form von großen Insekten leicht entdecken und fangen können. Wobei die Zwergohreule auch höherwüchsige, aufgelassene Bereiche bejagt, wenn die Vegetation licht genug wächst.
Stichprobenbeobachtungen, u.a. im Rahmen der systematischen Uhu und Waldkauz Kartierungen, bestätigten die weite Verbreitung der Zwergohreule im Halboffenland. Auf 154 km² wurden dabei 14 Reviere festgestellt (9 RP/ 100 km²). Der tatsächliche Bestand dürfte allerdings deutlich höher liegen. In der Provinz Málaga ist sie die zweithäufigste Eule, nach dem Steinkauz (Garrido Sánchez 1997).
In den Pinienwäldern der Randlagen, an den Gebirgshängen wurde keine Eule festgestellt. In den Ackerbereichen hingegen fehlen Bäume als Ansitz- und Brutmöglichkeiten.
Zwei Zwergohreulenreviere. Ein Revier befindet sich am Hang im Hintergrund, das zweite im Vordergrund. Dessen Niststandort befindet sich in dem Eichenbestand am Hang, rechts von dem gelben Gebäude.
Siedlungsdichte
Im südlichen Vorland der Sierra Alcaparaín, mit abwechslungsreichen und offenen Strukturen, mit kleinparzelliertem Weide- und Ackerland, Mattoral, sowie einigen Baumhainen, wurden in einer Distanz von 6 Kilometern 3 revieranzeigende Männchen fest gestellt.
In den Olivenhainen am Loma de Tolox wurden auf eine Fläche von 2,5 km² 2 Zwergohreulen Reviere festgestellt (0,8 RP/1 km²). Diese siedelten in relativ geringer Distanz. Die Olivenhaine wurden extensiv bewirtschaftet, mit überwiegend alten Bäumen mit zahlreichen Höhlen. Die Bodenstrukturen waren offen, mit lichtem Bewuchs, der alljährlich untergepflügt wurde. Überall in der Fläche befanden sich auch kleine Bereiche, die infolge des Reliefs nicht bearbeitet werden konnten und Wildwuchs vorherrschte. Große Insekten, wie Käfer oder Heuschrecken, waren häufig vertreten.
In einer 3 km² umfassenden Untersuchungsfläche in den Mandelbaum- und Olivenhainen östlich Guaro, wurden zwischen 2015 und 2021 konstant 6 Reviere festgestellt (2 RP/ 1 km²) und seit 2020 7 Reviere. Am westlichen Rand der Fläche befindet sich der Rio Seco. Die Aue ist bewachsen mit spanischem Rohr, Gebüschen, Weiden, Zitterpappeln, sowie kleinen Obstbaum- und Olivenhainen. Auf der westlichen Seite der Aue überwiegen Olivenhaine, mit wenig alten Bäumen. Östlich des Flusses steigt das Relief stark an. Hier befinden sich überwiegend Mandelbaumhaine und nur wenige Olivenhaine, die sehr extensiv genutzt werden und z.T. auch aufgelassen und verwildert sind. Dort haben sich zahlreiche stattliche Stein- und Korkeichen entwickelt, die einzigen Bäume im Bereich, die den Eulen Brutmöglichkeiten in Form von Baumhöhlen bieten können. Der gesamte Bereich wird stark beweidet, die Vegetation ist licht und entsprechend kurz. Daneben existieren aber auch einige stark versaumte Parzellen. Die Anzahl an größeren Insekten, insbesondere Heuschrecken ist sehr groß, ebenso auch von Eidechsen. Mäuse kommen im Umfeld der wenigen Fincas reichlich vor (Walz 2024).
In geeigneten Biotopen in Süd- Frankreich können hingegen Siedlungsdichten bis zu 5 RP/ km² erreicht werden, in der degradierten Garigue hingegen höchstens nur 2 RP/ 1 km² (Glutz von Blotzheim et al 1971). Die hier ermittelte Siedlungsdichte kann also nicht als hoch eingestuft werden. Bei Stichprobenkartierungen in weiteren Bereichen im Süden der Provinz Málaga, insbesondere innerhalb der 250 km² umfassenden Kontrollfläche, konnten jedoch kaum größere Siedlungsdichten, als am Loma Rozuela festgestellt werden. In weiten Bereichen der 1500 km² umfassenden Untersuchungsfläche fehlt hingegen die Zwergohreule, oder ist deutlich seltener, so u.a. in den ausgedehnten Wald- und Ackerbaugebieten, sowie innerhalb der Hochgebirge. Auch Oñate Gutiérrez & Oñate García (2012) geben die Zwergohreule als mäßig verbreitet, für den Raum östlich der Sierra de las Nieves an.
Bestandsentwicklung
Innerhalb der 3 km² umfassenden Untersuchungsfläche stieg der Bestand von 2014 bis 2021 von 6 auf 7 Reviere. Da allerdings im weiteren Umfeld zunehmend mehr extensiv bewirtschaftete Oliven- und Mandelbaumhaine in intensiv bewirtschaftete Olivenhaine und Avocadoplantagen umgewandelt werden, die keinen Lebensraum für Insekten bieten und zudem extrem häufig mit Chemie bearbeitet werden, ist zu erwarten, dass die Bestände zukünftig stark rückläufig sein werden. Und so wurde 2024 ein Brutrevier aufgegeben, nachdem das Männchen kurz nach der Ankunft verschollen war. Das Weibchen rief darauf vergeblich bis Mitte August nach einem Männchen. Dies spricht dafür, dass der Anteil an Junggesellen bereits so niedrig ist, dass Verluste von Reviervögeln nicht mehr genügend ersetzt werden und die Population im Schrumpfen begriffen ist.
Nach Mebs et al. (2012) ist in den letzten Jahrzehnten ein drastischer Bestandsrückgang der Zwergohreule auch in Spanien beobachtbar. Dieser wurde vor allem bewirkt durch die starke Intensivierung der Landwirtschaft, sowie durch den flächenhaften Einsatz von Bioziden und Kunstdüngern, die den Eulen die Nahrungsgrundlage, große Insekten, entziehen.
Habitat
Die Zwergohreule ist ein typischer Bewohner des Halboffenlandes. Sie benötigt freie Flächen zum Jagen und Bäume zum Ansitzen und Brüten, wobei diese einen entsprechenden Umfang haben müssen, damit sie Platz für Baumhöhlen haben, welche die Eulen zum Brüten nutzen. Die Vegetation am Boden muss licht und niedrig sein, damit die Eulen ihre Beute sehen und fangen können. Dennoch sind viele verschiedene Bodenstrukturen notwendig, damit ein reichhaltiges Leben an großen Insekten und kleinen Wirbeltieren ermöglicht wird. Das Jagdhabitat eines untersuchten Paares umfasste einen großen Anteil versaumter Bereiche, mit licht wachsenden Grasbulten und Zwergsträuchern, bis etwa 50 cm Höhe, wobei das Paar überwiegend Sattelschrecken und daneben auch Beißschrecken und Gottesanbeterinnen erbeutete. Arten, die nur in höherwüchsiger Bodenvegetation vorkommen.
Kleine Feldgehölze und dicht stehende Bäume bieten den ausgeflogenen Jungvögeln Schutz vor Feinden und Sonne. Entsprechend ist ihr Vorkommen in alten, extensiv genutzten Olivenhainen sehr hoch, wie auch in extensiv genutzten Mandelbaumhainen, wenn dort auch alte Bäume, insbesondere Eichen stehen. Zumeist bilden sie die Zentren der Aktivitäten der Eulen. Größere Siedlungsdichten wurden auch in verwildertem Kulturland und baumbestandenem Naturland registriert, wenn genügend offene Flächen mit lichtem Bewuchs vorhanden sind. Oftmals befinden sich Eichenwaldrelikte in den tief eingeschnittenen Hangrunzen und Tälern, weshalb sich die Eulen dann dort bevorzugt aufhalten. Auch Oñate Gutiérrez & Oñate García (2012) betonen die besondere Bedeutung der Eichen für die Eulen, wie auch alter Olivenbäume. Daneben kommen sie auch gelegentlich in Siedlungen und Parkanlagen vor
Neben dem Niststandort nutzen zumindest einige Paare, die in ungünstigeren Bereichen nisten, nach Ausflug der Jungen ein alternatives Revierzentrum und Ruhestandort. In einem beobachteten Fall war dies eine dicht stehende Eichen- und Olivenbaumgruppe in einem tief eingeschnittenen kleinen Tal, in einer Distanz zu dem Brutstandort von etwa 100 Metern. In dem beschatteten Tal verbrachten die Eulen den Tag und die noch im Fliegen ungeübten Jungvögel die Nächte. Von dort aus unternahmen die Altvögel ihre Jagdausflüge und später folgten ihnen auch die Jungvögel (Walz 2024).
Tagesaufenthaltsbereich einer Zwergohreulenfamilie mit flüggen Jungen, in einem beschatteten, abgelegenen Tälchen. In zwei aufeinander folgenden Jahren nutzten sie den gleichen Bereich und zumeist auch den geleichen Baum. Im Hintergrund links, ein angrenzender Mandelbaumhain, der von der Eulen zur Jagd genutzt wurde.
Aktionsraum- Reviergrößen