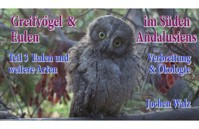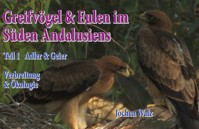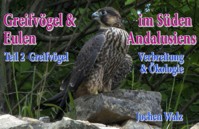
8,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Greifvögel und Eulen im Süden Andalusiens
- Sprache: Deutsch
Der Autor hat in weiten Bereichen der Provinz Málaga und in Teilbereichen der Provinz Cádiz die verschiedenen Greifvogelarten systematisch kartiert. Mit den Resultaten, die in den folgenden drei Bänden dargestellt wurden, kann der naturinteressierte Beobachter sich ein ernsthaftes Bild darüber machen, wie die Greifvögel, Geier und Eulen heute in den Provinzen Málaga und Cádiz verbreitet sind und in welcher Siedlungsdichte. Oftmals handelt es sich dabei nicht um die stets angepriesenen Naturgebiete, sondern um extensiv genutzte Kulturlandschaften, die zumeist wenig Beachtung finden. Neben der Verbreitung der Greifvögel, Geier und Eulen befassen sich die drei Bände kritisch mit deren Bestandsentwicklung und Gefährdung. Daneben informieren die Bände ausführlich über die Lebensräume und Lebensweise, Verhalten, Nahrung/ Jagdweise, Jagdrevier/ Aktionsraum, Balz/ Balzflüge, Interaktionen, Zug/ Überwinterung und Leben im Verlauf des Jahres/ Brut und Nachwuchs. Neben der Recherche aus der Literatur, wurden auch die Erkenntnisse eigener Beobachtungen und Untersuchungen angeführt, die an zahlreichen Greifvogel- und Eulenarten durchgeführt wurden. Daneben wurden Daten und Erkenntnisse aus Deutschland berücksichtigt. Entsprechend sind die drei Bände auch für all diejenigen von Interesse, die mehr über Greifvögel wissen möchten, unabhängig von Landesgrenzen. Zahlreiche Fotografien von den Greifvögeln/ Eulen sowie von ihren Lebensräumen, illustrieren anschaulich die Artkapitel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Greifvögel, Eulen und einige weitere bemerkenswerte Vogelarten in den Provinzen Málaga und Cadiz, ein Vergleich mit Mitteleuropa/ Baden Württemberg
– Teil 2 Greifvögel
Inhalt
Gleitaar (Elanus caeruleus)
Wespenbussard (Pernis apivorus)
Habicht (Accipiter gentilis)
Sperber (Accipiter nisus)
Rohrweihe (Circus aeruginosus)
Wiesenweihe (Circus pygargus)
Kornweihe (Circus cyaneus)
Rotmilan (Milvus milvus)
Schwarzmilan (Milvus migrans)
Mäusebussard (Buteo buteo)
Turmfalke (Falco tinnunculus)
Rötelfalke (Falco naumanni)
Wanderfalke (Falco peregrinus)
Baumfalke (Falco subbuteo)
Literatur
Die Greifvogelarten
Gleitaar (Elanus caeruleus)
Vorkommen nach Literatur in Andalusien
Der Gleitaar hat sich erst in den 70er Jahren des vorherigen Jahrhunderts in Spanien angesiedelt und sich seither konstant ausgebreitet. 2011 lebten in Andalusien bereits 177 Paare, die sich auf alle Provnzen verteilen, mit Ausnahme von Almeria. Der Schwerpunkt der Verbreitung liegt allerdings in den westlichen Provinzen, also insbesondere Huelva und daneben Sevilla, da sich die Art von Portugal her ausbreitete. Da die Art überwiegend in mit Bäumen bestandenen Ackerlandschaften lebt, liegen die Siedlungsschwerpunkte zudem in der Guadalqquvierebene. Im Bereich der Betischen Kordillere fehlt die Art. Und so fehlt sie in der Provinz Malaga weitgehend, mit Ausnahme der Bereiche nördlich der Gebirge.
Vorkommen innerhalb der 1500 km² umfassenden erweiterten Untersuchungsfläche
Innerhalb der Untersuchungsfläche kommt der Gleitaar nicht vor. Allerdings im Umfeld des Fuente de Piedra, wenige Kilometer nördlich. Dort brütete 2008 erstmals ein Paar und seitdem weiterhin unregelmäßig (Jiménez et al. 2012). 2013 hielt sich ein weiteres Individuum mehrmals einige Kilometer südwestlich des Fuente, an der Strasse nach Campillos auf.
Brutbestand
Spanien: 500- 1000 Paare (2002), Frankreich 13 Paare (2003), Portugal: 100- 150 Paare (1999) (Mebs & Schmidt 2006).
Bestandsentwicklung
Die ersten Brutvorkommen in Südwestspanien wurden Anfang der 1970er Jahre festgestellt. Seitdem hat sich der Gleitaar nach Norden und Nordosten ausgebreitet, bis in den Südwesten von Frankreich, wo 2003 bereits 13 Brutpaare siedelten. Allerdings wurden auch Reviere wieder aufgegeben, infolge Intensivierung der Landwirtschaft (Mebs & Schmidt 2006). Glutz von Blotzheim et al. (1971), geben noch 1971 an, dass der Gleitaar in Portugal ein seltener und nur lokal verbreiteter Brutvogel ist. D.h. er hatte Südspanien noch nicht erreicht. Die Verbreitung des Gleitaars erstreckte sich ursprünglich über Südost- und Südasien über den Nahen Osten und Afrika südlich der Sahara und Nordafrika, bis Marokko. Von dort aus ist er wahrscheinlich auf die Iberische Halbinsel eingewandert (Glutz von Blotzheim et al. 1971). Für 2011 wird ein Bestand von 177 Paaren für Andalusien angegeben (Garcia et al 2019).
Habitat
Der Gleitaar siedelte ursprünglich in den Savannen, auch Steppen und Halbwüsten, sowie Kulturland mit lichtem Baumbestand. In Trockengebieten siedelt der Gleitaar stets in der Nähe von Wasserflächen und z.T. auch in der Nähe von Siedlungen im Kulturland (Glutz von Blotzheim et al. 1971).
In Spanien lebt der Gleitaar in offenen Ackerlandschaften mit einigen eingestreuten Bäumen, nicht selten auch in der Nähe von Feuchtgebieten.
Typischer Lebensraum des Gleitaars am Fuente de Piedra.
Aktionsraum
In nahrungsreichen Gebieten umfasst der Aktionsraum nur etwa 2- 2,5 km² (Mebs & Schmidt 2006).
Nahrungserwerb
Der Gleitaar jagt aus dem langsamen Segelflug in geringer Höhe und rüttelt häufig. Bei stärkerem Wind steht er gegen den Wind, ohne einen Flügelschlag. Er schlägt die Beute nicht aus dem Sturzflug, sondern durch senkrechtes Absinken, mit hoch erhobenen Flügeln. Daneben betreibt er Ansitzjagd (Jiménez et al. 2012). Der Aktivflug findet unter ruckartigen Flügelschlägen statt, beim Gleitflug hält er die Flügel auffällig V- Förmig über dem Körper.
Nahrung
Der Gleitaar jagt überwiegend Kleinsäuger, vorallem Mäuse. Daneben auch Eidechsen, Kleinvögel und gelegentlich große Insekten, insbesondere fliegende Heuschrecken. Diese stellen aber einen geringen Anteil der Biomasse an der Beute dar (Glutz von Blotzheim et al. 1971, Mebs & Schmidt 2006).
Winter
Der Gleitaar ist Standvogel und die Paare überwintern in ihrem Revier oder dessen Nähe, in nahrungsreichen Bereichen, wie Feuchtgebieten. Das Paar am Fuente de Piedra ist das gesamte Jahr anwesend (Jiménez et al. 2012). Im Doñana Nationalpark überwintern regelmäßig Gleitaare. Die Jungvögel verstreichen in zumeist geringe Distanzen. Der Gleitaar vergesellschaftet sich im Winter auch mit Artgenossen, die gemeinsam nächtigen. In der Extremedura wurden Schlafplätze mit 42- 60 Individuen gezählt (Mebs & Schmidt 2006).
Überwinterhabitat des Gleitaar in den Feuchtgebieten des Doñana Nationalparks.
Balz
Die Brutreife wird wahrscheinlich bereits am Ende des ersten Lebensjahres erreicht (Mebs & Schmidt 2006). Der Gleitaar nistet in Bäumen, in Nestern anderer Vogelarten (Jiménez et al. 2012). Nach Mebs & Schmidt (2006) baut der Gleitaar hingegen zumeist jedes Jahr ein neues Nest, wobei sich beide Partner am Nestbau beteiligen. Das Männchen bringt überwiegend die Zweige und das Weibchen baut diese ein. Das Nest ist ein lockerer sehr flacher Bau. Das Männchen versorgt das Weibchen bereits während der Balz mit Nahrung (Glutz von Blotzheim et al. 1971).
Brut
Die Brut wird in Spanien Ende Februar/ Anfang März aufgenommen. Es werden (2) 3- 4 (6) Eier gelegt. Der Legeabstand beträgt 2- 3 Tage. Die Brut wird mit dem ersten Ei aufgenommen, es brütet überwiegend das Weibchen und wird nur gelegentlich vom Männchen abgelöst. Allerdings können die Brutpartner am Tage auch fast die gleiche Brutleistung erbringen, nachts brütet das Weibchen. Die Brutdauer beträgt 30- 33 Tage (Glutz von Blotzheim et al. 1971, Mebs & Schmidt 2006).
Nestlingszeit
Die Jungen schlüpfen Anfang bis Mitte April. Die Nestlingszeit beträgt 30- 35 Tage (Glutz von Blotzheim et al. 1971, Mebs & Schmidt 2006). Nach Beendigung der Huder beteiligt sich das Weibchen am Nahrungserwerb (Glutz von Blotzheim et al. 1971).
Familienverband
Nach dem Ausfliegen werden die Jungen noch einige Wochen zumeist vom Männchen versorgt, während das Weibchen, bei günstiger Nahrungssituation und günstigem Siedlungsbestand, eine zweite Brut aufnehmen kann (Mebs & Schmidt 2006)
Bruterfolg
Durchschnittlich fliegen 2,5 Junge pro erfolgreiche Brut aus. Die Fortpflanzungsziffer beträgt 2,0 Junge pro angefangene Brut.
Gefährdungsursachen
Die Intensivierung der Landwirtschaft hat in Spanien bereits zu Aufgaben von Revieren geführt. Dem Gleitaar werden dadurch die Nahrungsflächen entzogen und durch den Einsatz von Spritzmitteln auch die Beutetiere. Die massive Eutrophierung von Feuchtgebieten, infolge Überdüngung, sowie die zunehmende Austrocknung dieser, infolge exzessiver Wasserentnahme der Zuflüsse für die Landwirtschaft, nehmen dem Gleitaar zusätzlich Lebensräume.
Wespenbussard (Pernis apivorus)
Vorkommen in Andalusien nach Literatur
Der Wespenbussard brütet im Norden der Extremadura, in Andalusien hingegen nur ausnahmsweise, u.a. in den Montes Málaga mit mindestens einer erfolgreichen Brut, oder im Westen der Provinz Malaga in 1989. Er zieht aber alljährlich mit etwa 100000 Individuen durch Andalusien und über die Meerenge von Gibraltar. So kann man entlang der Zugwege in den Provinzen Cadiz und Malaga große Konzentrationen beobachten, u.a. auch, wie sie ihre Schlafplätze am Abend anfliegen.
Der Bestand des Wespenbussards östlich der Serranía de Ronda und in der Provinz Málaga
Der Wespenbussard kommt im Bereich östlich der Serranía de Ronda als sehr häufiger Zugvogel vor. Er zieht im Frühjahr insbesondere im April/ (Mai) durch Andalusien und im Herbst zwischen dem letzten Augustdrittel und Anfang Oktober. Er kann dann häufig, z.T. täglich, in großen Trupps bis 300 Individuen und mehr, beobachtet werden.
Der Brutbestand in Spanien beträgt (in 2002) 900- 1300 Paare (Mebs & Schmidt 2006), in Deutschland (in 2015) 4300- 6200 Paare (Lenz et al. 2021) und in Frankreich (in 2002) 10600- 15000 Paare (Mebs & Schmidt 2006).
Bestandsentwicklung
Der Brutbestand des Wespenbussards in Europa umfasst etwa 119000- 171000 Paare, die vor allem im Osten konzentriert sind, davon 49% in Russland. Der Bestand erscheint in Europa als stabil, mit abnehmender Tendenz in Deutschland, stabilem Bestand in Frankreich und eventuell zunehmendem Bestand in Spanien (Lenz et al. 2021).
Habitat
Der Wespenbussard benötigt reich strukturierte Landschaften, reines Offenland und ausgedehnte Waldgebiete werden gemieden. Er nistet in lichten Wäldern mit alten Baumbeständen, zumeist in Waldrandnähe, oder in Feldgehölzen.
Zur Nahrungssuche nutzt er insbesondere lichte und sonnenbeschienene, strukturreiche Wälder in verschiedenen Altersklassen und deren Waldränder. Daneben seltener in reich strukturiertem Halboffenland, mit Wiesen, Magerrasen, Hecken, Bäumen, Wachholderheiden und in Feuchtgebieten. Neben günstigen Brutmöglichkeiten für Wespen und Hummeln müssen die Bereiche auch störungsfrei sein, dass sich die Insektenvölker dort entwickeln können.
Reviere/ Aktionsräume
Die Aktionsräume sind stark abhängig von den Beständen der Wespen und schwanken z.B. zwischen 8- 16 km² in guten Wespenjahren und 16- 25 km² in schwachen Wespenjahren. In anderen Gebieten, mit geringerem Vorkommen an Wespen, können sie 45 km² umfassen. Die Männchen entfernen sich bei der Nahrungssuche bis zu 6 Kilometer vom Nest. Die häufiger bejagten Bereiche in Horstnähe werden gegen Artgenossen vom Männchen verteidigt (Mebs & Schmidt 2006, Lenz et al. 2021).
Nahrungserwerb
Der Wespenbussard sucht Wespen- oder Hummelnester aus dem tiefen Suchflug, unterbrochen mit häufigem Ansitzen. Die Nester gräbt er aus dem Boden aus, woauf er die Waben im Schnabel mit fortträgt, oder sogleich frisst. Kleinsäuger, Reptilien oder Amphibien jagt er z.T. auch zu Fuß (Mebs & Schmidt 2006).
Nahrung
Die Nahrung des Wespenbussards besteht überwiegend aus Wespen und Hummeln, sowie deren Brut. Daneben erbeutet der Wespenbussard Kleinsäuger, Reptilien, Amphibien und Kleinvögel, insbesondere Jungvögel und weitere Insekten und Wirbellose. Diese können bis zu 35% der Nahrung ausmachen, wobei die Alternativbeute vor allem bei Mangel an Wespen und Hummeln eingebracht wird. Daneben nimmt der Wespenbussard auch Früchte auf. Im afrikanischen Überwinterungsquartier ernährt sich der Wespenbussard hauptsächlich von Insekten (Mebs & Schmidt 2006, Lenz et al. 2021).
Winter/ Zug
Der Wespenbussard ist Langstreckenzieher, der in Afrika südlich der Sahara überwintert. In den Brutgebieten hält er sich nur 3,5- 4 Monate auf. Im Mai findet der Einzug in die mitteleuropäischen Brutgebiete statt. Der Abzug findet hauptsächlich zwischen Mitte August und Mitte September statt. Der Durchzug in Südspanien hat seinen Höhepunkt zwischen dem 20. August und Mitte September. Bis Ende September nehmen die Zugzahlen stark ab und im Oktober sind nur noch gelegentlich vereinzelte Individuen oder kleine Trupps beobachtbar. Die Populationen West- und Mitteleuropas ziehen überwiegend nach Südwesten, über Spanien und die Meerenge von Gibraltar und überwintern in der tropischen Regenwaldzone West- Afrikas, so in Liberia, Ghana, Nigeria, Gabrun und Kongo. Ein geringerer Teil zieht über Italien und Sizilien, darunter ein Großteil der Jungvögel, die bis zu 3 Wochen später abziehen, als die Altvögel. Ein in Norddeutschland besenderter Wespenbussard zog über Gibraltar in den Kongo, wo er überwinterte und flog über Italien zurück (Mebs & Schmidt 2006, Lenz et al. 2021). Es ist möglich, dass während des Frühjahrszugs generell häufiger Wespenbussarde größere Strecken über das Mittelmeer auf sich nehmen und nicht über Gibraltar ziehen, was auch die deutlich geringere Anzahl an ziehenden Wespenbussarden dort im Frühjahr andeutet. Auch innerhalb Süd- Andalusiens landen im Frühjahr, bei starkem Wind aus westlichen Richtungen, sehr viele Wespenbussarde auf der Höhe Marbellas und noch weiter östlich an, was einen deutlich weiteren Weg über das Meer beinhaltet. Während des Herbstzugs haben die Wespenbussarde hingegen über Spanien und Nordafrika zumeist Rückenwind, infolge des NO Passates.
Im Bereich der Provinzen Málaga und Cádiz fliegen die meisten Wespenbussarde entweder östlich der Serranía de Ronda und dann entlang der Küste nach Gibraltar oder Tarifa oder über das Rio Genaltal. Bei Ostwind fliegen sie im Aufwind der ostexponierten Gebirgsflanken der Serranía de Ronda (S. Alcaparaín bis S. Nieves) und von Los Alcornocales und ziehen bei Tarifa über das Meer. Bei Westwinden ziehen sie entlang der westexponierten Flanke des Genaltales, häufiger jedoch quer über die Guadalhorceebene und darauf an der Küste bis Gibraltar, wo sie dann übersetzen. Bei Bewölkung über den Bergen ziehen sie ebenfalls abseits von diesen, wieder zumeist über der Guadalhorceebene.
Eine der Hauptzugstrecken des Wespenbussards in der Provinz Málaga, entlang der Ostflanke der Serranía de Ronda (im Hintergrund) oder über das Hügelland der Guadalhorceebene (Bildmitte). Häufig nächtigen große Trupps in den Kiefernwäldern der Vorbergszone der Sierra Alpujata (Bildvordergrund).
Balz
Die Wespenbussarde nehmen frühestens im Alter von 3 Jahren die Brut auf. Bis dahin bleiben sie wahrscheinlich in Afrika. Neu angesiedelte Paare nehmen erst im Jahr nach der Ansiedlung die Brut auf. Alteingesessene Paare nehmen nach Ankunft des zweiten Brutpartners ab Anfang Mai die Balz auf. Die Männchen unternehmen ab da die typischen Wellenflüge über dem Brutrevier, die ansonsten für Adlerarten typisch sind und klatschen immer wieder die Flügel oberhalb des Körpers zusammen.
Brut
Die Brut wird in Mitteleuropa, wie in Spanien Ende Mai/ Anfang Juni aufgenommen. Es werden (1) 2 (3) Eier gelegt. Es wird ab dem ersten Ei gebrütet. Die Brutdauer beträgt (30) 34- 35 (37) Tage. Beide Partner brüten, wobei die Brutzeiten des Weibchens überwiegen. Nachts brütet das Weibchen (Sánchez et al. 1997, Mebs & Schmidt 2006, Lenz et al. 2021).
Nestlingszeit
Die Jungen schlüpfen Ende Juni bis Mitte Juli. Das Weibchen hudert die Jungen etwa 2 Wochen. Das Männchen besorgt die Nahrung. Im fortgeschrittenen Nestlingsalter beteiligt sich auch das Weibchen am Nahrungserwerb. Die Nestlingszeit beträgt 40- 48 Tage (Sánchez et al. 1997, Mebs & Schmidt 2006, Lenz et al. 2021).
Flugzeit/ Familienverband
Anfang, zumeist Mitte bis Ende August fliegen die Jungen aus, wobei die Reviere bereits Anfang September verlassen werden (Mebs & Schmidt 2006, Lenz et al. 2021).
Bruterfolg
Die Bruterfolge sind sehr stark abhängig von Witterung und dem Vorkommen von Wespen. Und deshalb auch von der ökologischen Qualität der Wälder und der angrenzenden Halboffenlandbereiche. Brutausfälle sind deshalb keine Seltenheit und können in intensiv bewirtschafteten Agrarländern, wie den Niederlanden bei über 50% liegen (Mebs & Schmidt 2006). Da der Wespenbussard zumeist nur zwei Junge großzieht, ist die Fortpflanzungsrate auch bei gelungenen Bruten entsprechend gering.
Die Überlebensrate beträgt im ersten Jahr zwischen 49% und 58% und in späteren Jahren zwischen 85% und 92%. Das Höchstalter beträgt 29 Jahre (Mebs & Schmidt 2006).
Gefährdungsursachen
Der extreme Einsatz von Düngung und Giften in der Landwirtschaft nimmt Insekten und auch Wespen und Hummeln die Nahrungsgrundlage (Blüten und andere Insekten) und tötet sie auch direkt. Die Ausräumung der einst strukturreichen Landschaft infolge Monokulturen, vernichtet die Lebensräume der Insekten zusätzlich. Ebenso auch eine zu intensive Waldbewirtschaftung.
In den Mittelmeerländern werden Wespenbussarde illegal noch intensiv verfolgt, insbesondere auf Malta, in Süditalien und Libanon.
Windkraftanlagen stellen auch für den Wespenbussard ein großes Kollisionsrisiko dar, insbesondere, wenn sie in Wäldern nahe der Neststandorte errichtet werden (Mebs & Schmidt 2006, Lenz et al. 2021).
Habicht (Accipiter gentilis)
Verbreitung in Andalusiennach Literatur
Aus der spanischen Literatur ist zu entnehmen, dass der Habicht in fast allen Waldgebieten der Naturlandschaften Andalusiens vorkommt. In der Sierra Grazalema siedeln sogar 14 Brutpaare.
Verbreitung/ Bestand innerhalb der 1500 km² umfassenden erweiterten Untersuchungsfläche
Über den Habicht können nur ungefähre Aussagen getroffen werden, da er sehr unauffällig lebt und nicht zielgerichtet kartiert wurde. Innerhalb der erweiterten Untersuchungsfläche von 1500 km² wurden bislang 14 Reviere festgestellt (knapp 1 PR/ 100 km²), wobei in den Unterhangbereichen fast aller Gebirge, wenn sie bewaldet waren, Reviere festgestellt wurden. Entsprechend zieht sich ein Siedlungsband entlang der Gebirgsränder im Süden, von der Monte Mijas über die bewaldeten Vorberge der Sierra Alpujata zur Sierra Blanca. Mit bislang 7 festgestellten Revieren, ist hier die Siedlungsdichte am höchsten. Dies mag u.a. mit dem sehr großen Vorkommen der Ringeltaube in diesem Bereich zusammen hängen. In den bewaldeten Vorbergen der Sierra Alpujata nisten 3 Paare auf einer Distanz von nur 4 Kilometern, ein viertes in einer Distanz von 4 Kilometern, sowie ein fünftes etwa 3 Kilometer entfernt im Offenland, in dichten Steineichenbeständen. Daran angrenzend zieht sich das Siedlungsband nach Nordost, über die Sierra de Tolox mit mindestens einem Paar, über die bewaldeten Randbereiche der Sierra de las Nieves, dem Rio Turon Tal, der Sierra Prieta und S. Alcaparaín. Darauf schwenkt es nach Ost ab, und endet in den bewaldeten Bereichen der westlichen Sierra Valle de Abdalajis (El Chorro). Der Bestand des Habichts dürfte in dem gesamten bewaldeten Bereich der Vorberge der südlichen Küstengebirge und dem bewaldeten Ostrand der Serranía de Ronda hoch sein, da in jedem intensiver beobachteten Bereich mindestens ein Revier festgestellt wurde. Mit einer Ausnahme innerhalb der Korkeichenwälder der Sierra de Tolox und einer in Korkeichenbeständen im Offenland, befanden sich alle Reviere in Kiefernwäldern mit alten Baumbeständen. Alle Reviere waren so ausgerichtet, dass das Halboffenland, mit extensiv genutzten Mandelbaum- und Olivenhainen nicht weit entfernt war. Systematische Beobachtungen im Bereich der Sierra Alpujata bestätigten die häufige Jagd im Halboffenland. In den höheren Gebirgslagen wurden keine Habichte registriert. Dort dürfte die Beutetierdichte zu gering sein. In der östlich angrenzenden Guadalhorceebene, mit weitgehendem Offenlandcharakter (überwiegend Ackerland, Oliven- und Fruchtbaumplantagen), die den gesamten zentralen und östlichen Teil der Untersuchungsfläche darstellt, wurde der Habicht nicht nachgewiesen. Unter Ausschluss der weiten Offenland- und Hochgebirgsbereiche, ist die Siedlungsdichte des Habichts deutlich größer, als die ermittelten 1 RP/ 100 km².
Nach Oñate Gutiérrez & Oñate García (2012) kommt der Habicht im Bereich östlich der Serranía de Ronda verbreitet und mäßig häufig vor, ist aber im Bereich der Serranía de Ronda nicht sehr verbreitet (Oñate García & Oñate Gutiérrez 2009).
In den bewaldeten Vorbergen der Sierra Alpujata nisten 3 Habichtpaare.
Verbreitung/ Bestand innerhalb der 154 km² umfassenden Untersuchungsfläche
Innerhalb der 154 km² umfassenden Untersuchungsfläche nördlich der Sierra Alpujata, die, mit zwei Lücken, relativ genau auf den Habicht kartiert wurde, wurden 6 Brutreviere (3,9 BP/ 100 km²) und 7 (4,5 RP/ 100 km²) Jagdreviere festgestellt. Geschätzt wurden 8 Brutreviere (5,2 BP/ 100 km²). Drei weitere Reviere befanden sich jeweils nur wenige Kilometer außerhalb. Alle Brutreviere befanden sich in Kiefernwäldern mit überwiegend älteren Baumbeständen. Und ein Revier in dichten Korkeichenbeständen mit alten Bäumen im Halboffenland. Alle beobachteten Paare jagten häufig über und in dem angrenzenden Halboffenland, das überwiegend mit Oliven- und Mandelbaumhainen kultiviert ist. Daneben häufig über den Ortschaften, mit großen Vorkommen an verwilderten Haustauben und Türkentauben. Taubenschläge wurden regelmäßig, z.T. täglich aufgesucht.
In Baden- Württemberg wurden Siedlungsdichten in günstigen Gebieten und Jahren von mehr als 7 RP/ 100 km² festgestellt und in ungünstigen weniger als ein Zehntel davon. Für Deutschland wird ein Mittelwert von 3,9 RP/ 100 km² angegeben und für Mitteleuropa 0,5- 7 RP/ 100 km² (Bauer et al. 2021). Mebs & Schmidt (2006) geben Siedungsdichten für Deutschland zwischen 1,7 RP/ 100 km² und 8,4 RP/ 100 km² an und für Zentral Polen 11,9 RP/ 100 km². Entsprechend kann der Bestand im Untersuchungsgebiet als mäßig hoch eingestuft werden. Unter Berücksichtigung der großen Offenlandbereiche innerhalb der erweiterten Untersuchungsfläche, ist der Bestand als eher gering einzustufen.
Bestandsentwicklung
In Spanien erscheint der Bestand des Habichts stabil zu sein (BirdLife International 2015 in Bauer et al. 2021).
Nach Sánchez et al. (1997) erscheint der Bestand in der Provinz Málaga einigermaßen stabil zu sein, mit eventuell leichten Bestandseinbußen mittels Vernichtung von Bruthabitaten infolge der häufigen Waldbrände.
Habitat
Der Habicht besiedelt strukturreiche Wälder, mit alten Baumbeständen und Lichtungen, zumeist in der Nähe zu strukturreichem Halboffenland. Offenes Agrarland wird höchstens in den Randbereichen bejagt. Dabei jagt er sowohl in den Wäldern, an den Waldrändern, wie im baumbestandenen Halboffenland. Voraussetzung ist ein großes Vorkommen an Beutetieren, Vögel, wie Säugetiere, die er aus der Deckung heraus überraschen kann.
Die Horste werden auf alten Bäumen angelegt, in lichten Baumbeständen, an Lichtungsrändern in Waldrandnähe, selten bis zu einem Kilometer entfernt, oder an Waldrändern. Daneben benötigt er freien Anflug auf den Horst, weshalb er häufig auch an Hängen nistet. Gelegentlich finden auch Bruten im Halboffenland statt, so z.B. in bachbegleitenden alten Gehölzen.
Innerhalb der Provinz Málaga siedelt der Habicht fast ausschließlich in den bewaldeten Bereichen der unteren Lagen der Gebirge oder deren vorgelagerter Hügelzone. Er jagt auch häufig im angrenzenden Kultur- und Halboffenland. Dabei beträgt die Distanz bis zu seinen Horstbereichen nicht selten bis zu 4 Kilometer.
Jagdhabitat eines Habichtspaares mit strukturreicher Landschaft und einem ehemaligen Stall mit verwilderten Tauben.
Aktionsraum
Je nach Nahrungsangebot können die Aktionsräume des Habichts unterschiedlich groß sein. So wurden in nahrungsreichen Gebieten Größen von 4 km² ermittelt, während in nahrungsarmen Gebieten oder Zeiten über 80 km² fest gestellt wurden. Die Distanzen zum Nest können dann 6- 8 Kilometer betragen (Bauer et al. 2021). Während der Jungenaufzucht dürften in der Regel, in einigermaßen reich strukturierteren Landschaften, die Aktionsraumgrößen zwischen 20 und 40 km² betragen. Zu große Horstdistanzen führen zwangsläufig zu geringen Bruterfolgen, da zu viel Zeit in aufwendige Flugstrecken investiert werden muss.
Im Untersuchungsbereich betrugen die regelmäßig zurückgelegten Maximaldistanzen eines Habichtspaares während der Jagdflüge 4 Kilometer. Sie führten in ein überwiegend mit Mandelbaumhainen und daneben Olivenhainen kultiviertes Halboffenland, sowie einer Ortschaft mit großem Vorkommen an Türkentauben und verwilderten Haustauben. Taubenschläge wurden gezielt und regelmäßig aufgesucht.
Jagdweise
Der Habicht jagt in deckungsreichen Abschnitten seines Jagdrevieres, wie in Wäldern, an Waldrändern oder in baumbestandenem Offenland, aus dem Ansitz. Daneben unternimmt er immer wieder Jagdflüge in geringer Höhe, wobei er relativ schnell linear durch zumeist ebenfalls deckungsreiche Landschaftsabschnitte fliegt und aus der Überraschung heraus Beute schlägt. Daneben zieht er in größerer Höhe Kreise und lange Bahnen, um darauf aus langgestreckten Flachstößen Beute zu greifen. Dabei ist der Habicht außerordentlich wendig und verfolgt, im Gegensatz zum Wanderfalken, die Beute auch nach verfehlten Beutestößen, noch häufig über längere Strecken, wobei er jeder Wendung, auch von Kleinvögeln, zu folgen vermag. Infolge der breiten Flügelfläche ist er in der Lage, sehr schnell aus dem „Stand“ zu beschleunigen und sehr schnell an Höhe zu gewinnen, wobei er leicht andere Vögel übersteigt, um sie darauf aus größerer Höhe schlagen zu können.
Im Bereich der Mandelbaumhaine suchte der Habicht zumeist in größerer Höhe die Landschaft unter sich ab, eventuell boten diese Bereiche zu wenig Deckung. Zudem hatte er dort einen besseren Überblick über die Tauben unter sich. Allerdings kombinierte er den Suchflug aus größerer Höhe nicht selten mit langgestreckten Flachstößen nach unten, um darauf in geringer Höhe in schnellem Flug über die Landschaft zu streichen.
Nahrung
Der Habicht bevorzugt als Beute mittelgroße Vögel und Säugetiere, die in seinem Lebensraum besonders häufig vorkommen. So gibt es eine relativ große Variationsbreite zwischen den unterschiedlichen Lebensräumen. Häufig sind dies Ringel- und Haustauben, daneben Eichelhäher, Drosseln und Stare. Dies trifft nicht nur auf weite Bereiche Mitteleuropas zu (Mebs & Schmidt 2006) sondern auch für den Untersuchungsbereich in der Provinz Málaga. Die meisten Beobachtungen an Jagdflügen bezogen sich auf die Jagd nach Haus- oder Ringeltauben, die im Offenland nach Nahrung suchen, oder sich auf dem Rückflug in ihre Brutwälder (Ringeltauben) befanden. In Katalonien bilden Rothühner, Kaninchen, Ringeltauben, Eichelhäher, Elstern, Drosseln und Eichhörnchen die wichtigste Beute (Mebs & Schmidt 2006). Im Untersuchungsbereich sind unterdessen Rothühner wie auch Kaninchen inzwischen äußerst selten geworden, infolge intensiver anthropogener Jagd, so dass diese kaum mehr eine Rolle spielen dürften. Daneben werden für die Provinz Málaga als Beute auch Reptilien angegeben (Sánchez et al. 1997, Oñate García & Oñate Gutiérrez 2009, Oñate Gutiérrez & Oñate García 2012).
Der Anteil an Säugetieren beträgt nur etwa 10% neben der Vogelbeute. Der Habicht ist auch in der Lage große Vögel zu schlagen, wie Graureiher oder Mäusebussarde (Bauer et al. 2021) wobei er zumeist Nestlinge oder flügge Jungvögel größerer Arten schlägt. Der Anteil großer Vögel ist allerdings sehr gering. Die deutlich größeren Weibchen schlagen im Mittel größere Beute als die kleineren Männchen.
Überwinterung
Der Habicht ist Standvogel, die Brutpaare überwintern in ihrem Revier. Die Jungvögel verstreichen, nachdem sie selbständig geworden sind, nur etwa 30 Kilometer weit und gründen ein eigenes Revier. Ost- und nordeuropäische Habichte ziehen hingegen von September bis November über große Distanzen (Mebs & Schmidt 2006, Bauer et al. 2021).
In Spanien ist der Habicht Jahresvogel. Die beobachteten Habichte im Untersuchungsbereich hielten ihr Revier das gesamte Jahr über. Im Winter nimmt der Bestand an Habichten zu, insbesondere an Junghabichten.
Balz
Die Balz beginnt, wie auch in Mitteleuropa, bereits im Februar mit z.T. spektakulären Flügen über dem Horstrevier, wobei bereits Ende Januar gelegentlich Balzflüge beobachtet werden können. Auch Auseinandersetzungen mit Artgenossen können bereits im Februar beobachtet werden. Während der Balz wird der Horst ausgebaut. Da diese häufig über viele Jahre genutzt werden, können mächtige Bauten entstehen. Zudem stehen einem Paar zumeist mehrere Horste zur Verfügung (Sánchez et al. 1997, Mebs & Schmidt 2006, Bauer et al. 2021).
Brut
Der Habicht ist bereits Ende des ersten Lebensjahres geschlechtsreif. Allerdings nehmen die meisten Individuen erst nach zwei oder drei Jahren die Brut auf (Mebs & Schmidt 2006).
Die Brut wird in Baden Württemberg und Mitteleuropa zwischen Mitte März bis Ende April aufgenommen, mit einem Median am 11.4. Das Weibchen legt (2) 3- 4 (5) Eier, in einem Abstand von 2- 3 Tagen. Die Brut wird nach dem zweiten oder dritten Ei aufgenommen. Die Brutzeit beträgt 38- 42 Tage. Es brütet alleine das Weibchen. Es wird vom Männchen mit Nahrung versorgt (Mebs & Schmidt 2006, Bauer et al. 2021).
Für die Provinz Málaga wird ein Brutbeginn von Ende März bis Anfang Mai angegeben, mit 2- 3 Eiern und einer Brutzeit von 36- 41 Tagen (Sánchez et al. 1997).
Nestlingszeit
Die Jungen schlüpfen zwischen Ende April und Ende Juni. Zumeist zwischen dem 15.5. und 25.5. Zunächst füttert nur das Weibchen. Erst im Alter von 3 Wochen füttert auch das Männchen, während das Weibchen sich an der Nahrungsbeschaffung beteiligt. Die Nestlingszeit beträgt 36- 40 Tage (Mebs & Schmidt 2006, Bauer et al. 2021).
Für Süd- Spanien wird eine entsprechende Nestlingszeit angegeben; nach 45 Tagen beginnen die Jungen zu fliegen (Sánchez et al. 1997).
Flugphase/ Familienverband
Mitte Juni bis Anfang Juli fliegen die Junghabichte aus. Die Ästlingsphase dauert nur wenige Tage. Dabei halten sich die Jungen häufig auf Ästen um den Horst auf und beginnen bereits zwischen diesen umher zu flattern. Innerhalb der ersten zwei Wochen sind die Jungen überwiegend mit Flugübungen, mittels kurzer Flüge zwischen den Bäumen im nahen Umkreis des Horstes unterwegs. Dabei sind ständig ihre Bettelrufe zu hören. Darauf nehmen sie die ersten Beuteschlagübungen auf, zunächst noch immer im Nahbereich um den Horst.
Da die Junghabichte langes Training benötigen, um zielsicher jagen zu können, bleiben sie noch etwa 4, maximal 5 Wochen bei ihren Eltern und im elterlichen Horstrevier. Im August werden die Jungen selbständig und ziehen zumeist gegen Ende August aus dem elterlichen Revier ab.