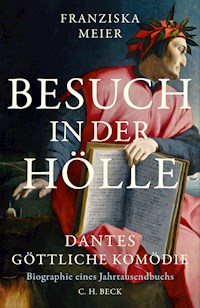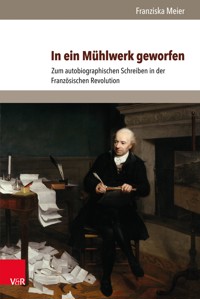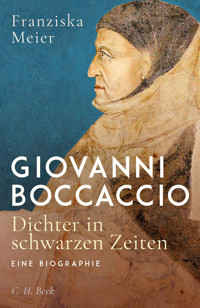
27,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Giovanni Boccaccio ist bekannt als Wegbereiter der Renaissance und weltberühmt durch den Decameron mit seinen freizügigen erotischen Geschichten. Sein Leben ist jedoch von Rätseln umgeben, sein Werk von starken Spannungen durchzogen. Die Literaturwissenschaftlerin Franziska Meier zeigt ihn in ihrer glänzenden Biographie als unruhigen Zeitgenossen eines krisengeschüttelten Jahrhunderts am Beginn der Neuzeit.
Pandemie, Klimawandel, Bankenkrise, Staatsverschuldung und der politische Umschwung zur Oligarchie: Giovanni Boccaccio (1313 - 1375) war ein Seismograph all dieser Erschütterungen in seiner Zeit. Teils sinnenfroh, teils sittenstreng, traditionsbewusst und zukunftsgewandt reagierte er mit seinem vielfältigen Werk auf die Widersprüche einer Welt im Umbruch. Franziska Meier rekonstruiert seine Kindheit und Schulzeit in Florenz und die Folgen seiner unehelichen Geburt. Wir erleben ihn in Neapel, wo König Robert von Anjou residiert, in Florenz, der stolzen, reichen Commune, die politisch und ökonomisch ins Schlingern geriet, an den Höfen skrupelloser Alleinherrscher in der Romagna und in der Einsamkeit seines Alterssitzes Certaldo. Vor allem aber schildert Franziska Meier ihn als brillanten Erzähler und herausragenden Dichter, als Freund Petrarcas und Verehrer Dantes, als Gelehrten und Biographen, dessen Werk zur Weltliteratur gehört.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
Franziska Meier
GIOVANNI BOCCACCIO
Dichter in schwarzen Zeiten
Eine Biographie
C.H.Beck
Frontispiz
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Frontispiz
Inhalt
Ansichten eines Dichters
Die frühen Konterfeis
Materialien zu Boccaccios Leben
Warum Boccaccio? Ein Zeitgenosse des 14. Jahrhunderts
TEIL I: Giovanni, Sohn des Boccaccio – Florenz – Neapel
Die Geburt des Helden oder der Makel des «Bastards»
Eine Kindheit in Florenz (1313–1327)
Ein Rekonstruktionsversuch der Schulzeit
Florenz in den 1310er und 1320er Jahren. Die Karriere von Vater Boccaccio
Der neue
Signore
aus Neapel in Florenz – ein prägendes Erlebnis?
Die besten Jahre des Lebens: Neapel (1327–1340)
Von Florenz nach Neapel
Unter Florentinern
Unter Neapolitanern
«Als Jugendlicher war ich am Hof Roberts»: Die Königliche Bibliothek
Unter Hofdamen und Rittern
Das Studium des kanonischen Rechts
Innenansichten oder die Suche nach dem Du (1339)
Die Anfänge: Schreiben, aber für wen
Die Briefe – ein autobiographisches Dokument?
Psychische Dissoziationen und die Fragilität menschlicher Zivilisation
TEIL II: Boccaccio florentinus – Florenz – Romagna – Florenz
Rückkehr in eine von Krisen geschüttelte Stadt (1340–1344)
Die Theseus-Sage im Gepäck
Winter 1341/42: Besuch aus Neapel
Elektrisierende Neuigkeiten: Francesco Petrarca
Neapel nach Florenz bringen oder die
Signoria
des Walter von Brienne (1342/43)
Die volkssprachliche Kultur in Florenz: Das Erbe Dantes
Das erste Meisterwerk:
Das Klagelied der Madonna Fiammetta
Alternativen zur Zivilisation:
De Canaria
und Pomenas Garten
Neue politische Verhältnisse in Florenz und Aufbruch in die Romagna (1344–1348)
Heitere Töne in Boccaccios Dichtung
Ein Vorschlag an die Adresse der Regierung des
Popolo
?
An den Höfen der Romagna
1348: Der Schwarze Tod und sein Augenzeuge
Die Pestbeschreibung: Recycling antiker Quellen
Wenn sich auf einmal alles zusammenschließt: Das
Decameron
Träume werden wahr: Ravenna, Florenz (1350)
Der Club der Petrarca-Verehrer in Florenz
Boccaccio in Ravenna: Eine erste Wiedergutmachung
Petrarcas Stippvisite in Florenz
Dominus Iohannes Boccaccii
– Jahre des Engagements (1351–1354)
Boccaccio als Gesandter der Stadt Florenz bei Francesco Petrarca in Padua
Zurück in Florenz: Der Dichter und Künstler als Aushängeschild der Stadt
Boccaccios Arbeit in der Florentiner
Res publica
Boccaccios Brandbrief an Petrarca –
Libertas florentina
TEIL III: Iohannes de Certaldo
1355 – ein schwarzes Jahr
Ein Geschenk Boccaccios oder die Tugend der Großherzigkeit (
Decameron
X)
Rückschläge: Die Lorbeerkrönung des Schulkameraden Zanobi da Strada
«Deinen zahlreichen Episteln entlockte ich einzig dies: Du bist verstimmt»
Aufarbeiten des Fiaskos: Vom Sturz berühmter Männer
(De casibus virorum illustrium)
In Mailand bei Petrarca (1359)
Menschlich Allzumenschliches
Dienst am zweiten Geschlecht
(De mulieribus claris – Von bekannten Frauen)
Wohin in dem von Kriegen zerrissenen Italien?
Boccaccios Engagement für volkssprachliche Dichtung
Eine konzertierte Aktion: Homer nach Oberitalien holen
Neustart und der fehlgeschlagene Rückzug aufs Land (1359–1363)
Seinen Namen verewigen: Die Fertigstellung von
De casibus
Wohin mit dem
Decameron
?
Ich war’s, der die Bücher Homers in die Toskana brachte
Certaldo – Sein und Schein des Lebens auf dem Land
Wenn plötzlich alles ins Wanken gerät
Mit Sack und Pack nach Neapel
Der Humanist mit Kratzern (1363–1370)
Bürger in Florenz und in der Welt: Das Netzwerk der Humanisten
Arbeit am Schiffbruch:
Genealogie deorum gentilium
Ein Bild von sich hinterlassen:
Self-fashioning
à la Boccaccio
Ein Brief unter tausend: Boccaccios Freundschaft zu Petrarca
Ende und Vermächtnis (1370–1375)
Geehrt in Neapel. Die Verteidigung der Dichtung
In Certaldo. Engagement für das volkssprachliche Erbe
Petrarcas fragwürdige Gabe: Die Griselda-Novelle (
Decameron
X 10)
Boccaccios Krankheiten
Testamentarische Verfügungen: Wer war Boccaccio?
Zeittafel
Abkürzungen
Literaturverzeichnis
Primärliteratur
Giovanni Boccaccio
Francesco Petrarca
Chroniken/Zeitgenössische Dokumente
Sekundärliteratur
Auswahl zitierter Publikationen zum geschichtlichen Hintergrund
«Bastarde» in der Renaissance
Kindheit, Schule in Florenz
Neapel der Anjou
Kanonisches Recht
Pest 1348
Allgemeines
Auswahl zitierter Publikationen zu Boccaccios Leben und Werk
Bildnachweis
Personenregister
Register der Werke Boccaccios
Zum Buch
Vita
Impressum
Ansichten eines Dichters
Giovanni Boccaccio? Wenn dieser Name fällt, wird den meisten als Erstes der Titel Decameron in den Sinn kommen und dann auch schon die Assoziation: ziemlich freizügige, erotische, wenn nicht obszöne Geschichten. Wer dann im Internet nach mehr Informationen und Videos surft, der bekommt rasch lebenslustige, mehr oder minder bekleidete junge Menschen in einer italienischen Stadt- oder Gartenlandschaft zu sehen. Wenig später schiebt sich eine Warnung und Altersbeschränkung auf den Bildschirm: FSK ab 16 freigegeben.
Nach wie vor umgibt Boccaccio und sein berühmtes Buch der Nimbus des Anrüchigen, Skandalösen, Unmoralischen. Als ein Jahr vor dem 650. Jubiläum seines Todestags die Netflix-Serie The Decameron ausgestrahlt wurde, wunderte sich die BBC-Rezensentin Kathleen Jordan, dass auf dem Index der Zeitschrift The New Yorker zu den «säuischsten» Werken der westlichen Welt keineswegs James Joyce, Henry Miller – man hätte auch an den Marquis de Sade denken können – an oberster Stelle standen, sondern ein Autor aus dem 14. Jahrhundert: Boccaccio.
Wer war dieser Boccaccio, der in einer durch und durch christlich-katholischen Welt lebte – mitten in einer Zeit, die gemeinhin dem späten Mittelalter oder der frühen Renaissance zugerechnet wird? Wie konnte er damals Geschichten schreiben, deren Loblied auf die Bedürfnisse und instinktiven Triebe unseres naturgegebenen menschlichen Körpers noch heute berüchtigt ist? Hat es im Florenz des 14. Jahrhunderts Freiräume für Körperlichkeit, Sexualität gegeben? Stand Boccaccio isoliert, oder sahen es seine Mitbürger, zumindest die Leser unter ihnen, genauso? Oder aber müssen wir ihn uns so vorstellen, wie es Franz von Suppés Operette Boccaccio tut? Einige Florentiner verpassen da einem Prinzen, weil sie ihn für Boccaccio halten, eine Tracht Prügel und toben, als sie ihren Irrtum erkennen, ihre Wut an einem Bücherstand aus.
Und weiter: Wie konnte und kann dieser Autor nach seinem Tod 1375 neben Dante Alighieri, dem sublimen Dichter und Jenseitswanderer der Göttlichen Komödie, und Francesco Petrarca, dem Dichter der unzugänglichen Laura im Canzoniere, als der Dritte im Bunde oder, wie es sich bald auch außerhalb Italiens einbürgerte zu sagen, als die dritte der drei Kronen der italienischen Literatur verehrt werden? Und das, obwohl noch im 15. Jahrhundert sein Name etymologisch von «bocca» (Mund) und dem negativ konnotierten Suffix «accio» abgeleitet wurde, was im Deutschen am besten mit übles oder loses Mundwerk wiedergegeben wird. Wie ist es möglich, dass das Decameron unumstritten zu den großen Büchern der Weltliteratur gehört? Warum wurde und wird Boccaccio in unserer abendländischen, aber auch globalen Tradition selbstverständlich neben Homer, Vergil, Shakespeare, Cervantes sowie Goethe und Schiller gereiht? Sollte er unter den handverlesenen Klassikern ein Kuckucksei sein?
Die frühen Konterfeis
Wenn man sich die wenigen bis ins 16. Jahrhundert entstandenen Abbildungen auf Fresken und Gemälden anschaut, wirkt Boccaccio fast verhuscht. Natürlich findet auch er auf Raffaels Fresko des Parnass im Vatikan Anfang des 16. Jahrhunderts einen Platz, aber nur in der hinteren Reihe unter einem der aufragenden Lorbeerbäume – er ist klein, korpulent, fast gnomisch und trägt ein schlichtes dunkles Gewand (Abb. 1). Obendrein kehrt er dem oben in der Mitte thronenden Apoll samt Musen den Rücken und uns Betrachtern die rechte Seite zu; ernst schaut er über den rechten Bildrand hinaus in Richtung des Freskos Schule von Athen mit den großen Philosophen und Gelehrten.
Abb. 1: Ausschnitt aus Raffaels Fresko Parnass in der Stanza della Segnatura im Vatikan, um 1511
Unter den sechs toskanischen Dichtern, die Giorgio Vasari 1544 malte, sitzt er abermals in der zweiten Reihe (Abb. 2). Aus dem Bildhintergrund schiebt er seinen Kopf nach vorne, um auf eine Linie zwischen Dante, der rechts im Vordergrund thront und den Kopf nach rechts dreht, und Petrarca, der die Mitte einnimmt, zu kommen. Boccaccio ist den Größten in der Schar gleichsam als Zuhörer und Sekundierender zugeordnet. Ist das ein Indiz dafür, dass ihm dieser Platz nur mit einigen – moralischen? – Vorbehalten oder Magengrummeln zugestanden wurde?
Abb. 2: Giorgio Vasari: Sechs toskanische Dichter, 1544
Von solchen Vorbehalten ist dagegen nichts zu spüren, wenn man in die unter Vasaris Regie zwischen 1560 und 1580 entstandene Säulenhalle der Florentiner Uffizien tritt. Dort reiht sich Boccaccios Statue gleichrangig unter die großen Söhne der Stadt neben Dante, Petrarca, Machiavelli und Michelangelo. In Größe und Gewand steht er den anderen in nichts nach. Sein Haupt ist lorbeerbekrönt, damit man ihn sogleich als Dichter erkennen kann; sein Gesicht wirkt jugendlich, frisch. Anders als Petrarca, der einigermaßen verzückt gen Himmel schaut, anders auch als Dante, dessen Blick streng nach unten gerichtet ist, schaut Boccaccio freundlich, fast lächelnd in die Welt. In der Hand des herunterhängenden rechten Arms hält er lässig ein Buch, in dem noch der Finger als Lesezeichen steckt, seine linke Hand ist auf Höhe der Taille geöffnet und uns zupackend entgegengestreckt. Im Vergleich wirkt er sehr viel zugänglicher und der Wirklichkeit zugewandter. War diese bei allen Differenzen im persönlichen Ausdruck gleichrangige Darstellung dem Konzept der Halle geschuldet, in der an jeder Säule ein großer Florentiner aufragt?
Abb. 3: Andrea del Castagno: Boccaccio, Ausschnitt aus den Fresken berühmter Männer und Frauen, um 1450
Ein ähnlicher Eindruck legt sich bei den illustren Persönlichkeiten nahe, die Andrea del Castagno schon Mitte des 15. Jahrhundts für die Villa Carducci im Westen von Florenz malte (Abb. 3). Während Dante und Petrarca in unterschiedlich nuancierten roten Gewändern einander zugewandt sind und sogar mit den Händen aufeinander weisen, steht Boccaccio neben ihnen frisch in Weiß, auf seinem Kopf eine mondäne rote Kappe, und schaut zu uns Betrachtern, während er einen großformatigen Codex (ein Titel ist darauf nicht erkennbar) vor seinem Oberkörper hält.
Ganz anders wirkt Boccaccio dagegen auf einem erst vor einige Jahren freigelegten Fresko, das Ende des 14. Jahrhunderts im Florentiner Gebäude der Richter und Notare (Palazzo dell’Arte dei giudici e dei notai) unweit des Bargello angebracht wurde (Abb. 19, S. 385). Es gilt als sein frühestes Konterfei. In dem Halbrund ist er auf der rechten Seite im Profil zu sehen. Sein Gesicht ist von scharfen Falten gezeichnet und rundum von einem schwarz-weißen Gewand bedeckt, das einen massiven Oberkörper einhüllt. Vor seiner Brust trägt er abermals ein großes, diesmal aufgeschlagenes Buch, abermals ohne Titel. Im Gegensatz zu dem in ein oranges Gewand gekleideten Dante weist er alle Züge eines Gelehrten und Klerikers auf – insofern fragt man sich, ob er hier wirklich das Decameron zeigt. Sah Boccaccio in seinen letzten Jahren so aus? Die Älteren unter den Juristen, die in dem anspruchsvollen Bildprogramm ihrer Zunft die großen Florentiner Dichter ehren wollten, könnten ihn auf den Straßen ihrer Stadt noch gesehen haben. Mit dem leichtfüßigen Erzähler schlüpfriger Geschichten hat dieser Boccaccio jedenfalls wenig gemein.
Verwirrend unterschiedlich fallen die Charakterisierungen Boccaccios auch in der überschaubaren Zahl von Lebensdarstellungen aus. Für die einen ist er der – manchmal auch zynisch – lächelnde Autor des Decameron, der, wie es im 19. Jahrhundert der Literaturhistoriker Francesco de Sanctis zuspitzte, erstmals die Gelüste des menschlichen Körpers zu ihrem Recht kommen lässt und dem nichts mehr heilig ist. Daneben gibt es auch die – weniger radikale – Variante eines witzigen, am Hof und bei den Damen gern gesehenen Entertainers. Für die anderen ist er dagegen ein ungeheuer fleißiger und findiger Gelehrter, der in der enzyklopädischen Tradition des Mittelalters groß wurde, einige historio- und mythographische Werke verfasste, etwa zur Herkunft der antiken Götter, und im Freundschaftsbund mit Francesco Petrarca zum Aufkommen des Frühhumanismus beitrug.
Im Laufe der Jahrhunderte hatten diese beiden Boccaccios unterschiedlich Konjunktur. 1375 ehrten die Nachrufe nur den Gelehrten oder Frühhumanisten; das Decameron blieb unerwähnt. Erst Ende des 15. Jahrhunderts ändert sich das. Weiterhin wird Boccaccio als Begründer der studia humanitatis gerühmt – damals gab es den Begriff des Humanismus noch nicht; gefeiert wird er als der, der die griechische Antike erstmals wieder im Original nach Italien brachte. Vor allem aber wird er nun wegen des unvergleichlichen Prosastils im Decameron bewundert, der künftigen Generationen ein Vorbild sein sollte.
Damit änderte sich auch das Boccaccio-Bild deutlich. Ende des 15. Jahrhunderts lässt sich an einer Büste sehen, wie sich die unterschiedlichen, wenn nicht konträren Vorstellungen übereinanderschieben. Der Bildhauer Giovan Francesco Rustici hatte sie für die kleine Kirche San Michele e San Jacopo in Certaldo angefertigt, in der Boccaccios Gebeine bestattet waren (Abb. 4). Er orientierte sich an zwei Altarbildern in derselben Kirche, die Boccaccio 1365/66 in Auftrag gab und auf denen er als Stifter in betender Pose kniend dargestellt war. Soweit sich das heute auf einer aus dem 16. Jahrhundert auf uns gekommenen Zeichnung der Altarbilder erkennen lässt, trug Boccaccio eine dunkle Kutte, die auch die Haare vollständig verdeckte. Dieses im Profil gemalte rundliche Gesicht mit Stupsnase nahm Rustici als Muster und drehte es für seine Büste um 90 Grad. Vor allem aber versah er es neu mit einem leicht schwülstigen sinnlichen Mund und einem verzückten, um nicht zu sagen süffisanten Lächeln, das das feiste Gesicht – des Autors des Decameron – in markante Falten legt. Er war zum sinnlich lächelnden Kleriker geworden!
Abb. 4: Giovan Francesco Rustici: Büste Boccaccios in der Kirche San Michele e San Jacopo in Certaldo, Ende 15. Jahrhundert
Die Frage, wie die beiden Boccaccio-Bilder zusammenpassten, löste man im 19. und 20. Jahrhundert damit, Boccaccios Leben in zwei Phasen zu teilen. Vor 1350 war er der volkssprachliche Erzähler, der lebensfrohe, ja unmoralische Mann, nach 1350 blickte er voller Reue auf seine sündhafte Jugend und wandte sich dem Studium antiker Dichtung zu. Die Umkehr bewirkte bei ihm keine vom Himmel herabgestiegene Beatrice wie fünfzig Jahre zuvor bei Dante, sondern – sehr viel irdischer und männlicher – Francesco Petrarca, mit dem Boccaccio seit Oktober 1350 eine persönliche Freundschaft verband. Unter dessen Anleitung gelangte er auf den Pfad der Tugend und richtete, so liest man, seinen Lebenswandel und sein Schreiben neu aus. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg brachte dies Boccaccio das Epitheton «Petrarcas größter Schüler» ein, so der bedeutende Humanismus-Forscher Giuseppe Billanovich, in Anspielung auf den Evangelisten und Lieblingsapostel Jesu Christi Johannes.
Mit einer solchen Kehrtwende, wenn nicht Konversion ließ sich erklären, wie aus derselben Feder erst «säuische» Geschichten, dann höchst gelehrte und moralisch erbauliche Werke fließen konnten; wie es möglich war, um ein bis heute Kopfzerbrechen bereitendes Beispiel zu nennen, dass aus demselben Mund aufregend frauenfreundliche, geradezu emanzipatorische und übelste misogyne Ansichten sprudeln konnten. Alles war eine Frage des Zeitpunkts – die Weltgeschichte kennt einige solcher radikalen Kehrtwenden wie die vom Saulus zum Paulus, vom ausschweifenden Sünder zum Kirchenvater Augustinus oder, moderner, vom Revolutionär zum Reaktionär. Boccaccios Fall gewinnt darüber allerdings eine geradezu tragische Note, denn ausgerechnet das Werk, das ihm den ersehnten Weltruhm bescherte, bereute er demnach zutiefst.
Nach wie vor wirkt diese Deutung in den Boccaccio-Darstellungen fort, inzwischen allerdings in stark abgeschwächter Form. Denn seitdem in den 1950er Jahren die in Berlin liegende Abschrift des Decameron als «aus letzter Hand» identifiziert werden konnte, kann keine Rede mehr davon sein, dass Boccaccio dieses Werk am Ende seines Lebens verworfen hat, im Gegenteil. Wenige Jahre vor seinem Tod übertrug er es auf großformatige Pergamentblätter, so dass man es wie die Bibel oder die Göttliche Komödie auf einem Lesepult aufschlagen musste – und nicht unter der Bettdecke lesen konnte. Es ist richtig, dass seine volkssprachlichen Dichtungen nach 1350 deutlich abnehmen, aber sie versiegen nicht. Heute nimmt man an, dass er am Decameron bis mindestens Mitte der 1350er Jahre gearbeitet haben muss. Sein letztes volkssprachliches Werk, Il Corbaccio, wird heute auf die Mitte der 1360er Jahre datiert. Der witzige, unanständige Geschichtenerzähler lebte also – einvernehmlich? – neben dem ernsten und gelegentlich moralinsauren Gelehrten, der punktuell ins ironisch anzügliche Erzählen verfallen konnte. Giovanni Boccaccio, das ist der Verehrer edler Frauen und Verteidiger ihrer Rechte, aber auch von Anfang an – er kopierte sich ein im Mittelalter einschlägiges misogynes Traktat – ihr vor keiner bösen Unterstellung zurückschreckender Ankläger. Er war der mitleidslose Satiriker der geldgierigen und heuchlerischen Kirchenleute – er wird deshalb auch der Voltaire des 14. Jahrhunderts genannt –, aber auch ein Mann, der die niederen Weihen annahm und sich zu Eremitenorden hingezogen fühlte. In seinem Fall gehen die Gegensätze weit über jene sprichwörtlich gewordenen «zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust» in Goethes Faust hinaus.
Wer also war Boccaccio? Wie lassen sich solche Widersprüche in einem Menschen verstehen? Wie hat er sie selbst empfunden? Hatte er womöglich eine – bei modernen Autoren würde man sagen – zerrissene oder gar bipolare Persönlichkeit? Oder sollte man sich die Widersprüche damit erklären, dass er sich in sehr unterschiedlichen Kreisen, unter Kaufleuten wie Frühhumanisten, bewegte, denen er – skrupellos oder sogar zynisch – lieferte, was sie hören wollten? Oder spiegelt sich in seinen Widersprüchen ein kulturhistorischer Wandel, an dem Boccaccio teilnahm, den er vorantrieb, dem er aber auch zum Opfer fiel?
Materialien zu Boccaccios Leben
Zu den Schwierigkeiten, die sich aus dieser Widersprüchlichkeit ergeben, kommt hinzu, dass es bei ihm wie bei so vielen europäischen Dichtern des Mittelalters und der Renaissance an verlässlichen historischen wie autobiographischen Dokumenten fehlt. Die Lücken sind so groß, dass es bis kurz vor der Pest 1348, als Boccaccio schon Anfang dreißig war, im Grunde nichts außer wenigen Handschriften aus seiner Feder gibt, die seine Existenz beweisen. Die späteren historischen Dokumente, die seit dem 19. Jahrhundert mühselig aus den Archiven zusammengetragen werden, sind zumeist recht spröder Natur: Steuerabgaben, Zuweisung von Ämtern in der Commune Florenz, Kauf- und Mietverträge, Streitigkeiten vor Gericht und diplomatische Begleitbriefe, das Testament. Vieles davon bleibt zudem eigenartig in der Luft hängen, weil sich die Umstände nicht eindeutig rekonstruieren lassen.
In den floskelhaften Begleitbriefen zu Gesandtschaften, auf die Boccaccio geschickt wurde, ist zu lesen, dass die Commune Florenz ihn als ihren geliebten Bürger vorstellte oder als «dominus» – ein Titel, der nur Rittern und studierten Juristen zustand. Ende des 19. Jahrhunderts konnte es übrigens ein Biograph kaum fassen, wie die stolze Commune Florenz einen solchen Luftikus und berüchtigten Kritiker des Klerus wie Boccaccio «dominus» nennen und ausgerechnet zum Papst schicken konnte. In zwei Schreiben, darunter einem päpstlichen, ist von Boccaccio als «clericus», als Kirchenmann, die Rede. Was war er, und warum bezeichnet ihn kein städtisches Dokument als Kleriker? Von Boccaccios jüngerem Freund, Coluccio Salutati, der seit 1375 Kanzler der Stadt Florenz war, erfahren wir, dass seine Stimme oder Redeweise «suavissimus» war, wörtlich übersetzt: höchst süß, was einschmeichelnd und äußerst gewinnend, aber auch klangvoll und elegant bedeuten könnte. Petrarca wiederum rühmt die völlig uneigennützige Liebe und Warmherzigkeit seines Freundes.
Überliefert sind zudem zwei Spottnamen, wenngleich nur aus den Briefen des Betroffenen. Sie stammen höchstwahrscheinlich von seinem Schulkameraden aus Florenz Niccolò Acciaiuoli, der in Neapel zum Großen Seneschall aufstieg. Als diese unter Florentinern sehr beliebte Praxis Boccaccio selbst traf, muss ihn das zutiefst verletzt haben. Vehement wehrt er sich gegen seine Verspottung als «Iohannem tranquillitatem». «Still vergnügter Hannes», so übersetzte Karl Vossler 1927 den Spottnamen, den er als Hinweis auf Boccaccios Gleichmut missverstand, der auf alles ruhig und mit einem Lächeln auf den Lippen reagiert habe. Gemeint war jedoch der die Ruhe bevorzugende Giovanni, der das Weite suchte, als es brenzlig um den Freund Niccolò Acciaiuoli stand. Ein Angsthase also, jemand, der Konflikten auswich, vielleicht sogar ein Opportunist! Jahre später, als Boccaccio der Spottname «uomo di vetro» (Mann aus Glas) zugetragen wurde, weist er das abermals empört als Verleumdung zurück. Damit war nicht etwa der ‹gläserne Mensch› gemeint, sondern jemand, der hochempfindlich bei der kleinsten Berührung zersprang, der nicht die geringste Belastung oder Frotzelei aushielt, sondern lieber gleich die Flucht ergriff. Eine Mimose also, was Boccaccio indes heftig bestritt!
Um die persönlichen Quellen ist es nicht viel besser bestellt. Ein Tagebuch hat Boccaccio nicht geführt, das war im 14. Jahrhundert nicht üblich. Es gibt auch keinen Codex, in dem er, wie es Petrarca von der Notarpraxis seines Vaters her ins Blut übergegangen war, wichtige Jahreszahlen, Daten und Ereignisse, die ihn persönlich betrafen, am Rand notiert hätte. Es ist auch kein umfangreiches, das ganze Leben umspannendes Konvolut von Briefen überliefert. Wir besitzen nur gut zwei Dutzend Briefe, einen in einer Übersetzung aus dem 15. Jahrhundert, fast alle anderen in nachträglichen Abschriften. Zusätzlich lassen sich Aussagen seiner – verlorenen – Briefe aus den Antworten Petrarcas erschließen, soweit dieser sie in seine großen Briefsammlungen der Familiares und Seniles aufgenommen hat. Doch das ist kein Ersatz. Die, die wir heute noch lesen können, lassen vor allem ahnen, was uns in den zahlreichen Briefen, die er geschrieben haben muss, nicht nur über Boccaccio selbst, sondern über subjektives Erleben, Wahrnehmen und zwischenmenschliche Beziehungen im 14. Jahrhundert entgangen ist.
Was wir dagegen ebenso wie bei Dante haben, sind über das umfangreiche Werk verstreute Selbstaussagen. Aus seinen frühen fiktionalen Prosawerken zieht man seit dem 16. Jahrhundert vor allem die Geschichte einer großen Liebe, die er einer neapolitanischen Adligen entgegenbrachte, die er selbst Fiammetta (Flämmchen) nannte – ein Deckname, wie er in der Lyrik gebräuchlich war. Aufgrund von Anspielungen Boccaccios vermutet man dahinter eine Maria d’Aquino – seit dem 19. Jahrhundert verlaufen jedoch die Archivrecherchen zu ihr im Sande. Es scheint keine Maria im Haus der Aquinos gegeben zu haben. Außerdem entnahm man einer kurzen Lebensbeschreibung, die Boccaccio am Ende seiner Genealogie deorum gentilium einfügt, Hinweise auf einen Konflikt mit dem Vater. Demnach war der Vater ein nur an Profit interessierter Banker, der seinen den Musen ergebenen Sohn erst in eine Kaufmannslehre und, als das zu nichts führte, in ein Kirchenrechtsstudium zwang. An Hinweisen auf einen solchen Konflikt mangelt es in den frühen Dichtungen nicht, aber es finden sich im Werk Boccaccios eben auch Stellen, an denen er sich sehr dankbar, beinahe liebevoll über seinen Vater äußert (AV XIV 43–45) oder ihn als ehrlichen Geschäftsmann charakterisiert (De casibus IX xxi 22) oder allgemein die Gehorsamspflicht der Kinder gegenüber ihrem Vater fordert (De casibus VIII xx). Des Vaters gedenkt er auch auf seiner Grabinschrift.
All diese Selbstaussagen – Boccaccio ist da keine Ausnahme – sind mit Vorsicht zu behandeln. Noch bevor der amerikanische Shakespeare-Forscher Stephen Greenblatt den Begriff des self-fashioning für Persönlichkeiten der Renaissance aufbrachte, sensibilisierten Italianisten wie Vittore Branca dafür, wie stark sich Boccaccio in seinen direkten und indirekten Selbstdarstellungen an Modelle und Topoi sowohl aus der mittelalterlich französisch-provenzalischen und volkssprachlich-italienischen als auch der antiken Literatur anlehnte. Was auch immer er in seinen Schriften (die Gesamtausgabe beläuft sich auf zehn umfangreiche, jeweils um die tausend Seiten fassende Bände inklusive des Anmerkungs- und Editionsapparats) über sich sagt – und er tritt ähnlich oft und gerne wie Dante und Petrarca als Autorfigur oder in Spiegelfiguren auf –, er modelliert sich bewusst entlang bestehender Traditionen. Was er sagt, ist darum nicht völlig aus der Luft gegriffen, aber es kann eben immer nur cum grano salis genommen werden.
Abb. 5: Eine der Zeigehände, maniculae, aus dem Hamilton-Codex
Wo aber könnte uns Boccaccio sozusagen unkontrolliert und unmittelbar entgegentreten? In seiner markanten, sehr gut lesbaren, wenngleich durch nachträgliche Korrekturen manchmal etwas flüchtig und unkonzentriert wirkenden Schrift? Ohne Zweifel war Boccaccio ein leidenschaftlicher und sehr guter Kopist fremder und eigener Werke, wenn auch ein etwas schlampiger. War er abgelenkt, oder interessierte ihn mehr der Inhalt? Unverstellt tritt er wohl auch in den Randbemerkungen zu Texten anderer hervor. Gerne bringt er maniculae, Zeigehände, neben ausgewählten Passagen an (Abb. 5). Zu einer Liebesszene notiert er etwa, er habe sich genauso verliebt – offenbar identifizierte er sich beim Lesen mit den literarischen Figuren. Oder er kommentiert eine knappe Beschreibung des Ortes Certaldo in der Antike mit den Worten, damals habe es noch nicht die berühmten roten Zwiebeln gegeben. Oder aber er lässt seinen Unmut über die stümperhafte Arbeit eines Gelehrten in einer Marginalie aus: «bergolus», Dummschwätzer. Platzte der Ärger, die Lust am Widerspruch beim Lesen, vielleicht auch im Gespräch aus Boccaccio leicht heraus? In Petrarcas Bibliothek konnten inzwischen ein paar Zeichnungen aus seiner Feder ausgemacht werden, etwa von Petrarcas einsamem Rückzugsort in der Vaucluse (Abb. 14, S. 233). All das sind kleine Fenster, die sich auf Boccaccio öffnen. Sie verraten etwas von seiner Lust am Lesen, am gelebten Dialog mit Texten, die er sich realistisch-plastisch vorstellt. Sie zeugen wohl auch von einem Hang zur Graphomanie, wie ihn viel später auch Stendhal hatte. Sie lassen eine emotional schillernde und facettenreiche Persönlichkeit ahnen, die sentimental, ironisch, polternd-zornig sein konnte. Aber all das sind Momentaufnahmen, die sich manchmal nicht einmal exakt datieren lassen.
Eine Biographie Boccaccios, die mehr sein will als eine geistes-, kultur- und literarhistorische Darlegung seiner italienischen und lateinischen Schriften, gleicht somit einem großen Fresko, in dem ganze Teile fehlen. Was sich von dem Bild erhalten hat, sind einzelne, isolierte Stellen mitten in großen weißen Flächen. Einige davon sind nicht authentisch, da es sich um indirekte Rekonstruktionen handelt; andere lassen sich ergänzen aus dem historischen Kontext zu Alltag, Mentalität, Kleidung, Bildungssystem und natürlich auch zu politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklungen im 14. Jahrhundert. Ein großer Teil des Freskos kann nur aus einer Reihe sozusagen auf die weiße Wand projizierter Bildfragmente bestehen. Oder anders: Die Biographie kann oft nur Fragen stellen und hypothetische Antworten geben.
Warum Boccaccio? Ein Zeitgenosse des 14. Jahrhunderts
Warum überhaupt eine Biographie über Giovanni Boccaccio schreiben, wenn wir so wenig wissen und im Grunde ein einziges Werk im deutschsprachigen Raum gelesen wird? Nur weil 2025 der 650. Jahrestag seines Todes ansteht? Mindestens zwei Gründe lassen sich anführen. Es stimmt mit unserer heutigen Tendenz überein, jahrhundertelang – aus welchen Gründen auch immer – vernachlässigten Autoren wieder zu ihrem Recht zu verhelfen. Im Fall Boccaccios mag das merkwürdig klingen, denn er ist gelesen, rezipiert und kanonisiert worden, doch verstellt das Bild des Erzählers erotischer Geschichten den Blick auf sein ganzes Werk. Zudem ist es tatsächlich keine Übertreibung, wenn man ihn als den vernachlässigten, von oben herab beäugten Dritten der drei großen italienischen Dichter im 14. Jahrhundert bedauert. Abgesehen von den Bemühungen und Versuchen jenseits und diesseits der Alpen im 19. Jahrhundert, gibt es nur wenige neueren Datums. In Deutschland gar ist ihm, genauer dem Humanisten Boccaccio, nur eine Kurzbiographie gewidmet worden. In Italien gibt es zwei umfangreiche Biographien, die sich indes an Forscher oder an ein italienisches Publikum wenden, das in der für die nationale Identität so zentralen Literatur des 14. Jahrhunderts bewandert ist. Die eine von Vittore Branca war nach dem Zweiten Weltkrieg wirkmächtig und ist als biographisches Profil der Gesamtausgabe Boccaccios beigefügt; sie entfaltet ihn als Dichter des Mittelalters und der Florentiner Kaufleute. Die andere, Boccaccio. Fragilità di un genio, 2019 erschienen, stammt von Marco Santagata und baut auf den neuesten Erkenntnissen auf, die sich aus intensiven Archivrecherchen der letzten 30 Jahre ergaben. Sie lässt Boccaccio sowohl aus der Bindung mit der großen Epoche der mittelalterlichen Kaufleute als auch – man möchte sagen: endlich – aus dem Schatten seines Meisters und Freundes Petrarca heraustreten.
Dass in jüngster Zeit viel über Boccaccio geforscht und auch viel Neues über ihn zutage gefördert wird, hängt auch damit zusammen, dass uns dieser Autor ebenso wie vieles in seinen Werken heute erstaunlich nahesteht. Sicher, als Zeitgenosse des 14. Jahrhunderts gehört er einer ganz anderen Zeit und Welt an, aber diese Zeit hat mit der unsrigen etliches gemein. Insofern gewährt die Rekonstruktion seines Lebens indirekt auch Einblick in Fragen, Sorgen und Ängste, die uns heute umtreiben. Denn damals vollzog sich ein ähnlich tiefgehender Wandel. Wie viele andere auch spürte und sah Boccaccio überall – oft traumatisierende – Anzeichen, ohne darum Ausmaß und Richtung zu begreifen. Was da vorging, suchte er in vertraute Begrifflichkeiten zu bringen, wie Niedergang, sittlicher Verfall, unheilvolle Sternenkonstellationen oder auch eine Strafe Gottes für das üble Treiben der Menschheit. Im Alter legte sich ihm auch das Bild des Schiffbruchs nahe, den großartige Kulturen wie die griechische und die römische erlebt hatten. Er haderte mit den Veränderungen, anfangs scheint er wohl auch gemeint zu haben, dass er allein in eine Welt totaler Ungewissheit und unvorhergesehener Umschwünge hilflos hineingeworfen wäre. Er suchte nach Erklärungen, Ankern, nach Vorbildern oder auch nach Parallelen in der Geschichte und in der eigenen Zeit. Darüber wurde das schon in der Antike bekannte arbiträre Schalten und Walten der Göttin Fortuna für ihn zu einem ebenso existentiellen wie historiographischen Thema, das nicht nur Hochrangige und Reiche, sondern jeden Einzelnen – gefühlt: fortwährend – betraf. Kontingent ist menschliches Leben immer, aber im 14. Jahrhundert war Kontingenz für jeden augenscheinlich sehr viel stärker spürbar, für Boccaccio aufgrund seiner Sensibilität und seiner besonderen Lebensumstände vielleicht noch dramatischer.
Diese Welt voller Unsicherheit lässt sich an ganz konkreten Ereignissen und Veränderungen anschaulich machen. Am bekanntesten ist der Ausbruch der Pest, des Schwarzen Todes, also einer Pandemie, die aus Asien über den Seeweg nach Italien gelangte und im Laufe der 1340er Jahre im ganzen lateinischen Europa wütete. Die Bevölkerung wurde stark dezimiert. Von da an gab es bis ins 15. Jahrhundert hinein immer wieder neu aufflammende Herde. In der Stadt Florenz spricht man von einem Drittel der Bevölkerung, das in wenigen Monaten der hochansteckenden Krankheit anheimfiel; noch Jahrhunderte später sollten sich in Florenz nicht die Einwohnerzahlen wiederherstellen, die die Stadt zu einer der am dichtesten besiedelten Metropolen Europas gemacht hatten. An hohe Sterblichkeit war man schon vorher gewöhnt, aber der Schwarze Tod überstieg jede Vorstellung. Wie sollte man sich das erklären, wie konnte man sich schützen, und wie sollte man danach weiterleben? Das Buch zum Thema schrieb Giovanni Boccaccio: Das Decameron will nicht nur unterhalten, sondern auch Rechenschaft ablegen und Wege aus der Vernichtung eröffnen.
Zudem brach in den 1330er Jahren ein blutiger und kostspieliger Krieg zwischen dem französischen und dem englischen Königshaus aus, der als Hundertjähriger Krieg in die Annalen einging. Das war nicht nur irgendein Konflikt fernab, an dem sich womöglich sogar verdienen ließ. Vielmehr zog er von Anfang an namentlich in Italien große Verwerfungen nach sich, darunter den Bankrott mächtiger Florentiner Banken und schließlich des gesamten florierenden Bankensektors, der von wenigen Florentiner Familien für und in ganz Europa betrieben wurde. Sie hatten Filialen in allen wichtigen Handelsstädten, die Florentiner Währung des Goldflorins (fiorino) war zu dem Währungsmaßstab geworden, da der materielle dem nominellen Wert exakt entsprach. Florentiner Banker – in anderen Ländern wurden Kaufleute aus Italien pauschal «Lombarden» genannt – gingen bei Königen selbstverständlich ein und aus, gewährten großzügige Kredite und erhielten im Gegenzug höchst einträgliche Lizenzen, etwa für die Ausfuhr von Schafswolle aus England. Als der englische König aber sein Vermögen im Krieg verausgabte und die Schulden nicht zurückzahlte, brach das lukrative Banken- und Handelsgeschäft über einen Zeitraum von einem Jahrzehnt zusammen. Die Stadt Florenz selbst machte Bankrott. Ein Krieg brachte die optimistisch auf fortwährende Expansion und Steigerung der Profite sowie des politischen Einflusses vertrauende Welt der oberitalienischen Kaufleute zum Einsturz. Man machte sich auf die Suche nach neuen Wegen im Bankwesen, im Handel und in der Herstellung.
Zu diesen menschengemachten Problemen gesellte sich im 14. Jahrhundert noch der Klimawandel. Die kleine Eiszeit brach an. Von dem Jahr 1317 an notierten Chronisten wie der Florentiner Giovanni Villani ebenso akribisch wie entsetzt, dass, wann und wo es – keineswegs nur in der weiteren Umgebung der Stadt, sondern bis tief nach Asien hinein – zu unvorstellbaren Überschwemmungen, zu Phasen extremer Trockenheit, zu Erdbeben oder auch zu bis dahin ungekannten Gewittern und Blitzeinschlägen kam. Während bisher das warme Klima so reiche Ernten beschert hatte, dass eine Bauernfamilie nicht nur satt wurde, sondern noch Geld zur Seite legen konnte, hatte die Landwirtschaft nun mit enormen Schwierigkeiten zu kämpfen. Es hatte immer mal Ernteausfälle aufgrund schlechter Witterung gegeben. Aber jetzt gab es sie regelmäßig, so dass auch die Vorräte, die sich betuchtere Familien für schlechtere Jahre anlegten, erschöpft waren. Hungersnöte mehrten sich. Das wirkte sich wiederum auf die gesellschaftlich-politische Ordnung aus. Die Bevölkerung schrumpfte nicht nur, die davon am härtesten betroffenen ärmeren Schichten wurden unruhig, wenn nicht rebellisch gegen die, die mehr hatten. Gewalt und Konflikte zwischen rivalisierenden Familien haben das Leben in Florenz immer geprägt, aber nun drohte das ganze System ins Wanken zu geraten. Teile der Eliten waren durch den Bankrott ruiniert und obendrein desavouiert, die Masse der Armen ließ ihrem Unmut freien Lauf. Infolge der Pest geriet sie dann überraschend in die günstige Lage, Bedingungen stellen, etwa höhere Löhne, und politischen Einfluss erfolgreich einklagen zu können. Sie durfte eine Zunft gründen, damals die Voraussetzung für politische Mitsprache. Angesichts der großen Schwierigkeiten und Konflikte putschten sich an vielen Orten in Italien Usurpatoren – in Florenz sprach man von Tyrannen – mit Gewalt, Intrigen oder auch mit der Zustimmung von Teilen der Bevölkerung an die Macht. In der Toskana ging schon in den 1330er Jahren die Angst vor dem Tyrannen um, da sich viele Bürger freier Städte angesichts der Unruhen nach einer starken Hand und Ordnung zu sehnen begannen. Von 1350 an bahnte sich in Oberitalien der Wechsel zu Regimen einzelner Herrscher oder Oligarchien an.
Der Zusammenbruch der alten Ordnung rührte auch daher, dass sich die großen Institutionen – Kaiser und Papst – und die vertraute Polarisierung zwischen den papsttreuen Guelfen und den kaisertreuen Ghibellinen überlebt hatten. Obgleich die alten Kampfnamen und Denkweisen fortbestanden, hatte sich der Kaiser de facto aus Italien verabschiedet. Seit dem Tod Kaiser Friedrichs II. 1250 wurde der jeweilige römische Kaiser Deutscher Nation zwar immer wieder als Ordnungs- und Friedensstifter herbeigerufen, aber von dem traditionellen Romzug zur Kaiserkrönung abgesehen, konzentrierten sich diese auf ihr Reich nördlich der Alpen. Der Papst wiederum hatte sich im Kampf mit dem Kaiser zwar durchgesetzt, aber seine Kräfte waren Anfang des 14. Jahrhunderts erschöpft. Der französische König zwang den Hofstaat der Kirche, nach Avignon oder, wie es in Italien hieß, ins babylonische Exil umzusiedeln. In Italien blieb der Papst als Gegenspieler des Kaisers zwar besonders in den guelfischen Gemeinwesen eine wichtige Größe, aber seine Einstellung zum Kaiser war nicht mehr so eindeutig, noch dazu wurde er selbst zur Kriegspartei. Er schickte Söldnertruppen unter Führung eines Legaten, der unter den Kardinälen ausgesucht wurde, um den Kirchenbesitz, etwa in der Emilia-Romagna, gegen Usurpatoren zu verteidigen und unter Kontrolle zu bringen. Kurz, im 14. Jahrhundert mussten die Machtverhältnisse unter den Stadtrepubliken, den Fürstentümern – insbesondere den expandierenden Territorialherrschern in Verona und Mailand – und den beiden Königreichen im Süden neu militärisch ausgefochten und diplomatisch ausgehandelt werden. Für die Stadt Florenz hieß das, dass sie ihre Interessen nun auch fern der eigenen Stadtmauern militärisch und ideologisch – als Fahnenträger politischer Freiheit – verteidigen musste und ihrerseits ihre Macht in die Toskana expandierte.
Charakteristisch für das 14. Jahrhundert ist schließlich ein kultureller Wandel. Boccaccio wurde in einer Stadt geboren, in der seit etwa 1270 das Dichten in der stark wandelbaren und gegenüber dem Latein als minderwertig geltenden Volkssprache (Volgare) blühte und sich in Dantes Göttlicher Komödie auf das Großartigste entfaltete. Dante schuf darin zugleich die Grundlage für das heutige Italienisch. Boccaccio wuchs in diesem Selbstbewusstsein der Florentiner auf, unter dem Eindruck der neuen Möglichkeiten, in der Muttersprache zu dichten und darin an die große Antike heranzureichen. Er teilte den Stolz, darin Gedankengänge aus Theologie und Philosophie, den damals höchsten Wissenschaften, auszudrücken und einer des Lateinischen nicht mächtigen, aber darum nicht dummen oder uninteressierten Leserschaft außerhalb der Universität zu vermitteln. Die rasante Entwicklung trieb zu seinen Lebzeiten zwar neue außerordentliche Blüten – dafür sorgten später er selbst und Petrarca –, aber diese blieben vereinzelt, fast im Geheimen. In der Breite verebbte der Boom; es wurde weitergedichtet, aber nicht weiterentwickelt. Ähnlich lässt der Florentiner Novellensammler Franco Sacchetti übrigens ein paar Florentiner Maler mit der Stagnation hadern, die sich nach den von Giotto initiierten grundlegenden Neuerungen in der zeitgenössischen Malerei breitgemacht habe. In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts begann die Volkssprache allmählich auf das Niveau der Unterhaltung, wenn nicht Volksbelustigung herabzusinken. In ihr ließ sich nicht mehr wie bei Dante der ganze Kosmos ausdrücken. Wer nach Höherem strebte, schrieb auf Latein. Es gehörte nun geradezu zum guten Ton, die Volkssprache zu verachten. Boccaccio spürte diesen Umschwung, er wehrte sich dagegen und wurde von ihm doch mitgerissen. Für antike Dichtung hatte er sich, ebenso wie Dante und viele andere, schon früh interessiert, daran Maß genommen, aber er hatte das nicht in der neuen, philologisch-historischen Form einer Rekonstruktion der untergegangenen Antike getan. Ohne seine Liebe zur volkssprachlichen Dichtung darum aufzugeben, trug nach 1350 auch Boccaccio sein Scherflein zur aufziehenden neuen Kultur bei, die wir heute Humanismus und Renaissance nennen.
Eine untergründige Verunsicherung ging schließlich von dem epistemologischen Wandel aus, dessen Charakteristika sich erst im Nachhinein erkennen lassen. Der Philosophiehistoriker Kurt Flasch hat ihn in seinem Buch Poesie nach der Pest dezidiert an der Philosophie des Wilhelm von Ockham festgemacht, die auch im Decameron Spuren hinterließ. Der 1347 in München gestorbene Franziskaner Ockham hatte aus der vorherigen langjährigen Integrationsarbeit der aristotelischen Philosophie in das von der Theologie beherrschte mittelalterliche System der Wissenschaften eine – auf der Hand liegende, damals aber radikale – Konsequenz gezogen. Dass Glaubenswahrheiten, die christliche Doktrin, etwa die Dreieinigkeit Gottes, mit den Instrumenten menschlicher Rationalität nicht begründet, erklärt werden konnten, wusste schon Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert. Den Abgrund suchte er, sehr vereinfacht gesagt, mit dem sprichwörtlich gewordenen Satz zu überbrücken: Credo quia absurdum (ich glaube, weil es absurd ist). Ockham ging einen Schritt weiter. Er forderte, dass der Sprachumgang in der Philosophie dieser Einsicht Rechnung tragen müsse und folglich jeder Begriff, der auf etwas Abstraktes verwies, das sich nicht – wie der dreieinige Gott – rational sagen ließ, aufgegeben oder, um seine Metapher zu verwenden, mit dem Rasiermesser gekappt werden müsse. Ockham zweifelte darum nicht an der Existenz Gottes oder an einem Leben nach dem Tod, aber die Kirche witterte zu Recht in diesen Thesen eine Gefahr. Wenn man über christliche Glaubenswahrheiten in der menschlich rationalen Sprache nichts aussagen konnte und es deshalb in philosophischen Theorien besser unterlassen wollte, schloss das ein, dass die irdische nicht mehr nahtlos in die göttliche Welt überging. Gott wurde sozusagen unergründlicher, die Menschen waren auf sich zurückgeworfen, alleingelassen – und das öffnete Säkularisierungstendenzen Tür und Tor.
Diesen tiefgreifenden Wandel hat Boccaccio in allen Facetten erlebt und erlitten, er hat darüber geflucht, aber auch nachgedacht, damit literarisch experimentiert und ihn selbst vorangetrieben. Er hat versucht, ihm im Kleinen seinen Stempel aufzudrücken und sich gegen den von ihm befürchteten Niedergang oder auch drohenden Kulturverlust aufzubäumen. Immer wieder muss er an ihm aber auch verzweifelt sein, nach einem rettenden Anker Ausschau gehalten haben. Er rang mit seinen Ängsten, seiner Verunsicherung, er stürzte sich darum aber nicht weniger in eine engagierte Arbeit gegen den Schiffbruch, der schon die Kultur der Antike getroffen hatte und nun seine eigene traf. All das rückt ihn uns heute merkwürdig nah. All das macht aus seinem Leben und Schreiben einen exzentrischen Spiegel unserer eigenen Schwierigkeiten, den Wandel zu leben.
TEIL I
Giovanni, Sohn des Boccaccio
Florenz – Neapel
Die Geburt des Helden oder der Makel des «Bastards»
Anders als sein großes Idol Dante Alighieri hat Boccaccio in seiner Dichtung weder mit der Sternenkonstellation bei seiner Geburtsstunde noch mit seinem Sternzeichen gespielt. Dabei hat er sich seit seiner Jugend stark mit Astrologie und Astronomie – beides war damals noch nicht voneinander getrennt – beschäftigt und anfangs Zeitangaben gerne über heute nicht leicht verständliche Planetenpositionen vermittelt. Wir wissen heute mit Gewissheit nicht einmal den Monat, in dem er zur Welt kam. Dass sich der Geburtstag nicht präzise ermitteln lässt, ist im 14. Jahrhundert allerdings nichts Ungewöhnliches. Aus einem späten Brief Boccaccios an den Freund Mainardo Cavalcanti (Ep. XXII) lässt sich schließen, dass sich in den Sommermonaten, also im Juni oder Juli, sein Geburtstag gejährt hatte, falls er nicht auf seinen im Katholizismus wichtigeren Namenstag am Johannistag (24. Juni) anspielte. Was das Geburtsjahr angeht, ist einer kurzen Stelle in einem Brief Petrarcas zu entnehmen, dass Boccaccio neun Jahre jünger war (Sen. VIII 1 60). Allerdings hat Petrarca diesen Altersunterschied augenzwinkernd mit einem Fragezeichen versehen. Er wisse ja nicht, ob sich Boccaccio ihm gegenüber ein paar Jahre älter gemacht, wie man es in der Jugend gerne tue, oder umgekehrt ein paar Jährchen abgezogen habe, wozu man im fortgeschrittenen Alter neige. Eine Bestätigung oder Richtigstellung Boccaccios ist hierzu nicht überliefert. Der Abstand von neun Jahren wird ihm jedenfalls gelegen gekommen sein. Seine Geburt war dadurch von der Zahl Neun umrahmt, eine nicht nur für Dante heilige Zahl, da in ihr dreimal die Drei, die für die Trinität Gottes stand, enthalten war. Es trennten ihn neun Jahre von Petrarcas Geburt 1304 und neun von Dante Alighieris Tod im September 1321. Demnach hat Boccaccio das Licht der Welt im Juni/Juli 1313 erblickt.
Anders als bei Petrarca, der in dem gerade zitierten Brief das Zusammentreffen seiner Geburt mit einem wichtigen historischen Ereignis verknüpft, hat Boccaccio seine Anfänge nicht mit irgendeiner historischen Koinzidenz versehen, zumindest nicht in den uns überlieferten Briefen. Petrarca hielt es für aufschlussreich, dass er in eben der Nacht 1304 geboren wurde, in der das letzte große militärische Aufgebot der exilierten Partei der Bianchi, auf dessen Seite Petrarcas Vater (und Dante) stand, den in Florenz regierenden Neri unterlag. Zu den Umständen von Boccaccios Geburt gehört, dass im Frühjahr 1313 die Guelfen-Hochburg Florenz einen Etappensieg gegen den römischen Kaiser Deutscher Nation Heinrich VII. errungen hatte. Sie zwang dessen Truppen, von denen sich Dante damals seine triumphale Rückkehr in die Heimatstadt erhoffte, die Belagerung aufzugeben und sich ins kaisertreue Pisa zurückzuziehen. Die Gefahr war damit jedoch nicht gebannt. Um ihren militärischen Schutz zu sichern und die innerstädtischen Konflikte zu befrieden, entschloss sich Florenz im Mai 1313, König Robert in Neapel, dem militärischen Haupt der Guelfen in Italien, die befristete Herrschaft, die Signoria, über die Stadt zu übertragen. Am 24. August konnten die Florentiner endlich aufatmen. Der Kaiser erlag in der Nähe von Siena dem Sumpffieber. In diesen Monaten höchster Anspannung kam Boccaccio auf die Welt.
Während der 1265 geborene Dante diese letzte Krise der das 13. Jahrhundert in Italien bestimmenden Konfrontation zwischen Papst und Kaiser existentiell erlebte, begann das Leben Petrarcas und Boccaccios in der Phase des Umbruchs oder Übergangs. Der Kampf gegen den Kaiser lag in den letzten Zügen. Sie lebten in einer Zeit, die Johan Huizinga als «Herbst des Mittelalters» und Jacob Burckhardt in seiner italienischen Kulturgeschichte als Beginn von Humanismus und Renaissance bezeichneten.
Das Dunkel, das die Umstände der Geburt Boccaccios umhüllt, betrifft auch den Ort. Mal wird Florenz, mal Certaldo, eine hochgelegene kleine Ortschaft südwestlich von Florenz, angegeben. Boccaccio hat sich dazu nicht eindeutig geäußert. Das ist umso erstaunlicher, als er unter den Gründen, warum dem Dichter eine so herausragende Bedeutung zukommt, häufig die Anekdote anführte, wonach sich viele griechische Städte gegenseitig den Ruhm streitig machten, Geburtsort Homers gewesen zu sein. Für Certaldo spricht, dass Boccaccio den Ort früh seinem Namen anfügt. Von dort stammten seine Vorfahren. Im Haus des Großvaters wird der kleine Giovanni vermutlich manchen Sommer, wenn nicht die ersten Jahre verbracht haben. Dorthin zog er sich viel später zurück und verfügte in seinem Testament, dass es im Familienbesitz bleiben solle. Heute ist es ein Museum. Für Florenz spricht dagegen, dass der Vater – vielleicht auch schon der Großvater – zusammen mit dem Bruder Vanni (von Giovanni) schon Ende des 13. Jahrhunderts wie so viele andere auch vom Land in die boomende Handelsstadt Florenz gezogen war. Die Brüder, namentlich der federführende Boccaccio de Chelino (in den Dokumenten wird er gelegentlich auch Boccaccino genannt, eine Diminutivform, die in der Boccaccio-Forschung an ihm haften blieb, um ihn von seinem größeren Sohn zu unterscheiden), arbeiteten dort sehr erfolgreich als Geldwechsler und Händler – zwei Berufe, die damals ineinander übergingen. Sie brachten es bald zu jenem schnellen Reichtum, den Florenz den Zuzüglern verhieß und in dem Dante die Ursache für den sittlichen Verfall seiner Heimatstadt sehen wollte.
Um das Jahr 1313 herum scheinen die Geschäfte der Brüder so gut gelaufen zu sein – in Handelsverträgen stößt man oft auf den Namen des Vaters, der mit den großen Florentiner Bankerfamilien, darunter den Bardi, zusammenarbeitete und mehrfach in Paris war –, dass sie aus ihrer Wohnung südlich des Arnos in das hoch angesehene, überwiegend von Adligen sowie reichgewordenen Kaufleuten (popolani grassi) bewohnte Viertel San Pier Maggiore nördlich der heutigen Piazza della Signoria umziehen konnten (Branca, 1974, 246). Sie waren zwar noch keine Bürger der Florentiner Commune – das wurde der Vater erst am 16. Mai 1320 –, aber sie lebten im Herzen der Stadt. Der kleine Giovanni wurde in einer wohlhabend gewordenen und bald zu Ansehen gelangten Kaufmannsfamilie groß. Anders als Dante und Petrarca sollte er die meiste Zeit seines Lebens am Arno verbringen, auch wenn er, so wie die beiden Kollegen, mit der Stadt meist haderte.
Seltsamerweise ist die größte Unbekannte bei seiner Geburt die Mutter. In der zweiten Fassung der Vita Boccaccios, die Filippo Villani in den 1390er Jahren in seine lateinische Geschichte der Stadt Florenz und ihrer großen Bürger einfügte (es ist zugleich die erste Vita des Dichters), taucht die Mutter ebenso flüchtig wie überraschend auf. Da ist auf einmal von irgendeiner jungen Pariserin die Rede, die aus einer Schicht zwischen Adel und Bürgertum stamme und mit der Vater Boccaccio den Bund der Ehe eingegangen sei. Als Quelle beruft sich Villani auf «Kenner des Werkes» Boccaccios, die sich diese Details aus zwei frühen volkssprachlichen Dichtungen der 1330er Jahre zusammengereimt hatten.
In dem umfangreichen Prosaroman Il Filocolo nahmen sie die Geschichte einer Nebenfigur namens Idalogos, die zuletzt aus Liebesschmerz in einen Baum verwandelt wird, für ein verschlüsseltes Selbstporträt des Autors (V 8). Erzählt wird von dem Schäfer Eucomos – Boccaccios Vater (?) –, der seine Herde zu einem Fluss führte, weil dorthin auch die prächtigen Schafe des (französischen) Königs Franconarcus kamen. Dem Schäfer fiel bald eine der vielen schönen Töchter des Königs auf. Zunächst erfreute er alle mit der Musik seiner «zampogna» (Sackpfeife). Als seine Musik aufgrund des aufflammenden Begehrens immer einschmeichelnder und lieblicher wurde, lockte er die in Bann geschlagene Prinzessin namens Gannai – ein Anagramm von Gianna/Giovanna – in ein schattiges Tal. Dort gestand er dem, wie es heißt, einfachen Mädchen seine Liebe und versprach ihr ewige Treue. Im Kommentar des Erzählers heißt es, das Mädchen habe zu ihrem Unglück dem Wort eines Rüpels («villano») geglaubt. Danach ging alles rasch. Sie bekam Zwillinge und wurde wenig später von ihrem Liebhaber verlassen. Dieser begab sich mit beiden Kindern, das eine bleibt namenlos, das andere ist Idalogos, zurück zu den eigenen Feldern, wo er wenig später eine Einheimische heiratete und weitere Kinder zeugte. Der ahnungslose Idalogos stieß jedenfalls im väterlichen Haus auf die übelwollenden Blicke zweier wilder Bären, so dass er es angsterfüllt verließ und sich dem Schäfer und Astrologen Calamo anschloss. Aus dieser idyllisch-bukolischen Geschichte mit Anspielungen auf Certaldo und Frankreich haben Leser seit dem 14. Jahrhundert auf ein Liebesabenteuer des Vaters in der Handelsmetropole und Universitätsstadt Paris geschlossen, dessen Frucht Giovanni Boccaccio gewesen sei.
Aus einer weiteren Nebenfigur mit dem sprechenden Namen Ibrida, also Hybrid, die Boccaccio Anfang der 1340er Jahre in seiner Comedia delle ninfe fiorentine entwickelt, entnahmen Kenner seiner Werke weitere, noch verrücktere Details zu seiner Herkunft. Von der Mutter heißt es da, dass sich an sie die Hoffnung knüpfte, aus ihrem Schoß werde nach dem Untergang Troias und Roms in Paris ein neues großes Geschlecht entstehen. Dessen erster Vertreter sollte aus ihrer Verbindung mit einem großartigen Ritter hervorgehen. Doch der starb gleich nach der Hochzeit. Wenig später begegnete die junge Witwe einem Mann, den ein Plebejer niederster Herkunft in Tuszien, bei Certaldo, mit einer ziemlich grobschlächtigen Nymphe gezeugt hatte, dessen äußeres Erscheinungsbild aber nichts von dem bäuerlichen Ursprung verriet. Er hatte die Felder des Vaters verlassen und einen lukrativen Handel aufgenommen, der ihn nach Paris führte. Mit vielen Versprechungen und diesmal sogar Treueschwüren vor der Göttin Juno verführte er dort die junge Frau. Die, die den Stammhalter eines neuen großartigen Geschlechts gebären sollte, brachte den Jungen Ibrida zur Welt. Danach erging es ihr wie ihrer Vorgängerin im Filocolo, nur dass diesmal die gebrochenen Schwüre des Mannes gerächt werden: Seine Geschäfte brechen ein, und um den Nachwuchs aus der zweiten Ehe ist es schlecht bestellt; Sohn Ibrida, mit dem das neue große Geschlecht seinen Anfang nehmen sollte, landet in der Obhut der Göttin Venus (Comedia XXIII).
Die Geschichten dieser beiden Nebenfiguren sind in der Tat aufschlussreich für ihren Autor, aber im Sinne von phantasievollen Versuchen, das Fehlen der Mutter und das angespannte Verhältnis zum Vater zu verarbeiten. Fast möchte man darin schon mit Sigmund Freud eine Variante des «Familienromans der Neurotiker» sehen, den Heranwachsende ausspinnen, sobald sie fühlen, dass die bewunderte Autorität der Eltern nicht so unangefochten und einzigartig ist, wie sie glaubten. Aber meistens dichten sie sich dann einen anderen, großartigeren, zumindest in irgendeiner Form ‹besseren› Vater an wie Julien Sorel, der Sohn eines grobschlächtigen Zimmermanns, in Stendhals Roman Le Rouge et le Noir, der seiner verstorbenen Mutter eine Liebesaffäre anhängt, um sich zu erklären, warum er derart aus der Art geschlagen ist. Im Falle Boccaccios liegen die Dinge anders. Als die beiden Nebenfiguren entstanden, war er schon Ende zwanzig, wenn nicht Mitte dreißig. Auch wenn er darin womöglich Kindheitsphantasien verarbeitete, wurzeln beide Geschichten in literarischen Traditionen, wie sie Otto Ranke Anfang des 20. Jahrhunderts auf die Formel von der Geburt des Helden brachte.
Boccaccio erfindet sich in diesen pseudoautobiographischen Medaillons auch keinen ‹besseren› Vater. Noch am Ende seines Lebens reagiert er beinahe aggressiv, wenn sich ein Alexander der Große etwa einen göttlichen Vater – Jupiter – andichtete, um seinen Glanz zu erhöhen, und dafür den Makel der unehelichen Geburt in Kauf nahm (Gen. XIII lxxi 2). Für Boccaccio lag das Problem eher darin, dass er um seinen ebenso realen wie imposanten Vater nicht herumkam. Auf ihn trifft das römische Rechtssprichwort, nach dem mater semper certa est, nicht zu. Eben die Mutter ist die große Unbekannte in seinem Leben. War sie bei der Geburt oder im Kindbett gestorben? Oder kümmerte sie sich nicht um den Jungen, weil der Vater sie nicht im Haus haben wollte? Bis etwa 1342 hinterlassen Boccaccios Fragen nach der Mutter in seinen Dichtungen Spuren. In seiner späten kurzen Vita am Ende der Genealogie spricht er nur noch allgemein davon, dass er vom «mütterlichen Schoß» an für die Dichtung bestimmt gewesen sei (Gen. XV × 6). Von der ungekannten Mutter scheint nun seine große Neigung zur Literatur herzukommen, für die der kaufmännische Vater nichts übrighatte.
Dass Boccaccio tatsächlich aus einer unehelichen Beziehung hervorging, wissen wir, weil ihm Papst Innozenz VI. am 2. November 1360 einen Dispens erteilte, der Boccaccio vom Makel des «Bastards» befreite und ihm die erforderliche dignitas verlieh, Ämter in der Kirche innezuhaben, und ihn zur «cura d’anima», zur Seelsorge, also zur Ausübung priesterlicher Funktionen, berechtigte:
Vom geliebten Sohn Johannes, Sohn des Boccaccio aus Certaldo, Florentiner Kleriker (…) über den Geburtsmakel, den er erlitt, von einem ledigen Vater und einer ledigen Mutter gezeugt zu sein.
Demnach waren weder der Vater noch die Mutter zum Zeitpunkt der Zeugung und Geburt verheiratet. Folglich konnte die Mutter eine junge Frau, eine Bauerntochter oder ein Hausmädchen oder auch eine Witwe gewesen sein.
Interessanterweise machen Biographen um Boccaccios uneheliche Geburt wenig Aufhebens. Manchmal hat es den Anschein, als gerate die Frage über dem Mitleid mit der getäuschten und am Schmerz verendeten Mutter ins Hintertreffen. Drängte sie sich nicht auf, weil der erste Biograph Filippo Villani den Makel gar nicht erst aufkommen ließ? Denn nach Dafürhalten jener «Kenner» schloss die Mutter des Dichters ja den Ehebund. Der Humanist Giannozzo Manetti wusste später zusätzlich zu berichten, dass der kleine Giovanni von seinen Eltern viel Liebe erfahren habe. Leonardo Bruni dagegen wollte 1436 seinen Lebensbeschreibungen Dantes und Petrarcas keine zu Boccaccio anfügen, weil man zu wenig über Herkunft und Familienleben wisse. Als sich Anfang des 19. Jahrhunderts die Frage wieder stellte, vermutete Giovanni Battista Baldelli hinter den unterschiedlichen Geburtsorten ein von Vater und Sohn betriebenes Verwirrspiel, um die uneheliche Geburt zu vertuschen (280); Boccaccios deutscher Biograph Gustav Körting wiederum hielt 1880 die Ehe der Eltern für wahrscheinlich, da sonst die politischen Ämter, die Boccaccio innehatte, nicht zu erklären wären.
Nach dem Zweiten Weltkrieg erwähnen Vittore Branca und Marco Santagata die uneheliche Geburt zwar – Letzterer etwa hielt die Herkunftsphantasien für typische Ausgeburten eines unehelich Geborenen –, doch tun sie sie rasch mit dem Verweis auf den für Mittelalter und Renaissance bezeichnenden Umgang mit «Bastarden» ab. Bis Mitte des 16. Jahrhunderts, also bis zum Tridentinischen Konzil, gab es tatsächlich in allen Schichten der Bevölkerung viele «Bastarde». Nach Schätzungen war ein Drittel damals unehelich. Zudem standen «Bastarde» noch nicht in jenem Zwielicht, das unter anderem Shakespeares Darstellung des heimtückischen Usurpators Edmund im King Lear auf sie werfen wird. Die Renaissance wird daher gern als Goldenes Zeitalter der «Bastarde» bezeichnet.
Ganz so golden war das Leben unehelicher Kinder bis ins 16. Jahrhundert jedoch nicht. Ihre Stellung in den Herrscherhäusern oder in reichen Adelsfamilien, die sich auch in der Commune Florenz über Gesetz und Moral demonstrativ hinwegsetzen zu können meinten, gilt nicht für alle gesellschaftlichen Schichten. Am schwersten hatten es die, die von ihrem Erzeuger nicht anerkannt wurden. Das war vor allem bei jungen Müttern aus den unteren Schichten der Fall. Zu welchen Schicksalen es in Florenz kam, lässt sich unter anderem daran ablesen, dass am Arno 1419 das erste Waisenhaus in Europa – «lo Spedale degli Innocenti» – von der Zunft der Seidenindustrie in Auftrag gegeben wurde. Brunelleschis Bauwerk mit der kleinen Öffnung in der Mauer, in die man die Neugeborenen mit oder ohne Kennzeichen legen konnte, steht noch heute und gehört zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt.
Giovanni Boccaccio gehört zu denen, die Glück hatten. Er wurde vom Vater anerkannt und aufgenommen. In Städten wie Florenz, in denen allein die väterliche Linie ausschlaggebend war und Bräute in einer langen, kostspieligen Prozession zum Haus des Ehemanns geleitet wurden – als wäre es ein langer Besuch –, war das entscheidend. Die Aufnahme in die väterliche Familie war wichtig, weil sich ein Einzelner im 14. Jahrhundert über die Zugehörigkeit zu einem Gemeinwesen und zu einer – väterlichen – Großfamilie definierte. Der Stammbaum, den Boccaccio in den letzten Lebensjahren anfertigte und der nach dem Zweiten Weltkrieg eingelegt in eine Abschrift des Decameron gefunden wurde, konzentriert sich ganz auf die männliche Linie; Mütter kommen darin nicht vor.
Dieses für Florenz und die Toskana bezeichnende patriarchale Denken lässt sich gut an den Gepflogenheiten bei der Namensgebung festmachen. Nachnamen besaßen nur die wenigsten; Notare, Mediziner konnten sie sich individuell zulegen, aber nicht an ihre Kinder vererben. Üblich war es, einem Neugeborenen einen oder zwei Vornamen zu geben, um sowohl den Usancen in der Familie als auch der Forderung der Kirche nach einem christlichen Vornamen nachzukommen. An diese hängte man dann den Vornamen des Vaters. Der offizielle Name ist dementsprechend Giovanni di Boccaccio, weil sein Vater Boccaccio di Chellino hieß (von Michele, wie der Großvater hieß).
Die lateinischen Briefe, die Petrarca an seinen Freund Boccaccio sendet, sind an «Iohannes Boccaccius» adressiert. Darin wird also der eigentliche Vatersvorname Boccaccio, der im Lateinischen im Genitiv – Boccaccii – stehen müsste, in einen Nachnamen im heutigen Sinne abgewandelt, unter dem der Dichter bis heute berühmt ist. Boccaccio selbst hingegen unterschreibt seine lateinischen Briefe meist mit Iohannes de Certaldo, das heißt: Er übernimmt die geographische Herkunft, wie das in Florenz viele vom Land in die Stadt gezogene Familien taten. So nannte er sich vermutlich schon während seiner Florentiner Schulzeit. In seinen lateinischen Werken, die seit den späten 1350er Jahren entstehen, firmiert er dagegen mit «Iohannes Boccaccius de Certaldo» (De mulieribus, De casibus). Er tat das umso lieber, als er sich auf diese Weise nicht nur klar von der als korrupt beschimpften Stadt Florenz absetzen (Ep. VI), sondern auch mit seinen Idolen Dante und Petrarca das Selbstverständnis als Florentiner teilen konnte, die der Heimatstadt wegen der Unmoral das Exil – mehr oder minder gezwungen – vorzogen.
Nur wenige der in der Volkssprache verfassten Werke versah er mit einer Autorsignatur. Im Decameron ist von einem «autore» die Rede, dessen Name – wie das in der mittelalterlichen Literatur durchaus üblich ist – im Titel nicht auftaucht. Bei den frühen Dichtungen schreibt er ihn einmal voll aus, etwa im letzten Vers der Widmungssonette zur Amorosa visione. Gleich nach der Anrede an die Geliebte Fiammetta ist gemäß der Florentiner Sitte zu lesen: «Giovanni è di Boccaccio da Certaldo». Soweit sich die von Boccaccio nachträglich ausgewetzte Unterschrift unter einem volkssprachlichen Brief an einen Schulfreund heute entziffern lässt, unterschrieb er so Anfang der 1340er Jahre.
Dass Boccaccio von seinem Vater als Sohn offiziell angenommen wurde, ist per se kein Zeichen besonderer Fürsorge oder Zuneigung. Er tat, was damals viele Kaufleute taten. Unter den Florentiner Kaufmannsfamilien, deren Handel sich über viele Städte und seit dem 13. Jahrhundert über immer mehr Länder erstreckte, war es üblich, die jungen Söhne für längere Zeit in Niederlassungen oder Kontore anderswo zu schicken. Oft blieben sie dort viele Jahre. Erst im reifen Alter, Mitte dreißig ungefähr, kehrten etliche von ihnen nach Florenz zurück, wo ihnen ihre Verwandten nach wirtschaftlichen und vor allem politischen Erwägungen eine sehr viel jüngere Einheimische ausgesucht und den Ehevertrag mit deren Eltern ausgehandelt hatten. In den langen Jahren, die die jungen ledigen Männer außerhalb von Florenz arbeiteten oder auch im Exil zubrachten, gingen sie die unterschiedlichsten Verhältnisse ein, eher flüchtige mit Hausmädchen, Arbeiter- und Bäuerinnen oder auch mit Sklavinnen – Letzteres war, wie wir heute wissen, bei Leonardo da Vinci der Fall. In mittelalterlichen Traktaten zur Liebe, namentlich in dem wichtigsten von Andreas Capellanus, dienten Mädchen aus dem unteren Stand der männlichen Lust wie Freiwild. In der Praxis kam es auch zu Begegnungen mit verheirateten oder auch mit nicht oder nicht mehr verheirateten Frauen. Junge Witwen gab es aufgrund des hohen Altersunterschieds zwischen Eheleuten viele. Im Corbaccio wird Boccaccio später klagen, wie zahlreich die in «spedali» abgegebenen Kinder waren (Corb. 238), und Auskunft über Verhütungs- und Abtreibungsmethoden im 14. Jahrhundert geben. Die Beziehung zu Witwen oder ledigen Frauen konnte aber auch in die geregelte Form des Konkubinats überführt werden. Das heißt, die ledigen Männer wohnten mit den Frauen unter einem Dach. Da hier ein eheähnliches Verhältnis vorlag, galten die Kinder rechtlich nicht als «spurii», sondern als «naturales». Wenn die Männer dann nach Florenz heimgeholt wurden, ließen sie ihre Konkubinen zurück, statteten sie eventuell mit einer guten Mitgift aus, damit sie leichter heiraten konnten. Die aus der Beziehung hervorgegangenen Kinder blieben entweder bei der Mutter in der neuen Familie, oder sie wurden vom Vater in die Ehe mitgebracht.
Anders als die Mädchen, die wegen der hohen Mitgift eher als Last wahrgenommen wurden, genossen die Buben unter den «Bastarden» großes Interesse. Die Kindersterblichkeit war hoch, noch dazu war nicht klar, ob die spätere Ehefrau Söhne zur Welt bringen würde. «Bastarde» konnten somit auch in der bürgerlichen Schicht als eine wichtige Ressource betrachtet werden, um den Fortbestand der Familie und des Geschäfts zu sichern. Viele von ihnen erhielten deshalb eine gute Ausbildung, wurden in die Geschäfte eingewiesen. Ähnlich dachte offenkundig auch Vater Boccaccio. Er ließ den Sohn zum Kaufmann ausbilden und scheute keine Ausgaben. Ob und, falls ja, in welcher Form er einen offiziellen Antrag auf volle Legitimation des Kindes stellte, ist nicht überliefert. Damals lag das in weltlicher Hand, nur der Kaiser oder dessen Delegierte – das konnte auch ein Bischof oder Notar sein – hatten das Recht dazu. Aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts sind für Florenz etliche Anträge dieser Art bei der Commune registriert.
Wie sehr das auch zum Problem werden konnte, hat der amerikanische Historiker Thomas Kuehn an einem Streit gezeigt, der im 14. Jahrhundert unter Juristen darüber entbrannte, ob uneheliche Kinder durch Legitimation den ehelichen Kindern wirklich gleichgestellt werden konnten. Durchsetzen sollte sich die konservative Position. Ein «legittimato» durfte nicht denselben Status oder Rang wie ein «legittimo» haben. Eheliche Kinder durften nicht benachteiligt werden. Juristen laborierten daher an der Definition dieses kleinen, aber zentralen Unterschieds. Demnach basierte die Legitimierung auf einer reinen Rechtsfiktion, die dem Faktum der ehelichen Geburt nicht gleichzusetzen war; sie war etwas Äußerliches, eine «Form» («figura»), die mit dem Eigentlichen, der «Substanz», die ein Legitimer hatte, nicht zu verwechseln war. Im konkreten Leben machten sich solche Differenzierungen vor allem dann bemerkbar, wenn es ans Erben ging. Giovanni Boccaccio hatte Glück. Als sein Vater starb, war sein letzter überlebender Halbbruder noch minderjährig. Giovanni Boccaccio wurde daher als Erbe und Tutor eingesetzt. Zugute kam ihm wohl auch, dass die Commune infolge der Pestepidemie das Erbrecht gelockert hatte.