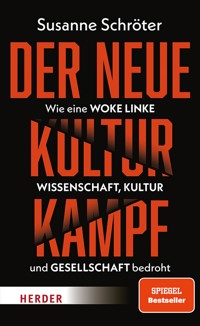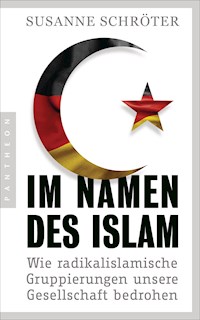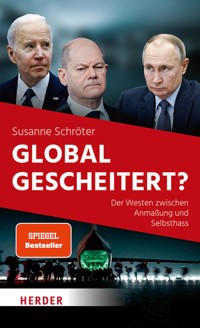
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Selten schien der Westen so geschlossen wie zu Beginn des Ukraine-Kriegs. Die Werte der Freiheit und Demokratie galt es gegen ein autokratisches System zu verteidigen. Doch hinter der vermeintlichen Geschlossenheit zeigten sich schnell die ersten Bruchstellen. Wie werden wirtschaftliche Zwänge mit politischen Zielen in Einklang gebracht? Wie viel sind dem Westen die eigenen Ideale wert? Dass sich dahinter ein tiefgreifendes strukturelles Problem des Westens verbirgt, zeigt die Ethnologin und Islamexpertin Susanne Schröter in ihrem neuen Buch. Angesichts der jüngsten Konflikte in der Ukraine, in Afghanistan und Mali sowie der Planlosigkeit westlicher Regierungen im Umgang mit Migrationsbewegungen, Islamismus und Cancel Culture diagnostiziert sie einen zwischen Hybris und Selbsthass gefangenen Westen, der unentwegt die Werte der Demokratie beschwört, sie aber gleichzeitig immer dann verrät, wenn es darauf ankommt. Befindet sich der Westen auf dem besten Weg, die eigene innen- wie außenpolitische Glaubwürdigkeit zu verspielen? In ihrem analytisch klugen und thesenstarken Buch gibt Susanne Schröter die Antwort.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Susanne Schröter
Global gescheitert?
Der Westen zwischen Anmaßung und Selbsthass
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2022
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Verlag Herder
Umschlagmotiv: Joe Biden © picture alliance /
ASSOCIATED PRESS / Thomas Coex; Olaf Scholz
©picture alliance / dpa / dpa-Pool / Michael Kappeler;
Vladimir Putin ©Imago / Alexei Drushinin /
Kremlin Pool; Militärtransportflugzeug © Imago /
Sra Taylor Crul / U.S. Air
E-Book-Konvertierung: ZeroSoft, Timisoara
ISBN Print 978-3-451-39367-9
ISBN E-Book (EPub) 978-3-451-82865-2
ISBN E-Book (PDF) 978-3-451-82868-3
Inhalt
Einleitung
Der russische Überfall auf die Ukraine
Genealogie eines unerwarteten Krieges
Putin und die Männerfreundschaft
Die neuen Falken
Frieren für den Frieden
Interventionsromantik
Das Afghanistan-Desaster
Freiheitsliebe und ethnische Solidarität
Lässt sich Demokratie exportieren?
Das Scheitern des Westens in Mali
Herausforderung Islamismus
Der Aufstieg Europas aus den Trümmern des Osmanischen Reichs
Gotteskrieger gegen die Kreuzzügler
Hamburgs Beitrag zum 11. September
Kampfbegriff antimuslimischer Rassismus
Im ideologischen Dschungel des Postkolonialismus
Die Verdammten der Erde
Der Orient im Okzident
„Weißsein wurde erfunden, um herrschen zu können“
Die vielen Gesichter der Sklaverei
Kulturkrieger auf dem Weg zur Macht
Rassismus ohne Rassen
Cancel Culture
Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies
Filzfrisuren und Indianerhäuptlinge
Identitätspolitik als Geschäftsmodell
Fallstricke der Migrationspolitik
Vom Hindukusch nach Deutschland
Parallelgesellschaften
Facetten der Zuwanderung
Hilfsbereitschaft und Abwehr in Europa
Geopolitische Machtspiele
Von Ho Chi Minh zu Rudi Dutschke
Schweigen im Sozialismus
Versöhnung und Verblendung
Zeitenwende
Menschenrechtsverletzungen im NATO-Land Türkei
Energiehunger und feministische Außenpolitik
Der chinesische Elefant im Raum
Antisemitismus
Die Zukunft des Westens
Zwischen Hybris und Selbsthass
Gespaltene Gesellschaften
Freiheit
Literatur
Anmerkungen
Über die Autorin
Einleitung
Der Westen ist die freieste, wohlhabendste und sozialste Region der Welt. Nirgendwo werden die Freiheitsrechte des Individuums stärker geschützt, haben Frauen im Kampf für Gleichberechtigung mehr erreicht, können sexuelle, ethnische und religiöse Minderheiten ihre Anliegen besser geltend machen. Nirgendwo profitiert die Bevölkerung mehr von steuerbasierten sozialen Einrichtungen, einem hoch entwickelten Gesundheitssystem sowie kostenloser Bildung.
Dennoch droht der Westen zu scheitern. Verantwortlich ist eine krude Mischung aus Hybris und Selbsthass, die gleichermaßen zum Aufstieg von Diktatoren wie zur Eliminierung fundamentaler demokratischer Errungenschaften führt. Der Angriff der russischen Armee auf die Ukraine war nur möglich, weil man die von Putin stets offen zur Schau gestellte Aufrüstung nicht als Bedrohungsszenario einstufte. Das gilt besonders für Deutschland. Selbst die Überfälle Russlands auf seine Nachbarstaaten hinderten deutsche Politiker nicht, weiterhin an der Mär Wandel durch Handel festzuhalten und die Abhängigkeit in besonders vulnerablen Sektoren voranzutreiben. Jetzt ist guter Rat teuer, wenn man die russische Militärmaschine nicht weiterhin mit Milliarden aus dem Gas-, Öl- und Kohlegeschäft finanzieren möchte. Wirtschaftsminister Robert Habeck besaß genug Weitblick, um festzustellen, dass es mit der populistischen Parole Frieren für den Frieden nicht getan ist, und pilgerte an den arabischen Golf, um dort für neue Energiepartnerschaften zu werben. Die künftigen Energielieferanten, mit denen langfristige Verträge anvisiert werden, sind allerdings ausnahmslos islamistische Diktaturen, die durch endemische Menschenrechtsverletzungen und eine extrem patriarchalische normative Ordnung auffallen. Man könnte Habecks Kooperationsbemühungen Realpolitik nennen, wenn nicht gerade von der deutschen Regierung eine feministische Außenpolitik ausgerufen worden wäre. Doppelmoral wäre daher wohl der treffendere Begriff für diese und andere Widersprüchlichkeiten, die das große Projekt des Westens, nämlich die weltweite Förderung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, immer wieder diskreditieren.
Zu den offensichtlichen Ambivalenzen gehört der halbherzige Umgang mit dem Islamismus. Der mit großem Pathos inszenierte Krieg gegen den Terror sparte außenpolitisch sowohl die Financiers als auch die wichtigsten Rückzugsgebiete islamischer Terroristen aus und setzte innenpolitisch vornehmlich auf eine fatale Beschwichtigungspolitik, um die einheimischen Muslime nicht zu verprellen. Ähnlich wie bei den Beziehungen zur Russischen Föderation setzt man seit Jahrzehnten auf die Hoffnung, dass Menschen zu Demokraten werden, wenn man das richtige Angebot macht und es monetär attraktiv ausgestaltet. In Afghanistan ist diese Strategie nach 20 Jahren ebenso krachend gescheitert wie beim politischen Islam westlicher Prägung, ohne dass dies zu tieferen Einsichten geführt hätte. Obgleich die Anzahl der Demokratien weltweit zurückgeht, verkünden westliche Politiker, allen voran der amerikanische Präsident, unverdrossen einen unvermeidlichen Sieg der Demokratie.
Im Angesicht der furchtbaren Bilder aus der Ukraine stehen Europa und die USA enger zusammen als in den vergangenen Jahren, und Bundeskanzler Scholz sprach sogar von einer Zeitenwende. Wer genau hinschaut, sieht allerdings die realen Bruchlinien hinter der wohlfeilen Rhetorik. Im globalen Süden wird die Parteinahme zugunsten des Westens weitgehend abgelehnt, und demokratische Staaten wie Indien haben ihre Geschäfte mit der Russischen Föderation sogar intensiviert. Doch auch innerhalb der EU und der NATO ist man von einer Einigkeit weit entfernt. Viele westliche Gesellschaften sind nämlich tief gespalten. Eine verfehlte Migrationspolitik hat gleichermaßen zur Herausbildung islamistischer Parallelgesellschaften wie rechtspopulistischer Parteien geführt, und mancher Politiker sieht sich Russland letztendlich näher als den USA.
Gerade für die westliche Linke ist ein tief verwurzelter Antiamerikanismus konstitutiv. Das liegt zum einen an fragwürdigen militärischen Interventionen, die ganze Länder zerrütteten und auch schon mal eine Demokratie zum Einsturz brachten, wenn die gewählte Regierung nicht den Vorstellungen der Machthaber in Washington entsprach. Zum anderen stand hinter der Feindschaft gegen die USA eine ideologisierte Einäugigkeit, die bemerkenswert ist. Während junge Revoluzzer in New York und Berlin über die angebliche Geißel des Kapitalismus und die Menschenrechtsverletzungen des US-Imperialismus dozierten, schwiegen sie über Millionen von Gefolterten und Ermordeten in kommunistischen Ländern. Während sie die Freiheitsrechte des Westens bei antiwestlichen Demonstrationen und Versammlungen in Anspruch nahmen, erwähnten sie mit keinem Wort, dass jede Form der Opposition in China, der Sowjetunion oder in Kuba mit äußerster Repression unterbunden wurde. Vor diesem Hintergrund empfanden viele auch die Demokratiebewegungen in Osteuropa als störend und wandten sich lieber dem Aufbau guter Beziehungen zum sowjetischen Nachbarn zu.
Bis auf den heutigen Tag wird der Westen von der Mehrheit der Linken bis hinein in konservative Kreise für Armut, Kriege, Umweltkatastrophen und andere Übel dieser Welt verantwortlich gemacht. An europäischen, amerikanischen und australischen Universitäten konstruieren sogenannte postkoloniale Theoretiker den Westen als Reich eines postreligiösen Antichristen, der die Welt in einen Zustand der Verdammnis gebracht hat. Dabei geht es längst nicht mehr nur um den Westen als politisches und ökonomisches System, sondern auch um Menschen weißer Hautfarbe. Ein neuer Rassismus formiert sich, und er richtet sich – historisch ein absolutes Novum – gegen die eigene Bevölkerung. Weiß sein wird in der weißen Welt zum Stigma, im postchristlichen Sinn zur neuen Erbsünde, und gerade Angehörige der privilegierten weißen Mittelschicht kultivieren einen skurrilen Kult, in dem sie öffentlich ihre Schuld, rassistisch zu sein, bekennen. Sie werden von Personen unterstützt, die sich als Opfer westlichen Rassismus oder anderer vermeintlich diskriminierender Praktiken inszenieren. Da die Anerkennung eines Opferstatus in der Regel mit finanziellen Zuwendungen belohnt wird und ein lukratives Geschäftsmodell darstellt, lässt sich gegenwärtig eine Multiplizierung von selbst ernannten Opfergruppen beobachten. Auf der Gegenseite wurde der heterosexuelle alte weiße Mann zur ultimativen Hassfigur.
Die Folgen sind alles andere als trivial. Die Idee der Gleichheit aller Bürger weicht einem identitätspolitischen Furor, der Menschen nach äußerlichen Merkmalen, sexuellen Gewohnheiten und, sofern es Muslime betrifft, auch nach Religionszugehörigkeit gliedert. In angelsächsischen Ländern wurden Arbeitsverträge gekündigt, weil die Hautfarbe der Angestellten als unpassend für ein diverses Zeitalter betrachtet wurde, und manch einer schwadroniert darüber, dass Weiße nicht mehr publizieren oder keine Führungspositionen mehr bekleiden sollten. Mit verordneten Sprachregelungen möchte man die Bevölkerung zur Anerkennung der neu geschaffenen Realitäten nötigen und setzt damit implizit an das alte kommunistische Ideal der Erschaffung eines neuen Menschen an, der in der Diktatur des Proletariats geschmiedet werden sollte. Auch die Meinungs-, Presse-, Kunst- und Wissenschaftsfreiheit geraten unter Druck. Verboten werden soll alles, was Lobbygruppenvertreter als verletzend empfinden könnten, und dies betrifft selbst schlichte Erkenntnisse der Naturwissenschaften.
Ein großer Teil der Bevölkerungen westlicher Länder lässt sich von der Aggressivität, mit der die neue Welt errichtet wird, einschüchtern und zieht sich in eigene Parallelstrukturen zurück. Einige schließen sich extremen Organisationen an. In etlichen Ländern, zu denen die USA und Frankreich gehören, werden Wahlen zur gesellschaftlichen Zerreißprobe. Wenn der Westen in diesen Herausforderungen bestehen will, muss er sich auf seine Grundlagen besinnen. Es gibt weder einen Grund für Überheblichkeit noch für Selbsthass. Beides behindert die realistische Überprüfung eigener Stärken und Schwächen, die notwendig ist, um aus Fehlern zu lernen und die Zukunft des Westens zu sichern. Eines sollte dabei gewiss sein: Wer die Freiheit im Innern nicht achtet, hat nach außen nichts zu verteidigen.
Der russische Überfall auf die Ukraine
Am 24. Februar 2022 überfiel die Armee der Russischen Föderation die Ukraine. In westlichen Ländern löste dieser Krieg mitten in Europa einen Schock aus. Das Prinzip Wandel durch Handel wurde vom russischen Präsidenten Wladimir Putin ebenso ad absurdum geführt wie die Hoffnung, dass sich regelbasierte Ordnungen westlichen Stils mithilfe von Soft Power durchsetzen lassen. Europa realisierte bestürzt, dass es sich in falscher Sicherheit gewogen hatte und der gern zur Schau getragene Hochmut gegenüber den USA, die seit Langem eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben angemahnt hatten, vollkommen inadäquat gewesen war. Besonders hart traf diese Erkenntnis deutsche Politiker, die für die Misere in entscheidendem Maß mitverantwortlich waren, weil sie das russische System verharmlost, politisch legitimiert und mitfinanziert hatten.
Genealogie eines unerwarteten Krieges
Im Rückblick muss man sagen, dass der Angriff mit Ankündigung erfolgte. Bereits am 1. Juli 2021 hatte Putin auf der Website des Kreml einen 24-seitigen Essay mit dem Titel Zur historischen Einheit von Russen und Ukrainern veröffentlicht, in dem er der Ukraine das Recht absprach, ein eigenständiger Staat zu sein. Es handele sich um eine illegitime Konstruktion der Bolschewiki aus dem Gründungsjahr der Sowjetunion, schrieb er, und diese werde gegenwärtig vom Westen gesteuert, um Russland zu schwächen. Russen, Belarussen und Ukrainer, so seine zentrale Aussage, seien ein Volk und gehörten zu einer dreieinigen russischen Nation. Diese Nation dürfe nicht gespalten werden.
Der Hintergrund dieser These ist ein gemeinsamer russisch-ukrainischer Ursprungsmythos, der ins neunte Jahrhundert zurückreicht, als normannische Stämme die Föderation der Kiewer Rus gründeten, die aus mehreren Herrscherhäusern bestand und vom Kiewer Fürsten angeführt wurde.[1] Die glanzvolle Zeit endete mit der Eroberung durch die Mongolen im Jahr 1237 und einer anschließenden Zersplitterung. Ab 1350 wurde Moskau das wichtigste Machtzentrum der Region und die Ukraina zum Grenzland. In den folgenden Jahrhunderten fielen Teile des heutigen Staatsgebietes an Polen, an Russland und an das Habsburger Reich.
Seit dem 19. Jahrhundert lassen sich Bestrebungen der Ukrainer erkennen, einen eigenen Staat zu gründen. Das gelang für eine kurze Zeit nach der Februarrevolution 1917, doch bereits 1918 eroberten die Bolschewiki die Region zurück und konstituierten 1922 eine Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik.[2] Es folgten Russifizierungsmaßnahmen und Zwangskollektivierungen. Widerstand wurde mit Säuberungsaktionen und dem Aushungern der Bevölkerung gebrochen. Nach Schätzungen starben dabei zwischen drei und sieben Millionen Menschen.[3] Eine zweite Repressionswelle und eine weitere Hungersnot folgten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Diese jüngere Geschichte wird heute von Ukrainern als ebenso traumatisch erinnert wie die Ermordung von acht Millionen Menschen durch das nationalsozialistische Regime.
Während der Perestroika unter Michail Gorbatschow entwickelte sich ab den 1980er-Jahren erneut eine ukrainische Unabhängigkeitsbewegung. Mehr als 90 Prozent der Bevölkerung stimmten 1991 in einem Referendum für den Austritt aus der Sowjetunion. Auch auf der Halbinsel Krim, die 1954 unter Nikita Chruschtschow dem ukrainischen Territorium zugeordnet wurde, entschied sich damals eine knappe Mehrheit der Befragten gegen einen Verbleib in der Sowjetunion. Im Budapester Memorandum, das die USA, Russland und Großbritannien 1994 unterzeichneten, wurde die territoriale Souveränität der Ukraine festgelegt. Im Gegenzug verzichtete diese auf die Atomwaffen, die in der Vergangenheit bei ihr stationiert worden waren. 1996 verabschiedete das ukrainische Parlament eine neue Verfassung, in der die Ukrainer als Staatsvolk und die ukrainische Sprache als Staatssprache genannt wurden, und 1997 schloss Boris Jelzin einen Freundschaftsvertrag zwischen Russland und der Ukraine, in dem die nationale Souveränität bestätigt wurde.
Trotz dieser Entspannung gab es starke Kräfte in Russland, die mit der Entwicklung nicht einverstanden waren und eine Wiedervereinigung der sogenannten russischen Zivilisation anvisierten. In der Ukraine selbst herrschte ebenfalls keine Einigkeit darüber, wie die Beziehungen zu Russland in der postsowjetischen Phase ausbuchstabiert werden sollten. Ein Teil der russischsprachigen Minderheit in der Bevölkerung blieb russlandorientiert, die Mehrheit strebte jedoch nach Europa. Ein wirklicher politischer Wandel war in den ersten Jahren der Unabhängigkeit ohnehin nur in Ansätzen erkennbar. Oligarchen und Funktionäre der Kommunistischen Partei etablierten einen dichten Filz korrupter und nepotistischer Strukturen, und ehemals sowjetische Eliten, die von Russland unterstützt wurden, dominierten weiterhin die Politik. Notwendige Reformen blieben aus, das Bruttoinlandsprodukt sank kontinuierlich, und Millionen Ukrainer verließen aufgrund wirtschaftlicher Not das Land.
Immer wieder zeigte sich, dass die Bevölkerung stark gespalten war. Bei den Wahlen im Jahr 2004 erhielt der europäisch gesinnte Wiktor Juschtschenko im westlichen Teil des Landes die absolute Mehrheit aller Stimmen, auf der Krim und in der Donbass-Region war der russlandtreue Wiktor Janukowytsch der erklärte Favorit. Janukowytsch reklamierte zunächst einen Wahlerfolg für sich, doch es gab begründete Zweifel an der Auszählung. Juschtschenkos Anhänger, die ihren Kandidaten als eigentlichen Wahlsieger sahen, protestierten gegen das ihrer Meinung nach manipulierte Ergebnis. Eine breite Bewegung entstand, welche die Farbe Orange, die Juschtschenko im Wahlkampf verwendet hatte, als Erkennungszeichen auf Bannern und Kleidungsstücken nutzte. Aus diesem Grund ging sie als Orange Revolution in die Geschichte ein. Sie vollzog sich lehrbuchhaft als Erfolgsgeschichte eines breiten zivilgesellschaftlichen Widerstands. Allabendlich versammelten sich Hunderttausende auf dem zentralen Platz der Unabhängigkeit in Kiew, dem Majdan Nesaleschnosti, und forderten eine Überprüfung des Ergebnisses. Es kam zu Blockaden und Streiks. Im Dezember wurde die Stichwahl zwischen den beiden Kontrahenten wiederholt. Juschtschenko wurde als Gewinner bestätigt und im Januar 2005 als Präsident vereidigt. Die Orange Revolution wurde in starkem Maße von westlichen Einrichtungen unterstützt, und in einigen meinungsbildenden Zeitungen wurde über eine amerikanische Orchestrierung spekuliert. Der Politikwissenschaftlerin Sabine Fischer zufolge, die damals am EU-Institute for Security Studies in Paris beschäftigt war, verursachte diese Entwicklung in Russland Befürchtungen, dass sich auch andere Staaten des russischen Einflussbereiches nach Westen ausrichten könnten. Sie schreibt der russischen Führung Einkreisungsphobien zu.[4]
Ruhe kehrte nach der Vereidigung Juschtschenkos in der politischen Landschaft der Ukraine nicht ein. Korruptionsvorwürfe und öffentlich ausgetragene Querelen im Regierungslager sorgten dafür, dass Janukowytsch 2010 erneut zum Präsidenten gewählt wurde. Er verhandelte ein Assoziierungsabkommen mit der EU und gleichzeitig die Integration der Ukraine in eine Zollunion mit der Russischen Föderation. Nach politischem Druck aus Moskau wurde das Abkommen mit der EU allerdings im November 2013 gestoppt. Daraufhin kam es erneut zu Demonstrationen, an denen zeitweise mehr als eine Millionen Menschen teilnahmen. Die Bewegung ist unter dem Begriff Euromaidan in die Geschichte eingegangen. Die Regierung reagierte mit Verhaftungen und Polizeigewalt, und der russische Außenminister Sergej Lawrow warnte den Westen davor, sich einzumischen. Dennoch siegte die Opposition, weil sich im Februar 2014 die Polizei, die Armee und der Geheimdienst der Demokratiebewegung anschlossen.
Putin sah diese Entwicklung erneut als Bedrohung und beschuldigte vermeintliche Faschisten, mit Unterstützung des Westens die Ausrottung alles Russischen zu betreiben. Diese Propaganda verfing im Donbass ebenso wie auf der Krim, die mehrheitlich von einer russischsprachigen Bevölkerung bewohnt sind, und machte es Putin möglich, eigene expansionistische Ziele als Maßnahmen des Schutzes der russischen Bevölkerung zu deklarieren. Unter russischer Anleitung wurden auf der Krim die Regionalregierung ausgetauscht, ein Autonomiestatus ausgerufen und ein Referendum abgehalten, das eine sogenannte Wiedervereinigung mit Russland zum Ergebnis hatte. Im März 2014 bat die neue Regierung Russland um militärische Unterstützung, und Putin annektierte das Gebiet. In den Schulen wurden fortan russische Schulbücher verwendet, der Rubel wurde als Währung eingeführt, und 2019 erhielten die Einwohner die russische Staatsbürgerschaft. Der Westen reagierte mit Sanktionen, doch innerhalb der Russischen Föderation fand dieser Bruch des Völkerrechts breite Zustimmung.
Nach dem Vorbild der Krim begann Putin auch die Donbass-Region zu destabilisieren. In den Regionen Donezk und Lugansk wurden Souveräne Volksrepubliken ausgerufen. Prorussische Separatisten versuchten, die regionale Unabhängigkeit mit Waffengewalt durchzusetzen, und wurden dabei von Russland unterstützt. Zwei Abkommen zur Deeskalation, die unter Beteiligung Deutschlands und Frankreichs in Minsk ausgehandelt wurden, scheiterten am Unwillen der Beteiligten. Die Ukraine beharrte auf der völkerrechtlich bindenden Unverrückbarkeit ihrer Staatsgrenzen, die Russische Föderation und ihre Stellvertreter im Osten des Landes strebten das Gegenteil an. Problematisch war, dass die Verträge eine starke russlandfreundliche Schieflage aufwiesen, die Putin zu nächsten Schritten der Eskalation ermutigte.[5] In einem Brief an den ukrainischen Präsidenten forderte er einen einseitigen Waffenstillstand der ukrainischen Armee, den Abzug schwerer Waffen, die Dezentralisierung der Ukraine und eine weitgehende Autonomie der Donbass-Region. Frank-Walter Steinmeier, der damals als deutscher Außenminister handelte, unterstützte die russischen Forderungen durch einen Vorschlag, der als Steinmeier-Formel bekannt wurde. Dabei sollten die Separatistengebiete einen Sonderstatus erhalten und eine Kommunalwahl durchführen. Auf Grundlage des Wahlergebnisses sollte dann über den dauerhaften Status entschieden werden. Große Demonstrationen in Kiew waren die Folge, und Steinmeier verspielte in der Ukraine seinen Ruf als unparteiischer Vermittler.
Dann kam das Jahr 2021, in dem konkrete Vorbereitungen für einen neuen Krieg unübersehbar wurden. Die Russische Föderation stationierte mehr als 100 000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine und auf der Halbinsel Krim und schränkte die Fahrt für ausländische Militärschiffe zu den ukrainischen Häfen am Asowschen Meer ein. Angela Merkel, Emmanuel Macron und Wolodimir Selenskyi mahnten eine Deeskalation an und forderten den Abzug der russischen Truppen. Auch ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im Normandie-Format wurde vorgeschlagen. Es handelt sich dabei um einen Gesprächskreis mit Vertretern Russlands, der Ukraine, Deutschlands und Frankreichs. Putin setzte seine Kriegsvorbereitungen jedoch unbeirrt fort. Er kündigte ein Manöver im Schwarzen Meer und die Sperrung bestimmter maritimer Gebiete an. Kriegerische Absichten verneinte er noch im Februar 2022, verschärfte allerdings einen an den Westen gerichteten Forderungskatalog und verlangte u. a. den Abzug von NATO-Truppen und schweren Waffen aus den Ländern des ehemaligen Warschauer Paktes sowie einen Verzicht auf die NATO-Osterweiterung. Unübersehbar zielte er auf die Entwaffnung großer Teile Europas und die Wiederherstellung russischer Dominanz. Die USA und die NATO lehnten den Affront ab. Im Januar 2022 trat der UN-Sicherheitsrat zusammen, und Russland wiederholte, dass keine Invasion geplant sei. Es folgte eine Reihe deeskalierender Verlautbarungen der russischen Seite, die aber stets durch weitere Verstärkungen der Truppenkonzentration ad absurdum geführt wurden. Für westliche Länder, allen voran die USA, waren dies eindeutige Zeichen eines bevorstehenden Angriffes.
Dann nahm ein Szenario seinen Lauf, das bereits von der Annexion der Krim bekannt war. Am 21. Februar 2022 erkannte Putin die ukrainischen Verwaltungsbezirke Donezk und Lugansk als unabhängige Volksrepubliken an, diese baten um militärische Unterstützung, und die russische Armee marschierte ein. Der Krieg wurde wohl maßgeblich aus innenpolitischen Erwägungen als Sonderoperation heruntergespielt. Putin verkündete in einer haarsträubenden Propagandaansprache, einen angeblichen Genozid an der russischen Bevölkerung beenden und die Ukraine entnazifizieren zu wollen. Damit knüpfte er rhetorisch an die Geschichte des Großen Vaterländischen Krieges gegen das nationalsozialistische Deutschland an, die in der russischen Bevölkerung präsent ist. In der russischen Nachrichtenagentur wurde ein Beitrag des Autors Timofei Sergeitsev veröffentlicht, in dem dieser zur Bestrafung und Tötung der ukrainischen Zivilbevölkerung aufrief, da diese mehrheitlich Nazis seien oder das Nazisystem unterstützt hätten.[6] Wer sich fragt, wie es zu den Massakern in Butscha und an anderen Orten kommen konnte, findet in dieser Propaganda die Antwort.
Putin und die Männerfreundschaft
Der Krieg löste auch deshalb Bestürzung innerhalb der westlichen Welt aus, weil man sich eingestehen musste, Putin verkannt zu haben. Bis zum 24. Februar 2022 galt er vielen vornehmlich als Partner einer europäischen Friedensordnung, obwohl seine geostrategischen Ambitionen nicht unbekannt waren. Jahrelang nahm niemand Anstoß an der Aufrüstung, in die in den vergangenen Jahren zwischen 3,7 und 5,4 Prozent des russischen Bruttoinlandsprodukts investiert wurden.[7] Während viele europäischen Länder ihre Armeen abbauten, weil man sie für überflüssige Relikte einer vermeintlich überwundenen Phase der Geschichte hielt, präsentierte Russland alljährlich bei der Militärparade zum 9. Mai, dem Tag des Sieges, an dem die Kapitulation Deutschlands gefeiert wird, die neuen Errungenschaften russischer Waffentechnik. Je stärker sich die osteuropäischen Länder von Russland entfernten, desto eindrucksvoller wurde diese Selbstdarstellung militärischer Stärke. Zur Waffenschau passte eine immer kriegerischer werdende Rhetorik. Putin, der den Zusammenbruch der Sowjetunion als größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet hatte, verfolgte einen revisionistischen Kurs. Dabei ging es ihm nicht um den Kommunismus, sondern um die Wiederherstellung eines russischen Imperiums. Nicht Stalin war sein Vorbild, sondern Peter der Große. Putin machte niemals ein Hehl daraus, dass ihn die Vision antrieb, den Bedeutungsverlust rückgängig zu machen, den Russland durch die Unabhängigkeit ehemals russischer Gebiete erfahren hatte. Dass er von der Demokratie wenig hält, war ebenfalls kein Geheimnis. Sein Lebenslauf spricht in dieser Hinsicht eine deutliche Sprache.
Er begann seine Karriere als Offizier des sowjetischen Geheimdienstes, wurde im Jahr 1999 von Boris Jelzin zum Ministerpräsidenten der Russischen Föderation ernannt und folgte ihm ein Jahr später als Präsident ins Amt. Eine seiner ersten Handlungen als Staatsoberhaupt war die Erhöhung des Militärbudgets um 50 Prozent. Eine andere bestand in einer neuen innenpolitischen Zentralisierung und in der Ausschaltung seiner Gegner. Der prominenteste von ihnen war Michail Chodorkowski, der dem Ölkonzern Yukos vorstand und als reichster Mann Russlands galt. Mit Putin geriet er aneinander, weil er die mangelnde innenpolitische Demokratie kritisierte und Reformen anregte. Nachdem er sich öffentlich mit dem russischen Präsidenten über die herrschende Korruption gestritten hatte, wurde er 2003 festgenommen, wegen angeblicher Steuerhinterziehung zu acht Jahren Haft verurteilt und in ein sibirisches Straflager verbracht. Yukos wurde zerschlagen und ging in die Hände regierungsnaher Kapitalgesellschaften über. 2009 erfolgte ein weiterer Prozess gegen Chodorkowski, der einiges Aufsehen erregte, weil die Assistentin des zuständigen Richters öffentlich berichtete, der Richter habe ein von anderer Seite angefertigtes Urteil verlesen müssen. Die Zeit unabhängiger Gerichte war in jedem Fall unübersehbar vorbei.
Wie Putin mit Personen umgeht, die ihm unbequem zu werden drohen, lässt sich auch an zwei weiteren Personen dokumentieren. Einer von ihnen war Alexander Litwinenko, der 2006 in seinem Londoner Exil mit der radioaktiven Substanz Polonium-210 vergiftet wurde. Alle Spuren wiesen nach Moskau. Von offizieller Seite wurde allerdings jede Verantwortung bestritten. Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny hingegen überlebte 2020 einen Giftanschlag, wurde aber in zwei politischen Prozessen kaltgestellt. Wie andere Diktatoren hatte Putin nicht nur jegliche Opposition durch blanke Repression erstickt, sondern auch für eine Verlängerung seiner Amtsperiode gesorgt und dafür die Verfassung ändern lassen.
Schauen wir uns an, wie man innerhalb der deutschen Regierung und besonders in der Regierungspartei SPD mit dem Mann aus Moskau umging. 1998 wurde Gerhard Schröder Bundeskanzler und Frank-Walter Steinmeier kurz darauf sein Kanzleramtschef. Schröders Regierungszeit zeichnete sich durch eine große Nähe zur Wirtschaft aus. Für die Außenpolitik hieß dies, auch für Geschäfte mit Autokraten zu werben. Dies betraf die Golfregion ebenso wie die Russische Föderation. Steinmeier wurde mit der Gestaltung des Projekts Nord Stream 1 betraut, einer Ostseepipeline, durch die russisches Gas unter Umgehung der Ukraine nach Deutschland gelangen sollte. 2005 wurde der Bau von Schröder und Wladimir Putin offiziell beschlossen. Auf Steinmeiers Initiative soll es, Markus Wehner von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zufolge, auch zu einer Annäherung von Schröder und Putins Stellvertreter Dmitrij Medwedjew gekommen sein, der damals Aufsichtsratsvorsitzender des Energieunternehmens Gazprom war.[8] 2005 verlor Schröder die Bundestagswahl und wurde zum Aufsichtsratschef des Nord-Stream-Konsortiums berufen. Noch nach der Wahlniederlage, aber vor dem Ende seiner Amtszeit brachte er eine staatliche Bürgschaft in Höhe von einer Milliarde Euro für Bankkredite an Gazprom auf den Weg. Die russische Seite lehnte das Angebot allerdings ab, um Schröders Ruf nicht übermäßig zu beschädigen. 2017 erhielt Schröder zusätzlich einen Aufsichtsratsposten im staatlich gelenkten russischen Energiekonzern Rosneft. Sein Vertrauter und Weggefährte Steinmeier wurde von 2005 bis 2009 sowie von 2013 bis 2017 Bundesaußenminister unter Angela Merkel. Es folgte der Aufbau einer engen persönlichen und politischen Beziehung zwischen Schröder und Putin, die durch Steinmeiers Aktivitäten auch die Russlandpolitik der Bundesrepublik Deutschland prägten. Das Konzept hieß Wandel durch Verflechtung, und bei dessen Umsetzung störten die nach Westen strebenden osteuropäischen Nachbarn. Im Jahr 2005 hatte der damals amtierende Präsident Juschtschenko den Wunsch einer Aufnahme der Ukraine in die EU bekundet, doch dies wurde maßgeblich durch die Intervention Deutschlands abschlägig beschieden.
Im März 2008 trug Steinmeier im Rahmen des Petersburger Dialogs seine Vision einer Annäherung durch Verflechtung als Teil einer Modernisierungspartnerschaft mit der Russischen Föderation vor. Als friedensfördernd sollte sich diese Einbindung nicht erweisen, denn bereits im August 2008 griff Russland militärisch in einen Regionalkonflikt im Südkaukasus ein. Mit dem Argument, das ehemals zur Sowjetunion gehörende Georgien begehe einen Völkermord an den nach Unabhängigkeit strebenden Osseten, ließ Putin seine Armee einmarschieren. Im Ergebnis konnten sich die Provinzen Südossetien und Abchasien aus Georgien lösen und wurden zu einem Stützpunkt der russischen Armee. Georgien selbst strebte nach Westen. Sanktionen gegen die völkerrechtswidrige Annexion lehnte Steinmeier ab. Er wolle die nachbarschaftlichen Beziehungen zu Russland nicht gefährden, hieß es ungeachtet der Tatsache, dass nicht Russland, sondern die osteuropäischen Staaten Deutschlands unmittelbare Nachbarn sind. Als George W. Bush im Jahr 2008 vorschlug, ein formelles Vorbereitungsverfahren für eine zukünftige NATO-Mitgliedschaft Georgiens und der Ukraine zu starten, scheiterte dies an Deutschland und Frankreich.
Spätestens im Jahr 2014 hätten die Illusionen bezüglich der russischen Politik einer realistischen Betrachtung weichen müssen. Putin annektierte die Krim, intervenierte mit Waffenlieferungen und inoffiziellen Truppen im Donbass, und am 14. Juli 2014 schossen russische Separatisten mit russischen Raketen eine malaysische Passagiermaschine ab, die sie für ein ukrainisches Flugzeug hielten. Dabei kamen 298 Passagiere um. Die guten Beziehungen zum Westen, besonders zu Deutschland, blieben bestehen, und Steinmeier plante bereits mit Gazprom die zweite Pipeline Nord Stream 2. Vorsitzender des Aktionärsausschusses wurde Gerhard Schröder. Für Putin war dies auch ein strategischer Schachzug, da die direkte Gasleitung die Ukraine als Transitland für Energielieferungen ausschalten würde. Dies ist vielleicht der eigentliche Skandal der deutschen Politik: Man belohnte die neokolonialen Aggressionen des russischen Präsidenten, indem man ihm ein energiepolitisches Instrument für weitere Kriegsführungen in die Hand gab. Im Ergebnis wurde Deutschland weitgehend von russischen Energielieferungen abhängig. Im Februar 2022 bezog das Land 55 Prozent des Erdgases, 42 Prozent des Rohöls und 50 Prozent der Steinkohle, aber auch eine Reihe anderer dringend benötigter Rohstoffe aus Russland. Dass Putin Energie als Waffe einsetzt, war spätestens seit 2004 bekannt. Die Wahl des demokratischen Präsidenten Juschtschenko in der Ukraine wurde damals mit stark erhöhten Gaspreisen und einem vorübergehenden Stopp der Lieferungen beantwortet. Frank Umbach, Experte für Energiesicherheit, warnte bereits 2006, dass Russland Energie als Mittel der Einschüchterung nutze, doch Steinmeier warf ihm damals Alarmismus vor.[9]
Und so ging es mit dem deutschen Appeasement weiter. Als die NATO 2016 ein großes Manöver im Osten Europas durchführte, kritisierte Steinmeier „lautes Kriegsgeheul und Säbelrasseln“. Die NATO solle keine Vorwände für eine Konfrontation liefern. Vor einem „Säbelrasseln in der Ukraine“ hatte übrigens auch Altkanzler Gerhard Schröder im Januar 2022 angesichts einer Verlegung von NATO-Truppen nach Osteuropa gesprochen und damit eine klassische Täter-Opfer-Umkehr betrieben. Steinmeier begründete die Zurückhaltung gegenüber Russland und den geforderten Verzicht Deutschlands an einer westlichen Wehrhaftigkeit mit der speziellen Verantwortung, die aus dem historischen Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion resultiere. Wer mit der deutschen Schuld argumentiert, sollte allerdings genau hinschauen. Der Historiker Timothy Snyder verweist mit Recht darauf, dass mehr ukrainische als russische Zivilisten im Zweiten Weltkrieg getötet wurden und die Besetzung der Ukraine das vorrangige Ziel Hitlers gewesen sei. Putin habe es allerdings immer verstanden, das Nachdenken über die Verbrechen des Nationalsozialismus in eine bestimmte Bahn zu lenken. Die Schuld gegenüber Russland sei eine geopolitische Ressource des russischen Imperialismus geworden.[10]
Steinmeier und Schröder, den mit Putin eine enge Freundschaft verbindet, waren die wichtigsten Erbauer des deutsch-russischen Netzwerks, das Putins Position stärkte und Deutschland in eine verhängnisvolle Rohstoffabhängigkeit führte. Sie handelten jedoch nicht alleine. Vielmehr war in einflussreichen Kreisen der SPD ein größerer Zirkel aus Politikern und Wirtschaftslobbyisten am Werk, um Russlands neuer imperialistischer Politik flankierend zur Seite zu stehen. Die Unionsparteien, die diesbezügliche Enthüllungen später genüsslich goutierten und diverse Rücktritte forderten, hatten das System allerdings mitgetragen. Bundeskanzlerin Merkel griff ebenso wenig ein wie andere Spitzenpolitiker der CDU. Im Gegenteil. Alexander Kissler legte in einem Artikel der Neuen Zürcher Zeitung den Finger in die Wunde und erwähnte die prorussischen Bekundungen innerhalb der CSU-Spitze. Horst Seehofer beispielsweise habe sich nicht nur gegen Sanktionen, sondern auch für Nord Stream 2 ausgesprochen.[11]
Das Ausblenden offenkundiger Realitäten war für einige politische Akteure sicherlich monetär bestimmt, aber dies ist nur ein Teil der Wahrheit. Nicht jede Person in Entscheidungsfunktionen verdiente an den diversen Deals mit Russland oder schlug anderweitig Profit aus den guten Beziehungen. Es muss davon ausgegangen werden, dass große Teile der Politik sich schlicht selbst überschätzt hatten. Allgemein herrschte die Vorstellung, dass Russland sich dem Westen normativ anpassen werde, wenn es in unzählige wirtschaftliche und gesellschaftliche Netzwerke eingebunden sei. Diese Vorstellung wurde von der zivilgesellschaftlichen Elite des Landes geteilt. Ein Beispiel für diese Haltung ist ein Apell, den 60 bekannte Personen aus Kultur, Medien und Parteien im Dezember 2014 veröffentlichten. Darin werden Russland, die USA und Europa gleichermaßen für die kriegerischen Aggressionen Putins verantwortlich gemacht und die Annexion der Krim als Folge der „für Russland bedrohlich wirkende(n) Ausdehnung des Westens nach Osten“ bezeichnet. Wer Feindbilder aufbaue und mit „einseitigen Schuldzuweisungen“ hantiere, gefährde den Frieden, schrieb man. Der Apell schloss in einer Aufforderung an die Medien, in Zukunft russlandfreundlicher zu berichten.[12] Die Unterzeichner waren keinesfalls totalitär gestimmte Personen, die heimlich mit Putin sympathisierten, sondern einfach nur davon überzeugt, dass eine friedliche Gesinnung ansteckend sein müsse. Dazu kam eine ausgefeilte Skepsis gegenüber den USA, denen man in linksliberalen Kreisen ohnehin gerne Kriegstreiberei vorwirft. Wenn an dieser Stelle aus gutem Grund vor allem von Deutschland die Rede ist, bedeutet dies jedoch nicht, dass die verhängnisvolle Blauäugigkeit spezifisch für unser Land war. Wie der ehemalige Moskau-Korrespondent Markus Wehner in einer Monografie ausführte, hatte Putin in anderen europäischen Staaten ebenfalls hochrangige Freunde und Verteidiger.[13]
Die neuen Falken
Nach dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine und den Bildern eines immer brutaler geführten Krieges, die allabendlich in bürgerliche Wohnzimmer eindrangen, brachen die sorgsam gehegten Gewissheiten im Zeitraffer zusammen. Eine erstaunliche Metamorphose fand in der westlichen Welt statt. Diejenigen, die Soldaten noch vor Kurzem für Mörder hielten und alles Militärische zum Reich der Finsternis zählten, machten sich plötzlich für die Einrichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine und damit für einen faktischen Kriegseintritt der NATO stark. Wer wie die Grünen Waffenlieferungen in Krisengebiete als Ursünde der Kriegstreiberei verurteilt hatte, forderte Panzer für die ukrainische Armee. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskyj, der sich medienwirksam im olivgrünen Hemd inszenierte, wurde von ehemaligen Kriegsdienstverweigerern und Feministinnen gleichermaßen als postmoderner Held gefeiert.
Der Wind hatte sich gedreht, und die gestern noch gültigen Paradigmen hatten sich in ihr Gegenteil verkehrt. Diskussionen über den Richtungswechsel fanden nicht statt. Angetrieben durch die mediale Berichterstattung, die Selenskyj meisterhaft zu beeinflussen verstand, gab es quasi über Nacht ein neues Gutes und ein neues Böses. Die Ausbuchstabierung des Bösen muss uns hier nicht interessieren, denn daran gibt es wenig zu rütteln. Doch wie steht es um die Guten, die Lichtgestalt Selenskyj, den ukrainischen Ex-Botschafter in Deutschland oder die ukrainische Politik der letzten Jahre?
Vor dem Krieg kam die Ukraine hauptsächlich wegen ihrer desolaten Wirtschaft, der Macht der Oligarchen und gelegentlicher Schlägereien im Parlament in die internationalen Medien. Seit 20 Jahren, so die Süddeutsche Zeitung am 23. September 2021 anlässlich eines vernichtenden Berichts des Bundesrechnungshofes, versuche die EU, ihren strategischen Partner Ukraine mit Zuschüssen, Krediten, Beratungs- und Förderprogrammen zu unterstützen. 15 Milliarden seien in den vergangenen fünf Jahren zur Verfügung gestellt worden. Doch noch immer würden Wirtschaftskapitäne, hohe Staatsdiener, Staatsanwälte und Richter den Staat unter sich aufteilen und Milliarden ins Ausland schaffen. Weder komme der Aufbau eines Rechtsstaates noch der Kampf gegen die allgegenwärtige Korruption in Gang.[14] Dies war wohl der wichtigste Grund für die nicht erfolgte Aufnahme in die EU. Dass diese Entscheidung 2022 revidiert wurde und die EU-Spitze in Brüssel einen Fast Track in die Gemeinschaft in Aussicht stellte, ohne auf die Erfüllung zuvor getroffener Standards zu bestehen, war eine populistische Entscheidung. Sie basierte auf einem medial inszenierten Heiligenkult um den ukrainischen Präsidenten und die unerfüllbaren Forderungen, mit der dieser die westlichen Parlamente überschwemmte. Da Europa aus nachvollziehbaren Gründen nicht in einen Krieg gegen Russland ziehen wollte, mussten andere Zeichen gesetzt werden, um die bekundete Solidarität materiell zu unterfüttern. Mit nüchternem Blick musste man verwundert zur Kenntnis nehmen, dass die gesamte westliche Führung sich wider besseres Wissen durch einen moralischen Diskurs zu Aktivitäten hinreißen ließ, die der Vernunft vollkommen widersprechen und zu einem Aufweichen von EU-Standards führen können.
Andrij Melnyk, der ehemalige ukrainische Botschafter in Deutschland, drehte besonders eifrig an der moralischen Schraube und zog gerne Vergleiche mit dem Nationalsozialismus, weil er um die Wirkung der historischen deutschen Schuld wusste. Ernst gemeint waren seine Reden nicht, denn noch 2015 hatte er in München das Grab des Nazi-Kollaborateurs Stephan Bandera besucht und ihn auf Twitter als ukrainischen Helden dargestellt. Bandera hatte als Milizenführer der antisemitischen Organisation Ukrainischer Nationalisten im von Deutschen besetzten Lemberg polizeiliche Aufgaben übernommen. Massenverhaftungen, Massaker an Juden und Exekutionen polnischer Zivilisten werden der Gruppe zur Last gelegt.[15] Wegen seines Kampfes für eine unabhängige Ukraine wird Bandera in der westlichen Ukraine allerdings noch immer verehrt. Präsident Juschtschenko hatte ihn zum Helden erklärt, Janukowytsch revidierte die Entscheidung wieder. Eine ähnliche Ambivalenz lässt sich auch bezüglich anderer ultranationalistischer Organisationen beobachten. Die bekannteste ist das Asow-Regiment, das 2014 in Mariupol gegründet wurde, um gegen prorussische Separatisten zu kämpfen. Ihm werden Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen vorgeworfen. Einer ihrer Gründer ist der Rechtsextremist Andrij Bilezkyj.[16] Der US-Kongress hatte die Unterstützung des Verbandes wegen der Verwendung von Nazi-Symbolen, darunter der Wolfsangel und der schwarzen Sonne, zurückgezogen. Ex-Botschafter Melnyk hingegen äußerte sich mehrfach positiv zu der Gruppe. Mariupol werde mutig vom Asow-Regiment verteidigt, schrieb er am 20. März 2022 auf Twitter und verstieg sich zu der zweifelhaften Aussage: „Jetzt verstehen Sie, warum die Russen sich in die Hosen machen, wenn sie das Wort Asow hören.“[17]
Vielleicht ist es verständlich, dass der Repräsentant eines Landes, das einem russischen Vernichtungskrieg ausgesetzt war, jeden Verteidiger seiner Heimat in gloriosem Licht darstellen wollte, doch dabei bleiben Fragen offen, die irgendwann wieder gestellt werden müssen. Wahr ist, dass das Asow-Regiment mittlerweile in die Nationalgarde integriert wurde und dem Innenministerium untersteht. Was das für die ideologische Ausrichtung der Gruppe bedeutet, ist jedoch nicht bekannt. Mediale Selbstzeugnisse sind zumindest irritierend. Wahr ist zudem, dass die an ausländische Kampfeswillige gerichtete Einladung Selenskyjs, sich am Krieg gegen Russland zu beteiligen, auch Rechtsradikale aus allen Teilen Europas mobilisiert hat. Allerdings steht die Ukraine mit diesem unklaren Verhältnis zum Rechtsextremismus nicht alleine da. Auf der russischen Seite beteiligen sich ebenfalls Faschisten und Ultranationalisten an den Kämpfen.
Selenskyj, der offenbar gut auf den Angriff vorbereitet war, signalisierte in zahlreichen Ansprachen, für die er sich in Parlamentssitzungen aller westlichen Staaten zuschalten ließ, die Ukraine könne den Krieg gegen Russland gewinnen, wenn sie entsprechend mit Waffen ausgerüstet würde. Diese Einschätzung wurde bald nicht nur von Politikern, sondern auch von einem Teil der militärischen Elite der westlichen Welt geteilt. Die Hoffnung, Putin könne den Krieg verlieren, wurde durch einige bemerkenswerte Erfolge der ukrainischen Armee genährt. Für die Europäer war dies ein Dilemma. Da Putin unverhohlen mit einem Atomkrieg drohte, wollte man eine regionale Ausweitung der Kampfhandlungen auf jeden Fall verhindern, gleichzeitig aber nicht schuldig an einer Niederlage der Ukraine werden. Jetzt war guter Rat teuer, und die Europäer zeigten sich uneinig. Während Polen eine Flugverbotszone forderte und zu einem Drehkreuz von Waffentransporten wurde, stellte der ungarische Präsident klar, dass sein Land für Aktionen gegen Russland nicht zur Verfügung stehe. Die deutsche Regierung, allen voran Bundeskanzler Scholz und seine SPD, waren zwiegespalten. Sie sagten militärische Ausrüstung zu, verschleppten dann die Auslieferungen und gerieten schließlich ins Fadenkreuz internationaler Kritik.
Für einen Krieg war man ohnehin schlecht gerüstet, ergab eine Inspektion der Bundeswehr. Alfons Mais, der Inspekteur des Deutschen Heeres, hatte die Bundeswehr nur als bedingt einsatzfähig bezeichnet. Das Heer stehe „mehr oder weniger blank da“, hatte er in den sozialen Netzwerken verlautbart. Das solle zukünftig anders werden, versprach der Bundeskanzler. In einer historischen Rede kündigte er an: „Wir brauchen Flugzeuge, die fliegen, Schiffe, die in See stechen, und Soldatinnen und Soldaten, die für ihre Einsätze optimal ausgerüstet sind.“[18]