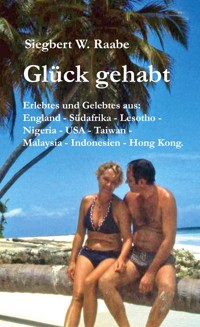
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Suche nach einem erfüllten Leben in der Ferne kann oft zu einem turbulenten Abenteuer werden. Der Autor, einst erfolgreicher Manager mit glänzender Karriereaussicht, sieht sich nun mit der bitteren Realität konfrontiert: der Kampf um das Sorgerecht für seine beiden Söhne. Die bislang so strahlende Hoffnung auf neue Zukunft verdampft schnell, während die Erinnerungen an die immer noch unerreichbare Ex-Geliebte - intelligent und unwiderstehlich anziehend - wie ein Schatten über ihm schwebt. Wir werden Zeugen von Tagen und Nächten voller Leidenschaft, Hingabe und schmerzhafter Abschiede. Doch die Reise führt weiter: Inmitten der Herausforderungen im Südafrika während der Apartheid, wo so vieles anders ist als erwartet, begibt sich der Autor auf eine ungewisse Suche nach einer Kombination aus familiärem- und beruflichem Glück. Ein großartiges, wenn auch abenteuerliches Projekt am Rand der Zivilisation droht zu scheitern. Die nächtliche filmreife Aktion mit schwerbewaffneten Freunden gibt nur einen kleinen Einblick in die irreal afrikanischen Gegensätze von warmherziger Menschlichkeit und nicht begreifbar brutalem Irrsinn. Fast wäre er dauerhaft drüben geblieben im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. In seinem Streben nach kosmopolitischem Leben durchquert er Asien von Indien über China und Hong Kong von Singapur bis Indonesien, doch je mehr er entdeckt, desto klarer wird: Ein einziges Leben reicht nicht aus, um all diese Welten zu erfassen. Und diese Frage bleibt: Was macht einen echten Weltenbürger aus? Gemeinsam mit dem Leser geht er auf die Suche nach Antworten im kaleidoskopischen Universum voller Überraschungen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2026
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Auftakt
BRITANNIEN
England - nicht Malaysia
Unausgesprochene Kumpanei.
Lammbraten mit Minzsauce.
Herrsche, Britannia.
Lingua franca.
Deutschland – Polen (1 : 0)
SÜDAFRIKA
Swimmingpool und Hauspersonal.
Afrikaans oder Englisch
Bringt euch in Sicherheit.
Schildkrötensuppe mit Goldstaub
Freitag der Dreizehnte
Ipi Tombi
Der Hausmeister .
LESOTHO
Literarisches Lesotho.
Glücksspiel und Leprastation.
Mit 70 Frauen 210 Kinder.
Der General.
Die Kühe füttern
Turm gegen König.
Die Schlangen von Penang.
Besuch des demokratischen China.
Erst Bretter klauen, dann beten
Beispielhaft königlich - Ma Mohato.
Ein Rolls Royce und eine Million in bar
NIGERIA
Pferdeäpfel.
Konspirativer Start.
Die erste Leiche.
Verlottert
Winkender Seemann und andere Leichen
Geadelt
Bei Wasser und Brot
Betrug, Diebstahl, Korruption.
Ich liebe Afrika
Seiltanz eines Flugzeuges.
NEW YORK – NEW YORK
Analoge Faszination
Louie's Oyster Bar und 5 Synagogen
Anzug, Krawatte, Westernstiefel
TAIWAN
Der Nationalfeiertag
Beschissen werden wir, aber im Rahmen
Sprichwortkultur und Fēng Shuǐ
Taifune, – Giftschlangen, – Erdbeben.
Chinesisches Weltkulturerbe
Zwischenmenschliches.
Heimweh?
SÜDAFRIKA
Wieder zu Hause
Das Unwort.
Zwanzigjähriger Kurzaufenthalt.
Jiddisch
Die Weihnachtskarte
Putzlappen
Boerewors bei Sonnenuntergang.
Klack, klack, klack – klick, klick, klick
Nkosi Sikelel'i Afrika
TAIWAN
Ein Sarg, ein Finger, ein toter Hund
Die Staranwältin.
INDONESIEN
Die Konsensgesellschaft.
Nelkenduft.
Das Shangri-La.
HMS Bounty
Koloniales, Kasten, Chaos
Ach, das sind ja alles Muslime
HONG KONG
China – Hong Kong keine zwei Systeme.
Firmengründung ohne Finanzamt.
Qingdao und Tsingtau
Separatismus im Keim ersticken
Jinan im Smog
Nicht China, sondern Indonesien.
Gleichberechtigung - Gleichstellung.
Schlussakkord .
AUFTAKT
Der Kampf des Vaters um das Sorgerecht für seine zwei heranwachsenden Söhne, das Opfern der vielversprechenden Karriere, ein vorzeitiges Ende des beruflichen Neustartes in England sowie das Träumen von seiner fernen ehemaligen Geliebten bilden den Auftakt zu dieser außergewöhnlichen Autobiografie. Der Autor erklärt seine Affinität für Britisches, geißelt jedoch zugleich die Überheblichkeit britisch imperialistischer Politik. Er entschließt sich aus Sorge um seine zwei heranwachsenden Söhne für die Rückkehr zur alkohol- und tablettenabhängigen Mutter der Kinder. In schier auswegloser Situation eröffnet sich dem grenzenlosen Optimisten plötzlich eine großartige Perspektive. Trotz früherer Abneigung gegenüber Südafrika sieht er in dem dort angebotenen Traumjob die Chance zur Lösung all seiner Probleme. Er kämpft um das Sorgerecht für seine Söhne, sucht und findet seine verlorengeglaubte Geliebte wieder und wird über Nacht zum Vater von vier Kindern. Mit Optimismus und Unvoreingenommenheit zeichnet der Autor ein ermutigendes Bild der von Apartheid geprägten südafrikanischen Gesellschaft. Seine mit viel Einfühlungsvermögen verbundene Neugier entwickelt sich dabei zu einer innigen Verbindung mit seinem Afrika. Trotz vernichtender Kritik an den Verantwortlichen für die immer noch menschenunwürdigen Verhältnisse in weiten Teilen des Kontinents. Während sich die Unruhen in Südafrika ausweiten, wird der Optimist erneut mit positiv Unerwartetem konfrontiert. Der Pferdebegeisterte erfährt im kleinen Bergkönigreich von Lesotho beruflich wie privat ungeahnte abenteuerliche Höhen und Tiefen. Die Nähe zu König Moshoeshoe II. sowie zu Ihrer Majestät Königin Mamohato, vor allem jedoch die brüderlich schwarzafrikanische Verbundenheit, werden die Bereicherungen aus dieser Zeit. Geschädigt durch geschäftliches Ganoventum bricht ein vormals vielversprechendes Unternehmen zusammen. Doch mit einem gewagten Millionencoup kann der zwischenzeitlich erfahrene Expatriate zwar nicht das Ende der Unternehmung, aber immerhin ein noch größeres Desaster verhindern. Dem tränenreichen Abschied aus diesem „gelobten Land“ folgt eine afrikanische Herkulesaufgabe in Nigeria. Dort erwarten Hunderte afrikanischer Beschäftigter den neuen Chef als ihren Häuptling. Der Autor konfrontiert uns mit den Geißeln dieses Landes, von Betrug und Diebstahl über Korruption bis hin zum Tod durch Steinigung. Dennoch wird der Beweis erbracht, dass am Ende des Tages durch Empathie und optimistische Grundhaltung die warme afrikanische Menschlichkeit erlebbar bleibt. Das US-amerikanische Intermezzo hätte ihn danach beinahe zu einem dauerhaften New Yorker werden lassen. Der Unternehmergeist gefiel sich im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. „Dort drüben“, so schwärmt er über seine amerikanischen Erfahrungen, „befindet sich seit 250 Jahren der Sammelpunkt nicht nur für Verfolgte, sondern besonders für solche, die möglichst ungehindert von Obrigkeiten mit ihren Ideen und Fähigkeiten das erfolgreichste Staatsgebilde erschaffen durften, das je auf diesem Globus existierte“. Deutschland hingegen war nach all den abenteuerlichen Jahren im Ausland nie eine Option, um sesshaft zu werden. Zunächst jedenfalls nicht. Er lernte viel in Asien, wenn auch zu wenig Chinesisch. Der Leser erhält Einblick in die Geheimnisse fernöstlicher Welten mit chinesischen Drachen und Tigern, Fēng Shuǐ und Cheng-yu. Seine Begeisterungsfähigkeit für alles Neue formte ihn schließlich zum Asien-Fan.
Trotzdem konnte er nicht widerstehen, noch einmal den Versuch zu unternehmen, sich dauerhaft in Südafrika niederzulassen. Ausgerechnet dort erfuhr er tiefere Einblicke in das Judentum. Es sollte dann aber doch sein endgültiger Abschied von Afrika werden, über den er schreibt: „Dieses wunderbare Land als dauerhaften Wohnsitz wählen? Dafür gab es damals wie heute, bei stetig wachsender Kriminalität, gar zu viele Bedenken - oder?“ Da kam das Angebot für ein zweites Formosa Abenteuer genau zum richtigen Zeitpunkt. Intensiv genoss er die traditionell geprägte chinesische Welt, wie sie fast nur noch in Taiwan anzutreffen ist. Das Leben in ungewöhnlichen, in exotischen, auch bizarren Welten, so muss man annehmen, erscheint beim Autor der Normalfall zu sein. Sozialisiert in der alten der europäischen Welt hatte sich der Autor zunächst zum Afrika-Enthusiasten entwickelt. New York und die „Neue Welt“ erbrachte neben wertvoller Erfahrungen die Gewissheit in beinahe jeder Weltregion leben und arbeiten zu können. Belohnt wurde diese Flexibilität mit dem ersten Asien-Engagement. Wenn auch nicht mit seinem Wunschland Malaysia. Für Indonesien entwickelte er ein besonderes Faible. Auch, weil dort inzwischen Enkelkinder warteten. Seine politischen, zweifellos subjektiven Analysen und Einlassungen, ob über Indien, Taiwan, die USA oder afrikanische Staaten untermauern das Erlebte aus drei Jahrzehnten. Und in so manch kritischer Lage beinahe gescheitert, wäre da nicht immer Verlass auf die Frau an seiner Seite gewesen. Wir lesen auch etwas über das Golfspiel, sein einziges, offenbar durch nichts zu ersetzendes Hobby.
Hansjörg Kaltenbacher, Fürth im September 2023
功成名就
BRITANNIEN
England, nicht Malaysia
Das Ereignis des Jahres 1974 war die Fußballweltmeisterschaft. Schon deshalb verstanden viele im Familienund Bekanntenkreis nicht, warum ich gerade zu diesem Zeitpunkt Deutschland verlassen wollte. Nicht, dass ich überhaupt kein Interesse hatte. Mal ein Länderspiel anzuschauen, das war schon ganz in Ordnung. Viel mehr aber auch nicht. Schon in der Kindheit und Jugend war mir das „Bolzen“ auf einem kleinen Platz, ganz in der Nähe unseres Hauses, keine geeignete Freizeitbeschäftigung. Vielleicht war ich ein zu schmächtiger Junge, dem das getreten- oder herumgeschubst werden, gar nicht gefiel. Als Alternative unternahm ich zusammen mit dem Nachbarschaftsfreund Klaus einen Abstecher zum Osnabrücker Polizeisportverein. Und zwar zur Boxstaffel. Dort war dann nach wochenlangem Aufbautraining die Angelegenheit im Ring klar geregelt. Kein Treten oder Schubsen von hinten. Wer schneller war und das befolgte, was der Trainer geraten hatte, konnte austeilen, anstatt einstecken zu müssen. Doch leider gab es auch mal eine blutige Nase. Daraufhin erwirkten meine beiden viel älteren Schwestern bei den Eltern ein Ende meiner „vielversprechenden Boxerkarriere“. Ich erinnere mich gern an diese Zeit. Regelrecht mager war ich zwar, aber durchtrainiert wie danach nie wieder.
Für alle an der Fußballweltmeisterschaft Interessierten, aber auch für die meisten eher Gleichgültigen, war der Fußballsommer etwas Besonderes. Im deutsch: deutschen Treffen zwischen den „DDR-Staatsamateuren“ und der Mannschaft von Franz Beckenbauer ergab sich im Hamburger Volksparkstadion zwar eine bundesdeutsche Niederlage von 0: 1 durch das Tor von Jürgen Sparwasser. Doch die Elf um „Kaiser Franz“ kickte sich dann doch noch zum Weltmeister und gewann in München mit einem 2 :1 im Endspiel gegen die Niederlande.
Die äußeren Umstände des Fußballjahres entwickelten sich sodann für mich als eher politisch interessiertem Normalbürger vornehmlich in eine Richtung.
In England zu leben und zu arbeiten war mein Ziel und somit war auch meine Interessenlage entsprechend fokussiert. England hatte sich auf den Weg nach Europa gemacht. Und der britische Premierministers Edward Heath, als einer der wenigen überzeugten Europäer aus der Riege britischer Politiker warb leidenschaftlich für Britanniens Rolle in Europa.
Diese europäische Stimmung passte recht gut zu meiner bevorstehenden beruflichen Aufgabe und dem damit verbundenen Umzug nach England. Als 1957 die Römischen Verträge geschlossen wurden, stand ein Mitwirken der Briten nicht zur Debatte. Es war das Europa der Sechs. Für Britannien war die enge Verbindung zum ehemaligen Weltreich, zum „Commonwealth“, deutlich wichtiger. Später wollte man dazugehören, doch Präsident de Gaulle hielt die Briten nicht für europatauglich. Zehn Jahre später durfte das Vereinigte Königreich endlich mitmachen. Und prompt fand Premierministerin Margaret Thatcher ein paar Haare in der Suppe. Und heute frage ich mich, was nach dem Brexit kommt. Wie lange es dauern mag, bis eine neue Bewegung, bis eine jüngere Generation für ein Zurück nach Europa, durch die Straßen von London ziehen wird?
Im Gegensatz zu Deutschland, Frankreich oder Italien bedarf es beim
„Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland“ tatsächlich immer wieder dieser erklärungsbedürftigen Formulierung. Zu Zeiten des britischen Weltreiches war mit „Britannien“ alles eindeutig beschrieben. Trotz seines komplizierten, weltumspannenden Herrschaftsbereiches. Geografisch spricht man auch weiterhin gern von „Den Britischen Inseln“. Dieser Begriff muss sich ebenfalls herübergerettet haben, aus einer Zeit, als Irland noch zum „Vereinigten Königreich“ gehörte. Und das ist seit nunmehr einhundert Jahren nicht mehr der Fall. Und die Kanalinseln zählen zwar politisch, jedoch nicht geografisch zum „United Kingdom“. Um dieses Britannien von heute verstehen zu können, sollte man sich, wenn auch nicht gerade wissenschaftlich, gleichwohl etwas intensiver mit der Vergangenheit des ehemaligen Imperiums auseinandersetzen. Einschließlich all der Absonderlichkeiten dieses Dinosauriers der Weltgeschichte. Mit wenigen Worten ist weder die Bedeutung noch die Eigentümlichkeit des „Britischen“ zu beschreiben. Der seinerzeitige EU-Beitritt bedeutete für mich zunächst nicht allzu viel. Interesse an politischen Entwicklungen galt schon in unserem Elternhaus als selbstverständlich. Doch meine persönlichen Belange ließen zu diesem Zeitpunkt nicht allzu viel Raum für politische Grundsatzüberlegungen.
Mein Entschluss, dort auf der anderen Seite des Kanals meine neue „Wahlheimat“ zu finden, hätte gewiss nicht gleich einen Engländer aus mir gemacht. Dennoch muss ich zugeben, viel britisch Absonderliches genossen zu haben. Trotz Stirnrunzeln auch Schmunzeln über Skurriles, Nettes und Verrücktes. Und anerkennend muss ich, aus der nicht unerheblichen Distanz von einigen Jahrzehnten bestätigen, dass man Britannien um vieles beneiden kann. Bei einer Erkundungsreise durch die Geschichte Britanniens reihen sich weltbewegende Ereignisse aneinander, wie die bunten Perlen einer Kette. Noch existierte die Wortschöpfung “Brexit“ nicht und Premierministerinnen wie die gestrenge Margaret Thatcher oder die unsichere Theresa May waren in der bürgerlichen britischen Gesellschaft nur schwer vorstellbar. Über die tatsächlich etwas hochnäsig klingenden Formulierungen des Mr. Heath amüsierte ich mich köstlich. Wie die von Kontinentaleuropäern als überheblich bis arrogant empfundene Bezeichnung „Der Rest der Welt“ für alles Nichtbritische. Oder „Overseas“ für alles, was geografisch jenseits der Britischen Inseln liegt. Es war jener, wie ich in späteren Jahren immer wieder lernen musste, merkwürdig verbreitete britische Dünkel. Wie ein permanentes Verschnupft sein, das sich offenbar bis heute erhalten hat. Selbst die kaum noch zu überbietende Impertinenz eines Nigel Farage zusammen mit seiner UKIP-Partei lag jenseits des Vorstellbaren. Offensichtlich scheint derart britische Hochnäsigkeit bereits in die übernächste Generation eingesickert zu sein. Ein uns nahestehender, junger, gebildeter Hong-Kong-Chinese war kürzlich zu Gast bei einer typisch englischen Familie nahe London. Deren achtjähriger Sohn wunderte sich ein wenig über den Besuch aus der ehemaligen Kronkolonie und unterstrich sein Allgemeinwissen mit dem Begrüßungskommentar: “Ah from Hong Kong? O yes I know, we used to rule you “. (Aha, aus Hong Kong? O ja, ich weiß, wir haben euch mal regiert). Der Mann aus Hong Kong war darüber keineswegs amüsiert. Bedeutsam ist dabei, dass bei dieser Bemerkung der Begriff „to rule you“ mit „beherrschen“ verstanden werden muss.
Im Laufe der Jahre sind dann viele ähnliche Erlebnisse in vormals oder ebenfalls heute noch britisch geprägten Regionen der Welt hinzugekommen. Da gab es die Ladys’ Bars in Südafrika, wo Alkohol auch an Damen ausgeschenkt werden durfte, während dem weiblichen Geschlecht der Zutritt zu normalen Bars oder Kneipen verwehrt war. Denn in der generell gepflegteren Atmosphäre einer Ladys’ Bar oder auch Hotelhalle waren Damen eben nicht dem vulgären Ton einer „Männergesellschaft“ ausgesetzt. Oder wo ein ausgezogener Herrenstrumpf als Krawattenersatz um den Hemdkragen geschlungen, notfalls ausreichte, um der Vorschrift „Collar & Tye“ zu entsprechen. Von schrullig über „zum Totlachen“ bis abstoßend reicht die Palette bleibender Eindrücke. Jahre später musste ich überrascht feststellen, einiges dieser britischen Borniertheit angenommen zu haben. „The British Empire“ war für mich allgegenwärtig. Wo immer ich zusammen mit meiner Frau, der Familie oder auch allein lernte, lebte und arbeitete, Britannien war überall. Ob in Südafrika, in westoder ostafrikanischen Einflussbereichen britischen Lebens, ebenso wie in Malaysia, Indien, Hong Kong oder gar „Down Under“. Doch tonangebend wirkt das Vereinigte Königreich auf mich heute nicht mehr. Die USA und China sind die Triebkräfte unserer Zeit. Doch die weltweite Hinterlassenschaft ehemals britischen Einflusses in Summe eher positiv, erscheint schon bei oberflächlicher Betrachtung noch immer allgegenwärtig und weltumspannend. Während meiner früheren geschäftlichen Englandreisen hatte ich mich auf der Insel stets wohlgefühlt. Obwohl die unangenehmen Vorgaben dieser Reisen durchweg darin bestanden, die Reklamationen einiger britischer Großkunden an unseren Produkten der Unterhaltungselektronik zu klären sowie damit verbundene Bedenken oder gar Forderungen auszuräumen. Summa summarum ergaben sich jedoch nur positive Ergebnisse dieser Missionen.
Doch für die persönliche Zufriedenheit fehlte etwas. Für mein Englisch wünschte ich mir eine ähnliche Ausdrucksfähigkeit, mich gleichwertig eloquent „verkaufen zu können“ wie im Deutschen. Die Lässigkeit, bei Konversationen, bei Streitgesprächen originelle eigene Standpunkte, pfiffige, auch zugespitzte Bemerkungen beitragen zu können, daran fehlte es. Eine Benachteiligung habe ich aufgrund meiner damals noch bescheidenen Fähigkeiten jedoch nie erfahren. Nicht einmal unterschwellige Reserviertheit habe ich wahrgenommen. Als britisch vornehme Zurückhaltung oder einfach als englische Höflichkeit würde ich diese Haltung auch nach langjähriger Erfahrung werten. Die Britischen Inseln sind im Laufe der letzten Jahrzehnte sehr viel näher an das kontinentale Europa und zugleich näher an den „Rest der Welt“ herangerückt. Allein die Metropolregion London bietet heute mit sechs Flughäfen eine nicht zu übertreffende, weitblickende Infrastruktur. Ein Paradebeispiel bester britischer Internationalität. Daher wurde auch besonders in England die Schließung des bewährten, legendären Berliner Stadtflughafens Tempelhof mit Kopfschütteln und herablassenden Bemerkungen über deutsche Provinzialität und Kurzsichtigkeit bedacht. Da wurde ohne Not ein symbolischer Begriff deutscher Vereinigungsgeschichte geopfert.
Von britischer Internationalität, dem kolonialen Erbe, der Allgegenwart des Commonwealth und der damit verbundenen Weltoffenheit wird der Englandbesucher ohnehin bereits am Flughafen bestürmt. Schon in den Siebzigern kam es mir vor, als ob jeder zweite, möglicherweise sogar neunzig Prozent aller am Heathrow Airport Beschäftigten indischer, pakistanischer oder afrikanischer Herkunft waren. Daher empfand ich diese Flughafen-Atmosphäre auch als so international und exotisch. Denn schließlich handelte sich bei den Herkunftsländern der in Heathrow Arbeitenden um Regionen, die ich für meine Firma noch nicht bereist hatte. Und ganz bewusst nenne ich das Bremer Unternehmen „meine Firma“. Denn in jenen Zeiten waren besonders bei mir die emotionale Bindung an das Unternehmen sowie die persönliche Identifikation mit der Marke, mit dem Firmennamen, außerordentlich stark. Fast alle Auslandsvertretungen unserer Weltmarke hatte ich während der letzten zehn Jahre besucht. Immer ging es dabei um die Klärung technischer Probleme und damit verbundener Kosten. In jungen Jahren bereits mit weitreichenden Vollmachten ausgestattet, hatte ich von vielen beneidet, eine ganz hervorragende Position im Unternehmen. Da fragte sich manch einer und zum wiederholten Male ich mich selbst, warum aussteigen, warum eine solche Karriere aufgeben und wofür? Für ein Englandabenteuer? War es unbedacht, wie einige damals glaubten urteilen zu müssen? Keineswegs. War es eine Fehleinschätzung? Eigentlich auch nicht. Und welche folgenschweren Konsequenzen sich aus nie befürchteten, auch nie erträumten Entwicklungen ergeben sollten, lag ohnehin im Ungewissen. In meiner beruflichen Umgebung begegnete mir vorwiegend Unverständnis. Für meinen Firmenbereich war ich erst kürzlich mit einem neuen Chef und somit organisatorisch mit einer zusätzlichen Management-Ebene konfrontiert worden. Eine neue Ebene zwischen den „Leitenden“ und der Inhaberfamilie. Selbst dieser neue Mann, der meinen Werdegang gar nicht mitverfolgt hatte, konnte es nicht fassen. Ich wollte meine von vielen als unüberlegt angesehene Entscheidung möglichst revidiert sehen. „Wie können Sie das, woran ihr ganzes Herzblut hängt, einfach aufgeben wollen“, fragte er mich kopfschüttelnd. Ich allerdings hielt es für hilfreich, nach der Scheidung eine größere geografische Distanz zu meinen bisherigen Lebensumständen herzustellen. Das war meine Motivation. Für Auslandseinsätze von Führungskräften galt England grundsätzlich als bevorzugter Karrierebaustein. Obwohl ich sehr viel lieber nach Malaysia gegangen wäre. Britannien war ok, eine gute zweite Wahl, könnte man sagen. Wenn auch nicht mein Sehnsuchtsland. Die Inhaber unserer Firma hatten wenige Monate zuvor einen sehr ansehnlichen Fertigungsbetrieb auf Penang, im Norden von Malaysia, aufbauen lassen. Auch Singapur lockte zu dieser Zeit als lukrativer Standort für alternative Fertigungseinrichtungen auf dem Gebiet der Elektronik. Allerdings nicht immer mit dem erhofften Ergebnis. Das zeigte sich am Beispiel der technologisch erstklassigen Fertigungseinrichtungen zur Produktion der legendären Kleinbildkamera „Rollei 35“. Wie sich leider sehr bald herausstellte eine Fehlinvestition. Zu aufwendig, zu spät, somit nicht marktgerecht, um nur wenige Gründe für das Scheitern zu nennen. „Unsere“ unweit des berühmten Schlangentempels gelegene Elektronikfertigung nahm Fahrt auf und kam zumindest vorerst sehr gut voran. Das Unternehmen war den lokalen Verhältnissen entsprechend außerordentlich gut angepasst. Im Vorfeld der Firmengründung konnte ich dem für dieses Vorhaben vorgesehenen Manager umfangreiche technische sowie logistische Unterstützung zukommen lassen. Und zwar einerseits durch Zugriff auf meinen umfangreichen Mitarbeiterstab, andererseits aufgrund meines intensiven Engagements für gerade dieses Projekt. Nicht zuletzt, weil ich nur zu gern selbst vor Ort auf der Insel Penang am Aufbau dieser Unternehmung hätte mitwirken wollen. Einsehen musste ich allerdings, dass man dort für mein damaliges Gehalt zwei bis drei gut ausgebildete lokale Ingenieure einstellen konnte. Gleichwohl spielte das südostasiatische Land in späteren Jahren nicht nur für mich persönlich eine magische Rolle. Doch asiatisch Exotisches wurde zunächst von ungemütlichem norddeutschen Februarwetter überdeckt, als ich mich zum Britannien-Abenteuer in Bremerhaven verabschiedete. Die schneeweiße Englandfähre “Prins Oberon“, ein beinahe nagelneues 8.000 BRT-Schiff, sollte mich zu meiner ersten kleinen Seereise bringen. Mehr als 1.000 Passagiere und über 300 Pkw wurden im Zweitagerhythmus von Bremerhaven nach Harwich befördert. Die Überfahrt dauerte 16 Stunden. Nachmittags ab Bremerhaven, morgens früh war Ankunft in England. Das Schwesterschiff, die „Prins Hamlet“, befuhr am jeweils anderen Tag die Strecke Hamburg-Harwich. Mein deutsches „Linkslenker“ Auto hatte ich bereits geparkt und genoss, an der Reling lehnend, diesen Augenblick des Aufbruchs in eine neue Welt. Die miesen Wetteraussichten für die Überfahrt, wie für die Ankunft in England, kümmerten mich nicht. Mehr als ausreichend Zeit stand nun zur Verfügung, um über die zukünftige berufliche Aufgabe im „United Kingdom“, besonders aber über die ganz persönlichen Konsequenzen dieses noch nicht einschätzbaren Lebensabschnittes nachzudenken.
Mit selbstverordneter Gelassenheit sowie der von meiner Mutter übernommenen Maxime: „Es wird schon alles gut werden“, konnte ich zumindest zeitweise das Suchen nach Problemlösungen vertagen. Mit einer Ausnahme: der Sorge um meine beiden Söhne. Die Jungs zurückzulassen unter den immer problematischer werdenden Verhältnissen mit der alkohol- und tablettenabhängigen Mutter, lastete schwer auf mir. Aber England sollte ein Neuanfang werden. So schnell wie möglich wollte ich die beiden aus diesem Dorf bei Bremen herausholen, für einen gemeinsamen neuen Lebensabschnitt. Den Papa zu erreichen, um Hilfe zu bitten, würde für die Elf- und Zwölfjährigen damals äußerst schwierig sein. Noch gab es kein Internet, kein Skype. Länderübergreifend zu Telefonieren funktionierte zwar, gestaltete sich aber im Vergleich zu heute recht aufwendig. Wie sollten sie die Zeit überstehen können, bis es Papa gelingen würde, sie nachzuholen? Außerdem musste dringend ein Weg gefunden werden, die Sorgerechtsfrage in unserem Sinn zu regeln. Wohl wissend, dass ungeachtet widrigster Umstände in solchen Fällen der Kampf fast immer zugunsten der Mutter ausging. Die Ungewissheit über die Lage, in der sich die beiden befanden, würde ich nicht lange ertragen können. Daher musste auf diese Frage schnellstens eine Antwort gefunden werden.
Unausgesprochene Kumpanei
Etwas kitschig, vielleicht, doch durchaus passend erklang aus den Deckslautsprechern das “Lied La Paloma“, dieser in Hunderten von Versionen immer wieder neu arrangierte Stimmungsmacher. Als Aufmunterung wirkte dieses Lied von der weißen Taube nicht. So erinnere ich mich jedenfalls sehr deutlich. Doch ein wenig Melancholie durfte bei einer solchen Reise auch erlaubt sein. Mein Gepäck umfasste neben der väterlichen Sorge um die Söhne auch eine gehörige Portion Frust. Denn die Frau, mit der ich so gern einen Neuanfang begonnen hätte, schien vorerst unerreichbar. Völlig aufgegeben hatte ich Pläne für ein gemeinsames Leben keineswegs. Allerdings glaubte ich, mich mit jeder Seemeile weiter und weiter von ihr zu entfernen. Sieben Jahre waren vergangen, seit wir uns zum ersten Mal begegnet waren. Nur heimlich hatte ich sie zunächst beobachtet. Unvergessen ihr warmherziges Lächeln. Der Blick: einmal überlegen und selbstbewusst, dann wieder besitzergreifend und verheißungsvoll. Auch eine nicht beherrschbare Gefahr glaubte ich damals zu erahnen, wie in einen tropischen Wirbelstrom hineinzugeraten. Einer Frau dieser Klasse war ich vorher noch nie begegnet. Sie mit hübsch zu beschreiben wäre völlig unzutreffend. Natürlich war sie bildschön, eine Traumfrau. Natürlich konnte man überwältigt sein von ihrer Ausstrahlung. Allein ihr Äußeres, ihre Figur, ihr geheimnisvolles Lächeln, ihre Bewegungen, alles zusammen eine berauschende Symphonie. Doch da war noch mehr. Es war die Persönlichkeit, die beim Betreten eines Raumes, ohne etwas zu sagen, die anwesenden Männer sprachlos und die Frauen eifersüchtig machte. Ebenso entwaffnend wirkten die wenigen, hervorragend platzierten, klugen Worte. Schönen Frauen - nun ja - begegnete man immer wieder. Aber schöne und zugleich kluge, weibliche Persönlichkeiten? Wie heißt es im Englischen so richtig und klangvoll: „Just once in a lifetime“. Doch leider, so war mir sehr schnell klar, war ich einer Frau begegnet, die mir unerreichbar schien. Also möglichst sofort verdrängen, was da an Vorstellungen aufkeimte. Ein noch unerfahrener Mann war ich mit meinen gerade mal 26 Jahren. Trotz früher Heirat und glücklicher Vater zweier Söhne. Doch schon das erste zaghafte Wortgeplänkel schien bei mir eine merkwürdig nachhaltige Wirkung hinterlassen zu haben. Bei einer kurzen Autofahrt zu dritt verspürte meine damalige Frau jedenfalls bereits Grund für ein leicht eifersüchtiges Verhalten. So ergaben sich im Mai 1967 während der ersten Hannover Messe, an der ich teilnahm, keinerlei Vertraulichkeiten. Eingestehen musste ich mir aber, dass sich während der Messetage eine innere Unruhe erzeugende Spannung aufgebaut hatte. Während der besagten kurzen Autofahrt fühlte ich mich dann auch wie der Mitverschwörer einer heimlichen, unausgesprochenen Kumpanei. In den Jahren danach begegneten wir uns auf der Hannover Messe nur im Vorübergehen. Für mehr als verstohlene, schmachtende Blicke reichte mein Mut nicht aus. Ihr Einfluss, ihr Eindruck auf mich musste sich jedoch im Laufe der Zeit zu einem permanenten, buchstäblich chronischen Verlangen nach Nähe zu ihr entwickelt haben. Unsere bisherige, von beiden Seiten nur mit viel Disziplin erreichte Zurückhaltung steuerte offenbar zwangsläufig in Richtung eines noch nicht klar erkennbaren Zieles. Während der Funkausstellung 1970 in Düsseldorf blieb es dann auch nicht bei einem ersten zaghaften Kuss. Wie im Rausch vergingen die Tage. Abends besuchte man gemeinsam mit Kollegen die Jazzkneipen. Anmerken ließen wir uns jedoch nichts. Und am nächsten Morgen fieberte ich danach, sie wieder in die Arme schließen zu können. Irgendwann begleitete ich sie zum Schuhkauf. Eine simple Angelegenheit, die jedoch Alltagsvertrautheit bedeutete. So als wenn bereits eine feste Verbindung zwischen uns bestehen würde. Als verschmustes Paar, Arm in Arm, schlenderten wir eines Abends durch die Altstadt und begegneten meinem soldatischen Mitarbeiter Heinz. Der ehemalige Oberfeldwebel blieb stehen, knallte die Hacken zusammen und grüßte freudig:
„Guten Abend, Frau Raabe, guten Abend Chef.“
Bis zum nächsten Tag ließ ich ihn in dem Glauben, dass es wohl Frau Raabe gewesen sei. Nein, es musste noch viel geschehen, bis wir endgültig ein Paar werden sollten. Wir telefonierten häufig während der Geschäftszeit. Erst die nächste Funkausstellung 1971 in Berlin brachte die folgenschwerste Vorentscheidung meines unseres Lebens.
Die Mauer stand noch immer drohend inmitten der deutschen Hauptstadt. Das Hotel Berlin war für alle von unserer Firma zur Messe Entsandten für 10 Tage unser zu Hause. „Sie“, deren Faszination ich zu erliegen drohte, wohnte im Zimmer 403. Mein Zimmer lag schräg gegenüber. Während dieser Tage waren zwei Menschen ständig damit beschäftigt, nach Gelegenheiten zu suchen, sich möglichst nah zu sein, während der Rest der Welt ausgesperrt blieb. An jenem denkwürdigen Abend saßen wir wie sonst zunächst in der Bar, um wie üblich Irish Coffee zu trinken und eine Kleinigkeit zu essen. Eingehüllt wie in einen imaginären Kokon schwebten die zwei Verliebten dem Ziel ihrer Träume entgegen. Völlig losgelöst waren wir ohne Gedanken an unser jeweiliges Zuhause, noch ohne die geringsten gemeinsamen Pläne. Wir erfreuten uns daran, zur gleichen Zeit Hermann Hesse gelesen zu haben. Narziss und Goldmund fanden wir wunderbar. Damals gab es im Hotel nicht nur einen Barkeeper mit vollendeter Fähigkeit zu gepflegter Konversation, sondern auch einen feinsinnigen Klavierspieler. Ich bat ihn, Pour Elise zu spielen, für die Traumfrau an meiner Seite. Dann, an ihre Worte erinnere ich mich wie heute:
„Essen wir noch etwas oder gehen wir gleich nach oben?“ Wir gingen sofort. Wir badeten gemeinsam. Wir liebten uns. Aber wir ahnten nicht, worauf wir uns eingelassen hatten. Während jeder der nachfolgenden Nächte in Berlin erlebten wir die Fortsetzung unseres nach den Sternen greifenden Traumes. Gleichwohl unfähig, über Konsequenzen für unser weiteres Leben zu entscheiden. Einer Illusion glich dieser wunderbare, warme Sommer fern aller Realitäten.
Das weitläufige Messegelände unter dem Funkturm eignete sich ideal, um hin und wieder über die blumenreiche Anlage zu schlendern. Wir achteten noch sehr darauf, trotz der vielen Menschen nicht doch gesehen und unverhofft von einem der Kollegen „überrascht“ zu werden. Nur wenige wussten oder ahnten, was mit uns geschehen war. Die übliche Clique ließ den einen oder anderen warmen Sommerabend bei einem Drink unweit des Hotels im Freien ausklingen. Ich schloss mich vorsorglich aus. Vermutlich hätten alle nur zu leicht bemerkt, dass da ein Ereignis von größerer Tragweite stattfand. Ich ging ins Hotel, legte mich ins Bett und wartete auf das leise Klopfen. Diese Hotelnächte sollten bis an unser Lebensende so manche düstere Stunde erhellen. Die zehntägige Messe rückte viel zu schnell dem Ende entgegen. Wie sollte es mit uns weitergehen? Beide lebten wir in chaotischen Bindungen. Jeder mit zwei Kindern und in finanziellen Verhältnissen, die es als undenkbar erscheinen ließen, im Hauruckverfahren einen Ausweg zu konstruieren. Das Druckmittel Kinder war für den jeweils anderen Partner die wirksame, scharfe Waffe. Beide waren wir uns darüber klar, dass sowohl meine Damalige als auch der Mann meiner Freundin alles versuchen würden, eine offizielle Trennung zu verhindern. Zudem galt bei einer eventuellen Scheidung noch das Schuldprinzip. Die Aussichten auf eine gemeinsame Zukunft schienen schlecht. Sie war mit dem Flugzeug von Hannover nach Berlin gekommen und musste auch auf diesem Weg wieder zurück. So begleitete ich sie nach Tempelhof, wir nahmen Abschied. Es gab Tränen der Verzweiflung und der Aussichtslosigkeit. Ganz aus den Augen konnten wir uns nach alldem, was geschehen war, nicht verlieren. Die Hoffnung stirbt bekanntlich so schnell nicht. Wenn auch mit großen Abständen, trafen wir uns und telefonierten oft. Oder wir ließen an bestimmten Tagen das Telefon genau dreimal klingeln, legten sofort wieder auf und wussten, dass wir wenigstens in Gedanken vereint waren. Recht kümmerlich waren diese kleinen Zeichen der Verbundenheit. Kaum vorstellbar, wie sich alles mit der Nutzung von Mobiltelefonen entwickelt hätte. Aber wer weiß? Unser Leben hätte eine völlig andere Wendung nehmen können. Wir trafen uns in einem Hotel in Hoya, einmal sogar spät abends in ihrer Wohnung. Oder am Langenhagener Flughafen, wenn ich für meine Firma eine der vielen Reisen unternahm. Das Erinnern an die Stunde, als wir eng umschlungen durch die Herrenhäuser Gärten schlenderten, wird wohl nie verblassen. An jenem Tag befand ich mich, befanden wir uns beide in einer Hochstimmung, die zu einem Kurzschluss hätte führen können. Ich hob sie hoch, schleuderte sie übermütig herum, küsste sie endlos. Sofort würde sich unser Leben auf den Kopf stellen, warnte ich. Nur ein einziges, das zündende Wort fehlte noch. Unerträglich war uns die Vorstellung, weiterhin getrennt zu sein. Ein anderes Mal mieteten wir uns ein Zimmer in einem miesen Gasthof an der B 65 gleich hinter Hannover. Ich bezahlte im Voraus. Nach ein paar Stunden schlichen wir uns wie Diebe aus dem Hotel. Den Zimmerschlüssel ließ ich vorsichtig und nahezu geräuschlos in den Briefkasten fallen. Nein, nicht diese, unsere Liebe war der Grund für die zerrütteten Verhältnisse in meiner Familie oder der ebenso dramatischen Situation bei ihr. In diesem Fall spielten Alkohol sowie die bereits als Abhängigkeit zu bezeichnende Tablettenproblematik die entscheidende Rolle. Einem solchen Drama, einer Persönlichkeitsveränderung gleichkommend, nahezu hilflos gegenüberzustehen, muss vor allem für meine beiden Heranwachsenden unerträglich gewesen sein. Während eines Spanienurlaubs wusste ich aus lauter Fassungslosigkeit nicht, worüber ich mehr entsetzt sein sollte. Über den Jähzorn-Ausbruch oder wegen des höchst peinlichen, dramatisch unschicklichen Auftretens eines Abends in der Hotelhalle. Ich schämte mich für sie so sehr, dass ich nur noch das Weite suchen wollte. Eigentlich hatte dieser Auftritt das Ende sein sollen. Während sie schlief, packte ich unsere Sachen, bezahlte die Rechnung, übergab der Concierge mehr als ausreichend Geld für die Zurückbleibende, damit sie nach Deutschland zurückfliegen konnte. Die Söhne musste ich nicht überreden, sie wollten nur schnell weg. Zum Entsetzen der zwei kehrte ich nach ein paar Stunden um und fuhr wieder zurück. Sie in ihrem Elend allein zu lassen schien unerträglich. Sie tat mir so unendlich leid. Besonders für den Älteren war meine Entscheidung eine riesengroße Enttäuschung. Dabei wollten wir nachts nur endlich wieder ruhig schlafen können. Angst hatten wir. Uns graute vor weiteren Nächten, in denen unsere Hausärztin kommen musste. Wenn auch 20 mg Valium intravenös sie nicht zur Ruhe brachten.
Vor Jahren schon hatte ich unsere Probleme einem Scheidungsanwalt geschildert. Meine damaligen Bedenken, bei einer Trennung die Söhne nicht allein zurücklassen zu können, ließ er nicht gelten. Stattdessen prophezeite er, dass ich eher früher als später doch die Scheidung einreichen würde. Endlich nach einem gemeinsamen Bulgarienurlaub, konnte ich mich zu einer Entscheidung durchringen. Ich befürchtete zunächst, dass die Schuldfrage für die spätere Sorgerechtsentscheidung von Bedeutung sein könnte. Letztendlich erfolgte die Scheidung nach hervorragender anwaltlicher Beratung, „in beiderseitigem Einvernehmen“. Aus dem Haus bei Bremen war ich schon kurz nach dem Bulgarienurlaub ausgezogen und hatte mir bis zu meiner Abreise nach England ein Mini-Apartment gemietet.
Lammbraten mit Minzsauce
Betont konservativ gekleidet, britischem Understatement entsprechend mit Tweed Jackett, Budapester Schuhen, dezentem Oberhemd, unauffälliger Krawatte sowie bestens gelaunt startete ich in meinem sehr deutschen, natürlich linksgesteuerten Fahrzeug auf der „falschen Straßenseite“ von Harwich im Osten der Insel quer durch London in Richtung Südwesten. Da mir kein Beifahrer das Kartenlesen erleichtern konnte oder sonst irgendwie hilfreich gewesen wäre, hatte ich mich schließlich unentwirrbar verfahren. Doch für ein paar englische Pfund lotste mich ein verständnisvoller Taxifahrer durch die Straßen der britischen Metropole, bis ich sicher meinen Weg zur M 4 fand, um dann weiter an Windsor und Ascot vorbei nach Camberley in der Grafschaft Surrey zu steuern. Während meiner bisherigen Englandreisen war ich nie selbst Auto gefahren. Auf der „falschen Straßenseite“ mit dem deutschen Linkslenker kam ich trotzdem überraschend gut zurecht. Ich fühlte mich bald wie zu Hause in der Grafschaft Surrey, einer der schönsten Regionen Englands, einer Wohlfühl-Umgebung, in der man sesshaft werden konnte. Trotz immer wieder aufkeimender Ängste darüber, dass sich die zwei bedauernswerten, mehr oder weniger hilflosen jungen Menschen weiterhin in der Obhut ihrer offenbar weiterhin viel zu viel Alkohol- und Tabletten konsumierenden Mutter befanden. Glücklicherweise gab es da noch eine Oma im Haus. Sie litt entsetzlich unter den Verhältnissen. Wie lange würde das wohl durchzuhalten sein? Das Frimley Hall Hotel in Camberley, ein für diese Gegend typisch viktorianischer Landsitz, nur wenige Kilometer von der Rennbahn Ascot entfernt, empfand ich zumindest als mittelfristige Unterkunft schon ein wenig luxuriös. Nicht zu verwechseln mit der behäbigen, plüschigen Atmosphäre südenglischer Altersresidenzen für Offizierswitwen und Ex-Kolonial-Offizielle. Derartige Herbergen lernte ich während meiner vielen Reisen auf der Insel kennen und auch schätzen. Diese als Monumente aus vergangenen Zeiten anmutenden Häuser sind heute noch besonders in den Küstenorten wie Bath, Weymouth oder Torquay zu finden. Hier in der Nähe zu London, Windsor und Ascot, in der als bevorzugte Wohngegend immer teurer werdenden Grafschaft Surrey, erfreute man sich einer Lebensqualität von gepflegtem englischem Understatement für die „British Upper Class“. Ganz besonderen Exemplaren dieser Gesellschaft stand ich nun eines Morgens im Büro der neu gegründeten Vertriebsgesellschaft für Unterhaltungselektronik gegenüber. Überproportional vertreten waren die Herren Direktoren. Zwei der insgesamt vier, vermutlich bestens dotierten Chefs, kannte ich bereits aus unseren Vertragsverhandlungen bei deren Besuch in Bremen. Der Oberchef und „Managing Director“, Michael, schottischer Abstammung, in Belfast Nordirland geboren, Sohn eines hohen Marineoffiziers, quirlig, immer zu Scherzen aufgelegt, lebte mit seiner Familie in Camberley, unweit meines Hotels. Der Zweite im „Board of Directors“, der Finanzchef, Inbegriff britischer Upperclass, stets mit Oberhemd, Klub-Krawatte sowie dunklem Blazer gekleidet, amüsierte mich durch seine vornehm, sehr nasal klingende Stimme, eben „very British“. Er sprach das typische „Queens-English“. Dieser Herr war dann auch mal für einige Wochen in Sachen privates Business in Afrika unterwegs. Seine Familie war in Malawi an einer Teeplantage beteiligt, die von seinem Bruder geleitet wurde. Obwohl er bei uns als Financial Director arbeitete, hatte Peter irgendwann die Aufgabe übernommen, dort im südlichen Afrika die Finanzen der aus Kolonialzeiten im Familienbesitz befindlichen Unternehmung zu überwachen. Direktor Nummer drei erzählte mir während einer Dinner-Einladung, im Familienkreis von seinem Onkel, der lange Zeit für „Die Krone“ in Indien tätig gewesen sei. Mein Eindruck: Irgendwie schien fast jede britische Familie irgendeine Verbindung zum ehemaligen Empire und somit zur Kolonialzeit zu haben. Das Abendessen im Familienkreis, in vorzüglicher Willkommensatmosphäre, gestaltete sich ebenfalls als eine etwas absonderliche Bereicherung meiner Englanderfahrungen. Denn es gab Lammbraten mit Minzsauce! Was mich an den Witz erinnerte, bei dem es heißt, dass Europas Untergang bevorstehen würde, wenn: „Die Deutschen, die Polizisten, die Schweizer die Liebhaber, die Franzosen die Automechaniker, die Italiener die Organisatoren und die Engländer die Köche stellen“. Es existierte dann noch ein weiterer Direktor, der jedoch nur einmal in Bremen in Erscheinung trat. Neben all den Häuptlingen arbeiteten dort nur noch eine Sekretärin, ein Lagerist sowie John Morgan jun., ein junger, recht smarter, aber unerfahrener Verkäufer. Erstaunlicherweise war es dieser kleinen, ambitionierten Niederlassung gelungen, in kurzer Zeit ein paar interessante und bestens etablierte Großkunden zu gewinnen. Das britische Gesellschaftsrecht für die übliche Ltd., also die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, macht es Firmengründern leicht, den Weg in die Selbstständigkeit zu finden. Dagegen sind die Hindernisse sowie der organisatorische und zeitintensive, kostspielige Aufwand inklusive der völlig überflüssigen Beschäftigung eines Notars bei deutschen Firmengründungen nicht nur unverhältnismäßig, sondern geradezu unternehmerfeindlich.
Hinzu kommt die Besessenheit unserer Finanzbehörden, die ganz offensichtlich in Firmengründern ohnehin fast ausnahmslos mit bescheidenem Anfangskapital in erster Linie potenzielle Betrüger sehen. Bei uns im Land der Bedenkenträger haben es angehende Selbstständige schwer. Nach wenigen Tagen des morgendlichen sowie abendlichen Pendelns zwischen Guildford, der alten Universitätsstadt, wo sich der Firmensitz befand, und meinem Hotel in Camberley, konnte ich mich eines Morgens an einem traumhaften Aha-Erlebnis erfreuen: Ich hatte zum ersten Mal auf Englisch geträumt. Aufgrund solch nebensächlicher Ereignisse konnte ich für mich zufrieden feststellen, gleichsam eingetaucht zu sein in diese für mich sehr neue britische Gesellschaft. Man hatte es mir leicht gemacht. Die viel gerühmte englische Höflichkeit, gerade bei schwierigen Gesprächen muss ich ebenfalls als äußerst positiven Erfahrungsschatz verbuchen. In späteren Jahren machten Freunde oder Familienmitglieder mich wiederholt auf eine typische Verhaltensweise aufmerksam. Auf eine Neigung, Gesten, Gewohnheiten, Ausdrücke oder Redewendungen aus einer alternativen Umgebung relativ schnell zu übernehmen. Bei aller Bereitschaft zur Selbstkritik sehe ich darin allerdings bis heute keine Affigkeit oder gar Anbiederung. Fremde Einflüsse zeitlich begrenzt oder dauerhaft zu übernehmen, sich quasi zu bereichern, halte ich immer noch für wohltuende Befruchtung. Erstaunlicherweise bin ich während meiner Zeit auf den Britischen Inseln nie mit der deutschen NS-Vergangenheit konfrontiert worden. Es ist anscheinend tatsächlich etwas dran an der „feinen englischen Art“. Zurückhaltung scheint die Maxime zu sein, zumindest innerhalb des Bildungsbürgertums. Etwas anders bei „Donald“, dem früheren Englandvertreter unserer Bremer Firma. In einem alten, doch sehr attraktiv wirkenden Rolls Royce kam er jeweils zur Hannover-Messe. Begleitet von mehreren außerordentlich auffälligen Damen. Donald meinte während eines Besuches, dass es doch für mich kein Problem darstellen dürfte, ihm mal eben ein Paar Manschettenknöpfe mit Hakenkreuz zu besorgen. Sein Ansinnen war zunächst insofern problematisch, ihn überhaupt sprachlich und begrifflich zu verstehen. Denn die Vokabeln Cufflinks für Manschettenknöpfe sowie der Begriff Swastika für das Hakenkreuz waren mir bis zu diesem Zeitpunkt nie begegnet. Aber Donald hielt es offenbar für selbstverständlich, dass alle Deutschen mit der NS-Zeit sowie deren Besonderheiten vertraut sein müssten. Dagegen profitierte ich für das Erkennen und Erlernen britischer Verhältnisse in ganz besonderem Maße von John M. jun. Er war etwa zehn Jahre jünger als ich, verfügte über gute Manieren, zeichnete sich aus durch Fleiß, unermüdlichen Einsatz und Freude am Vermitteln englischer Gewohnheiten, Eigenarten und kultureller Besonderheiten. John war Stipendiat und Absolvent des berühmten Kings College, einer der Schulen für den Nachwuchs der britischen „Upper Claas“ oder derer, die gern dazugehören möchten. Durch sein ungewöhnlich selbstbewusstes Auftreten hinterließ dieser begabte, sehr junge Mann einen guten, leicht irritierenden ersten Eindruck. Bisweilen störte nur sein oft zu lautes, etwas albern wirkendes Lachen. Es drückte zugleich etwas Überheblichkeit aus. Trotz allem konziliant konnte er sich ohne Weiteres für sein übertriebenes Gehabe sofort entschuldigen. Sein Vater, John Morgan sen., musste eine ganz herausragende Persönlichkeit sein. Vermutete ich jedenfalls damals aufgrund der Erzählungen. Ein früh pensionierter Luftwaffenoffizier, Wing Commander, also Oberstleutnant, der in zweiter Karriere als „Queen‘s Messenger“, entsprechend einem Kurier des Auswärtigen Amtes, ständig durch die Welt reiste. Einige Jahre später lernte ich ihn dann auch persönlich kennen. Allerdings endete diese kurze berufliche Verbindung zu ihm in einer mittleren Katastrophe fernab in Afrika. Der Junior würde unserer Firma vermutlich nicht sehr lange zur Verfügung stehen. So mein damaliger Eindruck. Denn er schwärmte ständig und gar zu enthusiastisch von Südafrika. Von den wunderbaren Lebensverhältnissen, von dem offenbar höchst angenehmen Klima, den ohne Weiteres adaptierbaren Lebensumständen, wo das Britische schließlich dominieren würde. Für mich bedeuteten die damit verbundenen Begriffe wie Apartheid, Homelands oder Unruhen unter der „nichtweißen Bevölkerung“ eher etwas Abschreckendes, aber keineswegs Einladendes. Sonnentage ohne Ende, preiswerte und höchst komfortable Wohnverhältnisse und obendrein noch bezahlbare, schwarze Bedienstete, also das Einwanderungsland schlechthin! Wie John M. jun. meinte. Ein zeitlich begrenzter Auslandsaufenthalt in England ja, aber bitte nicht Südafrika. Japan, Malaysia, Singapur, Hong Kong, das waren damals die erklärten Ziele, speziell für jemanden aus der Elektronikindustrie. Südafrika, das lag am Ende der Welt. Immerhin schienen alle derart exotischen Standorte eine Besonderheit aufzuweisen. Speziell für meine Überlegungen in der Sorgerechtsfrage. Etwa ein Jahr vor der Scheidung führte ich sehr ernsthafte Verhandlungen mit einer Bremer Im- und Exportfirma. Es ging dabei um die attraktive Aufgabe, die Leitung des Büros in Tokio zu übernehmen. In diesem Zusammenhang kam es zu dem Denkanstoß, die beiden Söhne einfach mal auf eine Urlaubsreise nach Asien mitzunehmen. Zweifellos wären die beiden in einem solchen Fall dann lieber gleich beim Papa in Japan geblieben. Selbstverständlich belehrte mich mein Anwalt, dass so etwas rechtlich keineswegs in Ordnung wäre. Gleichwohl sah er kaum Chancen, die Rückkehr der Jungs gegen ihren Willen durch die Mutter erzwingen zu lassen. Ähnliche Überlegungen für Südafrika anzustellen, waren zum Zeitpunkt meines Englandengagements natürlich nicht relevant. Zunächst galt es, eine solide Basis für meine englische Zukunft zu schaffen. Durch eine eventuelle Wiederheirat nebst ordentlichem zu Hause plus gutem Job hätte die Beurteilung in der Sorgerechtsentscheidung vermutlich sehr viel günstiger für mich ausfallen können. Trotzdem musste ich damit rechnen, dass es die Dame bei all ihrer Kreativität und Hartnäckigkeit, versuchen würde, unsere neuen Lebensumstände zu durchkreuzen. Denn die Britischen Inseln waren für eine Intervention viel zu leicht erreichbar. Im positiven Sinn war sie eine echte Kämpfernatur, die mit viel Fantasie immer neue Wege fand, um ihr Ziel zu erreichen. Zugunsten des britischen Abenteuers hatte ich meinen Traumjob in Deutschland aufgegeben. Die emotionale Auseinandersetzung mit dieser Entscheidung gleichwohl noch nicht abgeschlossen. Doch ab sofort konzentrierte ich mich ohne Wenn und Aber auf die englische Aufgabe. Ich sog all das Neue mit Begeisterung auf und hatte irgendwann das gesamte Vereinigte Königreich bereist. Inklusive der Unruheprovinz Nordirland. In Stonehenge hatte man diese unglaublichen Stelen noch anfassen können. Und in Devon am Straßenrand wurden noch die frischen Erdbeeren mit Devon Cream serviert. Sogar ein wenig britisch snobistisches Gehabe drohte auf mich abzufärben. Tweed Jacketts und andere passende Kleidung kaufte ich nicht mehr beim preiswerteren Marcs & Spencer, leicht vergackeiernd Marks und Sparks genannt. Selfridges hielt Exklusiveres bereit. Ich schickte die Kellnerin in der noblen, viel zu teuren Bar im ebenso affig teuren Park Tower Hotel im noch teureren Stadtteil Knightsbridge zurück, weil sie mir den ebenfalls überteuerten Whisky nach meinem Geschmack im unpassenden Glas servieren wollte. Ich besuchte Pubs wie “The Queens Head“ (gemeint ist damit das abgeschlagene Haupt der Königin von Schottland), dargestellt über dem Eingang als blutige Trophäe des Sieges über die Schotten. Ergötzte mich immer wieder an diesen für uns Kontinentaleuropäer scheinbar völlig sinnlosen, seltsam bekloppten Wortspielereien britischer Pub-Namen. So Verrücktes wie “The Pig and Whistle“ (Schwein und Pfeife), “Pig in the String“ (Schwein in der Schnur), “Lamb Breweries“ (Lamm Brauerei) oder “The leg of Mutton and Cauliflower“ (Hammelbein und Blumenkohl). In Nottingham suchte ich vergeblich Robin Hoods Nottingham Forest. Doch zu meiner Überraschung erfuhr ich, dass die Wälder schon vor Hunderten von Jahren zu Schiffsplanken verarbeitet wurden. Ich genoss es, die engen Landstraßen Südenglands zu erkunden. Unvergessen sind die herrlichen Fahrten von Camberley nach Ascot, Windsor und über die M 4 nach London. Die Umgebung von Windsor Castle wurde mir ebenso vertraut wie die ländlichen Pubs. Die wirkten zumeist nicht piek fein sauber, nicht schmutzig, doch unglaublich gemütlich. Eindrücke und Erlebnisse, die man sich anderswo schon gar nicht dort unten am Ende der Welt vorstellen konnte.
Herrsche, Britannia
Freitag, der 14. Juni 1974, war ein wunderbar sonniger Sommertag in Südengland. Das Vereinigte Königreich zeigte alles, was diese Monarchie an Traditionspflege zu bieten hat. Die Beisetzungsfeierlichkeiten für Prince Henry Duke of Gloucester, einem Onkel der Queen, waren ein Medienereignis ersten Ranges. Das ähnelte sehr dem 23 Jahre später weltweit beachteten Begräbnis von Prinzessin Diana. Für des Herzogs Beisetzung zeit seines Lebens Soldat, stand somit auch das Militärische bei dieser Zeremonie im Vordergrund. Sechsspännig gezogen wurde die Geschütz-Lafette mit dem Sarg. In Paradeuniform folgten die männlichen Teilnehmer der königlichen Familie. Besonders ergreifend anzusehen, wie auch in den USA bei Staatsbegräbnissen üblich, das reiterlos geführte Pferd mit den Stiefeln verkehrt herum in den Steigbügeln steckend. Neben dem allgemein bekannten Earl Louis Mountbatten, dem letzten Vizekönig von Indien und Lieblingsonkel der Königin, beschränkte sich der Bekanntheitsgrad von Onkel Henry vornehmlich auf das Vereinigte Königreich sowie die Staaten des Commonwealth.
Mit der britischen Geschichte nicht sonderlich vertraut, hatte ich nie zuvor von dieser hochinteressanten Persönlichkeit gehört. Geboren wurde Prinz Henry im Jahr 1900, also noch zu Zeiten der Regentschaft von Queen Victoria. Auch unser preußisch soldatischer Vater gehörte noch zu diesem Jahrgang. Einen weiteren Mann vom Jahrgang 1900, mehr Philosoph als ebenfalls Offizier, hätte ich gern als Gesprächspartner erlebt. Er verstarb leider zu früh, um auch real und gefühlt mein Schwiegervater sein zu können. Nicht vorstellbar, dass heutzutage außer den Briten noch irgendeine andere Nation in der Lage wäre, traditionelle Staatsbegräbnisse derart aufwendig und filmreif zu zelebrieren. Eine derartige Mega-Show, so muss man es, ohne despektierlich zu sein, einfach nennen, mit Hunderten von Pferden, fein abgestimmt in Rappen, Schimmel und Braune, hatte ich zuvor noch nie gesehen. Bei Militär- und Traditionsbegeisterten musste dieses Zeremoniell einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Im Nachhinein kann ich meinen Vater auch besser verstehen. Er schwelgte in seinen Erinnerungen davon, wie er als Junge, der auf jeden Fall Soldat werden wollte, in Berlin auf dem Tempelhofer Feld noch die kaiserlichen Paraden bestaunen konnte. Der erwähnte Earl Louis Mountbatten, allgemein als Lieblingsonkel der Queen bezeichnet, wurde fünf Jahre später ähnlich eindrucksvoll zu Grabe getragen. Er starb allerdings nicht eines natürlichen Todes, sondern war zusammen mit weiteren Opfern einem Terroranschlag der Irish Republican Army zum Opfer gefallen. Natürlich sind längst nicht alle Briten von dieser Traditionspflege begeistert. Daher darf man sich auch fragen, wie die Nation zur Monarchie steht, wie patriotisch die Gesellschaft generell empfindet. Tatsächlich hätten weniger als 15 Prozent der Briten lieber eine Republik anstelle der heutigen Verfassung. Noch mehr britischer Patriotismus bricht sich Bahn bei einer der beliebtesten jährlichen Großveranstaltungen. Eintrittskarten für die zwischen Juli und September in der Royal Albert Hall stattfindenden Konzerte sind stets viel weniger verfügbar als nachgefragt. Aber seit etlichen Jahren kann man sogar im Deutschen Fernsehen live dabei sein. Und wer es bis dahin noch nicht geahnt haben sollte, erfährt bei dieser Show, warum Briten keine richtigen Europäer sind und es offenbar auch gar nicht werden wollen. Jährlicher Höhepunkt der Promenadenkonzerte, der „Proms“, ist der letzte Abend dieser Konzertreihe. „The Last Night of the Proms“. Zeitgleich zur Aufführung in der „Royal Albert Hall“ feiern teilweise mehr als 40.000 Zuhörer das musikalische Erlebnis des Jahres im Hydepark. Um den immensen Andrang auf das Konzerthaus bewältigen zu können, wird die Vorstellung auf eine Großbildleinwand projiziert. Gegen Ende des letzten Konzertes kommt es dann zur Steigerung der Emotionen durch den Auftritt einer hochklassigen Sängerin oder eines männlichen Interpreten des klassischen Gesangs. Mit tosendem Beifall übertönt schließlich die riesige, bunt gemischte Menschenmenge den Sologesang. Wenn Normalbürger frenetisch singend ihren Patriotismus zum Ausdruck bringen, wenn mit voller Hingabe und Überzeugung die inoffizielle Nationalhymne geschmettert wird, dann erbebt die altehrwürdige Royal Albert Hall unter dem Ruf: “Rule Britannia! Britannia rule the waves. Britons never will be slaves.” Herrsche Britannia! Britannia beherrsche die Wellen. Briten werden niemals Sklaven sein. Wie ein Schlachtruf wirkt dieses Ritual Fähnchen schwenkender Briten. Von den „Brexiteers“ wurde der patriotische Text als Hymne umgedeutet, als Symbol für die britische Souveränität im Kampf für den Austritt aus der EU. Dagegen wirkt Deutschland vor allem im Blick von außen, auch 75 Jahre nach dem Neubeginn von 1945 weiterhin sehr moderat. Erst nach Bismarck hatten es die Deutschen so langsam verstanden, zu einer Nation zu werden. Bis in unsere Tage hinein oft die „zu spät gekommene Nation“ genannt. Trotzdem und glücklicherweise ist das heutige Deutschland mittlerweile gesund, föderal und fest verankert. Ohne irgendwelche Spaltungstendenzen. Kein Bayer will sein Bayern zu einem unabhängigen Nationalstaat machen, kein Ostfriese trachtet nach Selbstständigkeit und auch kein Sachse möchte, losgelöst vom Rest der deutschen Lande Ausschau halten, einen Nachfolger Augusts des Starken zu finden. Gründe, um Klage zu führen über Kleinstaaterei im Deutschland des einundzwanzigsten Jahrhunderts gibt es allerdings mehr als selbst die kritischsten Medien hierzulande publizieren. Einerseits kann man unseren Föderalismus durchaus begrüßen. Andererseits aber schlichtweg mit legalisierter Geldverschwendung gleichsetzen. Warum sechzehn Bundesländer, wenn auch die Hälfte ausreichen müsste? Eine Rechnung aufzumachen wäre selbstverständlich völlig vergebens. Denn wer will erwarten, dass sich die unzähligen Minister, Staatssekretäre, Abgeordnete, Beamte und Angestellte mit einer wie auch immer gearteten Reform selbst wegrationalisieren würden? Andere Nationen wie die Spanier, die Belgier, aber besonders die Briten, haben da schon mit sehr viel ernsteren Problemen zu kämpfen. Zeitweise finden dort „todernste“ bewaffnete Kämpfe statt. Die schottischen Bestrebungen nach Unabhängigkeit sind zwar recht vehement, aber grundsätzlich gewaltfrei. Ganz anders sah es jahrzehntelang im britischen Nordirlandkonflikt aus. Ich erinnere mich an die viel beachtete „Brexit“ - Rede von Theresa May, Großbritanniens etwas glückloser Premierministerin. Wie nicht anders zu erwarten war, sollte der EU-Außengrenze zwischen der Republik Irland und Nordirland bei einer möglichen Loslösung Großbritanniens von der Europäischen Union eine ganz besondere Bedeutung zukommen. Da verwunderte es nicht, dass Frau May in ihrer Rede zwölfmal den Begriff Nordirland verwendete. Auf einen kurzen, griffigen Nenner gebracht: Gäbe es nach dem Brexit eine sogenannte harte Grenze zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland, bestünde erneut die Gefahr einer bürgerkriegsähnlichen Eskalation. Zwischen den zur Republik Irland tendierenden Nationalisten im Verbund mit den gewaltbereiten Republikanern einerseits sowie den pro britischen Unionisten mit ihrem militanten Flügel der Loyalisten andererseits.
Bezeichnenderweise sprechen britische Medien selten oder nie von Konflikten zwischen Katholiken und Protestanten. Diese Termini scheinen gar nicht zu existieren. Man spricht und berichtet vielmehr über Unionisten oder Loyalisten, die sich dem Vereinigten Königreich zugehörig fühlen. Dem gegenüber stehen die irischen Nationalisten oder Republikaner. Bislang konnte ich noch keine vernünftige Erklärung dafür finden, warum deutsche Medien weiterhin mit Ausdauer die Mär von einer Art Religionskrieg vermitteln wollen. Seit dem Karfreitagsabkommen vom 10. April 1998 zwischen den Regierungen der Republik Irland und Großbritanniens sowie den Parteien in Nordirland war eine relativ friedliche Periode eingetreten. Meine Beurteilung und Wertung dieses irischbritischen Dauerkonfliktes ergibt ein sehr deutlich negatives Bild. Die Auseinandersetzung mit über 3.500 Todesopfern zwischen 1969 und 1998 als religiöse Streitigkeit zwischen Katholiken und Protestanten darzustellen, ist schlicht weg falsch. Das gehört in die Kategorie Geschichtsfälschung, oder „Fake News“. Wer erinnert sich heutzutage schon daran, dass Irland eine der ersten britischen Kolonien war. Also eine gewaltsame, mit perfidesten Mitteln unter britische Kontrolle gebrachte Eroberung. Auch fanden dort die anderswo als Völkermord bezeichneten ersten Vertreibungen großen Stils statt.
Wer sich nur ein wenig mehr als lediglich durch Schlagzeilen deutscher Medien über die tatsächliche Lage Irlands und Nordirlands informiert, muss Folgendes feststellen:
Hier gibt es definitiv keinen Religionskrieg zwischen Katholiken und Protestanten, wie es mancherorts heißt. Bereits die Formulierung Katholiken und Protestanten ist irreführend. Man könnte annehmen, dass es sich bei den Protestanten um Lutheraner oder Gläubige der reformierten Kirche handeln würde. Tatsächlich sind die früher einmal katholischen Engländer seit Heinrich dem VIII. (1531) zwangsweise Mitglieder der englischen Staatskirche. Und zwar, weil der damalige Papst nicht in eine kirchlich sanktionierte Wiederheirat des Königs mit Anne Boleyn einwilligen wollte, nachdem ihm Katharina von Aragon keinen männlichen Thronerben geboren hatte. Daraufhin beschloss der König im Gegenzug, seinen eigenen Religionsverein aufzumachen. Die heutige „Church of England“. Im Übrigen ähnelte vieles in dieser Kirchenneugründung von 1534 auf lange Zeit noch immer der römisch-katholischen Kirche. Mal vom fehlenden Zölibat abgesehen. Noch heute wirkt das Trauma der bestialischen Gewalttaten des Oliver Cromwell von 1649 nach. Leicht hatten es die Iren ohnehin nie auf ihrer Insel. Unterdrückung durch die britischen Besatzer, verbunden mit systematischer Enteignung. Armut und Hungersnöte kennzeichneten über Jahrhunderte hinweg das Leben in dieser britischen Kolonie. Der größte Teil Irlands erlangte nach langen, blutigen Auseinandersetzungen und schwierigen Verhandlungen letztlich 1921 die Unabhängigkeit von Großbritannien. Der nördliche Teil verblieb beim Vereinigten Königreich. Nicht zuletzt wegen der ertragreichen Kohlereviere Nordirlands. Bereits im 12. Jahrhundert war es England gelungen, die Region mit sogenannten „ethnischen Säuberungen“ sowie der Ansiedlung schottischer und englischer Einwanderer unter Kontrolle zu bringen. Gegen diese Kolonisierung verfestigte sich zwangsläufig ein permanenter Widerstand. Landenteignungen zugunsten der Eingewanderten, systematische Unterdrückung in Verbindung mit diskriminierenden Gesetzen und Vorschriften beförderten Hass und Widerstand. Das Unionsgesetz von 1801 hatte schließlich das „Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland“ geschaffen. Polizei und britische Armee konnten verschiedene spontane Aufstände schnell und effektiv niederschlagen. Doch der immer wieder aufkeimende Guerillakrieg wurde zum Normalzustand. Fast 100 Jahre lang gibt es jetzt das teilweise „befreite“ zweigeteilte Irland. Nicht die bürgerkriegsähnlichen Verhältnisse, nicht die Terroranschläge der IRA nicht das vehemente Einschreiten britischer Truppen, noch internationale Vermittlungsbemühungen haben es vermocht, die immer tiefer werdenden Gräben zu überwinden. Diese schwerwiegende Erblast britischer Unterdrückung der irischen Nation könnte eines Tages das „Vereinigte Königreich“ sogar zerreißen. Alljährlich wird von aggressiv demonstrierenden nordirischen Loyalisten an die erniedrigende irische Niederlage in der Schlacht am Fluss Boyne bei Dublin von 1690 erinnert. Der Marsch von Zehntausenden Anhängern des sogenannten Oranier Ordens soll die Überlegenheit der fest mit dem Vereinigten Königreich verbundenen Royalisten und Loyalisten in offener Feindseligkeit zum Ausdruck bringen. Gegendemonstrationen, Gewaltakte sowie eine Vertiefung der Gräben sind die Folge. Fazit: Der Fall Nordirland muss zwangsläufig als ungelöst gelten. Und zwar auf unbestimmte Zeit. Während weiterhin diese Erblast wie ein Mühlstein um den Hals Britanniens hängen wird. Diese Last wird zweifellos auch das Verhältnis zwischen dem „Vereinigten Königreich“ und der Europäischen Union auf lange Zeit negativ beeinflussen. Bleibt zu hoffen, dass dieser Negativeinfluss nicht noch dauerhaft zu einer generellen Schwächung des gesamten EU-Gebäudes führt.
Der englische Dichter Lord Byron 1788-1824, heutzutage in Deutschland eher unbekannt, gilt als eine der literarischen Lichtgestalten der englischen Romantik. Unser Goethe schätzte ihn so sehr, dass er ihn sogar in Faust II in der Gestalt des Euphorion verewigte. Seine herausgehobene Position als englischer Lord und Mitglied des Oberhauses in Verbindung mit seiner landesweiten Popularität als hochgeschätzter Dichter seiner Zeit macht es nur schwer verständlich, dass er die seinerzeitige britische Irlandpolitik so vernichtend verurteilte. Er schrieb:
„Denken sie an Irland, das unter der Gewalt Englands stöhnt. Sie wollten die Unterdrückung Englands nicht mehr ertragen. Da führten wir unter dem Vizekönig Lord Camden eine Blutherrschaft ein. Wir sind alle Engländer. Aber weil wir es sind, müssen wir es ehrlich sagen, mit Schamröte im Gesicht: Wir haben eine Blutherrschaft dort eingeführt. Hunderte Unschuldiger, die kein anderes Verbrechen begangen hatten, als dass sie Iren waren, wurden gepeitscht, bis ihnen die Haut in Fetzen vom Leibe hing, wurden gezwungen, auf einem Bein auf einem spitzen Pfahl zu stehen, wurden der genialen Methode des Halbhängens unterworfen, das heißt, man nahm sie kurz nach dem Hängen wieder vom Galgen. Auch der Sprung aus der Pechkappe, bei dem die Kopfhaut hängen blieb, war sehr beliebt.“
Hautnah erfolgte mein Lernprozess über das Nordirlandproblem durch einen Kundenbesuch in Belfast. Die Kaffeetassen auf unserem Verhandlungstisch klapperten. Eine Detonation von solcher Intensität, dumpf, durchdringend, furchteinflößend, hatte ich noch nie erlebt. Unsere Gesprächspartner an diesem Morgen im Mai 1974 in der Hauptstadt der britisch irischen Unruheprovinz erweckten den Eindruck, als sei so eine Bombenexplosion, also ein Terroranschlag, nicht sonderlich überraschend. „Bestimmt wieder das Europa.“ Meinte unser Gesprächspartner lakonisch. So war es tatsächlich. Der Eingangsbereich dieses beliebten „Hotel Europa“ war gerade vor ein paar Tagen nach dem letzten Anschlag wieder hergestellt worden. Die IRA-Bombe hatte zwar keine Personenschäden verursacht, sollte aber demonstrieren, dass die kämpfende Truppe der irischen Nationalisten jederzeit und überall zuschlagen konnte. Nun ist Nordirland ein besonders heikles Kapitel im Reigen der Überreste des einstigen britischen Weltreiches. Daher ist zu befürchten, dass gerade dieses Problem nie für alle Beteiligten zufriedenstellend gelöst werden wird. Auch die Bewohner anderer Regionen mit britischem Einfluss bauen weiterhin auf ihre Zugehörigkeit zur Krone. Denn schließlich stellt schon die Ausstattung mit einem britischen Reisepass einen überzeugenden Vorteil dar. Die gar nicht so kleinen Territorien kolonialer Überreste sorgen öfter für weltweite Aufmerksamkeit. So der Verlust von 1000 Menschenleben im Falklandkrieg von 1982. Skurril bis kriminell die Existenz von 800.000 registrierten Firmen bei 20.000 Einwohnern auf den kleinen britischen Jungferninseln. Kürzlich wurde über die letzten 50 Nachkommen der Bounty-Meuterer von 1790 berichtet. Sie leben noch immer im damaligen Versteck ihrer Vorfahren, auf einer der Pitcairninseln, der letzten britischen Kronkolonie im Pazifischen Ozean. Oder aber die 16 Staaten, die weiterhin Ihre Majestät als Staatsoberhaupt schätzen. Vom kleinen Bergkönigreich Lesotho, eine parlamentarische Monarchie nach britischem Muster, kannte ich zum Zeitpunkt meiner britischen Abenteuer noch nicht einmal den Namen. Ganz zu schweigen von seiner makabren Geschichte und Entwicklung, an der ich noch sehr regen, teils unvergesslich schönen, teils abenteuerlich gefährlichen Anteil nehmen sollte. Und dann eben Gibraltar, Stachel im Nationalstolz der Spanier, seit 1713 offiziell zu Großbritannien gehörend. Gibraltar ist ein Paradebeispiel dafür, wie man einer kleinen Zahl von Einwanderern dazu verhelfen kann, Mehrheitsbevölkerung zu werden. Da werden, ohne viel Aufmerksamkeit zu erregen, die üblichen, aber wirksamen Druckmittel angewendet. Kaum oder keine Arbeitsmöglichkeiten für Spanier, Bevorzugung Englisch sprechender Bewerber, geschickte, unauffällige Benachteiligung der ursprünglichen Bevölkerung bis hin zur künstlichen Verknappung von bezahlbarem Wohnraum. Der resignierende Rest der angestammten Bevölkerung kann danach mühelos unter Kontrolle gehalten werden. Und „demokratische Wahlen“ dokumentieren schließlich den Wunsch, dass die Bevölkerung mehrheitlich zum Vereinigten Königreich gehören will. Trotz allen Unbehagens über Negatives der Geschichtsschreibung hielt das Land eine großartige Auswahl an Neuem, Interessantem und auch Liebenswertem für mich bereit. Der 100 Club in der Oxford Street war für mich so eine ganz große Nummer. Ganz großes Kino, wie man so schön sagt. Auch heute noch eine der ersten Adressen für guten Live Jazz. Damals, 1974 eine eher schmuddelige, total verqualmte, riesige Kneipe. Allerdings mit großartigen Darbietungen. Ob Chris Barber, Monty Sunshine oder Ken Colyer alles, was seiner Zeit Rang und Namen hatte, war dort anzutreffen. Dort war ich Stammgast. Als ausgesprochen spektakulär, weder positiv noch negativ, würde ich die beruflichen, wie geschäftlichen Ergebnisse meines Englandaufenthaltes nicht werten wollen. Viel nachhaltiger wirken die vielen kleinen, meist positiv überraschenden Einsichten in britisches Leben.
Beim Schlendern durch die alten romantischen Gassen der Stadt Guildford ergatterte ich in einem kleinen, mit alten, muffig riechenden Büchern vollgestopften Antiquariat die kompletten 10 Bände „Geschichte Friedrich des Großen“ von Thomas Carlyle. Diese Biografie in einer Ausgabe von 1873 gilt allgemein als eine der besten, außerordentlich neutral geschriebenen, vermutlich Hunderter von Werken über den Preußenkönig. Wegen meiner seit den 1968er-Jahren bestehenden Affinität für Friedrich den Großen hatte ich lediglich einen Blick in das Antiquariat werfen wollen und meinte, dass über den preußischen König wohl kaum etwas im umfangreichen Bestand alter Bücher zu haben sein würde. Wie selbstverständlich wurde ich gleich mit einer guten Auswahl an neueren und älteren Werken konfrontiert. England überraschte mich eben ständig aufs Neue. Michael, unser Chef, stammte wie erwähnt nicht nur aus einer Familie mit Zugang zu höheren Kreisen der Royal British Navy. Es war ihm auch vergönnt, ohne jemals selbst eine Uniform getragen zu haben, Mitglied im Naval Club sein zu dürfen. Nur aufgrund der Tatsache, dass sein Vater früher ein hochrangiger Marineoffizier war. Auf Töchter würde sich im Vereinigten Königreich ein solches Erbe vermutlich nicht übertragen. Zumindest damals noch nicht. Eine Naval Club Mitgliedschaft, so scheint es mir heute noch, kommt dem Erreichen einer der höchsten „Weihen“ in der einflussreichen britischen Gesellschaft gleich. Immerhin war es auch mir einmal vergönnt, diesen „gesellschaftlichen Olymp“ über die lange aufwendig in „Naval Blue“ belegte Treppe als Gast erklimmen zu dürfen. Der Bartender gab sich deutlich vornehmer, als es einige der Gäste gern gewesen wären. Mein Wunsch nach einem irischen Whiskey, dabei auf einen Bushmills Black Label deutend, beantwortete er mit der spitzen Bemerkung:
„Sir, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, bei dieser Sorte handelt es sich nicht um einen irischen, sondern um einen britischen Whiskey.“ Nun ja, da muss man eben ganz genau hinschauen. Denn die uralte irische Whiskey Destille liegt im Ort Bushmills im County Antrim, und zwar in Nordirland, eben nicht in der Republik Irland. Und damit wären wir wieder zurück beim „never ending“ Nordirlandproblem. Der Naval Club strotzte nur so vor britischem Geschichtsbewusstsein mit seinen genialen Seeschlachtengemälden, goldgerahmten Porträts unzähliger Admirale und gekrönter Häupter, stilvoller Beleuchtung, antiker Vasen und Skulpturen. Teppiche, in denen man förmlich versank, gediegenen riesigen Ledersofas und Sesseln. Keine ordentliche Tageszeitung vermissend und vor allem mit einer sehr gedämpften, zum Leisesprechen zwingenden Atmosphäre.





























