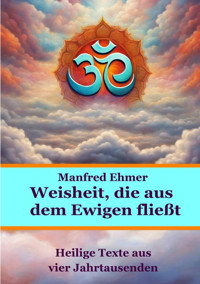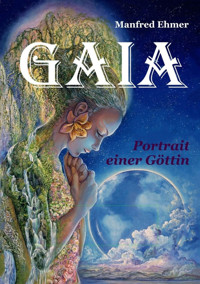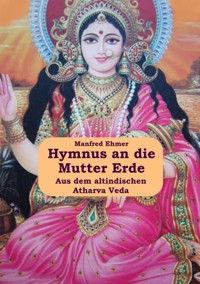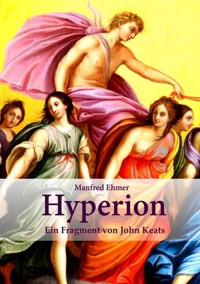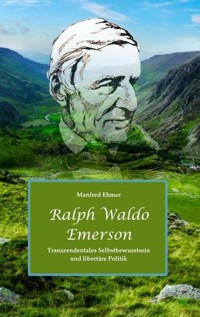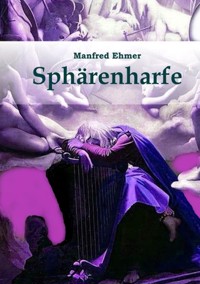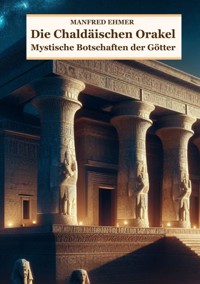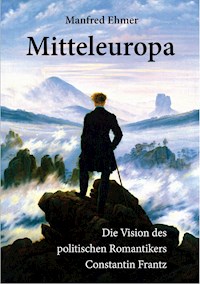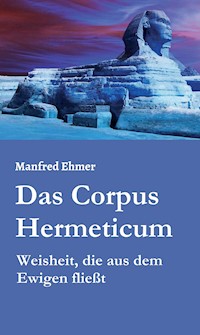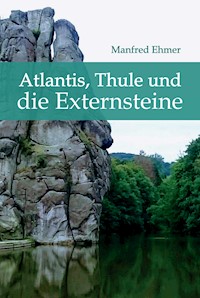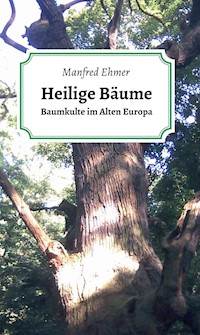2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Edition Theophanie
- Sprache: Deutsch
Götter, Geister, Dämonen, Sagengestalten und Heroen bilden in der griechischen Mythologie ein buntes Kaleidoskop: Kosmische Götter stehen neben chthonischen Urwesen, apollinische Lichtgestalten neben Verkörperungen unheimlich-dämonischer Mächte, einheimische Götter neben solchen, die aus dem Orient gekommen sind, meist in Verbindung mit uralten Mysterienkulten. Am Leitfaden von Hesiods Theogonie werden in diesem Buch die Götter und Göttinnen Griechenlands dargestellt, auch ihr Weiterleben in Kunst, Dichtung, Fantasy und moderner Esoterik. Hier wird eine gründliche und gut lesbare Darstellung vorgelegt, die auf dem Hintergrund esoterischen Wissens den Zugang zu den antiken Göttern neu erschließt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Manfred Ehmer
Götter und Göttinnen
in Mythologie, Kunstund Esoterik
© 2020 Manfred Ehmer
Umschlagbild: Giuseppe Collignon,
Der Feuerraub des Prometheus (1812)
Bildquelle: Wikipedia Commons
Bilder S. 13, S. 254: Wikipedia Commons
Buchschmuck: gemeinfreie Bilder
Verlag und Druck: tredition GmbH,
Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
Teil 2 der Reihe edition theophanie
ISBN: 978-3-7482-1081-8 (Paperback)
ISBN: 978-3-7482-1082-5 (Hardcover)
ISBN: 978-3-7482-1083-2 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Besuchen Sie den Autor auf seiner Homepage:
www.manfred-ehmer.net
Inhaltsverzeichnis
Die Götter Griechenlands
Götter ~ Heroen ~ Dämonen
Schöpfungsmythen
Ge ~ Gäa ~ Gaia
Uranos
Kronos
Die Götter des Olymp
Zeus ~ Dis Pater ~ Jupiter
Hera
Pallas Athene
Aphrodite
Artemis ~ Diana
Demeter ~ Persephone
Hestia ~ Vesta
Hermes ~ Merkur ~ Thot
Dionysos
Apollon
Poseidon
Hephaistos
Ares ~ Mars
Die Urgötter
Nacht ~ Nyx ~ Nott
Hekate
Die Titanen
Atlas
Prometheus
Die Musen
Die Moiren
Die Plejaden
Der Äther
Hyperion ~ Helios
Pan ~ Cernunnos
Orpheus
Ganymed
Bellerophon
Kirke und Kalypso
Isis ~ Neith ~ Nuth
Die Gottesmutter Maria
Die Hierarchie der Engel
Die Wiederkehr der Götter
Götter aus der Retorte
Bibliographie
Zitatnachweis
Die Götter Griechenlands
Wo jetzt nur, wie unsre Weisen sagen,
Seelenlos ein Feuerball sich dreht,
Lenkte damals seinen goldnen Wagen
Helios in stummer Majestät.
Diese Höhen füllten Oreaden;
Eine Dryas lebt‘ in jedem Baum,
Aus den Urnen lieblicher Najaden
Sprang der Ströme Silberschaum.
Friedrich Schiller1
Wie ein „Goldenes Zeitalter“ mutet uns jene längst versunkene Zeit an, in der die Welt noch als durchgeistigt erlebt wurde, als durchwirkt von Göttermacht: Da zog der Gott Helios allmorgentlich seinen Sonnenwagen über den Himmelsrand, da streifte der Große Pan durch die Wälder Arkadiens, ein Schrecken der Hirten zur Mittagsstunde. Nachts ließ die Mondgöttin Selene ihre silberne Sichel über den Himmel gleiten, und die Sternbilder leuchteten ewig am Firmament als Verkörperungen halbgöttlicher Helden. Poseidon, der Beherrscher der Meere, ließ Sturmwind und Wogenschlag aufkommen, und wenn im Frühjahr heftige Gewitter niedergingen, dann war es Zeus selbst, der grollend die Blitze schleuderte. In allen Naturvorgängen wurde das Ergebnis eines göttlichen Waltens, einer wirkenden Göttermacht gesehen.
Die Götter Griechenlands, wie sie uns in der Mythenwelt Homers und Hesiods entgegentreten, tummelten sich in einem Universum, das bevölkert war von Nymphen, Satyrn, Dryaden und Naturgeistern jeder Art, in einem wahrhaft verzauberten Universum. Aber nicht nur lichtvolle Zauberwesen gab es in diesem mythischen Universum, sondern auch Schreckgespenster, etwa die lehmigen plumpen Titanen, diese ewigen Widersacher der Götter, die Kyklopen, einäugige Ungeheuer, die Giganten und die Erinnyen. So gab es also Mächte der Höhe und solche der Tiefe, des Lichts und der Finsternis – und es gab ein ewiges Ringen zwischen diesen polaren Mächten, das die Welt letztlich im Gleichgewicht hielt. Immer sind die Götter jedoch Wesen, die in den Naturerscheinungen zum Ausdruck kommen, sei es in der Sonne oder im Mond, in Flussquellen oder in Bäumen, im Himmelsgewölbe oder im Wogenschlag des Meeres.
Wir dürfen davon ausgehen, dass die Griechen ursprünglich ihre Götter noch ganz naturmystisch im Weltganzen wahrnehmen konnten. Mit Animismus, mit fetischistischer Naturverehrung hat diese hochgeistige Naturmystik nichts zu tun. Die Götter wurden gesehen als numinose Geistmächte, die eigentlich „hinter“ den Naturerscheinungen stehen, aber nur „in“ ihnen zum Ausdruck kamen. So war die ganze Natur mit allem Belebten darin eine Epiphanie des Göttlichen.
Im weiteren Verlauf der Entwicklung ist es jedoch dazu gekommen, dass der ursprüngliche naturmystische Götterglaube langsam dahinschwand; ja es traten in späterer Zeit Kritiker und Spötter auf, die das einstige heilige Wissen um die Götter und ihr Wirken in der Welt als reines Ammenmärchen hinstellen wollten. Der Dichter Homer (um 800 v. Chr.) war wohl der Letzte, der die Götter der alten mykenischen Zeit noch als lebendig empfinden konnte; dann setzte eine Entwicklung ein, die man als eine „Entgötterung“ oder – um mit Max Weber zu sprechen – eine „Entzauberung der Welt“ kennzeichnen kann. Das Schicksal der Götter fortan war es, dass sie aus der harten rauen Wirklichkeit dieser Welt verbannt wurden, dass sie hinübergingen in das Land der Märchen und Mythen, auch in das Traumland der Dichter – zurück blieb eine entgötterte, eine leergewordene und darum tote Natur. Niemand hat diesen Verlust tiefer, schmerzlicher empfunden als Friedrich Schiller (1759-1805), der in seinem Gedicht Die Götter Griechenlands klagt:
Schöne Welt, wo bist du? Kehre wieder,
Holdes Blütenalter der Natur!
Ach, nur in dem Feenland der Lieder
Lebt noch deine fabelhafte Spur.
Ausgestorben trauert das Gefilde,
Keine Gottheit zeigt sich meinem Blick –
Ach, von jenem lebenwarmen Bilde
Blieb der Schatten nur zurück.
Alle jene Blüten sind gefallen
Von des Nordes schauerlichem Wehn:
Einen zu bereichern unter allen,
Musste diese Götterwelt vergehn.
Traurig such‘ ich an den Sternenbogen,
Dich, Selene, find ich dort nicht mehr;
Durch die Wälder ruf ich, durch die Wogen,
Ach! Sie widerhallen leer!
Unbewusst der Freuden, die sie schenket,
Nie entzückt von ihrer Herrlichkeit,
Nie gewahr des Geistes, der sie lenket,
Selger nie durch meine Seligkeit,
Fühllos selbst für ihres Künstlers Ehre,
Gleich dem Schlag der Pendeluhr,
Dient sie knechtisch dem Gesetz der Schwere,
die entgötterte Natur.2
Ganz ähnlich der Romantiker Novalis (1772-1801) in seinen berühmten Hymnen an die Nacht: „Zu Ende neigte die alte Welt sich. Des jungen Geschlechts Lustgarten verwelkte – hinauf in den freieren, wüsten Raum strebten die unkindlichen, wachsenden Menschen. Die Götter verschwanden mit ihrem Gefolge – Einsam und leblos stand die Natur. Mit eiserner Kette band sie die dürre Zahl und das strenge Maß. Wie in Staub und Lüfte zerfiel in dunkle Worte die unermessliche Blüte des Lebens. Entflohn war der beschwörende Glauben, und die allverwandelnde, allverschwisternde Himmelsgenossin, die Phantasie. Unfreundlich blies ein kalter Nordwind über die erstarrter Flur, und die erstarrte Wunderheimat verflog in den Äther. Des Himmels Fernen füllten mit leuchtenden Welten sich. Ins tiefre Heiligtum, in des Gemüts höhern Raum zog mit ihren Mächten die Seele der Welt – zu walten dort bis zum Anbruch der tagenden Weltherrlichkeit. Nicht mehr war das Licht der Götter Aufenthalt und himmlisches Zeichen – den Schleier der Nacht warfen sie über sich. Die Nacht ward der Offenbarungen mächtiger Schoß – in ihn kehrten die Götter zurück…“3
Die Nacht der Götter war also angebrochen – gewichen sind die Götter dem hellen klaren Tag des Verstandesdenkens, dem grellen Licht einer sinnentleerten „entzauberten“ Welt. Heute leben wir jedoch in einer Zeit, in der die Ausrichtung auf Fortschritt im Sinne einer perfekten technisch-rationalen Weltbeherrschung immer fragwürdiger wird. Die Entzauberung der Welt hat zu einem Identitätsverlust des Menschen geführt, zu einem Verlust der inneren Mitte, die nur durch echte religio, Rückbindung an den göttlichen Urgrund, behoben werden kann.
Die Wiederverzauberung der Welt – das ist die Wiederkehr wahrer Spiritualität in das Bewusstsein der Menschen, die Versöhnung von Geist und Natur, von Innen und Außen, von Religion und Wissenschaft, von Gott und Kosmos. Das bedeutet auch die Wiederkehr der Götter, ihre Rückkehr in die Reiche der Natur, aus denen sie verbannt wurden. So wird der schon seit Jahrtausenden währenden Götter-Nacht vielleicht ein neuer Götter-Tag folgen, und die Welt wird wieder transparent auf ihren geistigen Ursprung hin.
Der Durchbruch zu einer spirituellen Natursicht, zu einem neuen spirituellen Naturerleben – das ist wohl der wichtigste Aspekt, den eine „wiederverzauberte Welt“ mit sich bringen wird. Dies bedeutet keinesfalls, zu irgendwelchen vergangenen Welten zurückkehren zu wollen – es gibt kein Zurück zur heidnischen Antike oder zu irgendeiner anderen überwundenen Phase der Menschheits-Entwicklung. Die Rückbindung an die Natur, auch an ihre göttlich-numinosen Kräfte, kann heute nur in aller Verstandeswachheit erfolgen; sie muss von Erkenntniskräften begleitet sein, die aus dem voll entwickelten Ich-Bewusstsein des modernen Menschen erwachsen. Nicht um eine Rückkehr zu den „Göttern Griechenlands“ oder zu anderen alten Göttern kann es heute gehen, sondern vielmehr um die Gewinnung einer spirituell erweiterten Natursicht, die das Geistige in der Schöpfung zu erkennen vermag.
Der kulturgeschichtliche Hintergrund
Der kulturgeschichtliche Hintergrund der griechischen Mythologie ist von einer Serie prähistorischer Wanderungsbewegungen geprägt. In der Frühgeschichte Griechenlands werden üblicherweise drei Phasen voneinander unterschieden:
In der frühhelladischen Epoche (2500-1850) bemerken wir bereits die Bildung von verschiedenen ackerbautreibenden Kulturkreisen im ägäischen Raum; Träger dieser Kultur ist die vorindogermanische mediterrane Urbevölkerung.
In der mittelhelladischen Epoche (1850-1600) kommt es erstmals zur Einwanderung indogermanischer Stämme, der Joner und Aioler / Achäer, die auch als die „Protogriechen“ gelten und sich mit der mediterranen Urbevölkerung vermischen.
In der späthelladischen Zeit (1600-1150) beherrscht eine adelige Herrenschicht der eingewanderten Indogermanen, zumeist Streitwagenkämpfer, von gewaltigen Zwingburgen aus das Land.
Ab dem 15. Jhrdt. dehnt die aus dem Norden eingewanderte Schicht ihre Macht bis nach Kleinasien aus, besiedelt auch Kreta, Rhodos, Zypern. Um 1250 erfolgt, vom Dichter Homer besungen, die Zerstörung von Troja VIIa. Aber eine zweite indogermanische Einwanderungswelle rollt in der spätmykenischen Zeit (1400-1150) über Griechenland hinweg: die Einwanderung der Dorer, ab 1200, ausgelöst durch den Vorstoß der Illyrer zum Mittelmeer. Die Dorer als Reiterkrieger mit Eisenwaffen zeigen sich den mykenischen Protogriechen, Streitwagenkämpfern mit Bronzewaffen, im Kampf überlegen: Die mykenischen Burgen, einst stolze Adelssitze, versinken ab 1150 in Schutt und Asche.
Zwei Kulturbereiche, sich durchdringend, prägen demnach die Religion und Mysterienwelt der Griechen: einmal die altmediterrane Bauernkultur mit ihren Jahreslauf- und Vegetationskulten sowie Fruchtbarkeits-, Erd- und Muttergottheiten; dann die Kultur der eingewanderten Indogermanen mit ihren Wetter-, Licht- und Sonnengöttern, wie etwa Zeus und Apollo; hinzu kommen Götter, die aus Fremdländern übernommen wurden, aus Kleinasien oder Thrakien. Seit etwa 1600 v. Chr. verschmelzen in der mykenischen Adelswelt altmediterrane und indogermanische Gottesvorstellungen unter stark minoischem Einfluss.
Aber trotz aller Verschmelzung mit einheimischem Religionsgut blieb die „olympische“ Religion der Griechen immer dem Hohen, Hellen, Lichten zugewandt; sie blieb von ihrer Grundausrichtung her apollinisch. Dieser „Religion in Dur“, wie Thassilo von Scheffer richtig sagt, standen jedoch von jeher die dunklen Moll-Töne einer viel älteren Religion chthonischer Erdverehrung entgegen, die auch in den zum Teil ältesten Mysterienkulten Griechenlands weiterlebten. Über den Kultstätten von Eleusis und Samothrake waltete die Macht uralter Muttergottheiten. Die Orphische Mysterienreligion allerdings, die aus Thrakien, also aus dem nichtgriechischen Ausland, stammt, trägt eher den Charakter einer Jenseitsreligion, obschon sie durchaus von einer „dionysischen“ Grundstimmung getragen wird und insofern auch eher in Moll als in Dur erklingt. An die Orphik, die in vielem an die spätantike Gnosis erinnert, knüpfen Pythagoras und Platon an.
Götter ~ Dämonen ~ Heroen
Vor allem verehre die unsterblichen Götter,
So wie es die Göttliche Ordnung lehrt.
Ehre in frommer Scheu das Gelübde
Und die edlen Heroen, halte sie heilig.
Verehre die in der Unterwelt wirkenden Dämonen,
Indem du opferst, wie es geboten.
Die Goldenen Verse des Pythagoras4
Götter, Dämonen, Heroen – so heißen jene höheren Wesen, die nach Ansicht der Goldenen Verse des Pythagoras vom Menschen verehrt werden müssen; denn religio, Rückbindung an etwas Höheres, Transzendentes, macht das Wesen jeder Religion aus. Aber wer oder was sind die „Götter“? In den verschiedenen indogermanischen Sprachen sind sehr ähnliche Ausdrücke zu finden, die jenes Heilige und Numinose umschreiben, das wir mit dem Begriff „Gott“ verbinden; immer wieder begegnen uns die Wortwurzeln Dis, Deus, Theos, germanisch Tiuz, indisch Dyaus, auch Devas, das heißt „die Leuchtenden“.
Götter sind also Lichtwesen, aber das Licht, das sie ausstrahlen, ist transzendentes Licht, mit dem sie unser Bewusstsein erleuchten, das heißt, uns selbst zum Leuchten bringen. Auch die moderne Quantentheorie sagt ja, dass im Grunde genommen Alles nur Energie ist: die Vorstellung von fester undurchdringlicher Materie erweist sich als Illusion, die durch den blitzschnellen Tanz der Elementarteilchen erzeugt wird. Es gibt aber nur eine Quelle allen Lichtes, und das ist die göttliche Ur- und Zentralsonne des Alls (das „Zentralfeuer“ der Pythagoreer).
Ist Gott der All-Eine, so sind die „Götter“ das aus ihm hervorgegangene All-Viele. Man kann sich durchaus vorstellen, dass es eine Vielzahl von göttlichen Monaden gibt, die doch alle einer höheren Einheit angehören und dieser auch untergeordnet sind. Die Götter mögen sehr machtvolle Wesen sein, dem Menschen in vielerlei Hinsicht überlegen, aber die Götter sind nicht das Höchste im All. Die Götter des Hinduismus (die Devas) gelten als „Himmelswesen“, Bewohner einer der guten Existenzformen, die in den glücklichen Sphären des Himmels leben, aber wie alle anderen Wesen dem Kreislauf der Wiedergeburt unterliegen. Ihnen wurde ein langes und glückliches Leben beschieden als Lohn vergangener guter Taten (Karma!), aber gerade dieses Glück stellt das größte Hindernis auf ihrem Weg zur Erlösung dar. Den Göttern haftet keineswegs Vollkommenheit an, sie sind vielmehr selbst erlösungsbedürftige Wesen, die eine höhere Stufe in der Hierarchie des Universums erklimmen möchten.
In der Mythologie der antiken Völker, auch unserer Vorfahren, werden die Götter oft sehr menschlich dargestellt. Dies mag uns heute vielleicht etwas befremden. Aber der Zusammenhang von Menschenwelt und Götterwelt wurde in der Antike enger gesehen, als wir es uns heute vorstellen können. In den Goldenen Versen des Pythagoras lesen wir:
Du wirst erkennen der unsterblichen Götter
Und der sterblichen Menschen Verbindung,
Die in allem erscheint und alles überwindet.5
Die zentrale Aussage der Goldenen Verse besagt, dass „göttlichen Stammes die Sterblichen sind“, und daran knüpft sich die Verheißung, dass der Erkennende nach Verlassen seines physischen Leibes selbst zu den Göttern gehören wird; er ist dann „ein seliger Gott und kein Mensch mehr“. Gottwerdung durch Erkenntnis also, das ist der Kern der pythagoreischen Geheimschulung – zum Äther aufzusteigen und Unsterblichkeit zu erlangen. Die Wesensverwandtschaft von Göttern und Menschen war den Griechen durchaus geläufig. „Götter und Menschen sind desselben Ursprungs“, erklärte schon um 700 v. Chr. der Mythendichter Hesiod; und Kleanthes sagt, zu Zeus gewandt, in seinem berühmten Hymnus: „Wir sind deines Geschlechts“.
Diesen Gedanken griff der Apostel Paulus auf, als er den Athenern vom unbekannten Gott predigte: „Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige der Dichter bei euch gesagt haben: Wir sind seines Geschlechts“ (Apg. 17,28). Und Pindar von Theben (um 500 v. Chr.): „Ein Stamm: Menschen und Götter; von einer Art ja atmen wir, von einer Mutter wir beiden; doch Macht von ganz verschiedener Art trennt uns.“ Der Mensch also als ein den Göttern verwandtes, göttliches, himmlisches Wesen – das ist der Zentralgedanke jeglicher Esoterik, griechischer ebenso gut wie indischer, ägyptischer oder sonstiger Herkunft. Zwischen Menschen und Göttern besteht nur ein gradueller, kein prinzipieller Unterschied.
Ja selbst im Alten Testament steht: „Ihr seid Götter und allzumal Söhne des Höchsten“ (Psalm 82, 6-7). Was der Psalmist hier sagt, ist uns nicht neu. Im Gegenteil, es ist uralte esoterische Weisheit, bekannt schon den antiken Mysterien, den griechischen Philosophen, den Juden und den Heiden, vor allem aber den Mystikern, Hermetikern, Esoterikern und Theosophen aller Zeiten und Länder. Wir Menschen sind Himmelssöhne, Gottessöhne, ein gefallenes Engelsgeschlecht, Götter in der Verbannung. Das haben sie alle gewusst, die Gnostiker, Manichäer, Katharer, Albigenser, die von der Kirche Verfolgten, Geächteten, ja Verbrannten, auf den Scheiterhaufen des Mittelalters, dieweil die Kirche selber sich nicht mehr erinnern wollte oder konnte an jenes Schriftwort, das da besagt, dass wir alle Götter sind und allzumal Söhne des Höchsten.
Und nun müssen wir auf die Dämonen zu sprechen kommen. Denn diese gilt es ja neben den Göttern auch zu verehren. Die alten Griechen hatten die Vorstellung von einem Dämon, der dem Menschen beigesellt ist und ihn auf seinem Lebensweg unsichtbar begleitet. Der Mensch hat sich diesen Dämon selbst erwählt; er ist sein Hüter, sein Höheres Selbst, seine Innere Stimme, der lebenslange Begleiter auf dem Pfad der Inkarnation. Bei Platon, und zwar in seinem Hauptwerk Politeia, steht der Satz: „Nicht der Dämon wird euch erlosen; ihr selber sollt euch einen Dämon wählen“ – Der Begriff „Dämon“ mag dem heutigen Leser vielleicht befremdlich erscheinen. Doch muss man berücksichtigen, dass das Wort daimon erst nachträglich einer Sinnänderung unterzogen wurde, indem es ursprünglich eine göttlichnuminose Macht, später aber etwas Antigöttliches, „Dämonisches“ bezeichnete. Dieser Bedeutungswandel geht insbesondere auf das Christentum zurück, das seit den Kirchenvätern eine eigene Dämonologie herausbildete, in der mythische Gestalten der heidnischen Antike umgedeutet und einer fiktiven Gegenwelt Satans zugeordnet wurden.
Wir wollen jedoch auf den ursprünglichen, antiken, nicht durch das Christentum verfälschten Sinn des Wortes „Dämon“ zurückgehen. Unter „Dämonen“, daimones, verstanden die Griechen halbgöttliche Wesen, die als Mittlerwesen zwischen den Menschen und Göttern fungierten. Diese Anschauung, wohl die der Volksreligion, wird bei Platon in seinem Dialog Das Gastmahl wiedergegeben. Dort heißt es: „Das Reich der Dämonen liegt zwischen Göttern und Menschen. (….) Sie vermitteln den Göttern die Gebete und Opfer der Menschen, den Menschen überbringen sie den Willen der Götter und die Gegengaben für Opfer. Sie füllen die Kluft zwischen beiden, sodass sich das All zusammenfügt. Durch sie vollzieht sich jede Seherkunst und die Weisheit der Priester bei Opfern und Weihen und Beschwörungen und bei jeglicher Wahrsagung und Zauberei. Gott steigt nicht zum Menschen hernieder, – nur durch Dämonen gibt es Verkehr und Zwiesprache der Götter mit den Menschen, im Wachen und im Traum. Wer weise ist in diesen Dingen, der ist ein dämonischer Mensch; dagegen ist ein Banause, wer sonst in einer Kunst oder einem Handwerk Bescheid weiß.“6
Der Begriff des Daimon hat in der griechischen Religionsgeschichte eine durchaus wechselnde Bedeutung gehabt. Bei Homer begegnen wir den halbgöttlichen Dämonen, aber noch ganz in die Außenwelt projiziert; in jüngerer Zeit verschiebt sich der Begriff des Daimon mehr in das Innere des Menschen, wenn z. B. Heraklit den innersten Charakter des Menschen als seinen Daimon bezeichnet. Zugleich wachsen die Einzelgestalten der Dämonen zu dem eher abstrakten Neutrum des daimonion („das Dämonische“) zusammen. In diesem Sinne spricht Sokrates in seiner berühmten Verteidigungsrede vor Gericht von seinem „daimonion“ als einer Inneren Stimme, die ihn als eine Art Ratgeber durch das Leben begleitet; er spricht davon, „dass ein Göttliches und Dämonisches zu mir kommt, von dem ich euch mehrmalen und verschiedentlich gesprochen habe (….). Mir ist es von Jugend auf geschehen, dass sich mir eine Stimme hat hören lassen, und wenn sie sich hören lässt, so hält sie mich immer ab von dem, was ich tun will, treibt mich aber niemals an.“7
Die Dämonen besaßen in Griechenland keinen eigenen Kult; die späteren Philosophen – vor allem Sokrates – setzten sie mit dem Göttlichen im Menschen bzw. mit der inneren göttlichen Stimme gleich. Eine weitere Entwicklung des Begriffs lag darin, der der „Dämon“ als der persönliche Schutzgeist gedacht wurde, der jeden Einzelnen auf seinem Lebensweg begleitete und ermächtigt war, menschliches Schicksal zum Guten oder Bösen zu wenden. Vielfach wollte man den „Dämon“ für alles Verhängnisvolle verantwortlich machen, der in diesem Sinne dem Begriff „Tyche“ (Schicksal) nahekam. Auch die Römer kannten einen persönlichen Schutzgeist des Menschen, den sie den Genius nannten; er begleitete den Menschen sein ganzes Leben hindurch. Er wurde am Geburtstag der jeweiligen Person gefeiert und meist als Schlange dargestellt.
Platon sieht den Daimon als Innere Stimme, Ratgeber und Lebensbegleiter des Menschen. Dieser Ansicht hat er mehrfach in seinem Werk Ausdruck gegeben. Nehmen wir nur folgende Stelle: „Wer sagt dir denn, dass du gerade so große Macht habest wie Zeus? Nichtsdestoweniger hat er einem jeden einen Aufseher an die Seite gestellt, nämlich den Daimon eines jeden, und diesem hat er seine Bewachung anvertraut, und zwar ohne dass er schlummert oder sich hintergehen lässt. Denn wo sonst gäbe es einen besseren oder sorgsameren Wächter, dem er einen jeden von uns hätte anvertrauen können? Darum, wenn ihr die Türen verschließt und das Zimmer finster macht, so lasst euch doch niemals einfallen zu sagen: Jetzt sind wir allein. Denn ihr seid es nicht, sondern Gott ist bei euch drinnen und euer Schutzgeist (Daimon). Die bedürfen des Lichtes nicht um zu sehen, was ihr tut. Diesem Gotte solltet auch ihr einen Eid schwören, wie die Soldaten dem Kaiser.“ (Phaidon 107 d)8
Nach den Göttern und Dämonen wären nun an dritter Stelle die Heroen zu nennen. Wer sind die Heroen? Und welche Rolle spielen sie in der griechischen Mythologie? Vereinfacht ausgedrückt: Heroen sind sterbliche Menschen, durchaus mit historischer Existenz, aber solche, die den „Glanz des Göttlichen“ an sich tragen – die später, am Ende ihrer Laufbahn, zu den Göttern entrückt wurden und in ihrem Kreise fortan weilten. Wie es Karl Kerenyi treffend sagt: „Der Glanz des Göttlichen, der auf den Heros fällt, ist eigentümlich vermischt mit dem Schatten der Sterblichkeit.“9 Heroen sind also, kurz gesagt, vergöttlichte Menschen – Halbgötter, kultisch verehrte Stammväter von Geschlechtern, Städtegründer und Kulturbringer. Sie wohnten auf den Inseln der Seligen oder auf dem Olymp und genossen hohes Ansehen. Heroen waren beispielsweise Kadmos, der Begründer von Theben, Herakles, Theseus, Achilles, die Argonauten und die Helden des Trojanischen Krieges.
Schöpfungsmythen
Damals war nicht das Nichtsein, noch das Sein
Kein Luftraum war, kein Himmel drüber her. –
Wer hielt die Hut der Welt? wer schloss sie ein?
Wo war der tiefe Abgrund, wo war das Meer?
Nicht Tod war damals, nicht Unsterblichkeit,
Nicht war die Nacht, der Tag nicht offenbar. –
Es hauchte windlos in Ursprünglichkeit
Das Eine, außer dem kein andres war.
Von Dunkel war die Welt bedeckt,
Ein Ozean ohne Licht, in Nacht verloren; -
Da ward, was in der Schale war versteckt,
Das Eine durch der Glutpein Kraft geboren.
Aus diesem ging hervor, zuerst entstanden,
Als der Erkenntnis Samenkeim, die Liebe; -
Des Daseins Wurzelung im Nichtsein fanden
Die Weisen, forschend in des Herzens Triebe.10
Kosmogonische Vorstellungen des Rigveda
In den Schöpfungsmythen geht es um den Ursprung der Welt und um das Werden der Götter, Menschen und anderen Naturwesen, die den Kosmos als Ganzen beseelen; dabei wird der Weg gezeichnet, der von einem formlosen Urzustand bis zu dem wohlgeordneten Kosmos der Jetztzeit führt. Bezeichnend für die Sichtweise des Rigveda ist die Suche nach einem einheitlichen Ursprung des Weltganzen. Und ansatzweise ergibt sich aus diesem Suchen die Vorstellung von dem sichselbstgebärenden Einen, die später in den Upanishaden eine so große Bedeutung gewinnen wird: „Das Eine, außer dem kein andres war“.
Das Weltschöpfungslied ist ohne Zweifel das denkerisch tiefste unter den kosmogonischen Liedern des Rigveda; der anonyme Dichter will keine eigentliche Schöpfungslehre aufstellen, sondern ihn interessiert nur das Problem, wie denn die reale Welt aus dem Nichts entstanden sei. Da aber aus dem Nichtsein niemals irgendetwas hervorgehen kann, meint der Dichter, dass es ursprünglich weder Sein noch Nichtsein gab, sondern einen Zustand jenseits von beidem. „Weder Nichtsein noch Sein war damals; nicht war der Luftraum noch war der Himmel darüber. Was strich hin und her? Wo? In wessen Obhut? Was war das unergründliche tiefe Wasser?“11 In diesem pralayaischen Zustand universaler Latenz webte das Eine, das die Welt aus sich selbst gebar – der universelle Weltenkeim aller Dinge. Liebesverlangen überkam das Eine, Werdelust packte es, und so entfaltete sich das All aus dem Einen; am Anfang stand also der kosmogonische Eros.
Ein immer wiederkehrendes Denkbild aus dem Rigveda ist die Vorstellung von einem Urmenschen. Mit anderen Worten, die Einheit der Welt wird daraus erklärt, dass sie aus einem einzigen Urindividuum entstanden sei. Dieses Urwesen ist Purusha („ein Mannsbild von riesenhaftem Ausmaß“ nennt ihn Geldner), und das Lied schildert seine Geburt und Weltwerdung, seine weltumspannende Größe, und dann sein Geopfertwerden durch die Götter – aus den Gliedern seines getöteten Leibes formen sie die verschiedenen Teile der Welt. Dieser Mythos vom kosmischen Menschen, vom All- und Urmenschen als Urgrund der Schöpfung, ist Gemeingut aller alten Völker, ein Bestandteil jener esoterischen Geheimlehre, die in Urzeiten über die ganze Welt verbreitet war. Dem vedischen Purusha entspricht der jüdische Adam Kadmon, der persische Gayomard, der altnordische Ymir, ja sogar noch ältere Vorbilder aus eurasischer Vorzeit (Pangu in der chinesischen Mythologie). Auch erhält der Opfergedanke im Purusha-Mythos größere Bedeutung: durch Opfer ist die Welt entstanden – durch Opfer wird sie aufrechterhalten.
Zunächst einmal ist, nach Aussage des Rigveda, der Purusha identisch mit dem Makrokosmos: „Purusha allein ist diese ganze Welt, die vergangene und die zukünftige, und er ist der Herr über die Unsterblichkeit“12. Sodann wird der Urmensch geopfert, in Teile zerlegt und aus diesen die Welt geformt, sodass sich eine vollständige Analogie zwischen Makrokosmos und Mikrokosmos ergibt; den Gliedern des Makromenschen entsprechen die Glieder der Welt: „Der Mond ist aus seinem Geist entstanden, die Sonne entstand aus seinem Auge; aus seinem Munde Indra und Agni, aus seinem Aushauch entstand der Wind. Aus dem Nabel ward der Luftraum, aus dem Haupte ging der Himmel hervor, aus den Füßen die Erde, aus dem Ohre die Weltgegenden. So regelten sie die Welten.“13 Unser ganzes Universum wäre somit der Leib eines Großen Menschen. Ein ganz ähnliches Gedankenbild finden wir in der germanischen Mythologie, der dieselben urindoeuropäischen Mysterien zugrunde liegen wie dem Rigveda. In der aus Island stammenden Sammlung Edda, nordische Götterlieder, begegnen wir dem Urriesen Ymir, der auch von den Göttern geopfert wurde, um die mikrokosmische Welt daraus zu formen:
Aus Ymirs Fleisch ward die Welt geschaffen,
aus dem Gebein das Gebirg,
der Himmel aus dem Schädel des schneekalten
Riesen, die Brandung aus dem Blut.14
Der Begriff purusha hat in der späteren indischen Religionsphilosophie noch eine andere Bedeutung angenommen. In der Sankhya-Philosophie bezeichnet er in Abgrenzung gegen prakriti, die Materie, das Selbst, das Absolute oder das reine Bewusstsein; im Vedanta ist Purusha dann identisch mit dem Atman und somit auch mit dem Brahman. Das Purusha-Lied bildet nach P. Deussen den krönenden Abschluss der Philosophie des Rigveda, es ist sicherlich auch eines der jüngsten Hymnen in der ganzen Sammlung, da es als einziges die vier Hauptkasten erwähnt, die es ebenfalls aus dem Purusha hervorgehen lässt15.
Ein anderes Schöpfungslied stellt die Frage nach dem ungenannten Urgott in den Vordergrund. Die erst viel später angefügte Schlussstrophe gab ihm den Namen Prajapati. Da der Urgott und erste Schöpfer aber nicht unter den bekannten Göttern zu finden ist, wird als Refrain die Frage aufgeworfen, welchem Gott denn nun diese Ehre zukomme („Wer ist der Gott, dem wir mit Opfer dienen sollen?“). Dieses Lied enthält auch eine Kosmogonie, da von dem unbekannten Schöpfergott gesagt wird: „Im Anfang wurde er zum goldenen Keim. Geboren ward er der alleinige Herr der Schöpfung. Er festigte die Erde und diesen Himmel“16. Der Goldkeim – hiranyagarbha – ist die Vorstufe des goldenen Eies der späteren Kosmogonien, der als Keim im Urwasser treibt und nach seiner Befruchtung durch den Strahl des Logos die Welt aus sich hervorbringt.
Der babylonische Schöpfungsmythos
Der älteste babylonische Schöpfungsmythos, den wir besitzen, der Enuma Elisch, niedergelegt auf sieben Keilschrift-Tontafeln mit je etwa 150 Versen, stammt bereits aus einer Spätzeit, zwischen dem 19. und dem 17. Jh. v. Chr.; er reflektiert den Sieg des Patriarchats über das Matriarchat und zeigt das Bestreben, den babylonischen Stadtgott Marduk als den höchsten Herrn des Universums auszuweisen. Als die beiden Urmächte des Chaos werden die Große Göttin Tiamat, die Herrin des Meers, und der Gott des Süßwassers Apsu genannt; aus diesen entstehen spätere Generationen von Göttern, bis hin zu Marduk als dem Letzten und Jüngsten, der die kosmische Urmutter Tiamat tötet und aus ihrem Leib die Welt formt, aus der oberen Hälfte der Himmel und aus der unteren die Erde; auch die Sternbilder werden an den Himmel gesetzt und das Zeitmaß ihres Laufes festgesetzt. Als das Dokument einer „patriarchalischen Kulturrevolution“ im 2. Jahrtausend v. Chr. soll dieser Schöpfungs-Urmythos hier einmal, wenn auch leicht gekürzt, in vollem Wortlaut zitiert werden17:
Als droben die Himmel nicht genannt waren,
als unten die Erde keinen Namen hatte,
als selbst Apsu, der Unanfängliche,
der Erzeuger der Götter,
und Mummu Tiamat, die sie alle gebar,
ihre Wasser in eins vermischten,
als das abgestorbene Schilf
sich noch nicht angehäuft hatte,
Rohrdickicht nicht zu sehen war,
als noch kein Gott erschienen,
mit Namen nicht bekannt,
Geschick ihm nicht bestimmt war,
da wurden die Götter aus dem Schoß
von Apsu und Tiamat geboren ….
Aber das Urgötterpaar Apsu und Tiamat fühlt sich schon bald durch das lärmende Treiben der jungen Götterkinder belästigt; deshalb beschließen sie, die störende Nachkommenschaft kurzerhand zu beseitigen:
Es kamen zusammen die Brüder, die Götter,
zu stören Tiamat durch ungeordnetes Treiben.
Sie verwirrten tatsächlich Tiamats Gemüt,
da sie tanzend umhersprangen,
sie dämpften ihr Geschrei auch nicht vor Apsu.
Tiamat schwieg angesichts ihres Aufruhrs,
doch ihr Treiben war Apsu zuwider,
ihr Wandel missfiel ihm,
denn sie waren groß geworden ….
Sie berieten die Sache wegen der Götter,
Ihrer Erstgeborenen.
Apsu tat seinen Mund auf,
mit lauter Stimme sprach er zu Tiamat:
'Unerträglich ist mir ihr Verhalten.
Tagsüber kann ich nicht ruhen,
nachts kann ich nicht schlafen.
Ich will sie vernichten,
um ihrem Treiben ein Ende zu machen.
Stille soll herrschen, damit wir ruhen können.'
Man sieht hier die kosmische Dimension des Mythos, dass sich die alten Mächte des Chaos und der Urschöpfung durch das neu aufsprießende Leben bedroht fühlen. In einem ersten Kampf besiegt Ea den zunächst betäubten Apsu und wird dadurch zum Gott des Wassers. Mit der Kraft des Siegers zeugt er Marduk, den neuen kommenden Gott; Tiamat aber bereitet sich zum Kampf vor, der nun unvermeidlich ausbrechen muss. Zahllose Ungeheuer brachte nun Tiamat, die selbst als ein großer Seedrache dargestellt wird, selbstschöpferisch hervor, Schlangen, Drachen, Löwen, Skorpionmenschen und Sturmdämonen, um sie gegen die jungen Götter ins Feld zu schicken. Den nun folgenden Endkampf mit Marduk schildert das Epos in ausführlicher Dramatik:
Marduk, der Herr, erhob den Zyklon,
seine gewaltige Waffe,
und der Tiamat, die Versöhnung heuchelte,
rief er zu: 'Warum sprichst du freundliche Worte,
da du dich zum Angriff gerüstet?
Die Söhne haben sich getrennt,
ohne Achtung vor ihren Erzeugern,
denn du, die sie geboren,
hast jedem mütterlichem Sinn entsagt ….
Wider die Götter, meine Väter,
hast du deine Bosheit gerichtet.
Deine Truppe mag sich ausrüsten
oder dir die Waffen anlegen!
Begegnen wir uns lieber im Zweikampf!'
Als Tiamat dies hörte,
geriet sie außer sich, verlor den Verstand.
Sie stieß ein lautes Gebrüll aus,
rief eine Beschwörung und einen Zauberspruch.
Dann stießen zusammen Tiamat und Marduk,
der weiseste der Götter,
stürzten sich aufeinander,
und begegneten sich im Kampf.
Marduk breitete sein Netz aus,
fing darin Tiamat, ließ vor ihr los den Sturm,
den er vom Himmelsgott erhalten hatte,
als Tiamat ihn verschlingen wollte,
warf er den Sturm in ihren Schlund,
damit sie die Lippen nicht schließen konnte.
Die grimmigen Winde füllten ihren Leib.
Ihr Leib blähte sich auf, ihr Mund blieb offen.
Er schoss einen Pfeil ab, zerriss ihr den Bauch,
Ihr Inneres zerfetzte er
und durchbohrte ihr Herz.
Als er sie bezwungen hatte,
setzte er ihrem Leben ein Ende…..
Weitere Verse schildern, wie Marduk aus dem Leib der Tiamat die Welt erbildet, aus der oberen Hälfte das Himmelsgewölbe, das er in die Abschnitte der Sternbilder einteilt, wobei er auch den Gang von Sonne und Mond bestimmt und dem Gott Ea einen Himmelspalast zuweist. Aus der unteren Hälfte aber wurde die Erde gestaltet, aus dem Kopf der Tiamat ein hoher Berg, ihren Augen entspringen die Flüsse Euphrat und Tigris, aus ihrer Brust entsteht eine Hügellandschaft. Mit der Erschaffung der Menschen aus dem Blut eines geopferten Gottes endet der gewaltige Weltschöpfungs-Epos.
Der altjapanische Schöpfungsmythos
Im Mittelpunkt der altjapanischen Mythologie steht das Götterpaar Izanagi und Izanami, das mit dem himmlischen Juwelenspeer in der Salzflut rührte, bis diese sich verdickte und die Erde daraus entstand; danach ließen sie weitere Gottheiten aus sich hervorgehen, darunter die Sonnengöttin Amaterasu sowie den Mondgott und den Gott des Meeres. In einer modernen Nacherzählung liest sich dieser Schöpfungsmythos so:
Am Anfang waren Himmel und Erde nicht getrennt. Dann spross aus dem Ozean des Chaos ein Schilfrohr; das war der ewige Landbeherrscher Kunitokotatchi. Dann kamen die Göttin Izanami und der Gott Izanagi. Sie standen auf der schwimmenden Himmelsbrücke und rührten mit einem juwelenbesetzten Speer im Ozean, bis er gerann. So schufen sie die erste Insel, Onokoro. Sie bauten auf dieser Insel ein Haus mit einem Steinpfeiler in der Mitte; das ist das Rückgrat der Welt. Izanami ging in einer Richtung um den Pfeiler und Izanagi in der anderen. Als sie sich wieder gegenüberstanden, vereinigten sie sich; das war ihre Hochzeit. Ihr erstes Kind nannten sie Hiruko, aber es gedieh nicht sehr gut. Deshalb setzten sie ihn, als er drei Jahre alt war, in einem Schilfkahn aus; er wurde Ebisu, der Gott der Fischer. Danach gebar Izanami die acht Inseln Japans.18
Soweit also, frei nacherzählt, der Schöpfungsmythos aus dem Buch Kojiki, der „Sammlung der Dinge“, das im 8. Jahrh. n. Chr. auf Geheiß der Kaiserin Gemmyo zusammengestellt wurde. Mehrere Gesichtspunkte sind hierbei sehr bemerkenswert, und sie verdienen es, genauer hervorgehoben zu werden:
Izanami und Izanagi sind ein Götterpaar, und somit stellen sie eine männlich-weibliche Polarität dar. Es war also nicht ein isolierter männlicher Schöpfergott, der die Welt hervorgebracht hat, wie es in den Traditionen des Patriarchats so gesehen wird, sondern die Weltwerdung geht auf die Tat einer mann-weiblichen Paargenossenschaft zurück. Izanami und Izanagi verkörpern in diesem Sinne auch Yin und Yang, die mann-weibliche Ur-Polarität.
Die „schwimmende Himmelsbrücke“, auf der sie beide stehen, ist ohne Zweifel der Regenbogen, der in der religiösen Mythologie der Völker eine so große Rolle spielt. Seit jeher galt der Regenbogen als die Brücke zum Reich der Götter. In der germanischen Mythologie haben wir etwa die Himmelsbrücke Bifröst, auf der die Götter zur Erde herabsteigen. Die Regenbogenbrücke Antahkarana gilt als die Brücke zur Geistigen Welt.
Wenn die beiden Götter nun mit Hilfe eines Juwelenspeers die Salzflut aufrühren, so ist dies eindeutig eine Anleihe aus der indischen Mythologie. Dort wird nämlich berichtet, wie die Götter einst den Urozean aufquirlten, bis sie auf seinem Grunde Amrita, das Wundermittel der Unsterblichkeit, fanden.
Wenn es in der Erzählung heißt, die Götter bauten auf der erstgeschaffenen Insel ein Haus mit einem Steinpfeiler in der Mitte, der „das Rückgrat der Welt“ ist, so verweist dies auf eine uralte Vorstellung, nämlich die den Himmel stützende Weltsäule. Sie wird auch die Weltachse oder axis mundi genannt. Zu diesem Thema schreibt Nelly Naumann in ihrem Buch Die Mythen des alten Japan: „Nach der Vorstellung nordasiatischer Völker wird der Polarstern, um den sich das Himmelsgewölbe dreht, geradezu als Himmelssäule angesehen oder doch als der Punkt, in dem sich der Himmel um die Weltsäule dreht. Diese Welt- oder Himmelssäule steht vor der Wohnung des ,Himmelsgottes’ und wird teilweise mit dem Himmelsgott selbst identifiziert. Verschiedene sibirische Völker haben Bilder der Himmels- oder Weltsäule angefertigt (…). Auch hier zeigt sich demnach eine Bilderwelt, die derjenigen des japanischen Mythos gleicht.“19
Als ein weiteres mythisches Motiv wäre das der Heiligen Hochzeit zu nennen. Denn es wird berichtet, dass Izanami und Izanagi den Weltenpfeiler in je umgekehrter Richtung umgehen, bis sie in der Mitte wieder zusammentreffen; dies ist der Ort der Vereinigung, aus der weitere Götterkinder hervorgehen, vor allem Ebisu, der Gott der Fischer, und die acht Inseln Japans. An dieser Stelle geht der Mythos in Theogonie über, in die Lehre von der Gottwerdung und der Aufeinanderfolge der Göttergenerationen. Bei diesen Göttern handelt es sich um kosmische Götter, also um solche, die ganz direkt mit dem Naturgeschehen zu tun haben, nicht aber um transzendente Mächte.
Die hesiodische Theogonie
Hesiod (um 700 v. Chr.) war ein altgriechischer Bauerndichter aus Askra in Böotien, der das homerische Zeitalter durch zwei Hexametergedichte entscheidend ergänzte: Werke und Tage, 828 Verse und Theogonie, 1022 Verse, ein Werk, in dem erstmals eine systematische Darstellung der griechischen Götterwelt gewagt wird. Er bringt Ordnung und System in das bunte Göttergewoge Homers, stellt Zeus ganz in den Mittelpunkt, gibt auch einen Querschnitt durch die Entwicklung, indem er die ganze Reihe der aufeinander folgenden Götter-Generationen darstellt, von der ersten Urzeit bis zur Vollendung in der Gegenwart. Und wenn man sagt, dass Hesiod den Griechen ihre Götterwelt erst gegeben habe, dann muss man bedenken, dass er auch an vorindogermanisch-pelasgische Mythen anknüpft; ein Einfluss aus dem Orient ist zudem unverkennbar.
Am Anfang seiner Theogonie schildert Hesiod seine Berufung durch die Musen, diese nämlich „lehrten einst den Hesiod schönen Gesang, als er Schafe weidete unter dem gotterfüllten Helikon“; sie händigen ihm den Rhapsoden-Stab aus und den Lorbeerkranz, als Hoheitszeichen seines Dichtertums, und dann hauchten sie ihm „eine weissagende Stimme ein, damit ich rühme, was sein wird und was vorher war“. Die Musen waren die inspirierenden Schutzgeister der Dichter; es gab neun an der Zahl, und die erste unter ihnen war Mnemosyne, das heißt die „Erinnerung“, das „Weltgedächtnis“ oder, esoterisch gesprochen, die Akasha-Chronik. Hesiod versteht sich also auch als ein Prophet, der um Zukünftiges wie um Vergangenes weiß, weil er aus dem Tableau der Welt-Erinnerung schöpft. Und nun beginnt Hesiod mit seinem gewaltigen Weltschöpfungsmythos. Er fängt an bei einem Urzustand, in dem es selbst die Götter noch nicht gab; sie waren noch nicht ins Sein getreten, es gab nur wogende Urmächte, die aus tiefsten Gründen auftauchen und ein formloses Material zu der Welt formen, wie wir sie heute kennen:
Wahrlich, zuerst entstand das Chaos und später die Erde, breitgebrüstet, ein Sitz von ewiger Dauer für alle Götter, die des Olymps beschneite Gipfel bewohnen und des Tartaros Dunkel im Abgrund der wegsamen Erde, Eros zugleich, er ist der schönste der ewigen Götter; lösend bezwingt er den Sinn bei allen Göttern und Menschen tief in der Brust und bändigt den wohlerwogenen Ratschluss. Aus dem Chaos entstanden die Nacht und des Erebos Dunkel, aber der Nacht entstammten der leuchtende Tag und der Äther, schwanger gebar sie die beiden, von Erebos‘ Liebe befruchtet.20
Hesiod führt uns hier den Zustand der Urschöpfung vor Augen. Und es ist eine interessante Tatsache, dass er als ersten Ursprung das Chaos setzt. Der Wortbedeutung nach heißt „Chaos“ so viel wie „Spalt, Höhlung“, das dazu gehörige Verb bedeutet „aufsperren, aufklaffen, gähnen“, es ist also eine klaffende Tiefe, ein gähnender Abgrund. Aber dieses Chaos ist auch ein schöpferisches Prinzip, eine Art kosmische Gebärmutter: die Nacht und der Erebos gehen aus ihm hervor, die ihrerseits zusammen den Tag und den Äther erzeugen. Allenthalben ist das Motiv der „Heiligen Hochzeit“ allgegenwärtig. Es ist die mystische Union von Nacht und Erebos, später dann auch die von Erde und Himmel. Eros ist dabei immer gegenwärtig, er fungiert als der kosmogonische Eros, als die allverbindende Kraft im Universum, die alle Polaritäten zusammenbringt und damit die Heilige Hochzeit überhaupt erst ermöglicht.
Auch vom Tartaros ist im obigen Text die Rede. Er ist der tiefste Abgrund des antiken Welt-Kosmos; auch er gehört, wie das Chaos und die Erde, zu den Urzeugungsmächten, die seit Anbeginn bestanden; einsam steht er da, ohne Stammeltern und ohne Kinder; nur mit der Erde zeugt er das Ungeheuer Typhoeos. Streng genommen gibt es hier zwei Götter-Stammbäume, einmal die Kinder des Chaos (Nacht, Erebos, Tag, Äther), und dann die der Erde, die mit dem Himmel die Titanen und alle späteren Göttergeschlechter erzeugt. „Griechische Schau der Welt, griechisches Lebensgefühl kündet sich hier, gleich zu Beginn der Götterfolge an: ein zweifacher Ursprung, zwei polare Bereiche: Unform und Form, abgründige Tiefe und klare, feste Begrenzung; vage Todesdunkelheit … und gleichmäßig wandelnde Gestirne bestehen nebeneinander. Sie mischen sich nicht, die Nachkommenschaften von Chaos und Gaia gehen keine Verbindung ein, aber sie bekämpfen sich auch nicht, es ist kein Agon zwischen Unform und Form, zwischen den Ausgeburten des Chaos und den Kindern der Gaia.“21
Ge ~ Gäa ~ Gaia
C