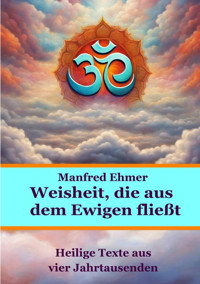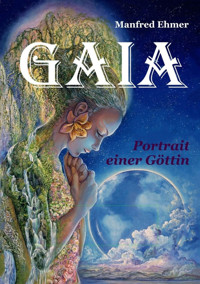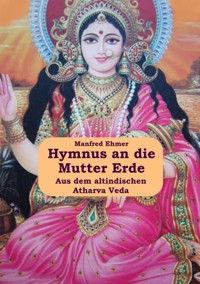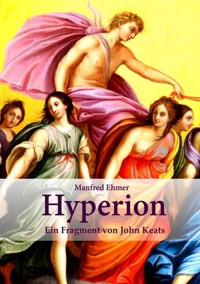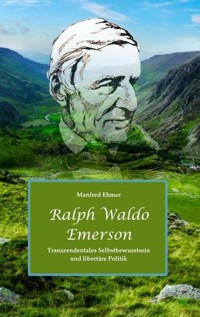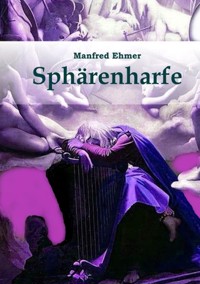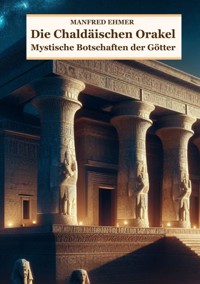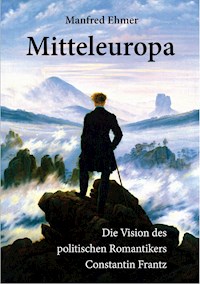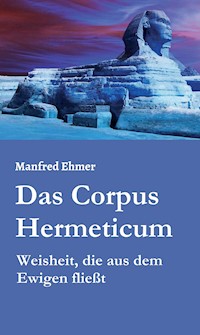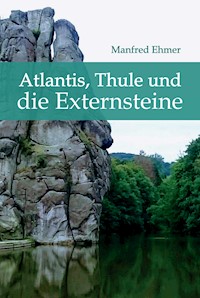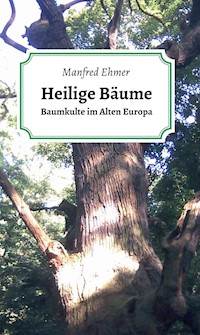2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Edition Theophanie
- Sprache: Deutsch
Von den Sängern Gottes handelt vorliegendes Buch - von den Dichtern, Sehern, Mystikern und Eingeweihten aller Zeiten. Wirkliche Dichtung ist ein Weg zum kosmischen Bewusstsein, zum All-Einheits-Bewusstsein der Mystiker. Der Dichter muss das ganze Welten-All in sein Inneres hineinnehmen, muss das Schicksal der ganzen Welt mittragen, mit allen Wesen mitfühlen, um den vielfältigen Stimmen des Seins Ausdruck zu verleihen. Dieses Buch zeigt das große Panorama der spirituell inspirierten Werke der Dichtkunst, von den ältesten indischen Veden bis zur Periode der Romantiker und Klassiker.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Manfred Ehmer
Die Weisheit der Dichter
Esoterik und Theosophie in den Werken der Dichtkunst
© 2017 Manfred Ehmer
Titelbild: The Skies ~ Pegasus RP. Quelle: 52DazheW.com
Abbildungen S. 115, 133, 155: Wikipedia Commons
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
Dieses Buch erscheint in der Reihe edition theophanie
ISBN: 978-3-7439-1462-9 (Paperback)
ISBN: 978-3-7439-1463-6 (Hardcover)
ISBN: 978-3-7439-1464-3 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Besuchen Sie den Autor auf seiner Homepage:
www.manfred-ehmer.net
Inhaltsverzeichnis
Der Dichter als Mittler zu den Göttern
Die neun Musen – ein Einweihungsweg
Die Veden – Urgestein altindischer Dichtung
Die Upanishaden – Perlen religiöser Poesie
Das Ramayana – Indiens großes Märchenepos
Der Sonnengesang des Pharao Echnaton
Gilgameschs Suche nach Unsterblichkeit
Homers Odyssee – ein Einweihungweg
Die Goldenen Verse des Pythagoras
Dantes Göttliche Komödie in geistiger Sicht
Das Vermächtnis der deutschen Klassiker
Kosmische Mystik in den Oden Klopstocks
Lessing – Freigeist und Esoteriker
Goethes Gedicht ‘Die Geheimnisse’
Friedrich Hölderlin – Prophet der Götter
Der magische Idealismus bei Novalis
Friedrich Rückert und die Weisheit des Ostens
Rabindranath Tagore – der Meisterdichter Indiens
William B. Yeats – Dichter, Mystiker und Theosoph
Das Mysterium der Sprache
Anmerkungen und Zitate
Der Dichter als Mittler zu den Göttern
Doch uns gebührt es, unter Gottes Gewittern,
Ihr Dichter, mit entblößtem Haupte zu stehn,
Des Vaters Strahl, ihn selbst, mit eigner Hand
Zu fassen und dem Volk, ins Lied gehüllt,
Die himmlische Gabe zu reichen.
Friedrich Hölderlin
In gewisser Weise gilt auch heute noch, dass der wahrhaftige Dichter ein Mittler ist zwischen Göttern und Menschen, Oben und Unten, Geist und Stoff. Das Mittleramt der Dichter liegt im Wesen der Dichtkunst selbst beschlossen. Wirkliche Dichtkunst ist nie bloß Handwerk, sondern Auftrag, Berufung. Der Philosoph Platon (427–347 v. Chr.) sprach in seinem Dialog Phaidros von einem „poetischen Wahnsinn“, der – als ein Geschenk der Götter – den Menschen einfach überkomme, ungerufen, um die Seele in einen verzückten Zustand zu erheben, in dem sie sich nur noch in Dichterworten zu äußern vermag. Allein dieser furor poeticus macht nach Platon das Wesen der Dichtkunst aus, nicht aber erlernte Kunst: „Wer aber ohne diesen Wahnsinn der Musen in den Vorhallen der Dichtkunst sich einfindet, meinend, er könne durch Kunst allein zum Dichter werden, ein solcher ist selber uneingeweiht und auch seine, des Verständigen, Dichtkunst wird von der des Wahnsinnigen verdunkelt.“1
Platon unterscheidet zwischen einem krankhaften Wahnsinn, der den von ihm Befallenen in den Untergang treibt, und einem heilsamen, ja göttlichen Wahnsinn, der die Menschen aus ihrer gewohnten irdischen Sphäre heraushebt und sie zu außerordentlichen Leistungen antreibt. Als Beispiele hierfür nennt Platon die Prophetinnen von Delphi, die Priesterinnen von Dodona und die Sibyllen – denn auch die Wahrsagekunst entspringt, wie die Dichtkunst, dem göttlichen Wahnsinn. Und ist der Dichter nicht auch ein „Wahrsager“, in dem Sinne, dass er die „Wahrheit“ spricht? Das Dichten, soweit es inspiriert ist aus der geistig-göttlichen Welt, gleicht einem hohepriesterlichen Amt. Ein solches Amt kann sich niemand selbst anmaßen; es kann nur von höherer Macht verliehen werden. Von Hesiod (um 700 v. Chr.) wird berichtet, wie er am Berg Helikon die Schafe hütend von den Musen zum Dichter berufen wurde – sie gaben ihm als Zeichen seiner neuen Hoheitsmacht einen Lorbeerzweig und den Rhapsodenstab, das Wahrzeichen des wandernden Sängers. „Ein Stab, das Zepter, gehört den Königen zu, aber auch Herolde, Priester und Propheten tragen ihn; das Gemeinsame ist das Zeichen höherer, gottgegebener, vom Menschen zu scheuender Vollmacht.“2
Wie jeder wahrhaft berufene Dichter ein Eingeweihter sein muss – denn nur ein solcher kann an die Sphäre der reinen Urworte heranreichen –, so stellt die Dichtkunst eigentlich ein Mysterium dar, dessen Vollzug das Wunder göttlich-menschlicher Kommunion vollbringt. Die Dichter der ältesten Zeit, Homer, Orpheus, die Verfasser der altindischen Veden, waren in der Tat Eingeweihte: Seher und Priester, angefüllt von göttlicher Schau. Und die ältesten Gedichte waren – Hymnen an die Götter! Bis auf den heutigen Tag schöpft die Dichtkunst aus der Kraft des Mythos; die Götter der alten Zeit bleiben in ihr noch lebendig, verwandeln sich zumindest in Schemen und Sinnbilder, die das Gefüge der Verse und Strophen geheimnisvoll durchweben. Was bedeutet es, Dichter zu sein in der heutigen, der modernen Zeit: in einer götterleeren, „entzauberten“ Welt? Können wir den verlorenen Zauber wieder zurückbringen? Zurück in diese seelenlose Welt? Sind wir nicht vielleicht gar Zauberer, Magier des Wortes? Ist nicht jeder Dichter im Grunde ein – Wortmagier?
Dichtung, Magie und Mythos sind eng miteinander verwandt; auch das Märchen stammt aus gleicher Quelle; sie alle sind vielleicht Erinnerungen an die goldenen Tage einer glücklichen, götterumsorgten Menschheits-Kindheit. So schrieb auch Novalis: „Der Sinn für Poesie hat viel mit dem Sinn für Mystizism gemein. Es ist der Sinn für das Eigentümliche, Personelle, Unbekannte, Geheimnisvolle, zu Offenbarende, das Zufällig-Notwendige. Er stellt das Undarstellbare dar. Er sieht das Unsichtbare, fühlt das Unfühlbare. Kritik der Poesie ist ein Unding. Schwer schon ist zu entscheiden, (…) ob etwas Poesie sei oder nicht. Der Dichter ist wahrhaft sinnberaubt – dafür kommt alles in ihm vor. Er stellt im eigentlichsten Sinn das Subjekt-Objekt vor: Gemüt und Welt. Daher die Unendlichkeit eines guten Gedichts, die Ewigkeit. Der Sinn für Poesie hat nahe Verwandtschaft mit dem Sinn der Weissagung und dem religiösen, dem Sehersinn überhaupt. Der Dichter ordnet, vereinigt, wählt, erfindet – und es ist ihm selbst unbegreiflich, warum gerade so und nicht anders.“3
Wer sichert den Olymp? Vereinet Götter?
Des Menschen Kraft, im Dichter offenbart.4
So heißt es in Goethes Faust, im Vorspiel auf dem Theater. Noch einen Schritt weiter geht der japanische Samurai-Dichter Ochiai Naobumi (1861–1903), der bekennt:
Wenn in der Nacht
Einsam ich aufwache
Und aus tiefer
Seele meine Verse sinne:
Dann bin auch ich ein Gott.5
Was ist ein Gedicht, diese seltsamste aller sprachlichen Offenbarungen? Niemand wird dieses Rätsel lösen können. Rudolf Hagelstange hat dennoch versucht, mit bebender Seele eine Antwort zu geben: „Ist es der Flaum von eines Vogels Brust, die Schuppe eines Fisches, das sinkende Blatt einer Rose? Das Winken eines seidenen Tuches, der Seufzer einer Liebesnacht? Der Kuss auf eine verblichene Stirn? Vielleicht ist es dies: ein kleiner Kristall, in dem alles Licht sich gesammelt hat, das unsere Tage erhellt. Eine Träne, die ins feste Gebild flüchtet, um nicht verloren zu sein. Träne der Freude, Träne der Trauer.“6
Und Hugo von Hofmannsthal lässt sein Gespräch über Gedichte in die folgende Betrachtung ausklingen: „Wovon unsere Seele sich nährt, das ist das Gedicht, in welchem, wie im Sommerabendwind, der über die frischgemähten Wiesen streicht, zugleich ein Hauch von Tod und Leben zu uns herschwebt, eine Ahnung des Blühens, ein Schauder des Verwesens, ein Jetzt, ein Hier und zugleich ein Jenseits, ein ungeheures Jenseits. Jedes vollkommene Gedicht ist Ahnung und Gegenwart, Sehnsucht und Erfüllung zugleich. Ein Elfenleib ist es, durchsichtig wie die Luft, ein schlafloser Bote, den ein Zauberwort ganz erfüllt; den ein geheimnisvoller Auftrag durch die Luft treibt: und im Schweben entsaugt er den Wolken, den Sternen, den Wipfeln, den Lüften den tiefsten Hauch ihres Wesens....“7
Die neun Musen – ein Einweihungsweg
Von den Musen will ich beginnen, von Zeus und von Phoibos.
Stammen doch von den Musen und von Apollon, dem Schützen,
Alle Liedersänger und alle Harfner auf Erden,
Könige aber von Zeus. O selig, wen immer die Musen
Lieben; denn süßer Gesang wird seinem Munde entströmen.
Heil euch, Töchter des Zeus, schenkt Ehre meinem Gesange,
Ich aber werde eurer und andrer Gesänge gedenken.8
Homerischer Hymnus
Die Musen, diese göttlichen Schutzgeister der Dichter, die in der Antike so oft angerufen wurden, galten gemeinhin als die Töchter des Zeus und der Mnenosyne; dabei ist Zeus esoterisch gesehen der kosmische Allgeist und Mnenosyne (Erinnerungsvermögen) das „Weltgedächtnis“ oder – mit einem indischen Ausdruck – die „Akasha-Chronik“. „Akasha“ bedeutet so viel wie „Äther“. Wir können uns die Akasha-Chronik vorstellen als einen unendlich dünnen feinstofflichen Film, aus der Substanz des Weltenäthers gewoben, der alle Eindrücke aus der physischen Welt empfängt und für alle Ewigkeit in sich aufspeichert. Alle Taten, die je begangen wurden, alle Gedanken, die je gedacht wurden, hinterlassen einen solchen bleibenden Eindruck in der Akasha-Chronik. Hellsichtigen Menschen, nicht Medien, sondern geschulten Eingeweihten, ist es möglich, in der Chiffrenschrift der Akasha-Chronik die Geschehnisse vergangener Perioden zu erkennen.
Alle Dichter, Seher, Propheten und Eingeweihten schöpfen aus der Kraft des Weltgedächtnisses, der Welterinnerung, personifiziert als Mnenosyne, die Mutter der Musen. Denn wie sonst könnten die Dichter und Sänger die Taten der Vergangenheit verherrlichen, wenn sie diese nicht in plastischen Imaginationen vor ihrem geistigen Auge sähen? Und vergessen wir nicht: Die Akasha-Chronik, die oben im Äther schwebt, ist ja kein „Buch“ im üblichen Sinne, schon gar kein geschriebener Text, sondern ein reines Bilder-Gedächtnis. Aus der Ebene der Akasha-Chronik empfängt der Dichtende seine zentralen Inspirationen, die er unter Mithilfe der Musen in machtvolle Sprachbilder umwandelt. So wirken die Musen als Mittler: sie tragen die Bild-Inhalte des Weltgedächtnisses in das Bewusstsein des Dichters hinein; und dort werden diese Inhalte in Gedankenformen gekleidet, damit sie an andere Menschen (in metrisch gebundener Form) weitergegeben werden können.
So unterstand die Dichtkunst in ältester Zeit waltenden Göttermächten. Ursprünglich nur auf drei beschränkt, treten die Musen schon bei Homer als neun Schwestern auf, wobei jede einzelne über eine bestimmte künstlerische Funktion zu wachen hatte und mit einem entsprechenden Symbol verknüpft wurde. Man kann die neun Musen durchaus als Stufen eines Einweihungsweges verstehen, an dessen Ende die Vereinigung mit dem Weltengedächtnis steht, das Lesen in der Akasha-Chronik. Die Anrufung der Musen bei Beginn einer künstlerischen Arbeit war seit Homer ein weithin gepflegter Brauch, der später auch an Stätten geistigen Lebens, wie Schulen, Philosophenkreise, geübt wurde. Die Namen der Musen und die ihnen zugeordneten Bereiche sind:
Erato
Liebesdichtung
Euterpe
Musik
Kalliope
epische Dichtung
Kleio
Geschichte
Melpomene
Tragödie
Polyhymnia
feierlicher Gesang
Terpsichore
Tanz
Thaleia
Komödie
Urania
Astronomie
Ein mythisches Wesen, das mit den Musen in engem Zusammenhang steht, ist der Pegasos, jenes wundersame Flügelpferd, auf dem Bellerophon einst zu den Göttern hinaufreiten wollte. Vom Pegasos wird berichtet, dass durch seinen Hufschlag zwei Quellen entstanden seien: die eine heißt Hippokrene und fließt in Böotien; die andere nennt man Peirene, in der Nähe von Korinth gelegen – beides Stätten, wo die Musen sich zu versammeln pflegten, als deren heiliges Pferd der Pegasos galt. Der Pegasos ist es auch, der den Dichter-Eingeweihten zu den geistig-göttlichen Sphären emporträgt – in jene Höhen des Geistes, wo allein Zeus und Mnenosyne walten, der kosmische Allgeist und das „Weltgedächtnis“.
Die indischen Rishis, die griechischen Rhapsoden und die BardenSänger der Kelten, die Troubadoure und Minnesänger des Mittelalters, ja noch die inspirierten Dichter der europäischen Klassik und Romantik, auch die japanischen Zen-Dichter, die gottestrunkenen persischen Sufi-Poeten – sie alle treten als Künder höherer Weltengeheimnisse auf; sie alle besitzen ein tiefes Wissen um die Geistige Welt, das sie in ihren Dichtungen mal nur andeuten, dann wieder klar und deutlich aussprechen. Deshalb ist die Dichtung des Morgen- und Abendlandes, zumal in ihren heiligen Anfängen, eine randvolle Schatzkammer spirituellen Wissens. „Dichtung kommt aus Gott und mündet in Gott. Sie schafft magisch die große Vereinigung zwischen Dingen und Geist, zwischen Denken und Sein, zwischen Welt und Schöpfer. Am farbigen Abglanz erschaut sie das Leben, und Natur hat für sie weder Kern noch Schale. Man könnte, ein Wort Spinozas variierend, sagen: Die Dichtung ist nicht die Vorstufe zu einem seligen Jenseits, sie ist dieses Jenseits selbst. Oder: Das Jenseits ist nur das anders angeschaute Diesseits. Denn jenseits dieser Welt gibt es nichts. Noch das Nirwana ... ist diesseits. Die Sterne leuchten auch den Toten, diese Blumen blühen auch für sie. Nur dass die verklärten Gesichter sie anders sehen. Mit übermenschlichen oder unmenschlichen Augen. So sehen auch die Dichter diese Welt mit über- oder unterirdischen Blicken. Gott ist der Geist. Und seine Geister sind die Dichter.“9
Von den Sängern Gottes handelt vorliegendes Buch – von den Dichtern, Sehern, Mystikern und Eingeweihten aller Zeiten. Wirkliche Dichtung ist ein Weg zum kosmischen Bewusstsein, zum All-Einheits-Bewusstsein der Mystiker. Solche Erfahrung, wie sie R. M. Bucke in seinem Buch Cosmic Consciousness („Kosmisches Bewusstsein“) in charakteristischer Weise schildert, eignet dem Mystiker wie dem Dichter gleichermaßen: „Wie in einem Blitz offenbart sich seinem Bewusstsein eine klare Vorstellung, eine globale Vision von Sinn und Ziel des Universums. Er kommt nicht zu einer bloßen Überzeugung, sondern er sieht und weiß, dass der dem Ichbewusstsein als tote Materie erscheinende Kosmos in Wirklichkeit etwas ganz anderes ist – nämlich tatsächlich eine lebendige Gegenwart.... Er sieht, dass das dem Menschen innewohnende Leben ewig ist wie alles Leben, dass die Seele des Menschen so unsterblich ist wie Gott, sieht, dass das Universum so geschaffen und geordnet ist, dass ohne jeden Zweifel alles zum Besten aller zusammenwirkt und dass das Grundprinzip der Welt das ist, was wir Liebe nennen, und dass das Glück eines jeden einzelnen letztlich gewiss ist....“10
In der Tat: Der Dichter muss das ganze Welten-All in sein Inneres hineinnehmen, muss das Schicksal der ganzen Welt mittragen, mit allen Wesen mitfühlen, um den vielfältigen Stimmen des Seins im lyrischen Gedicht – oder im Epos, im Drama, im Roman – Ausdruck zu verleihen.
Die Veden – Urgestein altindischer Dichtung
Wie aus dem wohlentflammten Feuer die Funken,
Ihm gleichen Wesens, tausendfach entspringen,
So geh’n, o Teurer, aus dem Unvergänglichen
Die mannigfachen Wesen
Hervor und wieder in dasselbe ein.
Mundaka-Upanishad 2,1
Dichterkraft und Sehertum, Sprachgewalt und mystische Schau – nirgendwo liegen sie so dicht beieinander wie in der altindischen Literatur, die in den ältesten Texten der Menschheit, den Vedas, den Puranas und Brahmanas, erstmals Ausdruck gewann, um wie ein Echo in den heiligen Schriften des klassischen Indien nachzuhallen. Die altindische Dichtung, eine reine Götterhymnendichtung noch, Ausdruck einer erhabenen Menschheits-Kindheit, ist dem Wurzelboden einer frühindogermanisch-arischen Spiritualität erwachsen, die wie eine UrgesteinsSchicht allem später Dazugekommenen zugrunde liegt. Ihrem Ursprung wie ihrer geistigen Grundhaltung nach beruht die altindische Dichtung weder auf der rein magischen Vorstellungswelt der Naturvölker noch auf den eher weltflüchtigen Tendenzen der späteren Hochreligionen, sondern auf jener geistig hochstehenden, natur- und kosmosverbundenen Spiritualität, die in der Frühzeit des indischen Ariertums Gestalt annahm. Heute, wo ein neues Weltzeitalter anbricht, können wir uns dieses geistige Urwissen wieder neu aneignen.
Aus dem geistigen Urgestein der frühindisch-arischen Spiritualität ragen wie vier monolithische Felsblöcke die vier Haupt-Veden hervor, die mit den zeitlich jüngeren Upanishads auch heute noch zu den kanonischen Texten des Hinduismus zählen. Das Wort Veda leitet sich her von vidya, das Wissen, das Gesehene. Darin finden wir die indogermanische Wurzel vid, die uns auch in dem lateinischen Verb videre für sehen begegnet. Die Veden, deren Umfang den der Bibel um das Sechsfache übersteigt, verstehen sich somit als geheiligtes Wissen. Nach orthodoxer Ansicht sind sie nicht menschliches, sondern göttliches Wissen, das anfanglos und unvergänglich ist, und das von den Priestern der Vorzeit in geheiligter Schau „gesehen“ wurde. Vedisches Wissen ist also Seherwissen.
Grundlegend für das vedische Weltbild ist, wie auch Hans Joachim Störig in seiner Weltgeschichte der Philosophie schreibt, dass „die unserem Denken heute so selbstverständliche Unterscheidung von Belebtem und Unbelebtem, von Personen und Sachen, von Geistigem und Stofflichen noch nicht vorgenommen wurde. Die frühesten Götter waren Kräfte und Elemente der Natur. Himmel, Erde, Feuer, Licht, Wind, Wasser werden, ganz ähnlich wie bei anderen Völkern, als Personen gedacht, die nach Art der Menschen leben, sprechen, handeln und Schicksale erleiden.“11
Der gesamte Veda enthält vier Sanhitas, Sammlungen von Liedern und Sprüchen für den Gebrauch der Priester bei feierlichen Opferhandlungen –: den Rig-Veda, den Sama-Veda, den Yajur Veda und den Atharva Veda. Der Rig-Veda zunächst ist das Buch der Götterhymnen. Seine 1028 Hymnen richten sich an die verschiedenen Naturgötter des frühindischarischen Pantheons: an den Feuergott Agni etwa, an den Sonnengott Surya, an den Windgott Vata, und natürlich an Indra, den Beherrscher von Blitz und Donner. Der Sama-Veda enthält Lieder und ist daher von grundlegender Bedeutung für die indische Musik. Der Yajur-Veda ist eine Sammlung von Opfersprüchen. Der Atharva-Veda mit seinen 731 Hymnen gilt als eine Sammlung von Zaubersprüchen und magischen Anrufungen; aber es sind, wie im Rig-Veda, auch Lieder zum Lobpreis von Göttern darin zu finden.
Wir haben guten Grund, den Atharva Veda gerade seiner Magie wegen zu den ältesten Teilen der Veden-Sammlung zu rechnen; heiliges Mysterienwissen erklingt aus diesen in Birkenrinde eingeritzten Hymnenliedern, die mindestens schon um 1800 v. Chr., wenn nicht gar noch früher, entstanden sein müssen. Ist doch die Magie die Urform der Religion, der Magier stets der Vorläufer des Priesters gewesen. Tatsächlich mag das Alter des Atharva-Veda gut 4000 Jahre betragen; seine Texte stammen vermutlich noch aus der Zeit, da die ostindogermanischen Stämme der Aryas, wie sie sich selber nannten – „Arier“, das heißt die „Edlen“–, in das damals noch dichtbewaldete Industal und in den Pandschab vorstießen. Der Geist jener Zeit war geprägt von einer staunenden Ehrfurcht vor der Natur. Die voralpine Landschaft an den Ufern des Indus und die schneebedeckten Berge des Himalaya im Hintergrund – das war die Umgebung, in der jene ersten „Arier“, ein schlichtes anspruchsloses Bauernvolk, das Göttlich-Numinose in der Natur erleben konnten.
Die Zeit zwischen 1000 und 750 v. Chr., gekennzeichnet durch das weitere Vordringen der Arier in die Ganges-Ebene, gilt nicht als die altvedische oder Hymnen-Zeit, sondern als die Zeit der Opfermystik. Die Kaste der Brahmanen hatte sich allmählich herausgebildet. Und der Mensch hatte sich gegenüber der Natur und den Göttern ein neues Selbstbewusstsein angemaßt: der Opfernde ist nun nicht mehr der Bittende, der sich an höhere Weltwesen wendet, sondern er ist der machtvolle Magier, der durch zwingenden Opferspruch den Göttern alles dem Menschen Zuträgliche abnötigt. Fast sieht es so aus, als stünden nicht die Götter über den Menschen, sondern umgekehrt die Menschen über den Göttern. In der Zeit zwischen 750 und 500 v. Chr., in der die Arier die Urbevölkerung des zentralindischen Dekkan-Hochlandes unterwerfen, entsteht die neue Literaturgattung der Upanishaden: das Indertum hatte sich ganz auf das Gebiet der philosophischen Spekulation geworfen, wobei der alte vedische Götterglaube nur noch schemenhaft weiterlebte.
Die Poesie des Rig-Veda ist eine bereits hochentwickelte Kunstdichtung mit stark höfischem Grundzug; die Lieder sind von priesterlichen Sängern im Dienste von Fürsten geschaffen worden, die ihnen ihre Werke mit reichen Gaben – Rindern und Rossen, Gold und Edelsteinen – belohnten. Als ein Beispiel für die zutiefst naturnahe Götterlyrik der vedischen Zeit sei hier der Hymnus an die Göttin der Morgenröte wiedergegeben.
In Majestät aufstrahlt die Morgenröte,
Weißglänzend wie der Wasser Silberwogen.
Sie macht die Pfade schön und leicht zu wandeln
Und ist so mild und gut und reich an Gaben.
Ja, du bist gut, du leuchtest weit, zum Himmel
Sind deines Lichtes Strahlen aufgeflogen.
Du schmückest dich und prangst mit deinem Busen
Und strahlst voll Hoheit, Göttin Morgenröte.
Es führt dich ein Gespann mit roten Kühen,
Du Sel’ge, die du weit und breit dich ausdehnst.
Sie scheucht die Feinde, wie ein Held mit Schleudern,
Und schlägt das Dunkel wie ein Wagenkämpfer.
Bequeme Pfade hast du selbst auf Bergen
Und schreitest, selbsterleuchtend, durch die Wolken.
So bring uns, Hohe, denn auf breiten Bahnen
Gedeihn und Reichtum, Göttin Morgenröte.
Ja, bring uns doch, die du mit deinen Rindern
Das Beste führest, Reichtum nach Gefallen!
Ja, Himmelstochter, die du dich als Göttin
Beim Morgensegen noch so mild dich gezeigt hast!
Die Vögel haben sich bereits erhoben
Und auch die Männer, die beim Frühlicht speisen.
Doch bringst du auch den Sterblichen viel Schönes,
Der dich daheim ehrt, Göttin Morgenröte!12
Der Atharva-Veda enthält außer dem in Prosa abgefassten Sechstel Hymnen, die zu sehr verschiedenen Zeiten entstanden sein müssen. Im Mittelpunkt steht jedoch weithin die Magie: Bannsprüche und Zauberformeln sind darin zu finden, böse Dämonen sollen abgewehrt, Krankheiten kuriert, Vorteile der verschiedensten Art wie Liebesglück, Sieg im Kampf sollen erlangt werden. Daneben kommen ansatzweise schon erste philosophische Spekulationen zum Ausdruck, noch zaghaft, fragend, suchend, erste Morgendämmerung eines noch nicht ganz zur Entfaltung gekommenen mentalen Bewusstseins. Bemerkenswert in dieser Hinsicht ist der Hymnus an den Zeitgott Kala, der sich an die Zeit, also nicht mehr an eine sinnlich in Erscheinung tretende Naturmacht oder Naturgottheit, sondern an eine Abstraktion wendet; einige Verse daraus sollen hier mitgeteilt werden:
Der Zeitgott eilt, ein Ross mit sieben Zügeln,
Er altert nie und sieht mit tausend Augen.
Die Weisesten besteigen seinen Wagen,
Und alle Wesen ihm als Räder taugen.
Mit sieben Rädern, sieben Naben fährt er,
Unsterblichkeit ist Achse seinem Wagen,
Er bringt die Dinge alle zur Erscheinung,
Als erster Gott lässt er dahin sich tragen.
Auf seinem Wagen steht ein Krug zum Spenden,
Wir sehn ihn überall, wo wir auch wohnen,
Er spendet allen Wesen. Alle sagen:
Er ist der Herr der höchsten Himmelszonen.
Zustande bringt er alles, immer hat er
Als der Allüberwinder sich erwiesen;
Als Vater ist zugleich er Sohn geworden,
Drum gibt es keinen Mächtigern als diesen.13
Der Vedismus, die älteste Religion Indiens, war eine Volksreligion mit stark polytheistischer, ja pandämonistischer Prägung, ganz der Welt zugewandt, deren Güter als im höchsten Maße begehrenswert erschienen, und mit Göttern, die dem Weltganzen in geheimnisvoller Immanenz innewohnten. Aus diesem so ganz diesseitszugewandten Vedismus erwuchs im Laufe der Zeit die Frage nach dem Einen, die Hauptfrage der indischen Religion, die ihre Antwort zuletzt in einer Einheitsmystik findet. Aus der Schar der vielen Welt-Götter, die zunächst alle gleichwertig nebeneinanderstehen, heben sich allmählich einzelne große Göttergestalten heraus; dabei entsteht wie von allein die Frage, wer denn der größte aller Götter sei. Dies ist, religionsgeschichtlich gesehen, ein erster Schritt vom Polytheismus zum Monotheismus, der aus einer religiösen Einheitsahnung erwächst, indem er die vielen göttlichen Numina zu einer einzigen, universalen Göttergestalt zusammenwachsen lässt.
Im jüngeren Rig-Veda nimmt das göttliche Eine schon ausgesprochen unpersonale Züge an; es ist ein nur in mystischer Versenkung zu erlebendes göttliches All-Eines, nicht ein personaler Schöpfergott. Das Eine, von dem im folgenden Gedicht die Rede ist, ist auch nicht mehr Teil der Welt, sondern besteht vor allem Gewordenen, das aus ihm überhaupt erst hervorgeht. Die immer wiederkehrende Frage: „Wer unter den Devas (Göttern) ist es, den wir mit Opferguss ehren?“ besagt, dass hier der fromme Dichter fragt, welcher von den bekannten vedischen Göttern dem einen namenlosen „Gott über allen Göttern“ am ehesten entspricht. Es geht nicht bloß darum, wer der größte unter den Göttern ist, sondern hier hat die fromme Ahnung bereits erkannt, dass alle Götter nur ein Gott sind.
Am Anfang stieg empor das goldne Glanzkind,
Es war des Daseins eingeborner Meister;
Er trug die Erde, trug den Himmel droben:
Wer ist der Gott, den wir mit Opfern ehren?
Der uns das Leben gibt, der uns die Kraft gibt,
Dess’ Machtgebot die Götter all’ gehorchen,
Dess’ Schatten die Unsterblichkeit, der Tod sind:
Wer ist der Gott, den wir mit Opfern ehren?
Er, der in Majestät vom höchsten Throne
Der atmenden, der Schlummerwelt gebietet,
Der aller Menschen Herr und des Getieres:
Wer ist der Gott, den wir mit Opfern ehren?
Er, dessen Größe diese Schneegebirge,
Das Meer verkündet mit dem fernen Strome;
Dess’ Arme sind die Himmelsregionen:
Wer ist der Gott, den wir mit Opfern ehren?
Er, der den Himmel klar, die Erde fest schuf,
Er, der die Glanzwelt, ja den Oberhimmel,
Der durch des Äthers Räume hin das Licht maß:
Wer ist der Gott, den wir mit Opfern ehren?
Zu dem empor, von seiner Macht gegründet,
Himmel und Erde blickt, im Herzen schauernd,
Er, über dem die Morgensonn’ emporflammt:
Wer ist der Gott, den wir mit Opfern ehren?
Wohin ins All die mächt’gen Wasser flossen,
Den Samen legend und das Feuer zeugend,
Da sprang hervor der Götter Eines Ursein:
Wer ist der Gott, den wir mit Opfern ehren?
Der über Wolkenströme selbst hinaussah,
Die Kraft verleihen und das Feuer zeugen,
Er, der allein Gott über alle Götter:
Wer ist der Gott, den wir mit Opfern ehren?
Mög’ er uns gnädig sein, der Erde Vater,
Er, der Gerechte, der den Himmel zeugte,
Der auch die Wolken schuf in Glanz und Stärke:
Wer ist der Gott, den wir mit Opfern ehren?14
Im Weltschöpfungslied des Rig-Veda tritt uns das göttliche All-Eine erstmals in mystischer Schau entgegen, nicht als persönlicher Gott, sondern als un- und überpersönliches Eines. Selbst die zahlreichen, der Schöpfung innewohnenden Götter und der ihnen zugeordnete Obergott verdanken diesem Unsagbar-Einen und Ursprünglichen ihre Entstehung. Hier beginnt erst Mystik im eigentlichen Sinne; denn das im Weltprozess tätige Eine entstammt einem Bereich nicht vorstellbarer Transzendenz. Es hat keinen Namen; es heißt einfach nur „Dieses“ (Tad), oder „Das Eine, außer dem es sonst nichts gab“. Die Chandogya-Upanishad nennt es „Eines ohne ein Zweites“, das zweitlose Eine. Der mystische Dichter dieses Liedes weist alle Spekulationen über die Weltentstehung zurück; er ist bereits zu der Erkenntnis gelangt, dass niemand wissen kann, wie alles Gewordene zustande kam, selbst die Götter und ihr Obergott nicht, denn auch diese sind später als das Eine.
Es war kein Nichtsein damals, und es war kein Sein;
Es war kein Luftraum auch, kein Himmel über ihm.
Was webte damals? Wo? Wer hielt in Schutz die Welt?
Wo war das Meer, der Abgrund unermesslich tief?
Nicht Tod war damals, auch das Leben gab es nicht;
Es gab kein Unterschied noch zwischen Tag und Nacht;
Doch Dieses atmete, auf seine Weise, ohne Hauch:
Das Eine, außer dem es sonst nichts gab.
In Dunkel war die Welt im Anfang eingehüllt;
Und alles ‘dieses’ war nur unkenntliche Flut.
Durch Leere war das wundersame Eine zugedeckt:
Da brachte es durch Glutes Kraft sich selbst hervor.
Da ward das Eine gleich von Liebeskraft durchwallt,
Die, aus dem Geist geboren, aller Dinge Same ist:
Das Herz erforschend, taten es die Weisen kund,
Wie alles Sein im Nichtsein seine Wurzel hat.
Und als die Denker querdurch spannten eine Schnur,
Da gab es ‘Oben’ plötzlich, und ein ‘Unten’ auch;
Und keimesmächt’ge Kräfte traten auf den Plan:
Begehren unten, oben der Gewährung Kraft.
Wer hat es ausgeforscht, und weiß es, tut es kund,
Woher die Schöpfung kam, und wie die Welt entstand?
Die Götter traten nach dem Einen erst ins Sein.
Wer also weiß, woher sie ausgegangen sind?
Woher die Schöpfung ist, und ob der Eine sie gemacht,
Das weiß, der über diese Welt die Oberaufsicht hat,
Und aus dem höchsten Himmel auf sie niederblickt:
Der weiß es wohl? Vielleicht weiß er es selber nicht.15
Wie ein Monument steht das Urgestein der altindischen Dichtung im Strom der Zeiten, alle Wechsel und Wandlungen überdauernd, einmalig in der Wucht und Größe seiner mystischen Schau, unvergleichlich im Zauber seiner lyrischen Poesie. Als Verfasser der Veden wird uns ein gewisser Vyasa genannt – ein hoher Eingeweihter zweifellos, eine bis heute nicht als historisch nachgewiesene Person, vom Dämmerlicht einer längst vergangenen Frühzeit umhüllt. Überdies scheint es fraglich, ob die Veden in ihrer Gesamtheit, mit ihrer großen Spannweite und der Vielfalt an Entwicklungsstufen, überhaupt der Feder eines einzelnen Mannes entsprungen sein können; so könnte man „Vyasa“ auch als einen Gattungs- oder Gruppennamen sehen, der auf eine ganze Schar von dichtenden Sehern der vedischen Zeit angewandt wurde, ähnlich wie im alten Griechenland Namen wie „Orpheus“ oder „Homer“ sich nicht so sehr auf einzelne Persönlichkeiten, sondern auf ganze Generationen von Dichter-Sehern beziehen können. Wie man eine ganze Literaturgattung „homerisch“ nennt, so schreibt man die altindische Dichtung als Ganzes „Vyasa“ zu.