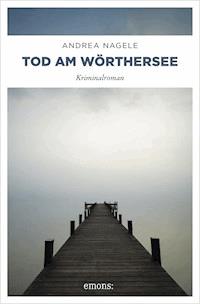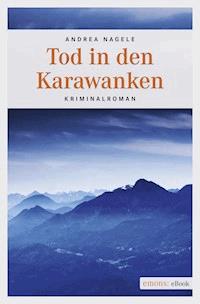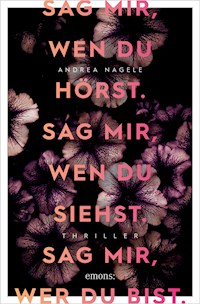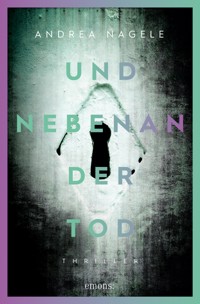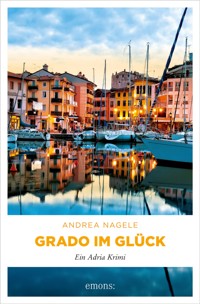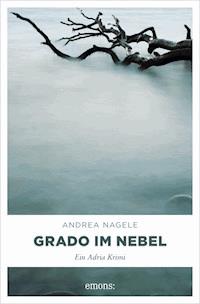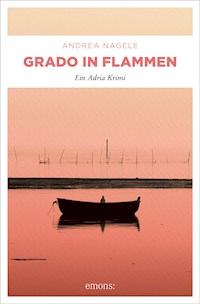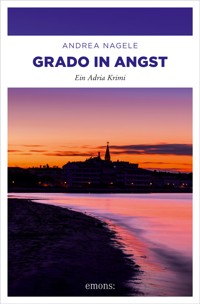Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Commissaria Degrassi
- Sprache: Deutsch
Neue Krimispannung an der Adria. Kommissarin Maddalena Degrassi wird zu einem Vermisstenfall gerufen: Ein sechzehnjähriges Mädchen ist nicht mehr nach Hause gekommen. Hatte sie sich in den Falschen verliebt? Und woher wusste der ortsansässige Toto schon vorher, dass bald etwas Schlimmes passieren wird? Maddalena, die immer noch mit einem persönlichen Schicksalsschlag zu kämpfen hat, muss hilflos mit ansehen, wie der Fall unaufhaltsam seinem tragischen Höhepunkt entgegensteuert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Andrea Nagele leitete über ein Jahrzehnt ein psychotherapeutisches Ambulatorium. Heute arbeitet sie als Autorin und betreibt in Klagenfurt eine psychotherapeutische Praxis. Sie pendelt zwischen Klagenfurt am Wörthersee, Grado und Berlin.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2023 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: shutterstock.com/Desizned
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Marit Obsen
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-055-6
Ein Adria Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Meinen Herzensfreunden
Die Leiche sank zu Boden, aber es waren nicht die Gase, die sie wieder hochtrieben,
Prolog
Sie wachte beduselt auf.
Das Atmen fiel ihr noch schwer, aber sie war wieder etwas klarer im Kopf.
»Wo bist du?«, brachte sie gequält hervor.
Er hatte sie einfach hiergelassen.
Gedankenverloren drehte sie am Ring, den er ihr geschenkt hatte. Er war wunderschön, jedoch wertloser Plunder.
Keuchend rappelte sie sich hoch und krabbelte zu einer Holzbank am Ufer.
Dort verharrte sie eine Weile.
Der Akku ihres Handys war leer.
Es war so schwer aufzustehen, und der Weg hin zu dem einzigen Gebäude, in dem man ihr helfen würde, erschien ihr endlos weit.
Menschen sah sie um sich herum keine mehr.
So dämmerte sie auf der Bank vor sich hin, bis sie eine wohlbekannte Stimme hörte.
»Mein Mädchen.«
Sie sah in ein vertrautes Gesicht.
»Du?« Ein warmes Gefühl umfing ihr Herz.
Zum Glück war er gekommen und würde sie aus der misslichen Situation befreien.
»Danke«, murmelte sie leise, »mit dir hätte ich nicht gerechnet.«
Sie wollte sich erheben, sackte jedoch kraftlos zur Seite.
Seine kräftigen Hände packten zu, schlossen sich um ihren Hals, und ein unerwartetes Gefühl der Panik ergriff sie, als ihr abermals die Luft wegblieb.
»Das war es mit uns, meine Kleine, du kehrst nicht mehr zurück.«
Innerhalb von Sekunden beendete er ihr Leben, kaum dass sie sich dessen bewusst wurde.
Was danach geschah, erlebte sie nicht mehr.
Als er mit ihr fertig war, schwamm sie noch einige Zeit mit ausgebreitetem Haar auf dem Wasser, ehe sie langsam in der Lagune versank.
1
Maddalena saß mit ihren Freundinnen Bibiana und Stella auf der schmalen Terrasse der neuen Wohnung, in der sie nun seit über einem halben Jahr lebte. Sie prosteten einander mit Prosecco zu. Es war später Nachmittag, und Maddalena baute heute ein paar ihrer Überstunden ab.
»Ich wusste, du würdest dich hier wohlfühlen. Immerhin habe ja auch ich dieses Kleinod für dich ausgesucht«, frohlockte Bibiana, die Immobilienmaklerin, sichtlich zufrieden mit sich und ihrer Entdeckung.
»Da gebe ich dir gern und unumwunden recht. Du kennst meinen Geschmack eben in- und auswendig.«
»Geschmack?« Stella grinste. »Unsere Maddalena trägt Boots, kaputte Jeans und unter der obligatorischen Lederjacke irgendein T-Shirt, das sie wahrscheinlich in einer Mülltonne gefunden hat.«
»Pfui«, entgegnete Maddalena lachend. »Wenn du weiter so über mich herziehst, rufe ich deinen ehrenwerten Ehemann an und lasse dich in Handschellen von ihm abführen und in Gewahrsam nehmen.«
In den letzten Monaten hatte sie sich immer enger mit der Frau ihres Mitarbeiters Guido Lippi angefreundet.
»Commissaria, ist Ihnen eine derart rigorose Ahndung angesichts eines doch so geringen Vergehens denn überhaupt erlaubt?«, erkundigte sich Bibiana mit unschuldigem Blick. »Überschreiten Sie da nicht ein wenig Ihre Befugnis? Comandante Scaramuzza hängt Ihnen ein Disziplinarverfahren an den Hals, so schnell können Sie gar nicht schauen.«
»Schlage du dich nur auf Stellas Seite. Wirst schon sehen, was passiert, wenn ich Guido Lippi herbeordere.«
»Der bringt höchstwahrscheinlich zwei weitere Flaschen Prosecco mit und beginnt danach, Lieder im heimischen Dialekt zu schmettern«, gibt Stella zu bedenken.
»Ein Volkstümler ist er also auch noch, dein Gatte?« Maddalena zog eine Augenbraue hoch.
»Nein und ja«, sagten Stella und Bibiana gleichzeitig.
»Da du aus dem Karst kommst, verzeihen wir dir deine Unwissenheit«, fuhr Stella fort. »Guido singt jedes Jahr im März mit großer Freude beim Graisan-Lieder-Festival. Sänger und Künstler aus Grado treten dort gegeneinander an. Der Sinn der Veranstaltung liegt darin, den Dialekt, der dem venezianischen ähnelt, zu erhalten. Insofern sind es Volkslieder. Dante, der Mann von Giorgia, deiner Freundin aus der Bar, hat den Wettbewerb schon einmal gemeinsam mit seiner Tochter gewonnen. Guido fühlt sich seiner Heimat also tatsächlich sehr verbunden, was aber nicht heißt, dass er deshalb ein reaktionärer Mensch ist.«
»Das habe ich so nicht gemeint«, gab Maddalena kleinlaut zurück und schämte sich ein wenig ob ihres Vorurteils. »Ich mag halt lieber Pop- oder Rockmusik und stehe nicht so auf Schlager und Volkslieder.«
»Themenwechsel«, schlug Bibiana vor. »Stellas Mann ist doch der Kollege, mit dem du früher oft Zoff hattest. Jetzt schaust du nicht mehr verbissen, wenn du über ihn redest, und mit seiner Frau bist du inzwischen befreundet. Anscheinend hat sich die Lage zwischen euch geändert oder gar verbessert, richtig?«
Maddalena hatte Bibiana nicht in jedes Detail ihrer teils schwierigen Beziehung zu Guido Lippi eingeweiht und blieb daher oberflächlich. »Dem kann ich guten Gewissens zustimmen. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass er Stella zurückerobern konnte, jedenfalls gab es keine Konflikte mehr mit ihm, und er war mir eine große Hilfe in meiner schweren Zeit.«
Stella lächelte fein und nahm einen Schluck Prosecco.
»Auch jetzt arbeiten wir quasi Hand in Hand«, fuhr Maddalena fort, »und er hat endlich sein Konkurrenzverhalten abgelegt und akzeptiert mich anstandslos als seine Vorgesetzte. Das hat sich in den letzten Monaten positiv auf das gesamte Team ausgewirkt.«
Immer noch konnte sie es kaum fassen, dass Franjo nicht mehr bei ihr war.
Bibiana, die wohl merkte, was in ihr vorging, legte ihre Hand auf Maddalenas Schulter.
Auf ihre Freundinnen war Verlass. Sie waren da und spendeten ihr Trost. Giorgia fehlte, aber sie kam so selten aus der Bar weg, dass Maddalena sie meistens dort besuchte.
Maddalena zündete sich eine Zigarette an und versuchte, ihre trüben Gedanken zusammen mit dem Rauch in den Himmel zu blasen.
Sofort ging es ihr besser. Auch mit ihrer Mutter, Sibilla, verstand sie sich neuerdings. Sie war feinfühliger als sonst und nervte nicht mehr ständig mit Banalitäten.
»Was haltet ihr davon, demnächst mal gemeinsam bei ›Rickys‹ zu Abend zu essen?«, fragte sie in die Runde. »Stella, du kannst Guido mitbringen. Bibiana kümmert sich um einen Babysitter für Simonetta, dann kann Fabrizio dich ebenfalls begleiten, und ich …« Sie spürte den Schatten, der ihre Worte begleitete, und wischte ihn bewusst weg. »Nun, ich werde eben jemandem einen Wunsch erfüllen.«
»Wem denn?« Bibianas Augen funkelten neugierig.
»Leonardo Morokutti, meinem Kollegen aus Triest.«
»Doch nicht dem Ungeheuer, das dir schon so lange nachstellt?« Bibiana machte ein enttäuschtes Gesicht. »An den hätte ich am allerwenigsten gedacht.«
»So schlimm kann er nicht sein, schließlich hat er unsere Maddalena an ihrem Geburtstag im Karst mit seinem Besuch überrascht und sie ein bisschen wachgerüttelt.«
»Das warst ebenso du, Stella«, antwortete Maddalena ehrlich. »Auch wenn es noch bis zu diesem Tag gedauert hat, bis ich mein Leben wieder in die Hand nehmen konnte.«
Nach Franjos Tod hatte Maddalena sich von allem und jedem zurückgezogen und war beinahe in ihrem Leid ertrunken. Stella konnte zu ihr durchdringen, aber erst nach Morokuttis ungebetenem Besuch war sie bereit gewesen, ihren Rat auch anzunehmen. Über dessen überzogenes Verhalten musste sie oft innerlich lachen. Er fand sich so megacool wie wahrscheinlich kein anderer, dabei war er abgemagert, mit erschlaffenden Muskeln und einer Mönchstonsur auf dem Kopf. Und er roch zehn Meter gegen den Wind. Nicht schlecht, sondern im wahrsten Sinn des Wortes umwerfend. Er war nichtsdestotrotz ein freundlicher Zeitgenosse, der sich stets viel zu sehr an ihr interessiert gezeigt hatte. Trotzdem war es ihm gelungen, sie zumindest für ein paar Stunden aus ihrer Schockstarre zu reißen. Er hatte etwas in ihr gelöst, das sie nicht genauer bestimmen konnte.
»Ist Morokutti nicht der schräge Vogel, der sich wie ein alt gewordener Jugendlicher kleidet?«, warf Bibiana ein.
»Stimmt, aber dennoch erheitern mich seine albernen Sprüche auf den T-Shirts. Zum Beispiel der: ›Alle Verbrecher schlecken ihr Eis aus der Tüte, nur nicht die Polizei, denn die hat einen an der Waffel.‹ Übrigens trägt er diese Shirts auch während seiner Dienstzeiten. Irre, oder? Seine Kollegen finden das nicht sehr witzig.«
»Ich schon. Das klingt umwerfend komisch«, entgegnete Bibiana lachend. »Habe meine Meinung soeben korrigiert. Ruf ihn an, gib Gas, ich will Spaß!« Sie klatschte begeistert in die Hände.
»Na, wenn sogar du darauf bestehst … Was bleibt mir da anderes übrig?« Maddalena griff gottergeben zum Handy und wählte die Nummer ihres Kollegen.
»Maddalena«, begrüßte Morokutti sie erfreut, »mit deinem Anruf hätte ich am allerwenigsten gerechnet, auch wenn ich ihn beinahe ständig herbeisehne. Womit kann ich dir behilflich sein? Sicher geht es um etwas Dienstliches.«
»Nein.« Sie zögerte, bevor sie fortfuhr. »Meine zwei Freundinnen wollen demnächst mit ihren Ehemännern und mir bei ›Rickys‹ in Grado abendessen. Hättest du Lust, mich dorthin zu begleiten?«
»Ich?«, fragte Leonardo erstaunt nach. »Habe ich dich richtig verstanden? Nichts lieber als das. Wann schlägst du vor, dass wir uns treffen?«
»Ich beratschlage mich und schicke dir dann eine WhatsApp mit Datum und Uhrzeit.«
»Klingt verlockend. Ich freue mich.«
Maddalena verabschiedete sich und sah ihre Freundinnen auffordernd an. »Leonardo ist mit dabei. Stella, checke den Dienstplan deines Mannes. Ich wäre für Samstag, denn am Sonntag habe ich frei und kann ausschlafen. Außer«, sie seufzte, »es passiert etwas, das mich daran hindert.«
»Wird schon nicht.« Bibiana winkte begütigend ab. »Auch du hast das Recht, dich zu entspannen.«
»Das erkläre mal bitte den Kriminellen. Mein Recht oder gar Gerechtigkeit spielen in meinem Job keine Rolle«, konterte Maddalena und trank den letzten Schluck Prosecco aus ihrem Glas.
Stella und Bibiana taten es ihr gleich. Schweigend beobachteten sie die weißen Schäfchenwolken, die gemächlich über den noch blauen Himmel schwebten. Bald würde er sich verdunkeln. Ein feines Lüftchen war aufgekommen und trug die Schreie und das Klagen der Möwen, die über dem Kanal kreisten, zu ihnen herüber.
Maddalena fühlte sich an ihre Gespräche mit Franjo erinnert, an ihre Zeit mit ihm, die sie viel zu wenig genossen hatte.
Was hatten sie sich über das Keifen der Möwen amüsiert!
Stella, die anscheinend ihre Gedanken lesen konnte, meinte lapidar: »Alles ist nie möglich, auch wenn wir uns das wünschen. Irgendetwas bleibt immer ungesagt.«
Bibiana blickte verständnislos zwischen ihnen hin und her, ehe eine Bewegung unterhalb des Balkons sie ablenkte.
»Schau mal, Stella«, sagte sie trocken, »wer da über die Stufen zu uns heraufsteigt. Ist das nicht derjenige, der dich in Handschellen abführen sollte? Den hat Maddalena wohl heimlich angerufen.«
Das dunkelgraue Metallgitter quietschte, als Guido Lippi die schmale Tür zur Veranda öffnete.
»Meine Damen«, grüßte er gut gelaunt und stellte zwei Flaschen Prosecco auf den Tisch.
»Was habe ich orakelt? Wusste ich es doch.« Stella stand auf und drückte ihrem Mann einen Kuss auf die Stirn.
Auch Bibiana sprang auf und holte ein weiteres Glas aus Maddalenas Küche. Sie verhielt sich zu Maddalenas Vergnügen stets so, als wäre sie die eigentliche Besitzerin der Wohnung.
Stella rückte zur Seite, um ihrem Mann Platz zu machen.
»Ich störe doch hoffentlich nicht, Chefin? Ich wollte nur meine Frau abholen. Und der gute Tropfen da, der lohnt sich.«
Maddalena konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Lippi war, neben vielen guten Eigenschaften, die immer mehr zum Tragen kamen, eben weiterhin mehr als nur überzeugt von sich.
»Sorry«, bat Stella augenzwinkernd, »mein Mann lädt sich überallhin selbst ein.« Ihre blonden Locken kräuselten sich um die vom Prosecco geröteten Wangen.
»Ist schon okay so, immerhin hat er uns einen guten Schluck mitgebracht«, entgegnete Maddalena.
Lippi nahm ihr den Öffner aus der Hand und entkorkte gekonnt die erste Flasche.
Nachdem er allen eingeschenkt hatte, sah er sich anerkennend um.
»Das hier ist ein besonderer Ort. Stimmt’s, Stella? So einen hätten auch wir gern. Mitten im historischen Zentrum und trotzdem am Ende des Kanals, der in die Lagune mündet.«
Lippi hatte recht. Maddalena fühlte sich hier wohl.
Sie hatte hinter dem Gebäude einen Abstellplatz für ihre Moto Guzzi und das Fahrrad, war aber dennoch nicht allzu weit entfernt von ihrer Dienststelle, die sie zu Fuß erreichen konnte.
Außer den Möwen machten nur die hungrigen und trinkfreudigen Touristen Lärm, die im Sommer in der Trattoria direkt nebenan draußen sitzen konnten.
Im Winter hingegen war es hier wie ausgestorben, manchmal vergaßen sogar die Möwen ihr Geplärre. Maddalena genoss dann die Stille.
Als Frühaufsteherin machte sie in den kalten Monaten gern einen Spaziergang im Morgennebel. Im Sommer lief sie hinunter zum Wasser, rollte ihre Jeans bis zu den Knien hoch und watete durch das seichte Meer, glücklich darüber, keiner Menschenseele zu begegnen. Am Ende der Costa Azzurra, dem westlichsten Strand Grados, von den Einheimischen »Spiaggia Vecja«, »alter Strand«, genannt, ging sie danach durch den Sand hinauf zur Straße, rollte die Hosenbeine wieder hinunter, säuberte ihre Füße und stieg in ihre Boots. Oft führte sie ihr Weg weiter geradeaus zu Giorgias und Dantes Bar, wo sie bei einem Schwätzchen den ersten Espresso des Tages genoss.
»Guido«, neckte Stella ihren Mann und zog ungeduldig an Lippis Ärmel, »guck dir erst mal die orientalischen Fliesen im Wohnzimmer an, damit du noch neidischer wirst.«
»Mach ich doch glatt.«
»Ich darf sie ihm doch zeigen?«, fragte sie etwas verspätet an Maddalena gewandt.
»Natürlich. Vergiss bitte nicht, auch auf die tollen Armaturen, die steinerne Arbeitsplatte und die coole Wischfarbe an der Wohnzimmerwand hinzuweisen«, entgegnete Bibiana sogleich eifrig.
Maddalena begann schallend zu lachen. »Das rohe Ei ist übrigens nicht nur in meiner Vorstellung auf die schicken Bodenkacheln in der Küche gekracht und zerplatzt, sondern auch schon einige Male in der Wirklichkeit.«
»Dann hör auf, rohe Eier zu essen.« Bibiana kicherte. »War wohl für die Bloody Mary gedacht?«
»Da kommt doch meines Wissens kein rohes Ei rein?« Maddalena sah ihre Freundin erstaunt an.
»Das ist nur in der Gastronomie so, wegen der Salmonellengefahr. Zu Hause darfst du so viele rohe Eier in deine Drinks mischen, wie du möchtest«, wurde sie von Bibiana, die sich in solchen Dingen sehr gut auskannte, belehrt.
»Aber so ein Gesöff trinke ich ohnehin nicht, ist mir viel zu scharf. Ich bin so frei und esse zum Frühstück gern mal ein fünf Minuten lang gekochtes Ei.«
»Bei so viel Poesie schenke ich euch lieber gleich den Rest Prosecco ein.« Lippi öffnete die zweite Flasche und goss nach. »Die Wohnung ist wahrhaft ein Juwel«, bekundete er überschwänglich.
»Guido, wir gehen am Samstagabend zu ›Rickys‹ mit Maddalena und ihrem Flirt.«
»Bitte lass das.« Maddalena warf Stella einen strafenden Blick zu. »Leonardo Morokutti ist bloß ein Kollege. Mich machen allein solche Anspielungen schon fertig. Das Kapitel Liebe bleibt für mich vorerst geschlossen.«
Lippi räusperte sich und wischte mit einem Stofftaschentuch über seine Stirn. Zwar hatte er seine Gewichtsprobleme so ziemlich im Griff, doch nach Jahren der Überdosis an fettigem Essen und Junkfood stand es trotz Stellas Bemühungen noch immer nicht hundertprozentig gut um seine Gesundheit.
Aber auch Menschen mit guten Blutwerten sterben mitunter, dachte Maddalena und versuchte, sich den Schatten zu entziehen, die sie immer wieder heimsuchten.
Langsam verspürte sie eine bleierne Müdigkeit, und sie hoffte, dass ihre Gäste von selbst aufbrechen würden.
»Ich bin am Samstag mit dabei. Habe gerade meinen Dienstplan gecheckt. Danke«, sagte Lippi zu Maddalena. Dann beugte er sich näher zu ihr und fragte leise und ein wenig selbstzufrieden: »Der Rest der Mannschaft, Fanetti, Rita Beltrame und Piero Zoli, bleibt also zu Hause?«
»Ja, ja. Es ist doch keine Teamsitzung.«
Das gefiel ihm sichtlich.
Maddalena grinste innerlich über Lippis Anflug von Eifersucht.
»Marsch, Kompanie! Zeit zum Aufbruch.« Bibiana gab sich militärisch, auch wenn ihre Stimme beschwipst klang.
Als alle fort waren, saß Maddalena noch eine Weile auf ihrer kleinen Veranda und ließ die Gespräche Revue passieren.
2
Toto war glücklich.
Heute Abend würde er nach Dienstschluss seinen alten Freund und dessen Freundin – oder sagte man dazu Verlobte? – treffen.
Bei solcherlei Begriffen kannte er sich nicht allzu gut aus.
Er hatte Olivia, seine Schwester, und Tante Antonella danach gefragt, aber keine eindeutige Antwort bekommen.
Olivia schüttelte missgelaunt den Kopf. »Was weiß ich? Ist doch gleichgültig.«
Sie konnte manchmal so patzig sein.
Traurig überlegte er, ob sie ihn weniger lieb hatte als früher. Dieser Gedanke machte ihm zu schaffen.
Seine Tante strich ihm wenigstens zärtlich über sein Haar. »Mach dir darüber keine Gedanken, Junge. Das ist unwichtig. Wenn sie verlobt wären, steckte ein Ring an Aquamarines rechter Hand.«
Aquamarine hatte ganz viele Ringe an ihren Fingern. Fast an jedem einen oder sogar zwei.
Aber hieß das nun, sie war verlobt, oder etwa nicht? Er verstand nur schwer, was andere anscheinend so leicht begriffen.
»In ein paar Stunden wird das geklärt, dafür sorge ich«, sagte er laut.
»Was meinst du damit, Toto? Willst du der Gewerkschaft doch noch beitreten? Das wäre super«, erkundigte sich Andrea, sein neuer Kollege im Lager des Baumarktes, interessiert.
Sie arbeiteten nebeneinander und sortierten gerade den Inhalt der angekommenen Schachteln in die Regale ein. Die Luft war stickig, und es fiel kaum Sonnenlicht in den Raum.
»Wieso sollte ich? Mir macht es großen Spaß, hier im Baumarkt zu sein. Die Werkzeuge sind mein Leben, sie riechen gut, glänzen, und ich sortiere sie gern. Wenn ich bei euch Mitglied werde, schmeißt Signor Calligaris, der Chef, mich raus. Und was wird dann aus mir?«
»Jetzt sei keine Memme. Der Alte kündigt dir niemals. Außerdem hast du eine mächtige Fürsprecherin.«
Meinte Andrea die Madonna aus der Basilika Santa Eufemia?
»Die Heilige aus Grado oder die schwarze Gottesmutter von der Isola Barbana?«
»Mensch, Toto, unabhängig von deiner körperlichen und geistigen Beeinträchtigung kannst du manchmal so was von bescheuert sein. Ich rede doch von keiner Heiligenstatue aus Stein, sondern von einer Person aus Fleisch und Blut. Wenn der Alte dir auch nur ein Härchen krümmt, macht die ihn zur Schnecke.«
»Schnecke?« Toto strich verlegen sein schweißnasses Haar zurück. »Ich bin kein Tier.«
»Davon war nicht die Rede, man sagt das so.«
Es war ihm peinlich, dass Andrea so mit ihm sprach. Der Kollege konnte manchmal ziemlich ruppig werden.
»Hast du es immer noch nicht geschnallt? Ich rede weder von der Kirche noch vom Tierreich. Deine Beschützerin ist niemand Geringerer als die Commissaria Maddalena Degrassi.«
Endlich begriff Toto, worum es ging.
»Ach so. Die Commissaria ist mein Vorbild. Die anderen dort auf der Dienststelle auch.«
»Ja, ja. Hör mit dieser Lobhudelei wenigstens in meiner Nähe auf. Mir sind diese Burschen von der Polizei nicht geheuer.«
»Aber die Commissaria ist wunderschön«, schwärmte Toto.
Andrea warf einen Hammer in die Luft und fing ihn geschickt mit der anderen Hand wieder auf.
Das gefiel Toto weniger. »Und du lass das Werkzeug in Ruhe. Es darf nicht kaputtgehen.«
»Ich spiele so lange mit den Geräten, bis du mir endlich verrätst, was du gemeint hast, als du eben sagtest, dass du heute noch was klären musst. Vielleicht kann ich dich ja dabei unterstützen?«
Toto kratzte unschlüssig mit dem Zeigefinger über seinen Nasenrücken. Er war nicht sicher, ob Andrea ihn für blöd verkaufte. Schließlich beschloss er, sich dem Kollegen anzuvertrauen. Meistens war Andrea lustig und hatte verwendbare Ratschläge für ihn.
»Aquamarine ist die Freundin meines jüngeren Freundes Sebastiano, seit vielen Jahren kleben die beiden wie Honig aneinander. Keinen sieht man ohne den anderen. Sind die beiden nun verlobt?«
»Frag sie einfach. Was interessiert dich das überhaupt so brennend? Hast du selbst Heiratsabsichten?«
»Doch nicht bei Aquamarine. Ich kenne sie schon so lange. Für mich ist sie wie eine meiner Cousinen. Und ich bin sehr anspruchsvoll, was Frauen betrifft.«
Andrea lachte schallend. »Nichts für ungut, Toto. Aber auch Frauen sind wählerisch. Die nehmen nicht jeden. Das muss schon ein ganz Besonderer sein. Sonst sind sie schneller wieder weg, als die Frecce Tricolori über den Strand von Grado sausen.«
»Dann wäre ich für viele Mädchen geeignet. Denn Tante Antonella und Olivia sagen, dass ich außergewöhnlich bin. Das war ich schon von Geburt an, auch wenn es nicht immer einfach für mich ist, etwas Besonderes zu sein.«
»Das glaube ich dir gern. Muss eine Qual sein.«
»Nicht immer, aber oft«, antwortete Toto.
»So, wir können zusammenpacken. Dienstschluss. Vergiss nicht schon wieder deine Brotdose.« Andrea verdrehte die Augen und grinste. »Die Tante soll dir salzige Wurst mitgeben. Dann hätte ich auch etwas davon.«
»Das wird sie sicher nicht. Sie findet mich zu dick und glaubt, dass ich zuckerkrank werde.«
»Ich habe doch nicht nach Apfeltaschen oder Nusshörnchen gefragt.«
Toto ging schwerfällig humpelnd zu seinem Spind und stopfte seinen Pulli und die Brotdose in seinen Rucksack. »Ciao, Andrea, bis morgen dann!«, rief er dem Kollegen zu. Draußen stieg er in sein behindertengerechtes Elektrofahrzeug und öffnete sämtliche Fenster, bevor er losfuhr.
Schon nach wenigen Minuten war er an seinem Ziel angelangt. Der Baumarkt befand sich an der Hauptstraße, die geradewegs zur Pineta führte.
Toto parkte ordentlich ein. Er hatte das viele Male geübt und war mächtig stolz darauf, nirgends anzustoßen.
Vorn am Meer saßen Aquamarine und Sebastiano im Sand. Beide winkten ihm zu, als sie ihn sahen.
»Toto, altes Haus, setz dich zu uns.«
Er mochte es zwar nicht so gern, wenn Sand in seine Hose kam, trotzdem ließ er sich neben die beiden jugendlichen Freunde fallen.
»Pfui!«, schimpfte Aquamarine und drehte sich weg. »Jetzt habe ich das ganze Zeug im Gesicht.«
Sebastiano kicherte. »Zicke, sie ist halt eine Zicke.«
Ein süßer Schwall wehte zu Toto herüber. »Was rauchst du da?«
Aquamarine und Sebastiano warfen einander merkwürdige Blicke zu, die Toto nicht einordnen konnte.
»Nur ein kleines Zigarettchen mit Honig-Menthol-Geschmack.«
Toto durfte nicht qualmen, also bat er um keinen Zug. Olivia und Tante Antonella hatten es ihm strengstens verboten, sogar die Coca-Cola musste er heimlich an der Tankstelle holen und im Baumarkt trinken. Da regte sich keiner darüber auf.
Er räusperte sich einige Male und kratzte betreten über seinen Hinterkopf, bevor er sein Anliegen hervorbrachte.
»Was ich fragen wollte«, Toto starrte auf Aquamarines Hände, »seid ihr nun verlobt, wegen der vielen Ringe? Ich dachte, ein einziger Ring würde genügen.«
Wieder sahen die beiden sich so komisch an, und Aquamarine schüttelte ihr langes blondes Haar, dass es nur so um ihr Gesicht flog. Sie sah wie ein Engel aus und erinnerte ihn an Nicola, die beste Freundin seiner Cousine Emilia.
Immer noch trauerte er um sie.
Aber Aquamarine war eben nicht Nicola.
Sie war viel schroffer und ihm weniger zugetan.
»Nö«, sagte sie, »bisher habe ich noch keinen Antrag bekommen.«
Jetzt war Toto auch nicht klüger als zuvor.
3
Aquamarine saß wie auf glühenden Kohlen. Längst schon sollte sie im Restaurant sein. Ihr Vater und Onkel Eduardo wurden ziemlich fuchsig, wenn sie sich mal etwas verspätete und so wie heute nicht rechtzeitig kam, um das Weißbrot in die Körbe auf den Tischen zu schichten.
Als Krönung von alldem stellte Toto auch noch so nervtötende Fragen. Obwohl sie sich mitunter zu dritt trafen, hatte er anscheinend eben erstmals den süßlichen Geruch aus Sebastianos Tschick wahrgenommen, bei dem sogar der dümmste der Dummen auf Marihuana tippen würde.
Sebastiano war nicht auf den Kopf gefallen, seine Antwort hatte Toto anstandslos geschluckt. Trotzdem. Hoffentlich erzählte er seiner Schwester, ihrer ehemaligen Lehrerin Signora Merluzzi, nichts von den Mentholzigaretten, die so süß wie Honig dufteten.
Und dann hagelte es auch noch die nächste unangenehme Frage nach einer Verlobung, die, so wie es aussah, wohl niemals stattfinden würde.
Sie begann zu schwitzen.
»Ich muss dann mal«, murmelte sie und rappelte sich hoch.
»Die Toiletten sind dort drüben.« Toto wies zu der Sanitäranlage neben dem Strandeingang.
Er wollte wieder mal behilflich sein, schoss aber mit seinen Aussagen wie üblich den Vogel ab.
Sebastiano kicherte beduselt. »Meine Freundin pinkelt nur zu Hause und nicht hier am Strand. Dazu ist sie sich viel zu fein.«
Aquamarine ärgerte sich über die unnötige Stichelei. Was konnte sie dafür, dass Sebastiano und sie aus unterschiedlichen Verhältnissen stammten?
Die sogenannte »gute Kinderstube«, die sie genossen haben sollte, existierte dabei in erster Linie in der Vorstellung ihres Freundes. Ihre Mutter war bei einem Zugunfall tödlich verunglückt, als Aquamarine ein kleines Mädchen war. Ihr Vater und dessen Bruder hatten anderes im Sinn gehabt, als sich um ihre Erziehung zu kümmern. Sie musste folgen und durfte nicht widersprechen. Auf ihre äußere Erscheinung achteten die beiden Herren jedoch sorgsam. Niemand sollte ihnen unterstellen, sie ließen Aquamarine verwahrlosen. Die Dame vom Jugendamt bekam bei ihren monatlichen Besuchen stets ein gutes Mittagessen vorgesetzt und zeigte sich von der sauberen, ordentlich gekleideten und braven Aquamarine beeindruckt.
Natürlich bekam sie nicht mit, dass Aquamarine, selbst als sie noch sehr jung war, kräftig mit anpacken musste. Sie war schon sehr früh für das Putzen und das Eindecken der Tische im Restaurant zuständig gewesen. Später dann machte sie die gesamte Wäsche. Das hieß, sie wusch, bügelte, räumte zusammen, begleitete ihren Onkel Eduardo, den Koch, beim Großeinkauf und half, so gut es ging, in der Küche mit.
Vieles andere hatte Aquamarine sich allein beigebracht oder sich bei Gleichaltrigen oder den Gästen im Restaurant abgeschaut. Es war ganz simpel und einfach, sie musste nur das Verhalten der anderen genau studieren und nachahmen. Dadurch war sie schnell selbstständig geworden.
Sie wusste sich zu benehmen.
Zudem gab es einen weiteren Onkel, Ricardo, der ein stiller Teilhaber des Familienbetriebes war, offiziell jedoch nicht in Erscheinung trat. Seinen Namen durfte das Lokal dennoch tragen, darauf war er stolz. Ihm galt es Respekt zu zollen, obwohl er keinen Finger für den Familienbetrieb krumm machte. Sie wusste, dass er ihrem Vater und ihrem Onkel zu Beginn einmal eine größere Geldsumme gegeben hatte, und da das Restaurant gut lief, bekam er seinen prozentuellen Anteil am Gewinn, der auch stets recht anständig ausfiel.
Sie mochte Onkel Ricardo nicht, er war unfreundlich zu ihr und ihrem Vater. Daher hatte sie ihm schon vor Jahren klipp und klar gesagt: »Wenn ich das Lokal einmal übernehme, und das werde ich, bekommst du deine blöde Kohle zurück und basta. Ich brauche keinen ›stillen Teilhaber‹, der am Kuchen mitnascht. Alles gehört dann mir allein.«
Onkel Ricardo hatte ihr daraufhin eine gescheuert. Ihr Vater und Onkel Eduardo waren herbeigeeilt und hatten sie verteidigt, sie sei doch noch ein Kind und meine es nicht so. Ihrer aller Verhältnis hatte sich dadurch jedoch nicht verbessert. Weiterhin holte der verhasste Onkel am ersten Montag im Monat regelmäßig seinen Gewinnanteil, und zeitweise hatte Ricardo sogar durchgesetzt, dass ihr Vater seinen Jungen, ihren stumpfsinnigen Cousin, als »Praktikanten« – beziehungsweise wohl eher als Spion – bei ihnen mitarbeiten ließ.
»Huch, pinkelt da etwa jemand im Stehen in den Sand? Hallo? Erde an Aquamarine!«
»Sebastiano«, schnauzte sie ihren Freund an, »das ist längst nicht mehr lustig. Überlege, was du von dir gibst.« Sie sah zu Toto, der seine Stirn in dicke Falten warf.
Das war ein untrügliches Zeichen dafür, dass er scharf nachdachte.
»Sie muss, hat sie gesagt. Das heißt doch, sie muss sich erleichtern. Also wollte ich ihr die Toiletten zeigen.« Seine Stimme kippte, und Aquamarine merkte, dass seine Verwirrung zunahm.
Er tat ihr leid.
Jeder wusste, dass der arme Kerl mehr als nur begriffsstutzig war. Dennoch war er fast so etwas wie das Maskottchen der kleinen Insel. Beinahe jeder kannte ihn hier. Er litt an einer äußerst seltenen Krankheit, die sich »Amniotisches-Band-Syndrom« nannte.
Aquamarine hatte sich schon vor Jahren schlaugemacht, als ihr niemand genauere Auskunft darüber geben wollte.
Toto war sowohl gefühlsmäßig-geistig als auch körperlich beeinträchtigt, etwa durch sein unübersehbares Hinken.
»Toto, tesoro, ich meinte, dass ich jetzt gehen muss, weil ich schon seit einer halben Stunde im Restaurant sein sollte. Papa und Onkel Eduardo warten dort auf mich. Allein schaffen sie die Arbeit nicht.«
»Ach so. Das ist wichtig. Soll ich dich begleiten? Ist ja nicht weit von hier.«
»Nein, Toto.« Sebastiano sprang auf und taumelte. »Ich bin ihr Freund, also gehen wir zusammen hin, und du gehst zu deiner Tante. Stimmt das, Aquamarine?« Besitzergreifend legte er seine Hand auf ihr Schulterblatt.
»Was Toto macht, weiß ich nicht, aber egal, wer mit mir kommt, er muss sich beeilen. Ich jedenfalls lege einen Sprint ein.«
In Aquamarines Bauch hatte sich eine anständige Portion Wut zusammengebraut. Sebastiano war seit dem Kindergarten ihr bester Freund, und vor ein paar Jahren, in der Pubertät, hatten sie angefangen, sich als Paar zu bezeichnen. Sie gingen seitdem miteinander und waren quasi unzertrennlich. Aquamarine hatte nie einen anderen Freund außer ihm gehabt. Doch manchmal spürte sie einen tiefen Groll gegen ihn, so wie eben, und hatte das Gefühl, dass sie sich nicht wirklich verstanden. Außerdem war er in letzter Zeit so bestimmend.
Der gut aussehende Junge, den sie gestern am Strand kennengelernt hatte, fiel ihr ein. Er war sehr freundlich gewesen, und sie hatten sich gleich verstanden, aber Sebastiano hatte ihn mit seiner Art vergrault, kaum dass er aufgetaucht war.
Sie strich leicht über Totos Wange und blitzte Sebastiano an. »Heute möchte ich nach meinem Dienst nur noch duschen und schlafen. Wir hören uns morgen.« Ohne seine Antwort abzuwarten, lief sie eilig davon.
»Aquamarine! So warte doch!«
Sie beachtete die Rufe nicht, sondern ging raschen Schrittes weiter. Die Nadeln der Zypressen rochen intensiv, und ihr Geruch vermischte sich in einmaliger Weise mit dem salzigen Duft des Meeres.
Eigentlich ist das Leben doch schön, dachte sie und begann leise zu summen.
Vielleicht wartete das große Glück ja noch auf sie.
4
Goran Sganbatic saß mit verschränkten Beinen im Sand. Gedankenverloren ließ er eine Handvoll davon durch seine Finger rieseln. Vor ihm lag das Meer, eine spiegelgatte blaue Fläche, die sich bis zum Horizont erstreckte. Weit draußen waren Tanker oder Transportschiffe auszumachen.
Von den vielen Touristen, die sich hier tagsüber in ihren Liegestühlen aalten und sich von der Sonne knusprig braun braten ließen, war keiner mehr zu sehen. Die hungrige Schar saß jetzt in ihren jeweiligen Hotels und Appartements beim Abendessen, und Goran genoss die dadurch eingekehrte Stille.
Sein eigener Magen begann ebenfalls zu knurren. Aus seinem Rucksack kramte er ein Thunfisch-Tramezzino und drei saftige Feigen hervor. Der süße Saft der Früchte rann ihm über das Kinn, und Goran wischte ihn träumerisch mit einer Papierserviette weg. Nach dem Sandwich, das die Hitze des Nachmittags gut überstanden hatte, öffnete er die Dose LemonSoda. Sie gab ein verheißungsvolles Zischen von sich, war aber eindeutig zu warm und schmeckte ihm längst nicht so gut wie das erste Mal davor.
Sie fiel ihm ein.
Eigentlich war sie ständig in seinem Kopf.
Aquamarine.
Vor zwei Tagen war er diesem einzigartigen Mädchen begegnet, das ihn augenblicklich verzaubert hatte. Er glaubte nicht an solche kitschigen Klischees wie Liebe auf den ersten Blick. Dennoch war sie ihm begegnet. Der kesse Ausdruck in Aquamarines großen blau schimmernden Augen ließ ihn nicht mehr los, und wenn er an ihr hellblondes Haar dachte, das so anmutig über ihre zarten Schultern fiel, bekam er bei diesen Mördertemperaturen glatt Gänsehaut.
Das Mädchen hatte einen knappen hellgelben Bikini getragen und war sehr schlank, ohne mager zu wirken. Die Kurven hatte sie auch an den richtigen Stellen. Doch es waren ihr Charme und ihre kecke Art gewesen, die ihn betört hatten.
Er war eben mit seinem Stand-up-Paddle aus dem Wasser gestapft und hatte sich auf sein Badetuch gelegt, als er sie bemerkte. Die Schöne saß auf einem wohl mitgebrachten Klappstuhl und brach Pistazien aus den bockigen Schalen. Säuberlich warf sie den Abfall in eine Papiertüte.
Für seine gestreiften, inzwischen schlabbrigen Boxershorts, die längst schon aus der Mode gekommen waren, hatte er sich auf der Stelle ein wenig geniert.
Als ihr auffiel, dass er sie beobachtete, warf sie ihr Haar zurück und hielt ihm ihre mit grünen Kernen gefüllte Hand hin.
»Magst du?« Sie sah ihn fragend an. »Ich bin süchtig nach dem Zeug.«
Er hatte keinen Moment gezögert und das Angebot angenommen.
Sein »Danke« war mehr ein Stottern als ein Wort.
»Ich bin Aquamarine.« Ihre Stimme klang ein bisschen rau. »Du hast ein cooles Stand-up-Paddle.«
»Na ja. Mein SUP, das ist die Abkürzung für Stand-up-Paddle –«
»Das weiß sogar ich«, unterbrach sie ihn glucksend.
»Nun, es ist aus Gummi und unterscheidet sich vom Hardboard dadurch, dass ich es aufblasen kann. Das bedeutet«, er zeigte auf seinen Rucksack, »ich kann das Ding darin verstauen, herumtragen und es, wann immer ich Lust habe, aufpusten, um damit auf dem Meer oder einem See herumzugondeln.«
Er war sich bei seinem Monolog so dämlich vorgekommen. Sie war schließlich keine Schülerin und er kein Surflehrer, der unbedarften Touristen etwas beibrachte.
»Mein Onkel Eduardo paddelt auch hin und wieder. Er hat mir erklärt, dass polynesische Fischer das Brett erfunden haben, um sich der Arbeit wegen flotter von einer Insel zur anderen bewegen zu können. Viel später erst hat es den internationalen Markt erobert und wurde zu einer Art Kult. Für mich ist das nichts. Obwohl ich am Meer aufgewachsen bin, schwimme ich nie weit hinaus, geschweige denn, dass ich mich überhaupt ins tiefe Wasser begebe. Es macht mir Angst, wenn ich die Bodenhaftung verliere. Aber ich bewundere all jene, die einem solchen Sport nachgehen. Das erfordert eine ordentliche Portion Schneid.« Sie bot ihm eine weitere Handvoll Pistazien an.
Nachdem Goran sich wieder einigermaßen gefasst und ebenfalls vorgestellt hatte, begannen sie ein zunächst holpriges Gespräch. Aquamarines Redefluss von gerade eben schien fürs Erste gebrochen.
Sie erzählte ihm, dass sie schon immer auf der Insel lebe und nicht mehr zur Schule ginge, sondern mit ihrem Vater und Onkel gemeinsam ein Restaurant betreibe.
Goran war beeindruckt.
Sie wirkte so mädchenhaft, fast kindlich.
»Wie alt bist du?«
»Siebzehn Jahre werde ich bald«, antwortete sie, ohne den Stolz bei diesen Worten ganz verbergen zu können.
»So jung und schon so geschäftstüchtig? Da kann ich mich mit meinen dreiundzwanzig Lenzen ja verstecken.«
»Was machst du so, und woher kommst du, Goran? Dein Akzent ist attraktiv.«
Das hatte ihm noch keiner gesagt. Einerseits freute ihn ihre Bemerkung, andererseits wäre es ihm lieber gewesen, wenn sie ihn, sprachlich betrachtet, als ihresgleichen empfunden hätte.
»Ach«, sagte er und machte eine wegwerfende Handbewegung. »Willst du meine Geschichte wirklich hören?«
»Klar, warum frage ich dich denn sonst danach?«
Also berichtete auch er und versuchte, so klug wie nur möglich rüberzukommen.
Manches war ihm unangenehm. Aber er wollte diesem Engel mit den meerblauen Augen unter den dichten schwarzen Wimpern nichts vorenthalten.
Ihre Reaktion war teilweise erstaunlich für ihn.
»Was? Du kommst aus Nova Gorica? Da wollte ich seit meinen Kindertagen hin.«
»Hmm, okay«, murmelte er, überrascht, dass jemand eine Stadt im Westen Sloweniens, unmittelbar an der Grenze zu Italien, besuchen wollte.
Denn Goran hatte sich immer schon als Italiener gefühlt.
Sein Zuhause war zwar nur rund fünfundsechzig Kilometer von der Landeshauptstadt Ljubljana entfernt, der er amtlich zugehörte, lag aber ebenfalls bloß fünfunddreißig Kilometer nördlich der italienischen Universitätsstadt Triest, die er ins Herz geschlossen hatte.
»Verstehe ich eigentlich nicht. Nova Gorica ist ein ödes Nest, und es ist wirklich dumm gelaufen, dass meine Familie sich dort angesiedelt hat. Sie sind überzeugte Slowenen, allesamt. Dabei hätten sie nur ein paar Meter weiterlaufen müssen und wären Italiener gewesen. Das hätte mir besser gefallen. Dein wunderbares Italien ist mein Traumland.«
»Nova Gorica wird 2025 mit ihrer italienischen Zwillingsstadt Kulturhauptstadt Europas, weißt du das?«
»Ja. Selbstverständlich. Steht in jedem Schmierblatt geschrieben. In allen Radio- und Fernsehsendern plappern sie davon.«
»Was gefällt dir denn nicht an deinem Heimatort?« Aquamarine hatte ihn aufmerksam angesehen. Und er verliebte sich, ohne sich selbst Einhalt gebieten zu können, unsterblich in jede ihrer unregelmäßig platzierten Sommersprossen.
»Ich fühlte mich dort immer fremd, sogar unerwünscht. Triest ist meine wahre Heimatstadt«, erklärte er schwärmerisch, »ich liebe den idyllischen Hafen mit den vielen Booten, den Ponterosso-Platz im Zentrum, das jüdische Viertel, den Canal Grande, die Kaffeehäuser, Bars und den ewigen Trubel. Sogar in die mitunter recht wütend stürmende Bora bin ich verknallt. Wenn sie mir um die Nase braust, glaube ich, gleich abzuheben.«
»Hast du einmal länger in Triest gewohnt?«
»Ja.« Er zögerte. »Ein paar Jahre.« Zu viel wollte er nicht preisgeben. Schon gar nicht diesem wunderbaren Mädchen gegenüber, denn er musste es erst besser kennenlernen, um sich ihm zu öffnen.
»Und?« Sie ließ nicht locker.
In seiner Zeit dort hatte er viele Kontakte zu internationalen Unternehmen, zum Beispiel zu berühmten Kaffeeproduzenten, Schiffbau- und Schifffahrtunternehmen und zu einigen Versicherungsgesellschaften.
»Geschäfte halt.«
»Ja, und weiter?« Sie klang ungeduldig. »Was hast du getan? Wovon gelebt?«
Schnell fuhr er fort. »Wenn es mir meine Zeit erlaubte, ging ich gern in die Observatorien für Astronomie und Geophysik. Ein paar Jahre zuvor hatte ich mit meiner Schulklasse aus Nova Gorica Cern, die europäische Organisation für Kernforschung in der Schweiz, besucht –«
»Ich weiß genau, was die da erforschen, und auch, wo das Institut seinen Sitz hat, das musst du mir nicht extra erklären«, unterbrach sie ihn ein wenig beleidigt und schnippte mit den Fingern ein Insekt von ihrem Oberarm.
»Dachte ich mir eh. Damals setzte ich mir jedenfalls in den Kopf, später mal dort in der Halbleiterproduktion zu arbeiten. Und so bin ich nach dem Abitur zum Studium ins schöne Triest gezogen. Aber alles war so kompliziert und verwirrend, dass ich es nicht schaffte.« Er brach ab und fühlte, wie eine kräftige Hand sein Herz zusammenquetschte.
»Mach dir keinen Kopf. Ich bin von der Schule abgegangen, weil ich neben der Arbeit im Lokal keine Energie mehr zum Lernen hatte. Also, wem erzählst du das?«
Goran atmete durch, und sofort dehnte sein Herz sich aus und stieß die lästige Kralle weg, die es umklammert hielt. Er litt seit seiner Kindheit an der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung und hatte – möglicherweise bedingt durch die damit einhergehende Symptomatik der Überaktivität und Impulsivität sowie einen Hang zur subversiven Kriminalität – auch ohne Abschluss Möglichkeiten gefunden, einen anständigen Batzen Kohle zu verdienen.
»Möchtest du ein Eis?« Unbeholfen zog er seine Brieftasche unter dem Handtuch hervor.
»Danke. Immer, mit Vergnügen. Pistazie mit Himbeere und etwas von der Schokosoße darüber.«
»Eine ungewöhnliche Kombination.«
Was gab er da für einen Blödsinn von sich?
»Das passt für mich sehr gut. Hätte auch etwas anderes sein können. Ich bin ziemlich einfallsreich, was das Mischen der Geschmacksrichtungen betrifft. Beim Eis, meine ich.« Sie grinste verschmitzt. »In der Küche staucht Onkel Eduardo mich allerdings ordentlich zusammen, wenn ich ihm das falsche Gewürz reiche.«
Goran hatte so ein Mädchen noch nie getroffen. Sie erinnerte ihn ein wenig an seine Lieblingsschwester Adele.
Auf seinen Flipflops war er durch den heißen Sand zum Eiswagen geschlurft. Dass die Sonne sich immer wieder hinter Wolken versteckte, tat der Hitze keinen Abbruch. Hinzu kam noch eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit.
»Das kann nur für die junge hübsche Lady aus dem ›Rickys‹ sein«, stellte der Mann hinter dem Tresen fest. »Das Mädchen hat Geschmack.«
Goran lächelte breit. Das war mal eine Ansage, die genau ins Schwarze traf.
Als er sich, um ebenfalls interessant zu erscheinen, für Kokosnuss mit Mango entschied und die Tüten in einen Pappbecher steckte, damit das Eis nicht überlief, spürte er, wie die Sonnenstrahlen auf seinem Rücken brannten. Er drehte sich um und sah, dass Aquamarine nicht mehr allein war. Wer neben ihr lungerte, konnte er nicht erkennen.
Mit dem Blick am Boden, um mit der kostbaren Fracht nicht auszurutschen, latschte er zu ihr zurück.
»Hi«, empfing sie ihn beschwingt, »danke für das Eis. Du bist ein Schatz. Der hier«, sie zeigte auf die hagere Gestalt, die sich neben ihr niedergelassen hatte, »ist Sebastiano.«
»Ich bin ihr Freund«, ergänzte der Typ und grinste ihn unverschämt siegessicher an.
Wie selbstverständlich nahm er Goran den Pappbehälter mit den Eistüten ab.
»Ach, meine Schöne hat sich mal wieder für etwas Besonderes entschieden.« Er reichte ihr das Eis mit der Schokosoße und schnupperte an dem Kokosnuss-Mango-Eis. »Na, das andere ist aber auch nicht von schlechten Eltern.«