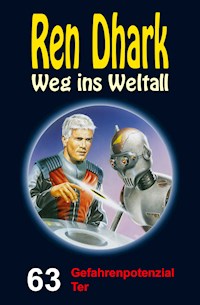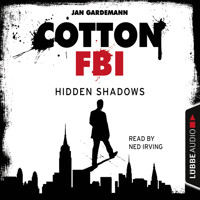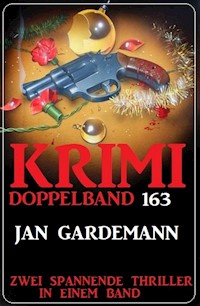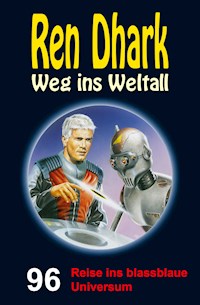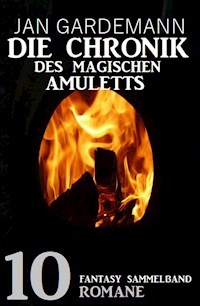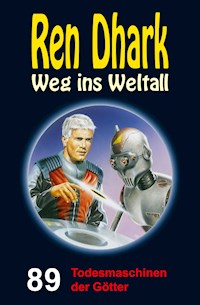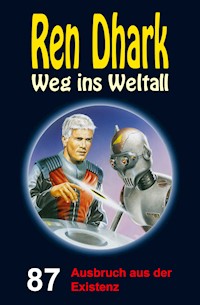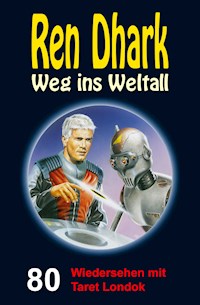4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Die Spur eines besonders machtvollen Seltsamen, die Felix Pechstein in dem Dorf Smolsky aufgenommen hat, führt ihn zurück nach Moskau, wo er in mysteriöse Intrigen verstrickt wird. Die Seltsamen nehmen Rache. Die Printausgabe des Buches umfasst 212 Seiten. Die Exklusive Sammler-Ausgabe als Taschenbuch ist nur auf der Verlagsseite des Blitz-Verlages erhältlich!!!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Jan GardemannDIE RACHE DER SELTSAMEN
In dieser Reihe bisher erschienen:
3401 Jörg Kleudgen & Michael Knoke Batcave
3402 Ina Elbracht Der Todesengel
3403 Jörg Kleudgen & E. L. Brecht Der Fluch des blinden Königs
3404 Thomas Tippner Heimkehr
3405 Melanie Vogltanz Die letzte Erscheinung
3406 Jan Gardemann Die Seltsamen
3407 Jörg Kleudgen & E. L. Brecht Höllische Klassenfahrt
3408 Daniel Weber Phantasmagoria Park
3409 Jan Gardemann Die Rache der Seltsamen
Jan Gardemann
Die Rache der Seltsamen
Ein Grusel-Thriller
Als Taschenbuch gehört dieser Roman zu unseren exklusiven Sammler-Editionen und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt.Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.© 2022 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Eric HantschTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerVignette: iStock.com/Hein NouwensSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-962-1
Teil 1 - Hotel Zarenkrone
Feodora Tarassowa hatte die Augen weit aufgerissen. Über die Regenbogenhaut ihrer Augäpfel huschte ein Schimmer, der ihrem jugendlichen Gesicht ein begeistertes Aussehen verlieh. Den Arm auf die in die Fronttür eingearbeitete Lehne gestützt, ließ die schlanke Brünette den Blick über die Hochhäuser, die Passanten und den hektischen Verkehr schweifen, der draußen an der Luxuslimousine vorüberglitt.
Es regnete heftig. Die Menschen eilten mit hochgezogenen Schultern über die Gehwege und Straßen, duckten sich unter ihre Regenschirme. Die Nässe hatte die Häuserfassaden grau und unansehnlich gemacht. Sturzbäche prasselten von den Markisen über den Schaufenstern und aus den schadhaften Regenrinnen herab.
Das Seitenfenster der Limousine stand oben einen Spaltbreit offen. Der hereindringende, von Regentropfen durchwirkte Fahrtwind spielte mit Feodoras langem welligen Haar und wehte über ihr Gesicht, das eine unverkennbare slawische Ausprägung aufwies und vom Sprühwasser feucht schimmerte.
Als zwischen zwei Häuserzeilen kurz die Zwiebeltürme des Kreml und der Basilius-Kathedrale zu sehen waren, entschlüpfte ihr ein entzückter Aufschrei.
„Der Anblick von Moskau scheint dich zu erregen, meine Liebe“, bemerkte der Mann, der neben Feodora auf der lederbezogenen Rückbank saß.
Er war nicht viel größer als seine Begleiterin und trug einen altmodischen Frack, der sich straff um seinen birnenförmigen drallen Leib spannte. Auf seiner Nase saß ein Kneifer, durch dessen Gläser er die üppige Schönheit an seiner Seite selbstgefällig betrachtete. Der an den Enden hochgezwirbelte Schnauzbart perfektionierte den Eindruck, dass dieser Mann mental ein Jahrhundert in der Vergangenheit lebte.
Ohne den Blick von der Straßenszene abzuwenden, sagte Feodora: „Ich bin zwar schon über hundert Jahre alt, Doktor, trotzdem war ich noch nie in meinem Leben in Moskau. Diese Stadt ist so faszinierend!“
Jemand, der Feodoras Geschichte nicht kannte, hätte ihre unbeschwert hingeworfene Behauptung sicherlich stutzig gemacht. Diese exotisch anmutende, erotische Person konnte nie und nimmer hundert Jahre alt sein. Das war ein Ding der Unmöglichkeit!
Ihr Begleiter jedoch nahm ihre Äußerung ohne jede Verwunderung hin. Er wiegte lediglich den Kopf hin und her, wobei sich die Fettwülste an Nacken und Kinn wie eigenständige Lebewesen regten. „Während deiner Streifzüge durchs Internet hast du diese Stadt aber doch schon oft besichtigt, meine Teuerste.“
Feodora zuckte mit den Achseln. „Das ist nicht dasselbe. Die Filme und Bilder im Internet können das eigene Erleben nicht ersetzen.“ Ein bitterer Zug umspielte ihre Lippen. „Die Bürger von Smolsky haben sich ständig eingeredet, es würde genügen, die Welt auf einem Bildschirm zu betrachten, aber jeder von uns wusste, wie armselig das im Grunde war.“
„Es stand euch jederzeit frei, euer Dorf zu verlassen und woanders hinzugehen“, bemerkte der Doktor.
Die Brünette stieß ein kurzes freudloses Lachen aus. „Was soll das, Schukow? Sie wissen genau, warum wir uns all die Jahrzehnte hinweg nicht aus Smolsky hinausgetraut haben.“
Der Doktor schüttelte seinen feisten, mit einem spärlichen Haarkranz gekrönten Schädel. Der wolkenverhangene Himmel spiegelte sich in seinen Kneifergläsern und ließ sie wie zwei silbrig schimmernde Münzen erscheinen, wie man sie in der Antike auf die Augen der Toten gelegt hatte. „Ein Jahrhundert lang in einem rückständigen Dorf zu leben ... Ihr Menschen nehmt eine Menge auf euch, wenn man euch dafür ewiges Leben in Aussicht stellt.“
Feodora drehte dem Mann das Gesicht zu. Eine steile Unmutsfalte bildete sich auf ihrer Stirn. „Sie haben gut reden, Doktor, denn Sie sind ein Seltsames Geschöpf und können viele Hundert Jahre alt werden. Ihr natürliches Ableben liegt in dermaßen weiter Ferne, dass es sich für Sie gar nicht lohnt, sich vor dem Tod zu ängstigen. Wir Menschen aber leben von Geburt an mit dem beständigen Wissen und der andauernden Furcht vor unserer Endlichkeit.“
Dr. Schukow legte eine Hand auf Feodoras Knie. „Auch dir steht ein unbegrenzt langes Leben bevor.“
Er ließ die Hand an Feodoras Oberschenkel hinaufgleiten, woraufhin sich die Frau in ihrem Sitz leicht versteifte.
„Das aus dem Blut eines Seltsamen gewonnene Elixier, das du viele Jahrzehnte lang in eurem Dorf regelmäßig eingenommen hast, hat dir Eigenschaften beschert, wie sie sonst nur meinesgleichen zu eigen sind. Du kannst fortan so alt wie ein Geschöpf werden – wenn dich keiner vorher umbringt.“
Feodora packte die Hand des Doktors am Handgelenk und schob sie bestimmend von sich. „Eine Lebensverlängerung menschlicher Versuchsobjekte, genau das war es doch, was Sie und General Assimow mit dem Jahrzehnte währenden Experiment an den Dorfbewohnern erreichen wollten!“
Schukow platzierte seine Hand mit Nachdruck erneut auf dem Knie seiner Begleiterin. „Richtig. Leider hat dieses aufwendige Unterfangen nur bei zwei Dorfbewohnern den gewünschten Effekt hervorgerufen. Beiden wurden übernatürliche Gaben verliehen, verbunden mit einem langen Leben.“
Die ihr Knie fordernd umschließende Hand ignorierend wandte sich Feodora wieder dem Fenster zu und schaute hinaus. „Alle, mit denen ich endlose Jahre in Smolsky zusammengelebt habe, sind jetzt tot!“, sagte sie rau.
„Mit Ausnahme von dir und Sophie Saizewa“, ergänzte Schukow. „Es ist ein Jammer, dass die Umstände mich zwangen, Sophie in Smolsky zurückzulassen.“
Feodoras Kopf ruckte herum. In ihren Augen blitzte es. „Den Tod von General Assimow scheinen Sie hingegen kaum zu bedauern, Doktor. Er war Ihr Freund und Mitstreiter – und ein Seltsames Geschöpf wie Sie!“
Schukow tätschelte Feodoras Knie begütigend. „Der gute Assimow ist für sein Ende selbst verantwortlich.“ Die Miene des Geschöpfes verfinsterte sich. „Aber du kannst versichert sein, dass sein Tod nicht ungesühnt bleiben wird! Felix Pechstein wird von mir zur Rechenschaft gezogen werden!“
Feodora ballte die Fäuste. „Dieser Irre hat sämtliche Bewohner von Smolsky auf dem Gewissen! Er ist ein Massenmörder!“
„Nun ja, so würde ich das nicht nennen. Genau genommen war die natürliche Lebensspanne der Dorfbewohner, für dessen Ableben er sorgte, längst abgelaufen.“
Feodora wischte sich gereizt das Regenwasser aus dem Gesicht. „Hegen Sie etwa Sympathie für diesen Killer?“
„Die Seltsamen brauchen ebenbürtige Gegenspieler“, entgegnete Schukow gelassen. „Nur so erlangen wir die Stärke, die wir benötigen, um eines Tages nicht nur Russland, sondern die ganze Welt zu beherrschen.“
Ein skeptischer Ausdruck machte sich auf Feodoras Gesicht breit. „Die Seltsamen Geschöpfe beherrschen Russland?“
Schukow sah die Frau über den Rand seines Kneifers hinweg an. „Klingt das in deinen Ohren etwa unglaubwürdig?“
„Im Internet werden die Seltsamen bisher jedenfalls nicht erwähnt.“
„Wir agieren im Verborgenen. Und so soll es auch bleiben!“
Feodora schien das Interesse an dem Gespräch verloren zu haben. Sie blickte aus dem Fenster und beobachtete das hektische Treiben auf einem großen Platz, an dem die Limousine soeben vorüberfuhr.
„Als General Assimow die Dorfbewohner mit der neuen Technologie ausstattete, vermittelte er uns das Gefühl, wir könnten in unserem abgeschiedenen Dorf mithilfe der Computer unmittelbar am Weltgeschehen teilnehmen“, sagte sie nach einer Weile gedankenverloren. „Bis dahin waren wir in Smolsky jahrzehntelang von der Außenwelt abgeschnitten gewesen. Nur selten erreichten uns Briefe oder Tageszeitungen mit Nachrichten. Wir erfuhren von Begebenheiten meistens erst, wenn die Welt diese schon wieder vergessen hatte.“
Tränen sammelten sich in ihren Augen. „Es erscheint mir wie ein Wunder, dass ich jetzt endlich aktiv am Leben teilhaben kann – wirklich und wahrhaftig, und nicht nur am Bildschirm.“
„Es ist ein Wunder“, bekräftigte Schukow. „Und dieses Wunder wird noch lange anhalten, wenn du es schlau anstellst, meine Schöne.“
Seine Hand zuckte zu Feodoras Kopf hoch. Er krallte seine fleischigen Finger in ihre Haarpracht und zerrte daran.
Die Brünette gab einen gequälten Laut von sich. Nur widerwillig ließ sie es geschehen, dass der unheimliche Doktor sie an den Haaren zu sich herüberzog. Mit der anderen Hand umfasste er ihre Schulter und drückte sie nieder, sodass sie schließlich mit durchgebogenem Rücken auf seinen Oberschenkeln lag.
„Was haben Sie mit mir vor?“, fragte Feodora verzagt.
„Meinst du jetzt oder später?“, entgegnete er gehässig und zerrte ihren Blusenzipfel aus ihrem Hosenbund hervor. „Was meine näheren Zukunftspläne betrifft, so werde ich dich in Moskau vorläufig bei jemandem unterbringen. Und was die nächsten Minuten angeht, da fällt mir schon etwas ein.“
Die Brünette, die wusste, was jetzt kommen würde, ließ den Kopf zurücksinken und schloss die Augen. Alles hatte seinen Preis, das ewige Leben gab es nicht umsonst.
„Eine vorläufige Unterbringung?“, fragte sie, während der Doktor die Bluse höher schob, bis Feodoras Bauch und die unteren Rippenbögen entblößt waren. „Das hört sich an, als hätten Sie Dringenderes zu tun, als mit mir herumzuexperimentieren. Wollten Sie nicht Laborversuche mit mir anstellen, um herauszufinden, wie genau das Elixier meinen Körper verändert hat? Zumindest haben Sie mir das angedroht, bevor Sie mich in Smolsky von Ihrem Diener in den Hubschrauber zerren ließen!“
„Dieses Vergnügen werde ich noch ein bisschen aufschieben müssen, meine Gute. Alles der Reihe nach.“
Ächzend neigte sich Schukow vor und klopfte mit dem Fingerknöchel gegen die Plexiglasscheibe, die den Fahrgastraum von der Fahrerkabine trennte.
„Blagow!“, rief er. „Schalte die Scheibentönung ein!“
Der zwei Meter große Hüne hinter dem Steuer drehte halb den Kopf, ohne den Verkehr dabei aus den Augen zu lassen, und er nickte kaum merklich. Dabei stieß der Scheitel seines ungeschlachten Kopfes fast gegen den Fahrzeughimmel. Blagow berührte ein Sensorfeld in der Mittelkonsole, woraufhin sich die Fenster rund um den Fahrgastraum dunkel einfärbten – und über die Trennscheibe schob sich leise surrend ein Vorhang.
Der Doktor legte beide Hände flach auf den straffen Bauch seiner Begleiterin. „Als Erstes werde ich meinem Sohn einen Besuch abstatten“, sagte er und presste die Fingerkuppen seiner rechten Hand in Feodoras Unterbauch.
Feodora stöhnte auf. „Sie haben einen Sohn?“ Ein dünnes Blutrinnsal floss von Schukows pressenden Fingern ausgehend ihre Taille hinab. „Die Bewohner von Smolsky sind alle unfruchtbar geworden, nachdem sie von dem Elixier tranken. Diese Unvollkommenheit scheinen die Seltsamen Geschöpfe offenbar nicht mit uns zu teilen.“
Schukows Hand tauchte tiefer in Feodoras Bauch ein. Fett- und Muskelgewebe glitten unter dem sanften, aber zwingenden Druck seiner Finger auseinander, was in Feodoras Leib ein kaltes Brennen verursachte. Blut tropfte von ihrer Hüfte auf die Gummimatten in den Fußraum hinab.
„Ja, wir sind fruchtbar“, bestätigte Schukow mit unterdrücktem Keuchen in der Stimme. „Allerdings finden Geschöpf-Mann und Geschöpf-Frau nur schwer zusammen.“
Er grinste, während er auf Feodora hinabschaute.
„Jedes Seltsame Geschöpf hat ein ausgeprägtes Ego und leidet an Selbstüberschätzung und Größenwahn. Hingabe und aufopfernde Liebe, wie sie bei den Menschen auftreten, sind uns fremd. Sich einem Artgenossen in einer Partnerschaft oder auch nur während eines einzigen Liebesaktes unterzuordnen, ist uns nahezu unmöglich. Eher würden wir uns gegenseitig die Augen ausstechen, bevor wir das Begehren eines anderen Seltsamen unserer eigenen Begierde voranstellen.“
Feodora streckte die Arme über den Kopf aus. Schukows Finger steckten nun in ihrem Bauch, strichen über die Außenwand ihres Magens und verursachten dabei ein befremdliches Kribbeln.
„Und trotzdem haben Sie es zuwege gebracht, eine Frau Ihresgleichen zu befruchten, Doktor“, stellte sie sachlich fest. „Die näheren Umstände, die dazu führten, möchte ich mir lieber nicht ausmalen.“
„Die gehen dich auch nichts an!“, blaffte Schukow und schloss die Hand um Feodoras Dickdarm. „Ein zweites Mal möchte ich dieser Furie jedenfalls nicht begegnen! Das könnte mein Ende bedeuten.“
Er neigte sich zu Feodoras Gesicht hinab und knetete dabei ihre Innereien. „Nicht nur deshalb sind mir Menschenfrauen als Gespielinnen tausendmal lieber!“
Feodoras Lippen entschlüpfte ein Stöhnen – nicht vor Schmerz.
Als Schukow gestern Nacht das erste Mal auf diese Weise mit ihr verfahren war, hatte sie vor Entsetzen schrill aufgeschrien. Erstarrt und vor Grauen wie gelähmt hatte sie im Sitz des Helikopters gekauert und mit vor Panik weit aufgerissenen Augen zugesehen, wie die Hand des Doktors in ihren Bauch eingetaucht war, um ihre inneren Organe zu betatschen.
Es hatte sie zutiefst verstört, festzustellen, dass diese innigen Berührungen keinen Schmerz, sondern ein seltsam abartiges Lustempfinden ausgelöst hatten.
Nur kurz hatte sie diesem überwältigenden Gefühl widerstehen können. Dann hatte die Erregung gesiegt und sie hatte sich den absonderlichen Liebkosungen des Doktors vorbehaltlos hingegeben. Schukow hatte während seines Tuns offenbar ähnliche Lust empfunden, denn er hatte unentwegt gestöhnt und gekeucht.
Auch jetzt traten ihm wieder Schweißperlen auf die Stirn. Er grunzte so wohlig wie ein zufriedenes Schwein. Spielend glitten seine Fingerkuppen dabei über Feodoras Milz.
Die Brünette machte ein Hohlkreuz, streckte dem Doktor den Bauch entgegen und bewegte sich dabei schlangenähnlich. Ihr Atem ging stoßweise, und ihr Gesicht verzerrte sich vor Entzücken.
Plötzlich stoppte die Limousine. Blagow schob den Vorhang vor der Trennscheibe einen Spaltbreit auf und schaute mit unbeteiligter Miene zu dem Paar auf der Rückbank.
„Wir sind am Ziel angekommen, Herr!“, dröhnte seine basslastige Stimme durch das Plexiglas hindurch.
„Ach, verflucht!“, schrie Schukow ungehalten und zog mit einem Ruck die Hand aus Feodoras Bauch. Blutschlieren bedeckten seine feisten Finger. „Konntest du nicht warten, bis wir fertig sind, Blagow? Ich hätte dir mehr Verstand und Feingefühl einhauchen sollen, als ich dich erschaffen habe!“
Der Hüne zuckte gleichmütig mit den Schultern. „Ihr hattet mir aufgetragen, Euch unverzüglich zur Zarenkrone zu fahren, Herr. Davon, dass ich mit dem Wagen so lange vor dem Eingang des Hotels stehen bleiben soll, bis Ihr Eure Verlustierung abgeschlossen habt, war nicht die Rede. Im Übrigen wartet bereits ein Hotelpage neben der Limousine. Er versucht gerade vergebens, die verschlossene Wagentür zu öffnen, um die neuen Gäste willkommen zu heißen.“
Schukow winkte entnervt ab. „Ist schon gut, Blagow, du hast alles richtig gemacht – du weißt es ja nicht besser.“
Ungestüm zog er ein Taschentuch aus der Brusttasche seines Fracks und reinigte seine Hand.
Noch leicht benommen setzte Feodora sich auf, sortierte ihr Haar und wischte dann mit dem Blusenzipfel ihren besudelten Bauch sauber. Wie schon beim ersten Mal, so hatte Schukows Eindringen in ihre Bauchdecke auch diesmal keinerlei Spuren hinterlassen. Als hätte sich ein philippinischer, auf mediale Operationen spezialisierter Geistheiler an ihr zu schaffen gemacht, hatte sich die Wunde nahtlos wieder geschlossen.
Dass diese angeblichen Heiler nur Scharlatane und ihre blutigen Zeremonien, bei denen sie ihren Patienten eklige Haarsträhnen oder Federn aus dem Bauch zogen, nur Taschenspieltricks waren, wusste Feodora aus dem Internet. Jene Männer konnten nicht wirklich mit ihren bloßen Händen in die Bauchdecke eines Menschen eindringen und das Gewebe nach der Behandlung unverletzt zurücklassen, es war alles nur Show.
Dr. Schukow hingegen war dazu imstande. Er war halt kein gewöhnlicher Mensch, sondern ein Seltsames Geschöpf. Und sie, Feodora, war ebenfalls keine gewöhnliche Menschenfrau mehr, seit sie von dem aus dem Blut eines Seltsamen gewonnenen Elixier getrunken hatte.
Nachdem sich die beiden wieder einigermaßen hergerichtet hatten, gab Schukow seinem Diener das Zeichen, die Türriegel zu entsperren.
Kurz darauf wurde der Wagenschlag geöffnet. Ein livrierter junger Mann beugte sich zur Türöffnung hinab und lächelte zuvorkommend. Über ihm wölbte sich ein großer Regenschirm.
„Willkommen in der Zarenkrone, Herrschaften. Bei uns wird jeder Gast behandelt, wie es ihm gebührt!“
„Ja, ja!“, belferte Schukow unleidig. Er stieß die Hand des jungen Mannes von sich, als der ihm beim Aussteigen behilflich sein wollte. „Ich kenne diesen Wahlspruch zur Genüge – wenn auch in abgewandelter Form: Jeder bekommt, was er verdient.“
Schon halb ausgestiegen wandte er sich noch einmal seiner Begleiterin zu.
„Möglicherweise ist Jorma nicht erfreut darüber, dass ich ihn in seinem Unterschlupf aufsuche, aber meine ansehnliche Begleitung – und damit meine ich gewiss nicht Blagow – wird ihn sicherlich begeistern, meine Liebe.“
Zwei Nächte später
Sophie Saizewa hatte sich bei Felix Pechstein untergehakt und trällerte fröhlich, wenn auch nicht ganz notensicher, ein altes russisches Volkslied vor sich hin. Es war kurz nach Mitternacht, und es regnete in Strömen.
Scheinwerferlicht von vorüberfahrenden Autos wischte über die wenigen Nachtschwärmer in den Straßen hinweg und ließ deren Kleidung und Regenschirme feucht aufschimmern.
Weder Sophie noch Felix schienen sich an dem aus dem Moskauer Himmel herabprasselnden Nass zu stören. Sophie, weil sie zu beduselt war, um sich über dieses Naturphänomen zu ärgern, und Felix, weil seine grüblerischen Gedanken es nicht zuließen, den Regen überhaupt wahrzunehmen.
Sorglos klammerte sich die Schwarzhaarige an den starken Arm des Deutschen. Dabei wankte sie so sehr, dass Felix Mühe hatte, seinen sturen, geradeaus gerichteten Gang beizubehalten. Das ungleichmäßige Hämmern von Sophies Pumps und ihr schräger Gesang hallten – vom Verkehrslärm durchmischt – von den Häusern wider, die auf dieser Seite des Sadowaja-Rings den Fußweg säumten. Die mit kleinen Balkonen ausgestatteten schlichten Wohnblocks hatten den Charme von aufgegebenen Gefängnistrakten, ein Eindruck, den die paar noch erleuchteten Fenster nicht mildern konnten.
„Moskau ist eine hinreißende Stadt“, lallte Sophie beschwingt und schwang mit dem freien Arm so begeistert in der Luft herum, dass ein ihnen entgegenkommendes Pärchen vorsichtshalber zur Seite auswich.
„Du benimmst dich unmöglich“, grollte Felix und zog Sophie mit dem Arm dichter zu sich heran.
Missmutig sah Sophie zu Felix auf. Auf ihrem ebenmäßigen, hübschen Gesicht glitzerten die Wassertropfen. „Warum bist du nur immer so sauertöpfisch?“, beschwerte sie sich und ließ ihre Handtasche gegen seine breite Brust klatschen. „Du elender Spielverderber!“
„Wir sind nicht nach Moskau gekommen, um uns in Nachtklubs zu amüsieren“, stellte Felix klar. „Und doch machen wir seit zwei Nächten nichts anderes!“
Sophie setzte ein trotziges Gesicht auf, und ihre fein gezeichneten dunklen Brauen schoben sich bedrohlich über ihrer Nase aufeinander zu. „Du hast hier gar nichts zu bestimmen, Felix! Ohne mich bist du so gut wie aufgeschmissen!“
„Und wenn schon!“ Verdrossen schob der Europol-Ermittler die Hände in die Hosentaschen.
Natürlich hatte Sophie recht – und das wurmte ihn ungemein.
Nach Moskau zurückzukehren, nachdem er in der Metropole mit der Geheimpolizei aneinandergeraten war, war ein äußerst riskantes Unterfangen. Womöglich hätte man ihn längst entdeckt und erneut verhaftet, hätte Sophie ihm nicht eine neue Identität ermöglicht. Sie hatte ihm den Ausweis ihres kranken Ehemanns Wladimir überlassen, der in Smolsky infolge von Felix’ Aktivitäten zu einem steinalten Mann geworden war. Bevor Sophie das Dorf zusammen mit Pechstein verlassen hatte, hatte sie Wladimir mit einem Kopfschuss von seinen Leiden erlöst.
Wie Wladimir, so war es auch den übrigen Dorfbewohnern ergangen. Außer Sophie und Feodora Tarassowa hatten sich alle in tattrige, dem Tod geweihte Greise verwandelt, nachdem Felix das Seltsame Geschöpf, aus dessen Blut sie ein lebensverlängerndes Elixier gebraut hatten, geköpft hatte.
Der Europol-Ermittler warf seiner Begleiterin einen verstohlenen Blick zu.
Seit er mit Sophie zusammen war, hatte sie ihm wegen seines kompromisslosen Vorgehens in Smolsky kein einziges Mal einen Vorwurf gemacht. Überraschend schnell hatte sie ihr altes Leben hinter sich gelassen, ohne es zu vermissen, was wohl vor allem daran lag, dass sie in Smolsky fast hundert Jahre lang ein viel zu geruhsames, isoliertes Dasein geführt hatte. Computer mit Internetanschluss waren dort die einzige Verbindung zum Rest der Welt gewesen.
Und nun stürzte sie sich hemmungslos ins Moskauer Nachtleben – und gebärdete sich dabei wie ein Landei, das das erste Mal Großstadtluft schnupperte.
Felix schaute in eine überbordende, zu einer Bank gehörige Fensterfront, an der sie vorübergingen. Im Innern der Filiale brannte nur die Notbeleuchtung, sodass die Scheiben eine perfekte Spiegelfläche abgaben. Der Mann, der Pechstein entgegenblickte, wirkte auf ihn wie ein Fremder.
Er hatte sein dunkelblondes Haar schwarz gefärbt und seine graublauen Augen unter braunen Kontaktlinsen verborgen. Wenn man nicht so genau hinschaute, bestand tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Foto auf dem Ausweis von Wladimir Saizewa. Felix beherrschte die russische Sprache perfekt. Sollte er von der Polizei kontrolliert werden, konnte er ihnen leicht vorspielen, ein waschechter Russe zu sein.
Seit er den Seltsamen Geschöpfen den Kampf angesagt hatte, litt er unter permanenter innerer Anspannung. Mitunter hatte er den Eindruck, wie Don Quijote aus dem Roman von Miguel de Cervantes gegen Windmühlenflügel anzukämpfen. Seine Gegner waren übermächtig und wurden von den meisten Menschen nicht als das gesehen, was sie waren.
Sophie riss an Felix’ Arm und unterbrach sein düsteres Grübeln. „Ich habe dich noch nie lachen sehen“, beschwerte sie sich. „Und getanzt hast du auch nicht. Dabei war die Musik in den Klubs doch suuuuuper!“
„Während du dich amüsiert hast, habe ich nach Seltsamen Geschöpfen Ausschau gehalten“, erklärte Felix verstimmt. „Immerhin bin ich davon ausgegangen, du würdest uns in Etablissements führen, in denen sich möglicherweise Doktor Schukow aufhält.“
Sophie kicherte glucksend. „Gibt es für dich denn nichts anderes?“
Felix blieb abrupt stehen, fasste Sophie bei den Oberarmen und drehte sie so unsanft zu sich herum, dass ihr klatschnasses, im Straßenlaternenlicht violett schimmerndes Haar hochwirbelte.
„Sag mir endlich, wo wir diesen Schukow finden, verdammt!“
Sophie machte sich von ihrem Begleiter los. Plötzlich wirkte sie wieder nüchtern und berechnend.
„Das werde ich schon noch – zu gegebener Zeit!“
„Und wann soll das sein?“, rief Felix aufgebracht. „So vergnügungshungrig, wie du bist, kann es Wochen, wenn nicht gar Monate dauern, bis du von den Bars und Nachtklubs endlich die Nase voll hast!“
Sophie setzte sich erneut in Bewegung, eilig, dabei stolperte sie fast über ihre eigenen Füße.
„Würdest du nicht ständig als Spaßbremse auftreten, wäre ich vielleicht schneller gesättigt!“, bemerkte sie schnippisch.
Felix beeilte sich, zu ihr aufzuschließen. „Vergiss nicht, warum Ama dich verschont hat. Anstatt dich umzubringen, weil du mitgeholfen hast, ihren Vater ein Jahrhundert lang in einem Schlossverlies gefangen zu halten, um ihm Blut für das Elixier abzuzapfen, ließ sie dich aus einem ganz bestimmten Grund am Leben. Du sollst mich bei meinem Kampf gegen die Seltsamen unterstützen!“
„Ama hätte sicher Verständnis für mein Vorgehen, schließlich ist auch sie eine lebenshungrige Frau.“
Felix ergriff Sophie bei der rechten Schulter und bremste ihren Lauf. „Ich verlange, dass du mir sofort verrätst, welchen Hinweis Ama dir gegeben hat! Wo werden wir Doktor Schukow finden?“
Sophie schüttelte seine Hand ab. „Du kannst mich nicht zum Reden zwingen.“
„Sieh doch mal das Gute an der Sache: Wenn du mir sagst, wo sich Schukow aufhält, wärst du mich endlich los“, versuchte Felix eine neue Strategie. „Du könntest dich in Moskau nach Lust und Laune amüsieren. Bestimmt findest du ruck, zuck einen geeigneteren Begleiter, als ich es bin.“
Sophie blieb stehen und drehte sich zu Felix um. „Du brauchst mich genauso wie ich dich. Auch wenn du es nicht wahrhaben willst: Wir sind ein ideales Paar!“
„Sind wir nicht! Ich will Doktor Schukow das Handwerk legen, während du bloß auf deinen Spaß aus bist.“
Sophie verzog spöttisch die Mundwinkel. „Glaube mir, ich habe nicht halb so viel Spaß, wie es dir vielleicht vorkommt! Im Übrigen: Wie willst du deinen Aufenthalt in Russland weiterhin finanzieren, ohne meine Unterstützung?“
Felix winkte trotzig ab. „Ich schlage mich schon irgendwie durch.“
Sophie drehte sich wortlos um und stakste weiter. Unbekümmert spitzte sie ihre Lippen und flötete erneut die Melodie des russischen Volksliedes vor sich hin. Missmutig vergrub Felix die Hände in den Hosentaschen, zog die Schultern hoch und folgte ihr in einigem Abstand.
Regenwasser rann aus seinem Haar und floss sein Gesicht hinab. Als er unter einer Markise einen Zeitungsjungen erblickte, der dort die neuesten Ausgaben der Tageszeitungen aufgestapelt hatte, ging er zu ihm und kaufte eine Iswestija.
Felix’ Laune verschlechterte sich noch um einiges, als er feststellte, dass er nur noch ein paar Rubel in der Tasche hatte und das Kleingeld gerade ausreichte, um sich zusätzlich zu der Zeitung in einem Café-Shop einen Becher Latte Macchiato zu kaufen.
Er rollte die Iswestija zusammen, trank das lauwarme, vom Regen verdünnte Gesöff aus und warf den zerknüllten Pappbecher in die Gosse.