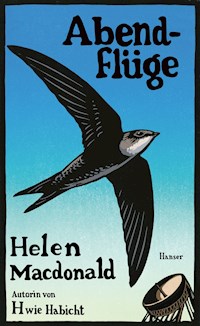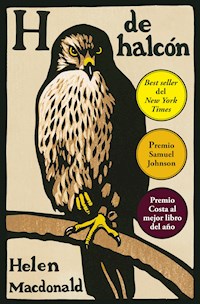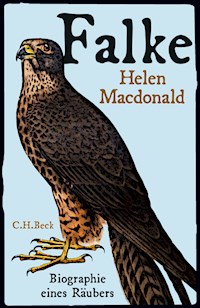14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der Spiegel-Bestseller Der Tod ihres Vaters trifft Helen unerwartet. Erschüttert von der Wucht der Trauer wird der Kindheitstraum in ihr wach, ihren eigenen Habicht aufzuziehen und zu zähmen. Und so zieht das stolze Habichtweibchen Mabel bei ihr ein. Durch die intensive Beschäftigung mit dem Tier entwickelt sich eine konzentrierte Nähe zwischen den beiden, die tröstend und heilend wirkt. Doch Mabel ist nicht irgendein Tier. Mabel ist ein Greifvogel. Mabel tötet. »Um einen Greifvogel abzurichten, muss man ihn wie einen Greifvogel beobachten, erst dann kann man vorhersagen, was er als Nächstes tun wird. Schließlich sieht man die Körpersprache des Vogels gar nicht mehr – man scheint zu fühlen, was der Vogel fühlt. Die Wahrnehmung des Vogels wird zur eigenen. Als die Tage in dem abgedunkelten Raum vergingen und ich mich immer mehr in den Habicht hineinversetzte, schmolz mein Menschsein von mir ab.« Helen Macdonald Ein Buch über die Erinnerung, über Natur und Freiheit - und über das Glück, sich einer großen Aufgabe von ganzem Herzen zu widmen. »[Macdonalds] anschaulicher Stil – verblüffend und außerordentlich präzise – ist nur ein Teil dessen, was dieses Buch ausmacht. Die Geschichte vom Abrichten Mabels liest sich wie ein Thriller. Die allmählich und behutsam anwachsende Spannung lässt den Atem stocken ... Fesselnd.« Rachel Cooke Observer * New York Times Bestseller * Costa Award für das beste Buch des Jahres 2014 * Samuel Johnson Prize
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Das Buch
»Ein einzigartiges und wunderschönes Buch, von geradezu schmerzhafter emotionaler Aufrichtigkeit und in einer anschaulichen Sprache verfasst, die in der zeitgenössischen Literatur ihresgleichen sucht.«
Aus der Begründung der Jury des Costa Award für das beste Buch des Jahres 2014
Schon als Kind beschloss Helen Macdonald, Falknerin zu werden. Ihr Vater unterstützte sie in dieser ungewöhnlichen Leidenschaft, er lehrte sie Geduld und Selbstvertrauen und blieb eine wichtige Bezugsperson in ihrem Leben. Als er stirbt, setzt sich ein Gedanke in Helens Kopf fest: Sie muss ihren eigenen Habicht abrichten. Sie ersteht einen der beeindruckenden Vögel, ein Habichtweibchen, das sie auf den Namen Mabel tauft, und begibt sich auf die abenteuerliche Reise, das wilde Tier zu zähmen.
Die Autorin
Helen Macdonald ist Autorin, Lyrikerin, Illustratorin und Historikerin. Sie arbeitet an der University of Cambridge, England, im Bereich Geschichte und Philosophie der Wissenschaften. H wie Habicht erhielt in England den renommierten Samuel Johnson Prize, der herausragenden Sachbüchern verliehen wird, sowie den Costa Award für das beste Buch des Jahres.
HELEN MACDONALD
H wie Habicht
Aus dem Englischen von Ulrike Kretschmer
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel
H is for Hawk
im Verlag Jonathan Cape, Random House,
20 Vauxhall Bridge Road, London SW1V 2SA.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Wir danken allen Rechteinhabern für die freundliche Erteilung der Abdruckgenehmigung der Textauszüge. Der Verlag hat die Quellenlage mit größter Sorgfalt recherchiert und die Nennung der Rechteinhaber dementsprechend vorgenommen. Sollte dennoch eine Textpassage nicht ausreichend als Zitat gekennzeichnet worden sein, bittet der Verlag um einen entsprechenden Hinweis des Rechteinhabers.
ISBN 978-3-8437-1147-0
© der deutschen Ausgabe 2015 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
© der Originalausgabe 2014 by Helen Macdonald
Übersetzung: Ulrike Kretschmer
Lektorat: Gabriele Banas
Sachverständigenprüfung: Matthias Bartek, Falkner, München
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur,
München, nach einer Vorlage von © Chris Wormell
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Für meine Familie
TEIL I
1
Geduld
Fünfundvierzig Autominuten nordöstlich von Cambridge beginnt eine Landschaft, die mir im Laufe der Zeit sehr ans Herz gewachsen ist. Dort geht feuchtes Moor in ausgedörrten Sand über. Es ist ein Land der knorrigen Kiefern, der ausgebrannten Autos, der kugeldurchlöcherten Straßenschilder und der US-Air-Force-Stützpunkte. Es herrscht eine nahezu gespenstische Atmosphäre. In den nummerierten Häuserblocks der Kiefernforstbetriebe verfallen die Gebäude. Hinter dreieinhalb Meter hohen Zäunen gibt es inmitten grasbewachsener Hügelgräber Stellflächen für atomare Luftwaffen, Tätowierstudios und Golfplätze der Air Force. Im Frühling setzt hier ein Lärmchaos ein: ununterbrochener Flugverkehr, Schüsse aus Druckluftgewehren über Erbsenfeldern, rufende Heidelerchen und dröhnende Düsentriebwerke. Die Landschaft heißt Brecklands – das gebrochene, zerklüftete Land –, und dort fand ich mich an diesem Morgen zu Beginn des Frühjahrs vor sieben Jahren wieder, auf einer Reise, die ich ganz und gar nicht geplant hatte. Um fünf Uhr morgens starrte ich auf einen erleuchteten quadratischen Fleck, den das Licht der Straßenlaterne an die Zimmerdecke warf, und hörte einem Paar zu, das sich draußen auf dem späten Nachhauseweg von einer Party unterhielt. Ich fühlte mich komisch: übermüdet, überreizt, unangenehmerweise irgendwie, als wäre mein Gehirn entfernt und mein Schädel stattdessen mit Alufolie aus der Mikrowelle ausgestopft worden, zerknüllt, verschmort und kurzschlussfunkensprühend. Nnngh. Aufstehen, dachte ich und warf die Bettdecke zurück. Los, raus! Ich schlüpfte in Jeans, Stiefel und Pulli, verbrühte mir den Mund an zu heißem Kaffee, und erst als mein eiskalter, uralter Volkswagen und ich die A14 schon halb hinter uns hatten, fiel mir wieder ein, wohin ich fuhr und warum. Da draußen, jenseits der beschlagenen Windschutzscheibe und der Straßenmarkierung, war der Wald. Der zerklüftete Wald. Dorthin war ich unterwegs. Um Habichte zu sehen.
Ich wusste, dass das schwierig werden würde. Habichte sind schwierig. Haben Sie schon einmal einen Greifvogel gesehen, der in Ihrem Garten einen anderen Vogel fängt? Ich nicht, aber ich weiß, dass es geschieht. Ich habe Beweise gefunden, manchmal winzige Spuren auf den Steinplatten der Terrasse: ein kleines insektenähnliches Singvogelbein, der Fuß dort eingekrallt, wie die Sehnen ihn bewegt hatten. Oder – noch grausiger – ein abgetrennter Schnabel, der Ober- oder Unterschnabel eines Sperlings, ein kleiner kegelförmiger Tropfen geröteten Blaugraus, durchsichtig schimmernd, noch mit ein paar hellen Federn daran. Aber vielleicht haben Sie es ja tatsächlich schon einmal gesehen. Vielleicht haben Sie zufällig aus dem Fenster geblickt, als ein verdammt großer Vogel mitten auf dem Rasen gerade eine Taube ermordete oder eine Amsel oder eine Elster – das gewaltigste, eindrucksvollste Stück Wildnis, das man sich vorstellen kann. Als hätte jemand einen Schneeleoparden in Ihre Küche gesetzt, der dann die Katze frisst. Es ist schon vorgekommen, dass ich von Leuten im Supermarkt oder in der Bibliothek angesprochen wurde, die mir mit weit aufgerissenen Augen erzählten: Heute Morgen hat ein Greifvogel in meinem Garten einen anderen Vogel gefangen! Mir liegt schon auf der Zunge zu antworten: Ein Sperber!, da sagt mein Gegenüber: »Ich habe im Bestimmungsbuch nachgeschaut. Es war ein Habicht!« Aber es ist nie einer – die Bestimmungsbücher funktionieren nicht. Beim Kampf gegen die Taube wird der Greifvogel auf Ihrem Rasen plötzlich überlebensgroß, und die Illustrationen im Buch stimmen mit der Erinnerung nicht überein. Der Sperber ist grau mit schwarz-weiß quergebänderter Körperunterseite, gelben Augen und langem Schwanz. Auch der Habicht ist grau mit schwarz-weiß quergebänderter Körperunterseite, gelben Augen und langem Schwanz. Hmm, denken Sie beim Lesen der Beschreibung. Sperber: dreißig bis vierzig Zentimeter groß. Habicht: achtundvierzig bis sechzig Zentimeter. Na also! Der Vogel war riesig. Es muss ein Habicht gewesen sein. Sie sehen absolut identisch aus, Habichte sind nur größer. Einfach nur größer.
Nein. Im echten Leben ähnelt der Habicht dem Sperber ungefähr so wie der Leopard der Hauskatze. Er ist größer, ja. Aber er ist auch massiger, blutiger, tödlicher, furchterregender und viel, viel seltener zu sehen. Diese Vögel der tiefen Wälder – nicht der Gärten – sind der geheimnisumwitterte Gral der Vogelbeobachter. Man kann eine Woche in einem Wald voller Habichte verbringen und nie einen zu Gesicht bekommen, höchstens Spuren ihrer Anwesenheit wahrnehmen. Eine plötzliche Stille, gefolgt von den Rufen zu Tode erschrockener Waldvögel, das Gefühl, dass sich etwas knapp außerhalb des Gesichtsfeldes bewegt. Vielleicht eine halb aufgefressene Taube, ausgestreckt auf dem Waldboden inmitten einer Explosion weißer Federn. Oder Sie haben Glück: Sie gehen im nebligen Morgengrauen spazieren, schauen sich um und sehen für den Bruchteil einer Sekunde einen Vogel vorbeifliegen, die Zehen mit den riesigen Klauen locker gekrümmt gehalten, die Augen auf ein fernes Ziel gerichtet. In diesem Sekundenbruchteil prägt sich das Bild unauslöschlich in Ihr Gedächtnis ein und lässt Sie begierig nach mehr zurück. Die Suche nach Habichten ist wie die Suche nach Gnade: Sie wird einem gewährt, aber nicht oft, und man weiß nie, wann oder wie. Etwas besser stehen die Chancen an einem stillen, klaren Morgen im Vorfrühling, denn dann verlassen die Habichte ihre Welt in den Bäumen und vollführen ihre Balzflüge am offenen Himmel. Darauf hoffte auch ich an jenem Morgen.
Ich schlug die rostende Autotür zu und machte mich mit meinem Fernglas auf den Weg durch den vom Frost zinnfarben getünchten Wald. Teile davon waren verschwunden, seit ich das letzte Mal hier gewesen war. Ich stieß auf zerstörten Boden, abgeholzte Flächen voller ausgerissener Wurzeln und vertrocknete Nadeln im Sand. Lichtungen. Die brauchte ich. Allmählich drang mein Gehirn wieder in Bereiche vor, die es seit Monaten nicht benutzt hatte – so lange hatte ich in Bibliotheken und Hörsälen gesessen, auf Bildschirme gestarrt, Seminararbeiten korrigiert, akademische Querverweise aufgespürt. Dies war eine ganz andere Art der Jagd. Hier war ich ein anderes Tier. Haben Sie schon einmal ein Reh beobachtet, das die Deckung verlässt? Es tritt heraus, hält inne und bleibt stehen, reglos, die Nase in der Luft; es blickt sich um und schnuppert. Vielleicht fährt ein nervöses Zucken über seine Flanke. Und wenn es sich vergewissert hat, dass alles sicher ist, stakst es aus dem Unterholz, um zu äsen. An jenem Morgen fühlte ich mich wie dieses Reh. Nicht dass ich in der Luft geschnuppert oder ängstlich innegehalten hätte – aber wie das Reh bewegte auch ich mich nach archaischen und emotional verankerten Mustern durch die Natur, in einer Weise und mit einer Wachsamkeit, die sich der bewussten Kontrolle entzieht. Irgendetwas in meinem Inneren befahl mir, wie und wohin ich treten sollte, ohne dass ich selbst viel darüber wusste. Vielleicht sind es Jahrmillionen der Evolution, vielleicht ist es Intuition, aber auf der Jagd mit meinem Habicht bin ich angespannt, wenn ich mich in der Sonne bewege oder im Sonnenlicht stehen bleibe. Unbewusst nähere ich mich dann den vom Licht durchbrochenen Stellen oder schlüpfe in die engen, kalten Schatten entlang der breiten Schneisen zwischen den Kiefernwäldchen. Ich zucke zusammen, wenn ich einen Häher rufen oder eine Krähe krächzen höre, zorniger Alarm. Beides kann entweder Achtung, Mensch! oder Achtung, Habicht! heißen. Und an diesem Morgen versuchte ich, das eine aufzuspüren, indem ich das andere verbarg. Die uralten geisterhaften Eingebungen, die seit Tausenden von Jahren Sehnen und Seele zu einer Einheit verschmelzen, hatten die Führung übernommen, taten, was sie immer taten, verursachten mir im hellen Sonnenlicht auf der falschen Seite eines Hügelkamms, Unbehagen, zogen mich auf die andere Seite einer ausgebleichten grasbewachsenen Anhöhe – zu einem Tümpel. Von seinem Rand stoben Wolken kleiner Vögel auf: Buchfinken, Bergfinken, eine Schar Schwanzmeisen, die in den Weidenzweigen hängen blieben wie lebendige Wattebäusche.
Der Tümpel war ein Bombenkrater, einer von einer ganzen Reihe von Kratern, die ein deutsches Flugzeug im Krieg über Lakenheath hinterlassen hatte. Eine Wasseranomalie, ein Tümpel in den Dünen, von dicken Sandseggenbüscheln umgeben, viele Kilometer vom Meer entfernt. Ich schüttelte den Kopf. Seltsam. Andererseits ist es hier sehr seltsam, und bei einem Spaziergang im Wald trifft man auf alle möglichen Dinge, die man nicht erwartet. Weitläufige Flächen von Echter Rentierflechte zum Beispiel: winzige Sternchen und Röschen, Andeutungen einer uralten Flora, die das erschöpfte Land besiedelt. Im Sommer knirscht sie unter den Füßen und wirkt wie ein Stück Arktis, das am falschen Ort auf die Welt gefallen ist. Überall ragt knochiger und scharfkantiger Feuerstein empor. An einem feuchten Morgen kann man Bruchstücke davon aufsammeln, die Handwerker aus der Jungsteinzeit aus dem Gesteinskern herausgeschlagen haben, winzige Schuppen, die von kaltem Wasser benetzt glänzen. Die Gegend hier war in der Jungsteinzeit das Zentrum der Feuersteinverarbeitung. Später wurde sie für ihre Kaninchen berühmt, die man des Fleisches und des Fells wegen hielt. Riesige umzäunte und von Dornenböschungen eingeschlossene Gehege dehnten sich einst über die gesamte Sandlandschaft aus und gaben den Ortschaften hier Namen wie Wangford Warren oder Lakenheath Warren. Damit brach schließlich auch eine Katastrophe herein. Gemeinsam mit den Schafen grasten die Kaninchen das Land so vollständig ab, dass die ohnehin schon kurze Grasnarbe am Ende nur noch eine dünne Wurzelkruste über dem Sand bildete. An den schlimmsten Stellen häuften sich Sandverwehungen auf, die über das Land wanderten. Im Jahr 1688 türmten stürmische Winde aus Südwest die Verwehungen himmelhoch auf. Eine gewaltige gelbe Wolke verdunkelte die Sonne. Tonnen von Land verschoben, bewegten und senkten sich. Brandon war vollständig von Sand eingekesselt; Santon Downham versank, der Fluss erstickte. Als sich die Winde legten, erstreckten sich zwischen Brandon und Barton Mills kilometerweit Dünen. Fortan war die Gegend als furchtbar unwegsam berüchtigt: In den weichen Dünen herrschte im Sommer sengende Hitze, nachts lauerten Wegelagerer darin. Unser ganz persönliches Arabia Deserta. John Evelyn beschrieb die Dünen als »reisende Sande«, die »dem Land schweren Schaden zufügten und wie der Sand in den Wüsten Libyens von Ort zu Ort rollten, dass sie die Ländereien einiger Gutsherren völlig verschütteten«.1
Da stand ich nun in Evelyns reisenden Sanden. Die meisten der Dünen sind von Kiefern verdeckt – den Wald pflanzte man in den Zwanzigerjahren, um uns mit Holz für künftige Kriege zu versorgen –, Wegelagerer gibt es längst nicht mehr. Aber die Gegend macht noch immer einen gefährlichen Eindruck, halb vergraben, lädiert. Ich liebe sie, denn von allen Orten, die ich in England kenne, scheint sie mir der ursprünglichste zu sein. Keine unberührte Wildnis wie ein Berggipfel, eher eine morsche Wildnis, in der sich die Menschen und das Land zu Fremdheit verschworen haben. Sie ist vom Gefühl einer alternativen Geschichte der Landschaft durchdrungen – nicht nur der grandiose, müßige Traum weitläufiger Güter, sondern eine Geschichte der Industrie, der Forstwirtschaft, der Katastrophen, des Handels und der Arbeit. Ich konnte mir keinen besseren Ort vorstellen, um Habichte aufzuspüren. Sie passen perfekt zu dieser seltsamen Breckland-Landschaft, weil ihre Geschichte ebenso menschlich ist.
Eine faszinierende Geschichte. Früher brüteten Habichte auf den gesamten Britischen Inseln. »Es gibt verschiedene Arten und Größen von Habichten«, schrieb Richard Blome 1618, »die sich in Güte, Kraft und Zähigkeit gemäß den Ländern, aus denen sie stammen, unterscheiden; doch bringt kein Land so gute hervor wie das Großfürstentum Moskau, Norwegen und der Norden Irlands, insbesondere das County Tyrone.«2 Mit dem Aufkommen der Einhegungen, der »Land Enclosure«, bei der gemeinschaftlich genutztes Land in Privatbesitz überging, waren die Qualitäten von Habichten vergessen, denn nun konnte das einfache Volk Greifvögel nur noch begrenzt fliegen. Mit dem Aufkommen von Präzisionswaffen kam statt der Falkenbeize die Jagd mit dem Gewehr in Mode. Nun waren Habichte Ungeziefer, keine Jagdgefährten mehr. Ihre Verfolgung durch Wildhüter gab der Habichtpopulation, die durch den immer weiter schwindenden Lebensraum schon geschwächt genug war, den Rest. Gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts waren die Habichte auf den Britischen Inseln ausgestorben. Ich habe eine Fotografie der ausgestopften Überreste eines der letzten Habichte, die geschossen wurden; der Schwarz-Weiß-Schnappschuss zeigt einen Vogel von einem schottischen Anwesen, schmuddelig, ausgestopft, mit Glasaugen. Die Habichte waren verschwunden.
Doch in den Sechziger- und Siebzigerjahren schmiedeten Falkner in aller Stille und ganz inoffiziell Pläne, wie man sie zurückbringen könnte. Der British Falconers’ Club errechnete, dass man für das Geld, das man für den Import eines Beizhabichts vom europäischen Festland ausgeben musste, auch einen zweiten Habicht ins Land bringen und freilassen könnte. Zwei kaufen, einen freilassen. Das war bei einem so autarken und räuberischen Vogel nicht schwer. Man suchte einfach einen Wald und öffnete die Kiste. Ähnlich gesinnte Falkner aus ganz Großbritannien folgten dem Beispiel des British Falconers’ Club. Die Vögel kamen aus Schweden, Deutschland und Finnland, die meisten waren riesige, hell gefiederte Habichte aus der Taiga. Einige ließ man absichtlich frei, andere gingen verloren. Sie überlebten, paarten sich und brüteten, im Geheimen und mit Erfolg. Heute beträgt die Zahl ihrer Nachkommen um die vierhundertfünfzig Paare.3 Der Gedanke an die scheuen und atemberaubenden Vögel, die sich in Großbritannien mittlerweile wieder völlig heimisch fühlen, macht mich glücklich. Ihre Existenz straft die Annahme Lügen, die Wildnis sei immer etwas von menschlichen Herzen und Händen Unberührtes. Auch Wildnis kann Menschenwerk sein.
Es war genau halb neun. Ich sah gerade auf einen kleinen Mahonienzweig hinunter, der aus dem Grashügel herauswuchs und dessen ochsenblutfarbene Blätter wie poliertes Schweineleder glänzten. Ich schaute kurz zum Himmel auf. Und erblickte meine Habichte. Da waren sie. Ein Paar, das in der sich rasch aufwärmenden Luft über den Baumkronen aufstieg. Wie eine flache, heiße Hand spürte ich die Sonne auf meinem Nacken, glaubte aber Eis zu riechen, als ich den beiden Habichten beim Aufsteigen zusah. Eis, Farnkraut und Kiefernharz. Habicht-Cocktail. Sie stiegen immer noch auf. Habichte im Flug sind ein komplexes Grau. Kein Schiefergrau, auch kein Taubengrau, eher ein Regenwolkengrau. Trotz der Entfernung konnte ich die große Puderquaste der weißen, fächerförmig gespreizten Bruck – der Unterschwanzdecken – und den kräftigen abgerundeten Schwanz dahinter erkennen. Ebenso die elegant gebogenen Armschwingen, die aufsteigende Habichte so einzigartig machen, dass man sie unmöglich mit Sperbern verwechseln kann. Sie wurden von Krähen schikaniert, aber das war ihnen egal, na und? Eine Krähe raste im Sturzflug auf das Männchen zu, das einfach einen Flügel anhob und die Krähe darunter wegfliegen ließ. Aber so dumm war die Krähe nun auch wieder nicht – sie blieb nicht lange unterhalb des Habichts. Ihr gesamtes Balzrepertoire zeigten die Habichte nicht: Ich konnte nichts von den Girlandenflügen ausmachen, über die ich so viel gelesen hatte. Aber sie liebten den Raum zwischen sich, den sie zu allen möglichen wunderschönen konzentrischen Akkorden und Abständen zuschnitten. Ein paar Flügelschläge und schon war das Männchen, der Terzel, über dem Weibchen; dann ließ er sich nordseits zu ihr treiben, bevor er plötzlich unter sie* glitt, blitzschnell und wie ein Messer, einen eleganten Schönschriftschnörkel am Himmel zeichnend. Sie senkte einen Flügel, dann stiegen sie gemeinsam wieder auf, standen direkt über einem Kiefernwäldchen ganz in der Nähe. Und dann waren sie plötzlich weg. Eben noch beschrieb mein Habichtpaar geometrische Figuren wie aus dem Lehrbuch am Himmel, und dann – nichts mehr. Ich erinnere mich nicht daran, dass ich weggesehen hätte. Vielleicht habe ich geblinzelt. Vielleicht war es nur das. Und in dieser winzigen schwarzen Lücke, die das Gehirn kaschiert, waren sie in den Wald abgetaucht.
* Anmerkung der Übersetzerin zur Verwendung des Personalpronomens: Spricht der Falkner von Habicht, meint er stets das Weibchen; meint er das Männchen, sagt er Habichtterzel. Deshalb beziehen sich die in diesem Buch verwendeten Personalpronomen auf das biologische Geschlecht des Vogels, nicht auf das grammatikalische.
Ich setzte mich, erschöpft, aber glücklich. Die Habichte waren verschwunden, der Himmel leer. Die Zeit verging. Die Wellenlänge des Lichts um mich herum wurde kürzer. Der Tag baute sich auf. Ein Sperber, leicht wie ein Modellflugzeug aus Balsaholz und Seidenpapier, schwirrte auf Kniehöhe vorbei, über Brombeergestrüpp hinweg und in die Bäume hinein. Ich schaute ihm nach, in Erinnerungen versunken. Diese Erinnerung leuchtete, war unwiderstehlich. Es roch nach Kiefernharz und dem pechartigen Essig der Waldameisen. Meine Kleinmädchenfinger hielten sich an Maschendrahtzaun aus Plastik fest, um den Hals spürte ich das Gewicht eines Feldstechers aus der DDR. Mir war langweilig. Ich war neun. Dad stand neben mir. Wir hielten Ausschau nach Sperbern. Sie nisteten ganz in der Nähe, und an diesem Nachmittag im Juli hofften wir, das zu Gesicht zu bekommen, was sie manchmal zeigten: ein unterseeisches Kräuseln in den Kronen der Kiefern, wenn ein Vogel in den Wald ein- oder daraus auftauchte; ein aufblitzendes gelbes Auge; eine gebänderte Brust vor tanzenden Kiefernnadeln; oder eine schwarze Silhouette, die sich sekundenlang gegen den Himmel über Surrey abzeichnete. Eine Weile war es aufregend gewesen, in die Dunkelheit zwischen den Bäumen und dem Blutorange-Schwarz zu starren, wo die Sonne verrückte und Schatten über die Kiefern warf. Doch für Neunjährige ist Warten schwer. Ich trat mit meinen Gummistiefeln gegen den Zaun. Wand mich und zappelte herum. Stieß einen Seufzer aus. Hängte mich an den Zaun. Da sah mein Vater mich an, halb verärgert, halb amüsiert, und erklärte mir etwas. Er erklärte mir Geduld. Was man nie vergessen dürfe, sei dies: Wenn man etwas unbedingt sehen wollte, musste man manchmal stillhalten, an einem Ort ausharren, sich daran erinnern, wie sehr man es sehen wollte, und geduldig sein. »Bei der Arbeit, wenn ich Fotos für die Zeitung schieße«, sagte er, »muss ich manchmal stundenlang im Auto sitzen, um das Bild zu bekommen, das ich will. Ich kann nicht einfach aussteigen und mir einen Tee holen oder auf die Toilette gehen. Ich muss Geduld haben. Und wenn du Greifvögel sehen willst, dann musst du auch Geduld haben.« Er sagte das ernst und eindringlich, nicht böse; er vermittelte mir eine Erwachsenen-Wahrheit, aber ich nickte nur schmollend und starrte auf den Boden. Es klang wie eine Belehrung, nicht wie ein Rat, und ich verstand nicht, was er mir damit hatte sagen wollen.
Man lernt. Heute, dachte ich, nicht mehr neun Jahre alt und nicht mehr gelangweilt, hatte ich Geduld gehabt, und die Habichte waren gekommen. Langsam stand ich auf – die Beine waren mir vom langen, bewegungslosen Sitzen ein wenig eingeschlafen – und fand in meiner Hand ein kleines Stück Rentierflechte; die verästelte, helle grüngraue Pflanze kann fast alles überleben, was die Welt ihr antut. Sinnfällig gewordene Geduld. Sperr sie ins Dunkle, frier sie ein, trockne sie, bis sie beinahe zerbröselt – sterben wird sie nicht. Sie begibt sich in Vegetationsruhe und wartet, bis die Lage wieder besser wird. Beeindruckend. Ich wog das dürre Bällchen in meiner Hand. Kaum zu spüren. Einem plötzlichen Impuls folgend, verstaute ich das kleine gestohlene Andenken an den Tag, als ich Habichte gesehen hatte, in der Innentasche meines Anoraks und fuhr nach Hause. Ich legte es auf das Regal neben dem Telefon. Drei Wochen später war es die Rentierflechte, die ich anstarrte, als meine Mutter anrief und mir mitteilte, dass mein Vater gestorben war.
2
Verlust
Ich wollte gerade aus dem Haus, als das Telefon klingelte. Ich nahm ab, auf dem Sprung, den Haustürschlüssel bereits in der Hand. »Hallo?« Pause. Meine Mutter. Sie musste nur einen Satz sagen: »Ich hatte einen Anruf aus dem St-Thomas-Krankenhaus.« Und in dem Moment wusste ich es, wusste, dass mein Vater gestorben war. Ich wusste, dass mein Vater tot war, weil es dieser Satz war, den sie nach der Pause sagte, mit einer Stimme, die ich noch nie zuvor bei ihr gehört hatte. Tot. Meine Beine gaben nach, knickten ein, ich saß auf dem Teppich, den Hörer ans rechte Ohr gepresst, hörte meiner Mutter zu und starrte auf das Bällchen Rentierflechte auf dem Regal, unfassbar leicht, ein luftiges lockeres Gewirr harter grauer Stängel mit scharfen, staubigen Spitzen, und Mum sagte, sie hatten nichts mehr tun können im Krankenhaus, es war sein Herz, glaube ich, man konnte nichts tun, du musst heute Abend nicht mehr herkommen, komm nicht, es ist zu weit, und es ist spät, so eine lange Fahrt, du brauchst nicht zu kommen – und das war natürlich Unsinn.
Weder sie noch ich wusste, was zum Teufel getan werden konnte oder sollte oder was hier los war, außer dass sie und ich und auch mein Bruder, wir alle also, uns an eine Welt klammerten, die es schon nicht mehr gab.
Ich legte auf. Den Schlüssel hatte ich immer noch in der Hand. In der Welt, die es schon nicht mehr gab, war ich mit Christina, einer befreundeten australischen Philosophin, zum Abendessen verabredet. Sie hatte auf dem Sofa gesessen, als der Anruf kam. Weiß wie eine Wand starrte sie mich an. Ich erzählte ihr, was passiert war. Und bestand darauf, trotzdem essen zu gehen, weil wir einen Tisch reserviert hatten, natürlich sollten wir gehen, und so gingen wir und bestellten, und als das Essen kam, rührte ich es nicht an. Der Kellner war verärgert und wollte wissen, ob irgendetwas nicht in Ordnung sei. Nun ja.
Ich glaube, Christina hat es ihm erzählt. Ich kann mich zwar nicht daran erinnern, aber der Kellner tat dann etwas ganz Außergewöhnliches. Er verschwand und erschien kurz darauf mit dem Ausdruck banger Besorgnis und einem Doppelschokoladenbrownie mit Eiscreme – auf Kosten des Hauses – wieder an unserem Tisch. Der Brownie war mit Kakao und Puderzucker bestäubt und mit einem Minzestängel garniert. Er lag auf einem schwarzen Teller. Ich starrte ihn an. Lächerlich, dachte ich. Und dann: Was ist das? Ich zog die Minze aus dem Eis, hielt sie hoch, blickte auf die beiden kleinen Blättchen und den winzigen schokoladenverschmierten Stängel und dachte: Das wird nie wieder wachsen. Dass ein Kellner gedacht hatte, gratis Kuchen und Eis würden mich trösten, berührte und befremdete mich zugleich. Ich blickte immer noch auf das abgeschnittene Ende der Minze. Es erinnerte mich an irgendetwas. Aber woran nur? Und dann war ich plötzlich, wie drei Tage zuvor an einem sonnigen Märzwochenende, wieder im Garten in Hampshire. Ich zuckte zusammen, als ich auf dem Unterarm meines Vaters eine hässliche Schnittwunde bemerkte. Du hast dich verletzt!, rief ich. Ach, das, erwiderte er und befestigte eine weitere Feder am Trampolin, das wir für meine Nichte aufbauten. Ist neulich passiert. Weiß gar nicht mehr, wie. Irgendwie halt. Ist schon in Ordnung. Ist bald verheilt. Es heilt gut. Da war sie, die alte Welt; sie flüsterte Lebwohl und verschwand. Ich rannte nach draußen. Ich musste nach Hampshire fahren. Jetzt. Weil die Wunde sich nicht schließen würde. Sie würde nicht heilen.
Hier ein Wort. Verlust. Oder beraubt. Lateinisch privatus, abgesondert, beraubt, getrennt. Jeden trifft es. Aber man fühlt es ganz allein. Einen erschütternden Verlust kann man nicht teilen, wie sehr man es auch versucht. »Stellt euch vor«, sagte ich damals zu ein paar Freunden – ich hatte allen Ernstes versucht, es ihnen zu erklären –, »stellt euch vor, eure gesamte Familie befindet sich in einem Raum. Alle. All die Menschen, die ihr liebt. Dann kommt plötzlich jemand in diesen Raum und versetzt euch einen Schlag in die Magengrube. Jedem von euch. Mit voller Wucht. Was passiert? Ihr brecht zusammen. Ihr spürt also alle den gleichen Schmerz, genau den gleichen, aber dieser Schmerz beherrscht euch so, dass ihr gar nicht anders könnt, als euch völlig allein zu fühlen. Genau so fühlt es sich an!« Triumphierend beendete ich meine kleine Ansprache, davon überzeugt, das perfekte Bild gefunden zu haben. Nur die mitleidigen, erschrockenen Gesichter meiner Zuhörer irritierten mich; ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, dass das Bild – die Familie meiner Freunde befindet sich in einem Raum und wird zusammengeschlagen – etwas von totalem Wahnsinn hatte.
Ich kann es auch heute noch nicht in die richtige Reihenfolge bringen. Die Erinnerungen sind wie schwere Glasbausteine. Ich kann sie an verschiedenen Orten aufstellen, aber sie ergeben keine Geschichte. Einmal gingen wir bei bewölktem Himmel von Waterloo aus zum Krankenhaus. Das Atmen fiel uns schwer. Mum drehte sich zu mir um, ihr Gesicht war angespannt, und sie sagte: »Eines Tages wird uns das alles wie ein böser Traum vorkommen.« Seine Brille, sorgsam zusammengeklappt auf der ausgestreckten Hand meiner Mutter. Seine Jacke. Ein Briefumschlag. Seine Uhr. Seine Schuhe. Als wir gingen, eine Plastiktüte mit seinen Sachen umklammernd, waren die Wolken immer noch da, ein Fries regloser Kumuli über der Themse, flach wie Vorsatzmalerei auf Glas. Auf der Waterloo Bridge lehnten wir uns über die Brüstung aus Portlandstein und blickten auf das Wasser hinunter. Ich lächelte, das erste Mal seit dem Anruf, glaube ich. Einerseits weil das Wasser zum Meer floss und dieser simple Grundsatz der Physik immer noch einen Sinn ergab, auch wenn der Rest der Welt es nicht mehr tat. Und andererseits wegen Dads wunderbar ausgefallenem Wochenend-Nebenprojekt vor zehn Jahren. Er hatte sich vorgenommen, jede einzelne Brücke über der Themse zu fotografieren. Ich habe ihn samstagvormittags manchmal auf seiner Fahrt in die Cotswolds begleitet. Mein Dad war nicht nur mein Dad, sondern auch mein Freund und bei Abenteuern wie diesen mein Komplize. Der Ausgangspunkt unserer Entdeckungsreise war die grasbewachsene Quelle in der Nähe von Cirencester; von dort aus folgten wir einem sich windenden, schlammigen Fluss, drangen unrechtmäßig in fremdes Gelände ein, um Bretterstege zu fotografieren, wurden von Bauern beschimpft und von Vieh bedroht, studierten hochkonzentriert Landkarten. Es dauerte ein Jahr. Aber er hat es geschafft. Jede einzelne Brücke. Irgendwo im Haus meiner Mutter steht eine Kiste mit Dias, die von der Quelle bis zum Meer Möglicheiten dokumentieren, die Themse zu überqueren.
Ein andermal hatten wir Angst, sein Auto nicht wiederzufinden. Er hatte es irgendwo in der Nähe der Battersea Bridge geparkt und – natürlich – nicht wieder abgeholt. Wir suchten es stundenlang, mit wachsender Verzweiflung, in Nebenstraßen und Sackgassen, ohne Erfolg. Wir weiteten die Suche auf Straßen aus, die Kilometer von dort entfernt waren, wo das Auto auch nur annähernd vernünftigerweise hätte stehen können. Im Laufe des Tages wurde uns allmählich klar, dass die Suche hoffnungslos war – selbst wenn wir Dads blauen Peugeot mit seinem Presseausweis hinter der Sonnenblende und seinen Kameras im Kofferraum gefunden hätten. Selbstverständlich war er abgeschleppt worden. Ich fand die Nummer des Abschleppdiensts heraus, rief an und erzählte dem Mann am Telefon, dass der Besitzer des Wagens sein Auto nicht mehr abholen konnte, weil er tot war. Mein Vater. Er hatte nicht vor, das Auto dort stehen zu lassen, er ist nur gestorben. Er wollte es wirklich nicht stehen lassen. Irrsinnige Sätze, bedeutungslos, wie in Stein gemeißelt. Ich verstand gar nicht, warum der Mann so peinlich berührt schwieg. Dann sagte er: »Tut mir leid, o Gott. Es tut mir so leid«, aber er hätte irgendetwas sagen können, und es hätte ebenso wenig bedeutet. Wir mussten dem Abschleppdienst eine Kopie von Dads Sterbeurkunde vorlegen, damit wir das Abschleppen nicht zu bezahlen brauchten. Auch das hatte keinerlei Bedeutung.
Nach der Beerdigung kehrte ich nach Cambridge zurück. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich fuhr viel in der Gegend umher. Ich starrte auf den Sonnenuntergang, den Sonnenaufgang und die Sonne zwischendurch. Ich beobachtete die Tauben, die auf dem Rasen vor meinem Haus ihr Schwanzgefieder ausbreiteten und in einer imposanten Pavane umeinander balzten. Immer noch landeten Flugzeuge, Autos fuhren, die Leute gingen einkaufen, unterhielten sich und arbeiteten. Nichts davon ergab irgendeinen Sinn. Wochenlang fühlte ich mich wie dumpf glühendes Metall. Genau so war es; ich war trotz gegenteiliger Beweise davon überzeugt, hätte man mich auf einen Stuhl gesetzt, hätte ich ihn glatt abgesengt.
Ungefähr zu dieser Zeit setzte eine Art Wahnsinn ein. Rückblickend glaube ich nicht, dass ich wirklich wahnsinnig war. Mehr so irr bei Nordnordwest. Ich konnte immer einen Habicht von einem Reiher unterscheiden, manchmal erschienen sie mir nur auffällig ähnlich. Ich wusste, dass ich nicht verrückt im Sinne von wahnsinnig war, weil ich schon Menschen mit Psychosen gesehen hatte, und da war der Wahnsinn so offenkundig gewesen wie der Geschmack von Blut im Mund. Ich erlebte eine andere Form von Wahnsinn. Eine stille und äußerst gefährliche. Ein Wahnsinn, der mich geistig gesund halten sollte. Mein Geist mühte sich ab, die Lücke zu überbrücken, eine neue und bewohnbare Welt zu schaffen. Das Problem war nur, dass er nichts hatte, womit er arbeiten konnte. Keinen Partner, keine Kinder, kein Zuhause. Keinen geregelten Arbeitstag. Also klammerte er sich, woran er konnte. Er war verzweifelt und nahm die Welt falsch wahr. Ich bemerkte plötzlich seltsame Verbindungen zwischen den Dingen. Unwichtige Dinge bekamen auf einmal eine ungeheure Bedeutung. Ich las mein Horoskop und glaubte daran. Prophezeiungen. Unmengen von Déjà-vus. Fügungen. Erinnerungen an Dinge, die noch nicht geschehen waren. Die Zeit lief nicht mehr vorwärts. Sie wurde zu etwas Festem, an das man sich schmiegen konnte und das spürbar Widerstand bot; eine zähe Flüssigkeit, halb Luft, halb Glas, die in beide Richtungen floss, Wellen der Erinnerung nach vorn und neue Ereignisse zurücksandte, sodass mir Neues, auf das ich traf, wie eine Erinnerung aus einer fernen Vergangenheit erschien. Manchmal, einige Male, hatte ich das Gefühl, dass mein Vater im Zug oder im Café neben mir saß. Das war tröstlich. Alles war tröstlich. Denn das war der ganz normale Wahnsinn der Trauer. Das wusste ich aus Büchern. Ich hatte mir Bücher über Trauer und Verlust gekauft. Sie stapelten sich meterhoch auf meinem Schreibtisch. Wie jeder gute Akademiker glaubte auch ich daran, dass man in Büchern Antworten findet. War es beruhigend zu lesen, dass jeder Geister sieht? Dass man nichts mehr essen kann? Oder nicht mehr aufhören kann zu essen? Oder dass die Trauer in Phasen verläuft, die man benennen und wie Käfer in einer Schachtel aufspießen kann? Nach dem Leugnen kommt der Schmerz, las ich. Oder die Wut. Oder Schuld. Ich weiß noch, dass ich mich besorgt fragte, in welcher Phase ich mich wohl befand. Ich wollte den Prozess klassifizieren, ihn ordnen, ihn logisch nachvollziehbar machen. Aber es gab keine Logik, und ich erkannte nicht eine einzige der Emotionen wieder.
Die Wochen vergingen. Die Jahreszeit wechselte. Die Bäume bekamen Blätter, morgens wurde es früher hell, und die Schwalben kehrten zurück. Mit lauten Rufen flogen sie über den frühsommerlichen Himmel an meinem Haus in Cambridge vorbei, und ich begann zu glauben, mir ginge es besser. Normale Trauer nennen sie es. Das war es. Das ruhige, langsame Zurückkehren ins Leben nach einem schmerzlichen Verlust. Ist bald verheilt. Ich muss heute noch lächeln, wenn ich daran denke, wie einfältig ich daran geglaubt habe, denn das war ein schrecklicher Irrtum. Ein nicht wahrgenommenes Bedürfnis brach aus mir heraus. Ich hatte einen unstillbaren Hunger nach allem, nach Liebe, nach irgendetwas, das den Verlust ausglich, und dafür zog sich mein Geist skrupellos alles und jeden heran, der ihm dienlich erschien. Im Juni verliebte ich mich vorhersehbarerweise und unsterblich in einen Mann, der das Weite suchte, als er merkte, wie kaputt ich war. Sein Verschwinden ließ mich fast besinnungslos zurück. Mittlerweile kann ich mich kaum noch an sein Gesicht erinnern. Ich weiß nicht nur, warum er die Flucht ergriffen hat, sondern auch, dass er praktisch jeder hätte sein können. Trotzdem hängt in meinem Schrank noch immer ein rotes Kleid, das ich nie wieder anziehen werde. So ist das nun mal.
Dann begann auch die Welt zu trauern. Der Himmel öffnete seine Schleusen, es regnete und regnete. In den Nachrichten wechselten sich Berichte von Überschwemmungen und überfluteten Städte ab; in Seen ertrunkene Dörfer; Sturzfluten auf der M4, die den Ferienverkehr zum Erliegen brachten; Kajaks auf den Straßen von Berkshire; ansteigende Meeresspiegel; die Entdeckung, dass der Ärmelkanal vor Jahrmillionen durch das Bersten eines gigantischen Supersees entstanden ist. Und immer noch hielt der Regen an: In den Straßen stand zentimeterhoch das Wasser, er riss Markisen mit sich und verwandelte den Fluss Cam in eine milchkaffeebraune Brühe voller abgebrochener Äste und durchweichten Gestrüpps. Meine Stadt schien der Apokalypse entsprungen zu sein. »Ich finde das Wetter ganz und gar nicht merkwürdig«, sagte ich zu einer Freundin. Wir saßen vor einem Café, und der Regen prasselte hinter unseren Stühlen so heftig auf das Pflaster, dass wir unseren Kaffee von kaltem Dunst umgeben tranken.
Als es regnete, das Wasser stieg und ich versuchte zu überleben, begann etwas Neues. Ich wachte stirnrunzelnd auf. Ich hatte von Greifvögeln geträumt, schon wieder. Ich träumte die ganze Zeit von ihnen. Noch so ein Wort: Raubvogel, Beutegreifer, von Lateinisch raptor, Räuber, und rapere, entreißen, rauben. Berauben. Genau genommen träumte ich von Habichten, vor allem von einem bestimmten. Vor einigen Jahren hatte ich in einer Auffangstation für Greifvögel direkt an der Grenze zwischen England und Wales gearbeitet; eine Gegend der roten Erde, der Kohlengruben, der feuchten Wälder und der wilden Habichte. Dieser Habicht, ein erwachsenes Weibchen, war bei der Jagd gegen einen Zaun geprallt und hatte das Bewusstsein verloren. Jemand hatte sie so gefunden, in einen Pappkarton gelegt und zu uns gebracht. Hatte sie sich etwas gebrochen? Hatte sie sonst Schaden genommen? Wir versammelten uns in einem abgedunkelten Raum, der Karton stand auf dem Tisch, und die Chefin schob ihre behandschuhte linke Hand hinein. Ein kurzes Handgemenge, und aus der Dunkelheit des Kartons tauchte in die nicht viel hellere Umgebung ein riesiger alter weiblicher Habicht auf, der graue Scheitel aufgestellt und die gebänderten Brustfedern in einer Mischung aus Aggression und Angst aufgeplustert. Alt, weil ihre Füße rau und schuppig waren, ihre Augen von einem dunklen, feurigen Orange – und sie einfach wunderschön. Schön wie eine Granitklippe oder eine Gewitterwolke. Sie füllte den Raum komplett aus. Ihr massiver Rücken war von sonnengebleichten grauen Federn bedeckt, sie hatte Muskeln wie ein Pitbull und wirkte höllisch einschüchternd, selbst auf die Mitarbeiter, die sich tagein, tagaus um Adler kümmerten. So wild und gespenstisch und reptilienartig. Sehr vorsichtig breiteten wir ihre großen, mächtigen Schwingen aus, während sie den Kopf in unsere Richtung schlängelte und uns, ohne zu blinzeln, anstarrte. Wir fuhren mit den Fingern an den schmalen Knochen ihrer Flügel und ihres Bugs entlang, um zu prüfen, ob etwas gebrochen war, die Knochen leicht wie Röhren, hohl, jeder im Inneren mit kragstufenartigen Knochenstreben ausgestattet, wie das Innere eines Flugzeugflügels. Wir untersuchten ihr Schlüsselbein, ihre stämmigen, beschuppten Beine, die Zehen und die zentimeterlangen schwarzen Klauen. Ihr Sehvermögen schien ebenfalls in Ordnung zu sein: Wir hielten ihr abwechselnd einen Finger vor jedes glühende Auge. Schnapp, schnapp machte ihr Schnabel. Dann wandte sie den Kopf und sah mich direkt an. Der Blick aus ihren Augen über dem geschwungenen schwarzen Schnabel traf sich mit meinem, sie fixierte mich mit schwarzen Pupillen. Ich hatte damals das Gefühl, dieser Habicht ist größer als ich und bedeutsamer. Und viel älter: ein Dinosaurier aus dem Forest of Dean. Ihre Federn hatten einen deutlich wahrnehmbaren prähistorischen Geruch, der mir pfeffrig und rostig wie Gewitterregen in die Nase stieg.
Sie war kerngesund. Wir brachten sie nach draußen und ließen sie frei. Sie öffnete ihre Flügel und war weg. Sie verschwand über eine Hecke, einen Abhang hinunter ins Nichts. Als hätte sie einen Riss in der feuchten Gloucestershire-Luft gefunden und wäre hindurchgeschlüpft. Diesen Augenblick spulte ich immer und immer wieder vor meinem geistigen Auge ab. Das war der wiederkehrende Traum. Und von da an war der Habicht unausweichlich.
3
Kleine Welten
Ich war zwölf Jahre alt, als ich das erste Mal einen abgerichteten Habicht sah. Bitte, bitte, BITTE!, hatte ich meine Eltern angebettelt, und sie hatten es mir erlaubt. Mich sogar hingefahren. Wir kümmern uns um sie, sagten die Männer. Sie hatten Greifvögel auf der Faust: orangeäugige Habichte, unnahbar und reglos wie Statuen, mit gebändertem grauem Schwanz und Brustfedern, die die Farbe von fauligem Schnee hatten. Mir hatte es die Sprache verschlagen. Ich wollte, dass meine Eltern wegfuhren, doch als sie es taten, wäre ich fast hinter dem Auto hergerannt. Ich hatte Angst. Nicht vor den Vögeln – vor den Falknern. Männern wie ihnen war ich noch nie zuvor begegnet. Sie trugen Tweed und boten mir Schnupftabak an. Gesellige Männer mit zerbeulten Range Rovern und Vokalen, die Eton und Oxford verrieten. Ich hatte die erste ungute Vorahnung, dass ich zwar um jeden Preis eine Falknerin werden wollte, möglicherweise aber nicht ganz wie diese Männer sein könnte. Dass sie mich eher als Kuriosität, nicht als Seelenverwandte betrachteten. Doch ich schob meine Angst beiseite und beruhigte mich, denn dies war das erste Mal, dass ich die Falknerei im Feld erlebte. Diesen Tag werde ich nie vergessen, dachte ich. Eines Tages werde ich das sein.
Im schummrigen Winterlicht stiefelten wir über Felder, auf denen neuer Weizen zu sprießen begann. Riesige Wacholderdrosselschwärme überzogen netzartig den Himmel und verwandelten ihn in etwas, das seltsamerweise an einen perlenbestickten Ärmel aus dem sechzehnten Jahrhundert erinnerte. Es war kalt. Meine Schuhe wurden vom klumpigen Lehm immer schwerer. Und zwanzig Minuten nachdem wir aufgebrochen waren, passierte es – das, was ich erwartet hatte, worauf ich aber keineswegs vorbereitet gewesen war. Ein Habicht schlug einen Fasan. Es war nur ein kurzer, brutaler Sturzflug von einer Eiche in das Gewirr der feuchten Hecke; ein jäher, gedämpfter Aufprall, brechende Zweige, Flügelschlagen, rennende Männer und ein toter Vogel, den man ehrfürchtig in einer Falknertasche verstaute. Ich stand etwas abseits. Biss mir auf die Lippe. Fühlte Dinge, für die ich keine Namen hatte. Für eine Weile wollte ich die Männer und ihre Vögel nicht mehr sehen, meine Blicke schweiften ab in die dunklen Zweige und Äste vor dem helleren Himmel – ein Bild, das mich an einen Scherenschnitt erinnerte. Danach ging ich zu der Hecke hinüber, in der das Habichtweibchen seine Beute geschlagen hatte. Spähte hinein. Tief im Gewirr der Dunkelheit leuchteten sechs Kupferfasanfedern in ihrer Wiege aus Schlehendorn. Ich griff in die Dornen hinein und sammelte eine nach der anderen ein; dann steckte ich die Hand in die Tasche und barg die Federn in meiner Faust, als wollte ich einen Augenblick in sich selbst festhalten. Ich hatte den Tod gesehen. Und ich war mir nicht sicher, welche Gefühle das in mir ausgelöst hatte.
Doch ich erlebte an diesem Tag noch mehr als meinen ersten Blick auf den Tod. Etwas anderes, das mich aber auch tief beeindruckte. Im Laufe des Nachmittags verschwanden immer mehr Männer aus unserer Gruppe. Ein Habicht nach dem anderen hatte für sich beschlossen, es sei nun genug; sie hatten keine Lust mehr, zu ihrem Falkner zurückzukehren, und setzten sich stattdessen in die Bäume, wo sie, aufgeplustert und nicht zu erweichen, ihre Blicke über beinahe endlose Weiden und Wälder schweifen ließen. Schließlich gingen wir mit drei Männern und drei Habichten weniger nach Hause; Erstere warteten immer noch unter den Ästen, auf denen sich ihre Vögel niedergelassen hatten. Ich hatte schon gelesen, dass Habichte gern mal in Bäumen schmollen. »Wie zahm und umgänglich sie auch sein mögen«, schreibt Frank Illingworth in Falcons and Falconry, »es gibt Tage, da zeigt der Habicht ein eigentümliches Gemüt, ist dann schreckhaft, mürrisch und scheu. Es kommt vor, dass sich diese Symptome einer vorübergehenden Tollheit im Laufe einer Jagd entwickeln, und dann steht dem Falkner stundenlanger Verdruss bevor.«
Doch die Männer unter den Bäumen schienen nicht verdrossen, nur schicksalsergeben. Sie zuckten mit den gewachsten Schulterpolstern, stopften ihre Pfeifen, zündeten sie an und winkten uns zum Abschied. Wir stapften in die hereinbrechende Dämmerung. Das Ganze hatte etwas von einer verhängnisvollen Polarexpedition, von einem edwardianischen Heldenepos. Nein, nein, geht nur! Ich würde euch bloß aufhalten. Ihre Habichte zeigten in der Tat ein eigentümliches Gemüt. Scheu waren sie nicht. Es war viel seltsamer: als würden die Habichte uns überhaupt nicht wahrnehmen, als wären sie aus unserer Welt hinaus- und in eine andere, wildere hineingeschlüpft, aus welcher der Mensch komplett eliminiert worden war. Und die Männer wussten, dass die Vögel verschwunden waren. Ihnen blieb nichts anderes übrig, als zu warten. Also ließen wir sie zurück: drei einsame Figuren, die in der Winterdämmerung in Bäume starrten, während der Nebel auf den Feldern um sie herum immer dichter wurde und sie darauf vertrauten, dass sich die Welt wieder einrenkte und die Habichte zu ihnen zurückkehrten. Und ebenso wie die Federn in meiner Jackentasche berührte auch ihr Warten mein leicht verwirrtes Herz.
Diese schweigsamen, eigensinnigen Habichte habe ich niemals vergessen. Aber ich wollte nie einen fliegen, als ich selbst Falknerin wurde. Sie verunsicherten mich. Sie rochen nach Tod und Schwierigkeiten: gespenstische, fahläugige Psychopathen, die im Dickicht der Wälder lebten und töteten. Meine Liebe galt den Falken: Greifvögel wie Geschosse, mit scharf die Luft durchschneidenden Flügeln, dunklen Augen und außergewöhnlicher Eleganz beim Fliegen. Ich genoss ihre Rasanz in der Luft, ihre Gutmütigkeit, das atemberaubende Niederstoßen aus dreihundert Meter Höhe, bei dem sie mit den Flügeln das Geräusch einer zerreißenden Leinwand erzeugten. Sie unterschieden sich von Habichten wie Hunde von Katzen. Sie schienen mir sogar besser als Habichte: All meine Bücher versicherten mir, dass der Wanderfalke der beste Vogel auf Gottes Erde sei. »Er hat eine edle Natur«, schrieb Captain Gilbert Blaine 1936. »Von allen Kreaturen verkörpert er Kraft, Geschwindigkeit und Anmut am reinsten.«4 Es dauerte Jahre, bis mir klar wurde, dass der Grund für diese Glorifizierung teilweise darin zu suchen war, wer Falken fliegen konnte. Einen Habicht kann man fast überall fliegen: Sie jagen mit einem blitzschnellen Flug von der Faust nach Beute in der unmittelbaren Umgebung. Für die Beizjagd mit dem Falken braucht man Platz: Moore voller Raufußhühner, Landgüter voller Rebhühner, riesige Flächen offenen Ackerlands – nicht einfach zu finden, es sei denn, man ist sehr wohlhabend oder hat gute Verbindungen. »Unter den zivilisierten Völkern«, so Blaine weiter, »blieben der Gebrauch und Besitz der edlen Falken der Aristokratie als alleiniges Recht und Privileg vorbehalten.«5
Im Vergleich zu diesen aristokratischen Falknern kam der Autourserie, der Habichtler, der auf das Abtragen von Habichten und Sperbern spezialisierte Falkner, nicht so gut weg. »Die plumpen Habichtler sind nicht im gleichen Raum wie die Falkner unterzubringen«, giftete der normannische Dichter Gace de la Bigne im vierzehnten Jahrhundert. »Sie sind in der Schrift verflucht, denn sie hassen Gesellschaft und begeben sich allein auf die Jagd. Sieht man einen missgestalten Mann mit riesigen Füßen und langen, unförmigen Schenkeln, der wie ein Stützbock gebaut ist, ganz krumm und schief und mit einem Buckel, und den man nachäffen möchte, so sagt man: ›Sieh nur, was für ein Habichtler!‹«6 Und wie der Habichtler, so der Habicht, auch noch in Büchern, die sechshundert Jahre später geschrieben wurden. »Man kann für einen Habicht einfach nicht denselben Respekt und dieselbe Bewunderung aufbringen wie für einen Wanderfalken«, meint Blaine. »Die Namen, die man ihr normalerweise gibt, zeugen ausreichend von ihrem Charakter. Namen wie ›Vampir‹, ›Jezebel‹, ›Swastika‹ oder ›Mrs Glasse‹ passen ausgezeichnet zu ihr; bei einem Wanderfalken wären sie völlig unangebracht.«7 Habichte galten als Rüpel: mordlustig, schwer abzutragen, launisch, aufsässig und fremd. Blutrünstig, schrieb der Falkner Major Charles Hawkins Fisher im neunzehnten Jahrhundert mit unverhohlener Missbilligung. Abscheulich.8 Jahrelang war ich geneigt zuzustimmen, da ich mir nach immer wieder geführten Gesprächen mehr als sicher war, es nie mit einem Habicht probieren zu wollen. »Sie fliegen Falken?«, wurde ich einmal von einem Falkner gefragt. »Ich ziehe Habichte vor. Da wissen Sie, woran Sie sind.«
»Gehen die einem nicht furchtbar auf die Nerven?«, fragte ich zurück und erinnerte mich an all die kauernden Umrisse, die da hoch oben in den winterlichen Bäumen gehockt hatten.
»Nicht, wenn man das Geheimnis kennt«, entgegnete er und beugte sich zu mir herüber. Wie in einer Filmszene mit Jack Nicholson. Leicht beunruhigt wich ich zurück. »Es ist ganz einfach. Wenn Sie einen braven Habicht wollen, müssen Sie eins tun: Geben Sie ihm die Gelegenheit zu töten. So oft wie möglich. Mord bringt ihn auf Linie.« Er grinste.
»Ah ja.« Eine Pause. Das war wohl nicht ganz die richtige Antwort gewesen. Ich versuchte es noch einmal: »Danke.« Und dachte nur: Ja, verflucht! Da bleibe ich doch lieber bei meinen Falken! Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages einen Habicht abtragen würde. Nie. Nichts von mir hatte sich je in diesen kalten, mordlustigen Augen widergespiegelt. Nicht für mich, hatte ich immer wieder gedacht. Nicht wie ich. Aber die Welt hatte sich verändert. Und ich auch.
Es war Ende Juli, und ich redete mir ein, dass so ziemlich alles wieder beim Alten war. Und trotzdem wurde die Welt um mich herum immer seltsamer. Das Licht in meinem Haus war bleiern, eine Mischung aus Magnolien- und Regenwasserfarben. Dinge kauerten darin, waren dunkel und reglos. Manchmal hatte ich das Gefühl, in einem Haus auf dem Meeresgrund zu wohnen. Ich spürte einen kaum wahrnehmbaren Druck. Leise klopfende Wasserrohre. Ich hörte mich atmen und zuckte bei dem Geräusch zusammen. Ich war nicht allein; irgendetwas, das ich weder berühren noch sehen konnte, stand neben mir, war nur den Bruchteil eines Millimeters von mir entfernt, irgendetwas ungeheuer Falsches, das den Abstand zwischen mir und all den vertrauten Gegenständen in meinem Haus unüberbrückbar machte. Ich ignorierte es. Es geht mir gut, sagte ich mir. Alles in Ordnung. Ich ging spazieren, arbeitete, machte Tee, putzte, kochte, aß und schrieb. Nachts aber, wenn der Regen orangefarbene Lichtpunkte an die Fensterscheiben pikste, träumte ich von dem Habicht, der durch die feuchte Luft woandershin entschwand. Ich wollte ihm folgen.
Der graue Regen draußen vor dem Fenster dämpfte das Licht in meinem Arbeitszimmer. Ich saß am Computer. Telefonierte mit Freunden. Schrieb E-Mails. Fand einen Greifvogelzüchter in Nordirland, der einen jungen Habicht aus dem diesjährigen Gelege übrig hatte. Sie war zehn Wochen alt, zur Hälfte tschechisch, zu einem Viertel finnisch und zu einem Viertel deutsch. Und für einen Habicht war sie klein. Wir verabredeten uns in Schottland, wo ich sie abholen sollte. Der Gedanke an einen kleinen Habicht gefiel mir. »Klein« war die einzige Entscheidung, die ich traf. Was den Habicht selbst anging, glaubte ich nicht eine Sekunde daran, dass ich eine Wahl hatte. Der Habicht hatte mich gefangen. Nicht umgekehrt.
Als der Regen aufhörte, kam die Hitze. Hunde hechelten im dunklen Schatten unter den Linden und auf dem Rasen vor dem Haus, der fast versengt war. Ein feuchter, heißer Wind trieb Blätter vor sich her, schaffte es aber nicht, irgendetwas abzukühlen. Eigentlich machte er alles nur noch schlimmer, wie eine Hand, die heißes Wasser in der Badewanne verwirbelt. Spazierengehen fühlte sich an als wate man bis zum Hals in einer zähen Flüssigkeit. Ich quetschte mich in mein Auto, das einem Glutofen glich, und fuhr zu einem Freund, der in einem kleinen Ort knapp außerhalb der Stadt wohnte. Ich wollte über Habichte reden, und das kann ich mit niemandem besser als mit Stuart. Er ist mein Habichtguru. Vor Jahren bin ich mit ihm an Spätwinternachmittagen auf die Beizjagd gegangen; wir warfen lange Schatten, und unter unseren Füßen knirschten Zuckerrüben. Während wir auf der Suche nach wilden Moorfasanen waren, saß sein großes altes Habichtweibchen wie eine Galionsfigur auf seiner Faust und lehnte sich im goldenen Licht der Sonne gegen den Wind. Stuart ist ein klasse Typ, ein Schreiner und Ex-Biker, sicher und ruhig wie eine Welle mitten auf dem Ozean, und seine Partnerin Mandy ist unglaublich großzügig und humorvoll. Sie zu sehen baute mich total auf. Ich hatte schon fast vergessen, wie freundlich und warm die Welt sein kann. Stuart warf den Grill an, und bald darauf füllte sich der Garten mit Kindern, Teenagern, Zigarettenrauch, umherschnüffelnden Pointern und Frettchen, die in ihren Käfigen herumsausten. Als sich der Nachmittag dahinzog, wurde der Himmel allmählich weißer; die Sonne war hinter einer faserig-hellen Wolkenfront nur noch zu ahnen. Eine Spitfire donnerte über unsere Köpfe hinweg. Der Schweiß lief uns in Strömen herunter. Die Hunde hechelten, die Frettchen tranken aus ihren Wasserschalen, und Stuart schuftete am Grill. Als er um die Ecke kam, wischte er sich die Stirn mit dem Ärmel ab und rief überrascht: »Es wird kühler!« »Nein«, riefen wir zurück, »du bist nur vom Grill weg!«
Ich ließ mich mit einem Burger auf einen weißen Plastikstuhl fallen. Gegenüber, im Schatten der Hecke, stand eine Jule auf dem Rasen, und darauf saß, das Durcheinander völlig ignorierend, ein perfekter kleiner Wanderfalke und pflegte sorgfältig die langen, gebänderten Federn seines Brust- und Leibgefieders. »Halb tschechisch?«, fragte Stuart. »Der blutdurstigste Habicht, den ich je abgetragen habe, war ein tschechischer. Ein Albtraum! Bist du sicher, dass du das willst?«
Er nickte in Richtung der Jule. »Du kannst den fliegen, wenn du möchtest. Wanderfalke gefällig?«
Mein Herz setzte einen Schlag aus. Der Falke. Da saß er, ein unwirklich schönes Tier von der Farbe abgesplitterten Feuersteins und weißen Kalks, die Flügel eng am Rücken gefaltet, das dunkle Gesicht zum Himmel gewandt. Er beobachtete die Spitfire über uns mit professioneller Neugier. Ich schaute auch zu dem Flugzeug hinauf. Der Klang seines Motors hatte sich verändert; er wurde gedrosselt, langsam glitt die Spitfire am weißen Himmel zu dem Luftfahrtmuseum hinunter, in dem sie Ausstellungsstück war. Der Falke hielt den Kopf schräg und verfolgte ebenfalls das Flugzeug. Unsere Blicke hatten genau dieselbe Richtung. Einen sehr langen Augenblick fragte ich mich, ob ich nicht im Begriff war, einen schrecklichen Fehler zu begehen.
»Das würde ich sehr gerne«, sagte ich steif, förmlich. Der halb aufgegessene Burger in meiner Hand schien mir plötzlich unappetitlich. Ich holte tief Luft, und dann sagte ich: »Normalerweise würde ich es auch tun, ich würde die Gelegenheit beim Schopf packen. Das ist wirklich ein unglaubliches Angebot, Stu. Aber ich will diesen Habicht.« Er nickte. Tapfer aß ich den Burger auf. Ketchup tropfte wie aus einer Wunde an meinem Arm herunter.
Es würde also ein Habicht sein. Und dann geschah Folgendes: Meine Augen begannen, einem ganz bestimmten Buch auf dem Regal neben meinem Schreibtisch auszuweichen. Zuerst war es nur ein optischer blinder Fleck, ein Zucken des Augenlids; dann wie ein Körnchen Schlaf in meinem Augenwinkel. Mit einem kurzen Aufblitzen von Unbehagen, das ich nicht so recht einordnen konnte, sah ich an der Stelle, an der das Buch stand, vorbei. Schon bald konnte ich nicht mehr an meinem Schreibtisch sitzen, ohne daran zu denken, dass es da war. Zweites Regalbrett von unten. Roter Leineneinband. Silberne Buchstaben auf dem Rücken. The Goshawk. Der Habicht. Von T. H. White. Ich wollte das Buch da nicht, und ich wollte auch nicht darüber nachdenken, warum ich es nicht wollte. Bald war es so weit, dass ich nur noch das verdammte Buch sah, wenn ich an meinem Schreibtisch saß, auch wenn es der einzige Gegenstand in diesem Raum war, den ich mich weigerte anzusehen. Eines Morgens saß ich da, die Sonne schien auf den Tisch, der Kaffee dampfte, der Laptop war eingeschaltet und ich unfähig, mich zu konzentrieren. Lächerlich, zischte ich, beugte mich nach unten, zog das Buch aus dem Regal und legte es vor mir auf den Schreibtisch. Es war ja schließlich nur ein Buch. Noch nicht einmal ein besonders bösartiges. Es war alt und hatte Wasserflecken, die Enden des Buchrückens waren abgestoßen und abgeschabt, als hätte es Jahre in Taschen und Kisten verbracht. Hmm, dachte ich. Plötzlich interessierte ich mich für meine Gefühle diesem Buch gegenüber. Vorsichtig dachte ich darüber nach, ließ meine Gefühle darüber gleiten wie die Zunge über einen schmerzenden Zahn. Meine Abneigung war regelrecht greifbar, aber mit einer merkwürdigen Vorahnung verbunden, die auseinandergenommen werden wollte, weil ich wissen musste, woraus sie bestand. Ich öffnete das Buch und begann zu lesen. Kapitel eins, stand da. Dienstag. Und dann: Als ich ihn das erste Mal sah, sah ich etwas Rundes, wie einen mit Sackleinen bedeckten Wäschekorb.9 Ein Satz aus einer längst vergangenen Zeit, und als Vorahnung schwang ein anderes Selbst mit. Nicht der Mann, der ihn geschrieben hatte – ich. Ich, als ich acht Jahre alt war.
Ich war ein dürres, zu großes Kind mit tintenbefleckten Fingern, einem Fernglas um den Hals und Beinen voller Pflaster. Ich war schüchtern, ging über den großen Onkel, hatte X-Beine, war unglaublich ungeschickt, hoffnungslos unsportlich und allergisch gegen Hunde und Pferde. Aber ich hatte eine Obsession. Vögel. Vor allem Greifvögel. Ich war mir sicher, sie waren das Beste, das je existiert hatte. Meine Eltern dachten, auch diese Obsession würde ebenso vergehen wie die für Dinosaurier, Ponys und Vulkane. Doch das tat sie nicht. Sie wurde schlimmer. Als ich sechs war, versuchte ich, mit hinter dem Rücken verschränkten Armen – wie Flügel – zu schlafen. Das hielt nicht lange an, weil es sehr schwer ist, so zu schlafen. Als ich dann später Bilder des altägyptischen falkenköpfigen Gottes Horus sah – eine türkisbesetzte Fayence mit einem perfekten Bartstreif unter den großen, eindrucksvollen Augen –, kam noch eine Art religiöse Ehrfurcht hinzu. Das war mein Gott, nicht der, zu dem wir in der Schule beteten, der alte Mann mit Rauschebart und Faltengewand. Wochenlang flüsterte ich in geheimer Ketzerei Lieber Horus, wenn wir bei den Schülerversammlungen das Vaterunser aufsagen mussten. Eine angemessen formelle Anrede, wie ich fand, hatte ich sie doch vom Beantworten meiner Geburtstagskarten gelernt. Greifvogel-Verhaltensweisen, Greifvogelarten, wissenschaftliche Namen von Greifvögeln: Ich kannte sie alle, hängte Bilder der Beutegreifer in meinem Zimmer auf und zeichnete sie, immer und immer wieder, auf Zeitungsränder und Notizzettelschnipsel, in meine Schulbücher, in der Hoffnung, sie dadurch zum Leben zu erwecken. Ich weiß noch, wie uns ein Lehrer Bilder der Höhlenmalereien von Lascaux zeigte und sagte, niemand wüsste, warum die Menschen damals diese Tiere gemalt hätten. Ich war empört! Ich wusste genau, warum, konnte meine Erkenntnisse in diesem Alter aber noch nicht in Worte fassen, die einen Sinn ergeben hätten, noch nicht einmal für mich.
Dann entdeckte ich, dass es die Falknerei immer noch gab, und die Dinge nahmen eine weniger nebulös-religiöse Gestalt an. Ich teilte meinen leidgeprüften Eltern mit, dass ich, wenn ich groß sei, Falknerin werden wollte, und machte mich daran, alles über diese wunderbare Kunst zu lernen. Zunächst begaben Dad und ich uns bei Familienausflügen auf die Jagd nach Büchern über die Falknerei. Wir erstanden einen Klassiker nach dem anderen. Secondhandtrophäen in Papiertüten aus Buchhandlungen, die schon längst nicht mehr existieren: Falconry von Gilbert Blaine; Falconry von Freeman und Salvin; Falcons and Falconry von Frank Illingworth; das Buch mit dem wunderbar alliterativen Titel Harting’s Hints on Hawks. Die ganzen Jungsbücher. Ich las sie immer und immer wieder und lernte lange Passagen von Prosa aus dem neunzehnten Jahrhundert auswendig. In der Gesellschaft dieser Autoren fühlte ich mich wie auf einer exklusiven Privatschule, denn es handelte sich fast ausnahmslos um raubeinige, aristokratische Sportsmänner, die Tweed trugen, Großwild in Afrika schossen und gewichtige Meinungen vertraten. Ich brachte mir nicht nur selbst die praktischen Grundlagen des Greifvogelabtragens bei, ich sog damit unbewusst auch die Haltungen einer imperialistischen Elite auf. Ich lebte in einer Welt, in der englische Wanderfalken vor ausländischen Greifvögeln immer die Nase vorn hatten, in einer Welt der Raufußhuhnmoore und Herrenhäuser, in der Frauen nicht existierten. Diese Männer waren meine Seelenverwandten. Ich fühlte mich wie einer von ihnen, einer der Auserwählten.
Ich wurde zum schrecklichsten aller Falknerei-Langweiler. Wenn ich an verregneten Nachmittagen von der Schule nach Hause kam, schrieb meine Mum Artikel für die Regionalzeitung – über Gerichtsverhandlungen, lokale Feste, Planungsausschüsse. Sie saß im Esszimmer, ihre Finger tanzten über die Tasten der Schreibmaschine; auf dem Tisch lag ein Päckchen Benson & Hedges, daneben eine Tasse Tee, ein Stenoblock – und neben ihr stand eine Tochter, die unvollständig memorierte gelernte Sätze aus Falknereibüchern des neunzehnten Jahrhunderts herunterspulte. Es war mir ungeheuer wichtig, meine Mutter wissen zu lassen, dass Hundeleder sich für das Beizvogelgeschirr zwar am besten eignete, heutzutage aber kaum mehr zu bekommen war. Dass das Problem mit Merlinen war, dass sie dazu neigten, die Beute davonzutragen. Und wusste sie schon, dass Sakerfalken, die ursprünglich aus Wüstengebieten stammen, unter den klimatischen Bedingungen Englands eher unzuverlässige Leistungen erbrachten? Sie nahm sich ein weiteres gelbes Blatt, fummelte mit dem Durchschlagpapier herum, damit es nicht verrutschte, nickte zustimmend, sog an ihrer Zigarette und versicherte, wie interessant das alles sei, wobei sie mich mit bewundernswerter Leichtigkeit glauben machte, dass es sie tatsächlich interessierte. Bald war ich Expertin für Falknerei, etwa so wie der Teppichverkäufer, der immer in die Buchhandlung kam, in der ich einmal gearbeitet hatte, Experte für die Perserkriege war. Der schüchterne, zerknitterte, mittelalte Mann, den der Hauch einer unausgesprochenen Niederlage umwehte, fuhr sich immer nervös über das Gesicht, wenn er an der Kasse Bücher bestellte.
Auf einem Schlachtfeld hätte er wahrscheinlich nicht lange überlebt. Aber er wusste alles über die Perserkriege, unterhielt gewissermaßen intime Beziehungen zu jeder einzelnen Schlacht und wusste genau, wo die verschiedenen Einheiten der phokischen Truppen auf den Hochgebirgspässen aufgestellt waren. Und genau so kannte ich mich mit der Falknerei aus. Als ich Jahre später meinen ersten Greifvogel bekam, war ich überrascht, wie real er war. Ich war der Teppichverkäufer in der Schlacht bei den Thermopylen.
Es ist der Sommer des Jahres 1979. Ich bin acht Jahre alt, stehe in einer Buchhandlung unter einem Oberlicht und halte ein Taschenbuch in der Hand. Ich bin extrem verwirrt. Was zum Teufel ist eine Verführungsgeschichte aus dem achtzehnten Jahrhundert? Ich hatte nicht die leiseste Ahnung. Also las ich den Text auf dem Rückendeckel noch einmal:
Der Habicht ist die Geschichte eines Duells zwischen Mr White und einem großartigen, wunderschönen Greifvogel während des Abrichtens des Letzteren – hier treffen zwei ungeheuer willensstarke Kreaturen aufeinander. Letztlich ist es die fast wahnhafte Willenskraft des schulmeisterlichen Falkners, die den Stolz und das Durchhaltevermögen des wilden Raubvogels bricht. Die Geschichte ist komisch, tragisch und fesselnd. Und sie erinnert an die Ver- führungs-Erzählungen des achtzehnten Jahrhunderts.10
Noch immer keine Ahnung. Aber ich musste das Buch trotzdem haben, denn auf dem Umschlag vorn war ein Habicht abgebildet. Voller Trotz und Zorn stachen seine Augen unter den Brauen hervor, das schuppenartige Gefieder ein Chaos aus Safrangelb und Bronze. Seine Fänge hielten den bemalten Handschuh so fest umklammert, dass meine Finger in mitfühlender Taubheit zu kribbeln begannen. Er war wirklich wunderschön; angespannt vor Widerwillen wie ein zorniges Kind, dem man den Mund verboten hatte. Sobald wir zu Hause waren, rannte ich in mein Zimmer, warf mich aufs Bett, legte mich auf den Bauch und schlug das Buch auf. Und so – auf die Ellbogen gestützt und mit den Füßen in der Luft – las ich die ersten Zeilen von The Goshawk zum allerersten Mal.
Als ich ihn das erste Mal sah, erblickte ich etwas Rundes, wie einen mit Sackleinen bedeckten Wäschekorb. Aber er war ungestüm und furchterregend, ähnlich abstoßend wie Schlangen auf Menschen wirken, die sich mit diesen Tieren nicht auskennen.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.