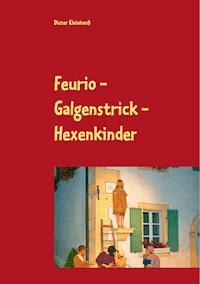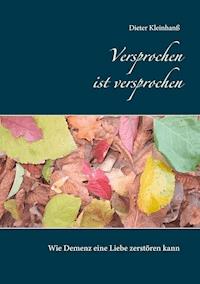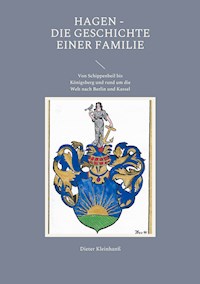
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch beleuchtet die Geschichte der Familie Hagen, der meine Frau Helga entstammt. Ihre Mutter Lore Korth war eine geborene Hagen. Lores Vater hat 1938 eine Familiengeschichte seiner Familie verfasst. Diese ist die Grundlage dieses Buches. Ich habe versucht, die umfangreiche Familiengeschichte mit ihren vielen darin abgedruckten Zeugnissen und Urkunden als Roman leichter lesbar zu machen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gewidmet Helga Kleinhanß geb. Korth Bernd Korth Fritz Korth
In memoriam Lore Korth geb. Hagen
Ein biografischer Roman nach der Familiengeschichte von Siegfried Hagen
Annäherung an eine bedeutende Familie aus Königsberg
von
Dieter Kleinhanß
verheiratet mit Helga geb. Korth, einer Enkelin von Siegfried Hagen
2020
Inhalt
Vorwort
1.
Schippenbeil und die Pest Heinrich Hagen (1709 – 1772)
2.
Mediziner Apotheker und Gelehrter Carl Gottfried Hagen (1749 – 1829)
3.
Krieg und Politik Königsberg im 19. Jahrhundert
4.
Ein neuer Lebensabschnitt Der Pensionär Carl Gottfried Hagen
5.
Der Kumsthagen Carl Heinrich Hagen (1783 – 1856)
6.
Eine Apothekerfamilie Johann Friedrich Hagen (1788 – 1865)
7.
Das Weltall und die Sterne Johanna Henriette Hagen (1794 – 1885) und Friedrich Wilhelm Bessel (1784 – 1846)
8.
Der Künstler Ernst August Hagen (1797 – 1880)
9.
Militär und fremde Länder Heinrich Curt von Hagen (1859 – 1897)
10.
Soldat, Physiker und Politiker Franz Neumann (1798 – 1895) Florentine Hagen (1800 – 1838) Wilhelmina Hagen (1802 – 1877)
11.
Vater der Konfliktzeit Adolf Hagen (1820 – 1894) Hannchen Hagen (1826 – 1856) Anna Hagen (1831 – 1905)
12.
Tierfreund und Agronom Siegfried Hagen (1870 – 1958)
13.
Siegfrieds Kinder Günter Hagen (1909 – 1943) Heinz Hagen (1914 – 1978) Lore Hagen (1915 – 2005)
14.
Korth’sche Familie Werner Korth (1910 – 1987)
Dank
Stammtafel
Anhänge
Quellenangaben
Literaturverzeichnis
Wir lesen Zeitungen um uns zur Privatgesellschaft vorzubereiten. Wir lesen gelehrte Bücher, um uns zur öffentlichen Gesellschaft zu bereiten. Wir lesen Sachen der Annehmlichkeit nicht in der Absicht, uns zur Gesellschaft zu bereiten, sondern weil sie unsere geselligen Eigenschaften der Gesprächigkeit, der Feinheit, der Artigkeit, Empfindsamkeit und Lebhaftigkeit kultivieren. Wir ziehen uns an, wir möblieren, wir bauen für die Gesellschaft. Das ist dasjenige, wodurch aller Menschen Bemühungen Einheit bekommen.1
Immanuel Kant
Die Red ist uns gegeben,
Damit wir nicht allein
Vor uns nur sollen leben
Und fern von Leuten sein;
Wir sollen uns befragen
Und sehn auf guten Rat,
Das Leid einander klagen,
So uns betreten hat.2
Simon Dach
Die reiche Bürgerey
Fuhr auf dem Pregel heim
mit lachen und Geschrei
Theils von dem Lande,
theils auß ihren schönen Gärten
Vnd hatten, Bacchus,
dich sampt Venus zu Gefährten
Und grüßten vns dabey.3
Simon Dach
Vorwort
Der Poet Simon Dach, der Philosoph Immanuel Kant und die Gelehrtenfamilie Hagen sind neben Anderen wichtige Persönlichkeiten der ostpreußischen Stadt Königsberg. Aus diesem Grund sind dem Buch Zitate von den beiden ersten Persönlichkeiten vorangestellt.
Dieses Buch beleuchtet die Geschichte der Familie Hagen, der meine Frau Helga entstammt. Ihre Mutter Lore Korth war eine geborene Hagen. Lores Vater hat 1938 eine Familiengeschichte seiner Familie verfasst. Diese ist die Grundlage meines Buches. Ich habe versucht, die umfangreiche Familiengeschichte mit ihren vielen darin abgedruckten Zeugnissen und Urkunden als Roman leichter lesbar zu machen.
Die Kapitel beleuchten die einzelnen Persönlichkeiten dieser Familie – begonnen mit Heinrich Hagen, dem Vater des Gelehrten Karl-Gottfried Hagen.
Es werden immer wieder Passagen aus Siegfried Hagens Buch zitiert, die durch die kursive Schreibweise gekennzeichnet und mit der entsprechenden Seitenzahl angegeben werden.
Weitere interessante Textauszüge zu den jeweiligen Kapiteln sind im Anhang ausführlich aufgeführt – mit einer kurzen Notiz in der Fußzeile.
Michelbach/Lücke 2021
Dieter Kleinhanß
1
Schippenbeil und die Pest - Heinrich Hagen - (1709 – 1772)
Ein klirrend kalter Wind weht von Osten her über das flache Land. Sibirien ist zwar weit weg. Aber die sibirische Kälte ist da. Die Welt ist zu Eis erstarrt. Die masurischen Seen und die Bodden sind schon lange zugefroren. Der Winter 1708 kommt sehr früh. Viel zu früh. Das Obst hängt noch auf den Bäumen. Es ist erfroren. Die Bäume stehen noch im Saft, die Blätter sind noch grün. Im Sonnenlicht glänzen die Eiskristalle wie Diamanten und das Grün der Bäume gaukelt den Frühling vor. Doch in den Wäldern platzen die Rinden der Bäume. Ein Platzkonzert mitten im Wald. Frierend drängen sich die Menschen in den Küchen ihrer Häuser. Hier brennt wenigstens ein Feuer. Wer nicht schon früh im Herbst vorgesorgt und Holz geschlagen oder Torf gestochen hat, ist übel dran. Er friert oder erfriert. Menschen sind draußen auf der Straße kaum zu sehen. Nur wenn es unbedingt und dringend notwendig ist, geht man aus dem schützenden Haus, hinaus in die klirrende, oft auch den Tod bringende Kälte mit ihrem eisigen und schneidenden Wind. Die vom Wind heran gepeitschten Schneekristalle treffen die Menschen wie Glassplitter im Gesicht. Die Gottesdienste im Dom zu Königsberg fallen aus. In keiner Kirche der näheren und weiteren Umgebung wird noch gesungen oder gebetet. Der Atem gefriert, kaum dass er Mund und Nase verlassen hat. Der Tod hält reiche Beute. Die Menschen sterben wie die Fliegen. Die Eiseskälte rafft sie dahin. Sie können noch nicht einmal bestattet werden, denn der Boden ist metertief gefroren. Ein Grab auszuheben ist nicht möglich. Hacke, Pickel und Schaufel haben keine Chance. Gespenstig. Ein apokalyptisches Bild: die Toten liegen auf ihren Gräbern im Schnee, von einem Leichentuch aus Schnee bedeckt. Sie verwesen nicht. Sie sind tiefgefroren. Dennoch ist in Ostpreußen nicht alles Leben erloschen. Die Armen frieren und hungern, aber die Reichen haben ihren Spaß. Mit Rössern und Schlitten machen sie, dick in Pelze gehüllt, weite Ausflüge über die zugefrorene Ostsee. Sie könnten, wenn sie nur wollten, bis Stockholm oder Kopenhagen fahren. Mit genügend heißem Tee oder Wein ließe sich das sicher aushalten. Nur die Pferde könnten erfrieren, trotz ihrer weichen und wärmenden Pferdedecken. Deshalb bleibt es meist bei kleinen Kutschfahrten oder beim Reiten. Wer kann schon einmal über das Wasser reiten? Wer kann wie einst Jesus über Wasser gehen? Über dem tiefen Schnee ist fast alles Leben erstarrt. Winterstarre im ganzen Land. Ostpreußen: ein riesiger Kühlschrank. Unter dem Schnee jedoch tummelt sich das Leben. Kleine Nager graben sich Gänge, suchen nach gefrorenen Insekten oder Wurzeln. Sogar über die Ostsee kommen ganze Armadas von Nagern. Ratten aus dem Osten. Von Riga oder Memel. Königsberg und ganz Ostpreußen werden in diesem Jahr von einer Rattenarmee heimgesucht. Die Tiere scheinen gegen die Kälte resistent zu sein. Oder schlau. Jede Ritze finden sie, um in Häuser oder Scheunen zu kommen. Sie wärmen sich in der Küche am oder unter dem Ofen. Ratten und Mäuse sind schon immer eine Plage. Doch 1709 werden sie zur Landplage. Mit schlimmen Folgen. Nicht nur in Königsberg, auch in Bartenstein und Schippenbeil finden die gefräßigen Nager fette Beute. Die Menschen werfen seit jeher ihre Abfälle aus den Fenstern auf die Straße oder hinter ihre Häuser, wo sie in diesem Jahrhundertwinter vom Schnee gnädig zugedeckt werden. Der Dreck und Schmutz ist nicht mehr zu sehen, wohl aber zu riechen. Ratten haben feine Nasen und erschnüffeln alles, was fressbar ist.
Wo das Flüsschen Guber in die Alle mündet, liegt die beschauliche Kleinstadt Schippenbeil mit ihren zwei mächtigen Stadttoren und der hohen Stadtmauer. Als die ersten Toten zu beklagen sind, glauben viele, dass diese Menschen erfroren oder verhungert sind. Das böse Erwachen kommt jedoch sehr schnell. Es wird schrecklich, denn die Pest hat Schippenbeil und Umgebung in ihrem Würgegriff. Die Ratten haben ihre kleinen Untermieter mitgebracht: Flöhe. Keiner weiß damals, dass diese fast unsichtbaren Plagegeister die Erreger der Pest (Yersina pestis) sind. Damals vermutet man noch, dass giftige Ausdünstungen von Kadavern oder von den vielen Toten auf den Straßen und dem Friedhof, die sogenannten Miasmen, die Pest verursachen. Der Rat der Stadt gibt deshalb einen Befehl aus: Die Menschen haben sich in ihren Häusern zu verbarrikadieren und dürfen sie nicht verlassen. Manche sehen ein, dass es so sein muss, es gibt keine andere Möglichkeit sich zu schützen. Andere bezweifeln diese Maßnahmen. Sie leben so, als ob nichts wäre. Sie treffen sich, treiben dick eingemummt Sport, fahren gemeinsam Schlittschuh, essen und feiern zusammen – und stecken sich an. Die Vernünftigen schließen sich jedoch ein und gehen nicht mehr auf die Straße. Die sozialen Kontakte kommen zum Erliegen. Man tauscht sich nicht mehr aus. Man meidet sich. Keiner spricht mehr mit dem anderen. Was beim Nachbarn passiert, wen kümmert es schon? Gefährliche Gedanken kommen hier und da auf. „Die Juden sind schuld!“ Ein Gerücht, das es seit dem frühen Mittelalter gibt und das nicht tot zu kriegen ist. „Die Russen haben uns die Pest an den Hals gewünscht und die Ratten aus dem Osten zusammen mit der Kälte geschickt, um unser Land in Besitz zu nehmen.“ „Die vielen Bettler, die sich nie waschen und gräulich stinken, wollen uns vernichten, um uns auszurauben.“ Krude Gedanken, die in den Köpfen verunsicherter und ängstlicher Ostpreußen umherschwirren. Aber es gibt auch Leute, die durch diese Seuche profitieren: Verbrecher und Diebe. In Schippenbeil, Bartenstein und Tilsit und in allen anderen ostpreußischen Städten gehen einige Verwegene trotz Pest und behördlichem Verbot auf die Straße. In den zugenagelten Häusern hoffen sie auf Sterbende, die sich nicht wehren können, auf Tote, bei denen etwas zu holen ist. So wird die Pest immer weiter getragen. Immer mehr Menschen stecken sich an und sterben. Nicht nur Ratten und Flöhe verbreiten die tödliche Seuche. Es sind auch die Wegelagerer und Kriminellen. In der Stadt Schippenbeil sterben annähernd 800 Einwohner.
Während dieser Pestepidemie wird dem Ehepaar Gottfried Hagen und Christina, geb. Stendel am 4. Oktober 1709 der jüngste Sohn Heinrich geboren. Doch schon ein Jahr später im Dezember 1710 stecken sich beide Elternteile mit der Pest an. Gottfried sen. und seine Frau Christina liegen bald im Sterben. Ihre älteren Kinder Gottfried jun. und Maria Christina werden gleich beim Ausbruch der Pest im eigenen Haus zu Bekannten in Pflege gegeben. Der jüngste Spross, Heinrich, ist jedoch noch zu klein und bleibt vorerst bei den Eltern. Gottfried jun. überlebt die Pest. Er wird zum Gründervater der älteren Linie Hagen, die die Wege unserer Geschichte nicht mehr berührt. Maria Christina überlebt ebenfalls, stirbt jedoch 1711 mit sieben Jahren an Gichtern (Tuberkulose).
Ein langer Zug Pestkarren zieht durch Schippenbeil. Die Sterbenden und die Toten werden zu einem Massengrab außerhalb der Stadt gebracht. Dort sollen sie, so gut es geht, später einfach verscharrt werden. Im Moment ist ein Begraben wegen des strengen Frostes nicht möglich. Auf einem dieser Pestkarren liegen der sterbende Gottfried sen. und Christina. Neben ihr liegt ihr kleiner Sohn Heinrich. Er wird noch gestillt. Unterwegs sieht der Bruder von Christina, Gottfried Stendel seine Schwester auf dem Karren und er sieht auch den kleinen Heinrich neben der sterbenden Mutter liegen. Er weiß, dass auf einem Pestkarren der Tod mitfährt und reißt ihr Heinrich aus dem Arm.
Heinrich, der später zum Begründer des jüngeren Zweiges der Familie wird, wird von seinem Onkel Gottfried Stendel dem Tod entrissen und in die Familie seiner Tante Anna Dorothea Heling aufgenommen. Nach seiner Schulzeit in Schippenbeil wird er Lehrling in der Apotheke seines Onkels. Das Leben in einer Apotheke ist interessant. Da sind einmal die vielen Pülverchen und Salben, die verschiedenen Kräuter und Gewürze. Die gilt es mit dem Mörser zu zerstoßen, mit verschiedenen Salben und Tinkturen zu vermischen, in Döschen zum Verkauf abzufüllen, Rezepte der Ärzte müssen zusammengestellt werden. Heinrich liebt diese Arbeit. Besonders wichtig ist ihm, dass er bei dieser Arbeit viel über die Wirkung von Kräutern und anderen Essenzen lernt. Er stellt fest, dass er sich für Chemie und alles, was mit der Natur zu tun hat, sehr interessiert. Kurz, die Arbeit in einer Apotheke macht ihm viel Freude. Beim Verkauf lernt er viele Menschen kennen und kann dabei gute Gespräche führen. Er erfährt von Krankheiten, die ihm unbekannt sind und von Schicksalsschlägen, welche manche Menschen erleiden müssen. Er geht ganz in der Apotheke auf. Folgerichtig wird er, der so gerne dort arbeitet, nach seiner Ausbildung Verwalter dieser Apotheke.
Immer wieder bekommen die Helings auch Besuch von ihrem Schwiegersohn Johann Georgesohn, einem bekannten Apotheker aus Königsberg. Mit dabei die Tochter Maria Elisabeth. Sie und Heinrich verlieben sich ineinander und heiraten am 16. März 1738. Die Verheiratung mit seiner Großnichte lässt Heinrich vielmals auf alle möglichen Ämter gehen. Schon damals ist es nicht einfach, innerhalb der erweiterten Verwandtschaft zu heiraten. Aber Heinrich lässt nicht locker. Auch sein Schwiegervater in spe Johann Georgesohn legt ein Wort für seine Tochter und die Heirat ein. So zieht Heinrich mit seiner Frau zu den Schwiegereltern nach Königsberg und hilft dort in der Apotheke mit.
In ganz Preußen herrscht zu dieser Zeit jedoch noch eine weitere Seuche, eine ganz besondere. In Nowgorod soll ein Apotheker Gold für den Zaren hergestellt haben. Was die Russen können, das können wir schon lange, denkt man in Preußen. Auch Heinrich Hagen und Johann Georgesohn sind dieser Meinung. Den Preußen ist nichts unmöglich. Warum also nicht Gold machen? In einer Apotheke gibt es viele Mittelchen, Pulver, Salben und Chemikalien.
Eines Tages nach dem Sonntagsgottesdienst in der Stadtkirche, in dem er für das Gelingen seines alchemistischen Versuchs inniglich zu Gott betet, geht Johann ans Werk. In seinen Gläsern und Kisten, in den Regalen und im Giftschrank sucht er sich, wie er glaubt, einige passende Mittelchen zusammen. Zuerst holt er Blei, denn Blei ist fast so schwer wie Gold. Als Nächstes kramt er Quecksilber hervor, denn Quecksilber ist für alles zu gebrauchen. Sodann wird ein Silbertaler in kleinste Stücke zersägt und in Salzsäure gelegt. Aus der untersten Schublade seines Regals nimmt er noch einen Löffel Heilerde. Auch Zinn darf nicht fehlen. Heinrich wird in den Garten geschickt. Er soll Ackerschachtelhalm sammeln und nachsehen, ob die Tollkirsche schon reif ist. Sie ist reif und glänzt tiefschwarz. Georgesohn mischt alles zusammen. Aber kein Goldglanz entsteht. Es zischt zwar und köchelt, es stinkt und brodelt, aber das ist alles. Zum Glück fällt ihm noch ein, dass er den Goldglanz mit Messingstaub herstellen könnte. Vielleicht kann auch eine Messerspitze Arsenik nicht schaden, denkt Johann. Alles hilft nichts. Es entsteht kein Gold, noch nicht einmal eine feste Masse. Aber ein Georgesohn gibt niemals auf. Immer wieder versucht er es mit neuen „Rezepturen“. Ohne jeden Erfolg. Auch mit der Zugabe von Himmelsschlüsselchen der Kelten, mit Katzengold oder dem Bohnerz, mit zermahlenem Bernstein oder mit einer Prise Zink kann er kein Gold generieren. Gold bleibt so weit weg wie der Mond. Zum Schluss versucht Johann noch einen Löffel Schwarzpulver unterzumischen. Aber das Gemisch fliegt ihm um die Ohren. Quecksilber und Salzsäure, vermischt mit den anderen Ingredienzien und mit Schwarzpulver versehen, vertragen sich nicht. Es explodiert. Er muss froh sein, dass ihm nur ein paar Glasampullen und Porzellanschalen um den Kopf fliegen. Ein Mörser allerdings bricht Johann fast die Nase. Die hat dieser jetzt gestrichen voll. Das Goldmachen war ein totaler Fehlschlag. Deswegen übergibt 1747 Johann Georgesohn die 1735 erworbene Hofapotheke in der Junkerstraße an seinen Schwiegersohn Heinrich Hagen. Dieser wird Besitzer der ersten Hagenschen Hofapotheke. Dafür wird ein eigenes Wappen entworfen. Der jüngere Zweig der Familie Hagen wird gegründet.
2
Mediziner, Apotheker und Gelehrter - Carl Gottfried Hagen - (1749 – 1829)
Es gibt viel zu tun. Weihnachten naht. Die Geburt Jesu in Bethlehem. Dazuhin auch in Königsberg eine Geburt. Hochschwanger steht Maria Elisabeth in der Küche der Apotheke. Sie ist beschäftigt. Heute werden die nach altem Familienrezept hergestellten Morsellen gemacht. Zusammen mit ihren Mägden hat sie schon gestern Nachmittag kleine Papierstückchen zugeschnitten. Darin sollen die Zuckerstücke eingewickelt werden. Zunächst gilt es, den Zucker in großen Pfannen zu schmelzen, Lavendelblüten und Bernstein werden zerstoßen, natürlich darf auch Pfefferminze nicht fehlen. Frisch und vor allem süßaromatisch sollen die Morsellen schmecken. Alle Ingredienzien werden unter den geschmolzenen Zucker gerührt und die flüssige Masse auf lange Bretter gegossen bis die heiße Masse erstarrt ist. Mit kräftigem Rütteln und Klopfen wird die feste Masse von den Brettern gelöst und anschließend in Streifen geschnitten. Dann werden aus den langen Zuckerstreifen die kleinen Morsellenquadrate geformt. Für Mägde und Kinder die größte vorweihnachtliche Freude. Denn Randstücke und zerbrochene Zuckerstücke dürfen sofort an Ort und Stelle gegessen werden. Wenn sie noch ein wenig warm sind, schmecken sie besonders gut. Warme Morsellen sind beliebt bei Jung und Alt. Später werden die Zuckerstücke in die kleinen Papierstücke eingewickelt und in der Apotheke verkauft. Gleichzeitig müssen die Lehrlinge in der Apotheke aus allerlei duftenden Substanzen Räucherkerzen herstellen. Weihnachten ohne Räucherwerk ist in Königsberg nicht denkbar. Jedes Jahr muss der Hausherr einen großen Weihnachtsbaum besorgen, der an Heilig Abend von den Eltern geschmückt werden wird. Kinder dürfen nicht dabei sein. Erst wenn der Baum fertig geschmückt ist, werden die Kinder ins festliche Zimmer geholt. Im Jahr 1749 steht der Christbaum am Heiligen Abend ohne jeden Schmuck im Zimmer. Stattdessen wuseln die Mägde eilig hin und her. Leinentücher werden hervorgekramt, Wasser wird abgekocht. Die Männer werden nach unten in die Apotheke geschickt. Männer kann man in diesem Moment nicht brauchen. Sie hindern nur. Immer stehen sie im Weg. Maria Elisabeth bekommt ein Kind. Ein wirkliches Christkind. Carl Gottfried wird geboren. Die Geburt geht gut. Das junge Menschenleben tut nach kräftigem Schlag auf den Po seinen ersten Schrei. Mutter und Kind sind wohlauf. Das ist nicht immer so. Geburt und Tod liegen in jenen Zeiten oft nahe beieinander. Aber mit Carl Gottfried, dem sechsten Kind der Familie Hagen, geht alles glatt. Der nächste Apotheker aus der Familie ist geboren. Aus dem Kleinen wird ein ganz Großer werden.
Selbstverständlich besucht Carl Gottfried die allerbesten Schulen in der Stadt, hat überall die besten Zeugnisse und ist bei Lehrern und Mitschülern beliebt. Das Schönste an der Schule ist für Carl Gottfried der Unterricht in Naturkunde. Vor allem liebt er Mathematik, Chemie, Physik und natürlich den täglichen Sportunterricht, damals Leibesertüchtigung genannt. Es wird geturnt, exerziert, lange Strecken werden im Eiltempo gelaufen, häufig auch mit einem Tornister und einem Holzgewehr. Die Schüler sollen schon früh auf ihr Soldatendasein ausgebildet werden. Nicht das Wissen ist wichtig, sondern Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit. Darauf legt der preußische König großen Wert. Carl Gottfried turnt zwar gerne, aber mit dem Soldatenleben will er nichts zu tun haben. Er will forschen und entdecken. Nach Beendigung der Schule lässt sich Carl Gottfried zum Apotheker ausbilden. Wie sein älterer Bruder Heinrich wird auch er von seinem Vater in der königlichen Hofapotheke angelernt. Carl Gottfried ist eifrig und lernwillig, sehr zur Freude seines Vaters.
Der einst kleine und schmächtige Junge ist inzwischen zu einem sehr großen und kräftigen Mann herangewachsen. Wo er in Königsberg auftaucht, zieht seine imposante Erscheinung die Blicke auf sich. Es sind nicht nur die verstohlenen Blicke der jungen Damen, es sind vor allem die aufmerksamen Blicke ganz bestimmter Männer. Der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. hat in ganz Preußen Werber ausgeschickt, die hoch aufgeschossene, über 1,80 Meter große Männer, für seine „langen Kerls“ anwerben sollen. Carl Gottfried ist solch ein möglicher Kandidat. Aber er hat überhaupt keine Lust zu den Soldaten zu gehen. Er will studieren. Er will kein General, er will Gelehrter werden. Zu seinem Glück gilt damals noch: Wer in der Universität Königsberg, der „Albertina“, immatrikuliert ist, wird vom Militärdienst befreit; auch wenn es vereinzelt vorkommen kann, dass Studenten auf offener Straße von Offizieren verhaftet und zum Kriegsdienst gezwungen werden. Wenn sich Carl Gottfried deshalb auf die Straße begibt, muss er sehr aufpassen, keinem Soldaten zu begegnen. Männer, die auffällig anderen Männern nachschauen, muss er meiden. Sie können heimlich und verdeckt künftige „Lange Kerls“ auskundschaften. Ihnen aus dem Weg zu gehen, ist gar nicht so einfach. Wenn es sein muss, begibt sich Carl Gottfried einfach in ein Ladengeschäft, meist eine Bäckerei und kauft sich eine Schrippe. Er bleibt so lange im Laden, bis die Soldaten oder der Offizier weiter gegangen sind. Aber so kann ein junger Mann nicht leben, wenn er sich von jeder Öffentlichkeit fern halten muss. Zum Glück nimmt der der Mediziner Prof. Büttner den jungen Apotheker in seine Gruppe der angehenden Mediziner auf. Damit ist Carl Gottfried während seiner Lehrjahre zunächst vor möglichen Übergriffen des Soldatenkönigs geschützt.
Sein größtes Problem ist allerdings, dass ihm das Medizinstudium überhaupt keinen Spaß macht. Er versäumt zwar keine Vorlesung, besucht aber weitere, für ihn interessantere physikalische und mathematische Vorlesungen, um sich umfassend und weitestgehend fortzubilden. Später wird Hagen sagen, dass er anatomische Bücher nur mit zugehaltener Nase lesen könne. Wenige Jahre studiert er an der Universität, als 1769 plötzlich sein Vater krank wird. Ohne Abschluss in Medizin und Pharmazie verlässt Carl Gottfried die Universität und hilft in der Apotheke aus. Ein Schritt, der ihm nicht leicht fällt. Aber es bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich der familiären Gegebenheit zu fügen.
Bei der Hochzeit seines Bruders Heinrich mit Luise Henriette geb. Dorn am 02. März 1770 tut sich Carl Gottfried im doppelten Sinne hervor. Der 21-jährige junge Mann stürmt in den großen Festsaal. In seinem Eifer und Ungestüm reißt er einen Hochzeitsgast samt Stuhl um. Das Geschrei ist dementsprechend groß. Keiner wird gerne in seinem schönsten Anzug vor allen Gästen, vor allem den Frauen, so unsanft und unverhofft auf den Boden geworfen. Das Missgeschick ist jedoch bald vergessen, weil Carl Gottfried zu Ehren seines Bruders und dessen Braut eine brillante Rede hält, die an diesem Festtag zum Gespräch der ganzen Hochzeitsgesellschaft wird. Der Stuhlfall ist vergessen.
Nach dem Tod seines Vaters Heinrich Hagen am 12. Oktober 1772 übernimmt Carl Gottfried gegen den Widerstand der anderen Apotheker die Hofapotheke in Königsberg. Seine Kollegen werfen ihm vor, sein Studium nicht vollendet zu haben und deswegen auch kein Recht zu haben, eine Apotheke zu leiten. „Ohne Abschluss keine Apotheke“, sagen sie. Die königliche Verwaltung löst den sich anbahnenden Rechtsstreit dadurch, dass die Witwe einen Provisor einstellen muss und der Junior in Berlin zwei Semester lang erneut Pharmazie studiert. Dort legt er auch die pharmazeutische Prüfung ab. Diese besteht er natürlich mit Bravour und kann deshalb schon ein Jahr später die Leitung der Apotheke übernehmen. Carl Gottfried Hagen hat sich durchgesetzt und bewiesen, wozu er fähig ist. Das Apothekergeschäft erfüllt ihn so sehr, dass er dem abgebrochenen Studium der Medizin überhaupt nicht nachtrauert. Ihm selbst trauern dagegen an der Universität andere nach. Wie gut er sich dort hervorgetan hat, zeigt ein am 09. April 1773 ausgestelltes Schreiben von Immanuel Kant, in welchem der „virus juvenem egregium“, der Kraft der hervorragenden Jugend ein gutes Zeugnis ausgestellt wird.
Eines Tages betritt der Dekan der Universität Prof. Orlovius die Apotheke. Zunächst blickt er hoch zur Decke der Apotheke. Er weiß, dass sie ein Schmuckstück ist. Zwischen den Deckenbalken sind die Brustbilder der vier Jahreszeiten gemalt. Dazu kommen noch die Bilder der vier Erdteile. Den Bediensteten verrät er, Herrn Hagen sprechen zu wollen. Dieser ist gerade in seiner Kammer hinter dem Verkaufsraum mit einem Experiment beschäftigt. Carl Gottfried Hagen ist dabei, den „taurinischen“ Versuch zu machen, den ein Mann namens Stirisch beschrieben hatte. Hagen stellt gerade einen Topf Wasser auf den Tisch, den er für den Versuch braucht. Gleichzeitig hat er in seinem Brennofen Kupfer zum Schmelzen gebracht. Wenn er dieses geschmolzene Kupfer über das Wasser gießt, wird das Kupfer auf der Wasseroberfläche ganz fest und glatt. Wenn er hingegen das Wasser über das geschmolzene Kupfer schüttet,