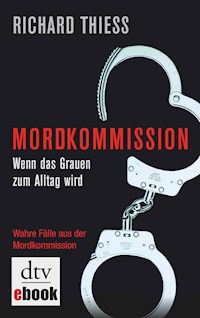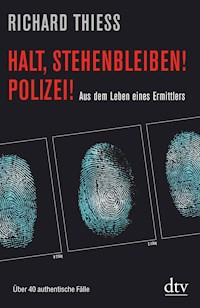
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Kommissar Thiess ermittelt wieder Nach seinem Bestseller ›Mordkommission‹ gibt Richard Thiess hier einen spannenden Einblick in die Arbeit der Kriminalpolizei und ihre Ermittlungsmethoden. Neben skurrilen, tragischen, absurden Fällen stehen anrührende und auch komische Episoden. Thiess spezialisiert sich zunächst auf Jugend- und Bandenkriminalität, er bringt u. a. die Münchner Marienplatzrapper zur Strecke, die größte Jugendbande, die bis dato in Deutschland ihr Unwesen trieb und sich sogar »Sklaven« hielt. Wir begegnen raffinierten Serien- wie Einzeltätern, aber auch grenzenlos naiven Zeitgenossen, die einen Diebstahl geradezu provozieren, und unerschrockenen »Miss Marples«. Es geht um Betrug und Erpressung, Dreistigkeit, Arglist, Gier – und um Besessenheit. Doch das Leben ist schillernd und hält immer wieder Überraschungen bereit, und so flicht Richard Thiess mit hintergründigem Humor auch so manch kuriose Episode ein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
RICHARD THIESS
HALT,
STEHENBLEIBEN!
POLIZEI!
AUS DEM LEBEN EINES ERMITTLERS
DEUTSCHER TASCHENBUCH VERLAG
Originalausgabe 2011
© 2011Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,
KN digital– die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
eBook ISBN 978-3-423-41502-6 (epub)
ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-34676-4
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website www.dtv.de/ebooks
Vorwort
Aller Anfang ist schwer
Sicher ist sicher – mein erster Arbeitstag
Habgier
Tadel für den KGB
Eine »folgenlose« Trunkenheitsfahrt
Hundert für dich, hundert für mich …
Abschied von der Tochter
Die Waffenexpertin
Zwischenlandung
Wenn der Vater mit dem Sohne
Die Mittagsvertretung
Belgische Staatsanleihen
Die Münchner Marienplatzrapper
Der Verdacht
Die Suppe der Barmherzigkeit
Eine Lokalrunde von Giovanni
Ein lukratives Schneeballsystem
Das Sechsaugenprinzip
Auch Kleinvieh macht Mist
Ein »sauberes« Geschäft
Die Krankenhausmafia
»Mama ist doch krank«
Die Essenseinladung
Der »Kaiser« und die Kaffeekanne
Miss Marple
Im Schuhparadies
Versteckte Kamera
Wölfe im Schafspelz
Die falsche Beleuchtung
Der Schnäppchenmarkt
Die Geheimagentinnen
Gewichtsprobleme
In letzter Sekunde
Personalrabatt
Ein exklusiver Geschmack
Da kann nichts passieren …
Das Plädoyer oder: Die Intelligenz der Frauen
Die verschwundene Marmelade
Die geheimnisvolle Stimme
Auf verschlungenen Pfaden
SchlussgeDanke
[Informationen zum Buch]
[Informationen zum Autor]
Vorwort
Im Polizeidienst begegnet man im Laufe eines langen Berufslebens den unterschiedlichsten Personen und Persönlichkeiten. Warum die Polizei gerufen wird, hat mannigfaltige Gründe, das reicht vom streunenden Hund auf einer vielbefahrenen Hauptstraße, der vermissten demenzkranken Altersheimbewohnerin oder einem auf dem Schulweg verletzten Erstklässler über Schwarzfahrer, gewaltbereite Demonstranten, diebische Kaufhausdetektive, Verstöße gegen die Lebensmittelhygiene, technisch mangelhafte Gefahrguttransporter und Großbrände bis hin zu Raub, Mord und Totschlag. Auch bei Naturkatastrophen und großen Unglücksfällen bemühen sich Polizeibeamte an vorderster Front um die Rettung von Menschenleben oder Sachwerten, und dies nicht selten unter Einsatz des eigenen Lebens. An 365Tagen im Jahr engagieren sie sich rund um die Uhr für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und die Sicherheit jedes einzelnen Bürgers, mutig und besonnen zugleich. Daraus resultiert eine unglaubliche Vielfalt an Erlebtem und an Erfahrungswissen (schließlich hat so gut wie jeder im Laufe seines Lebens mal mit der Polizei zu tun), die kein anderer Beruf– wirklich keiner– in diesem Umfang und dieser Gemengelage aufzuweisen hat.
Diese Vielfalt und die außergewöhnlichen Erlebnisse haben mich veranlasst, Ihnen, verehrte Leserin, verehrter Leser, zu erzählen, wie es hinter den Kulissen zugeht; einen Einblick in Dinge zu geben, die Außenstehenden sonst weitgehend verborgen bleiben. Sie aber auch mit den Besonderheiten eines Berufes vertraut zu machen, der wie kaum ein anderer von den menschlichen Stärken, aber auch von ihren Unzulänglichkeiten beeinflusst ist.
In einem ersten Schritt habe ich dieses Vorhaben bereits in meinem Buch ›Mordkommission– wenn das Grauen zum Alltag wird‹ umgesetzt. ›Mordkommission‹ befasst sich mit einem sehr speziellen Bereich polizeilicher Ermittlungsarbeit sowie den außergewöhnlichen psychischen Belastungen. Bei Mord und Totschlag, Geiselnahme und Entführung handelt es sich um Straftaten, die besonderes öffentliches Interesse hervorrufen, die aber dennoch nur einen kleinen Teil der polizeilichen Arbeit repräsentieren.
Nicht weniger interessant, wenngleich meist weniger medienwirksam, sind jedoch auch die unzähligen Begebenheiten außerhalb dieser »Königsdisziplin« polizeilicher Ermittlungen, nämlich der tägliche Kampf gegen das »Böse« in all seinen Spielarten. Aber auch Merkwürdiges und Verblüffendes prägen den Alltag von Polizisten in besonderer Weise. So habe ich schon bald nach dem Beginn meiner Arbeit bei der Polizei begonnen, erstaunliche oder auch einfach lustige Episoden zu sammeln. Allesamt natürlich wahre Begebenheiten, die ich nur so weit abgeändert oder verkürzt dargestellt habe, als dies aus Gründen der Geheimhaltung oder des Datenschutzes erforderlich war.
Aus meinen zahlreichen Ermittlungen und einem Erfahrungsschatz von mehr als dreitausend eigenen Festnahmen und der Bearbeitung bzw. der Mitwirkung bei rund fünfzigtausend Strafanzeigen, den ich bereits vor meinem Wechsel zur Mordkommission im Jahr 2001 sammeln durfte, habe ich eine Auswahl von vierzig besonderen Fällen zusammengestellt. Darunter sind auch kuriose Vorfälle, die in Form von Anekdoten zeigen, dass es nichts, aber auch gar nichts gibt, mit dem Polizisten im täglichen Dienst nicht konfrontiert würden.
›Halt, stehenbleiben! Polizei!‹ ist ganz bewusst nicht als weitere Folge von ›Mordkommission‹ konzipiert, sondern will in Abgrenzung, aber auch in Ergänzung dazu aufzeigen, dass auch außerhalb des blutigen Geschehens bei Mord und Totschlag die Arbeit der Polizei Ausdauer, taktisches Geschick und psychologisches Einfühlungsvermögen erfordert, um mit teils sehr hoher krimineller Energie verübte Straftaten zu klären und den Opfern zu ihrem Recht zu verhelfen.
Die geschilderten Ereignisse stammen aus der Zeit vor meinem Wechsel zur Mordkommission, also noch vor der Einführung des Euro. Da uns dieser aber längst geläufig ist, habe ich der besseren Lesbarkeit wegen die Schadenssummen überall dort, wo dies vertretbar erschien, in Euro angegeben.
Aller Anfang ist schwer
Im Herbst 1977 zog ich als sogenannter Altanwärter zum ersten Mal die Uniform der Bayerischen Polizei an. Ich hatte mich mit rund hundert anderen Dienstanfängern im ehemaligen Kloster Seeon im Chiemgau, heute einem Bildungszentrum, eingefunden, um dort fernab von Hektik und Stress eine auf neun Monate stark verkürzte Ausbildung für den mittleren Polizeidienst zu erhalten. Zu dieser Zeit konnte ich bereits auf mehr als zweitausend Festnahmen zurückblicken, an denen ich in den vergangenen vier Jahren als Zivilfahnder der Feldjäger bei der Bundeswehr und vor allem als Kaufhausdetektiv beteiligt gewesen war. Nun war ich gespannt auf die Abläufe bei der Polizei: Was geschieht etwa, nachdem der Detektiv einen Ladendieb übergeben hat? Aber es galt auch tausend andere Dinge zu lernen, um bereits bei unseren ersten Einsätzen auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Das zumindest war das zweifellos hehre Ziel unserer Ausbilder und sie überboten sich förmlich darin, uns zu versichern, welches Glück wir doch hatten, sie als Ausbilder bekommen zu haben. Eingedenk meiner bisherigen Erfahrungen im Umgang mit bösen Buben und beflügelt durch die bevorstehende Intensivausbildung durch Deutschlands erfahrenste Beamte sah ich meiner künftigen Tätigkeit im Kampf gegen das Verbrechen mit größter Gelassenheit entgegen. Was sollte es da im späteren polizeilichen Alltag schon Aufregendes geben, auf das ich nicht bestens vorbereitet sein würde? Die Monate vergingen, und bereits nach kurzer Zeit war ich in der Lage, selbstständig drei Klimmzüge zu machen, und auch die Anwendung des Marschbefehls »Links schwenkt– marsch!« auf dem Weg zur Kantine, den ich mir bereits als Offizier bei der Bundeswehr zu eigen gemacht hatte, bereitete mir keine Schwierigkeiten. Bald schon war ich bewandert darin, fotografisch festzuhalten, wie Kollegen auf dem Klostergelände eine Unfallstelle durch Aufstellen eines Warndreiecks professionell sicherten. Beeindruckend fand ich auch das Werfen von Handgranaten auf demselben Übungsplatz, auf dem ich bereits während meiner Bundeswehrzeit Handgranaten zum Explodieren gebracht hatte. Lediglich hinsichtlich der Frage, ob denn Handgranaten künftig zur Standardausstattung im Streifendienst erhoben werden sollten, herrschte eine gewisse Unsicherheit bei meinen Kollegen und mir.
Auch die umfassende theoretische Ausbildung kam nicht zu kurz. So erlernten wir beispielsweise, welche Stellen– im Besonderen, welche Öffnungen– am menschlichen Straftäterkörper geeignet sind, gefährliche Gegenstände oder Beweismittel zu verbergen. Weiterhin übten wir die Handhabung von Kompass, Stadtplänen und Landkarten und erlernten den Umgang mit Telefonbüchern. Schreibmaschineschreiben und Fahrschulausbildung rundeten die Vorbereitung auf die zukünftigen Einsätze ab. Ach ja, natürlich hatten wir auch praktische Polizeiausbildung, genannt »Polizeidienstkunde«. Von echten Praktikern für zukünftige Praktiker. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich mir nie merken konnte, ob die Seite, an der Grabsteine bemoost sind und Ameisenhaufen ihren Eingang haben, nach Norden, Osten oder vielleicht doch nach Westen zeigt. Heute, knapp vierzig Jahre später, kann ich jedoch feststellen, dass mir diese Unsicherheit beruflich nicht wirklich geschadet hat!
Sicher ist sicher– mein erster Arbeitstag
Neun Monate später hatten wir es endlich geschafft. Die Grundausbildung war überstanden, nunmehr trennte uns nur noch der sechsmonatige Anstellungslehrgang für den mittleren Polizeivollzugsdienst davon, unser geballtes Wissen in der Praxis anwenden zu dürfen. Wiederum waren es außerordentlich erfahrene Fachlehrer, die uns die rechtlichen Finessen nahebrachten, die man nun mal braucht, will man später den Spitzfindigkeiten eines Konfliktverteidigers unbeschadet Paroli bieten können. Die Zeit verstrich, die Anstellungsprüfung war dank unserer soliden Ausbildung für die meisten von uns lediglich eine Formsache und dann wurde es endlich ernst: Der polizeiliche Einzeldienst harrte unser!
Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums München allerdings begann die große Freiheit mit einem kleinen dienstlichen Umweg, genannt Einsatzhundertschaft. Dabei handelt es sich um eine sogenannte geschlossene Polizeieinheit. Dieser Polizeiverband rückt jeweils in Zugstärke aus, die im Idealfall dreißig Beamte umfasst. Voran der Zugführer, die folgenden VW-Busse sind jeweils mit sechs Mann besetzt, weshalb der Volksmund diese süffisant »Sixpacks« nennt. Der Aufgabenbereich der Einsatzhundertschaften reicht vom gemeinsamen Vorgehen im geschlossenen Verband, etwa bei der Suche nach vermissten Personen oder bei Demonstrationen bis hin zu den ersten eigenverantwortlichen Handlungen eines uniformierten Beamten, der so behutsam an den gefahrenträchtigen polizeilichen Großstadtalltag herangeführt wird.
Unser Gruppenführer entpuppte sich zu unserer großen Freude als der Behutsamste von allen: Er beorderte uns zunächst bei einer sechsstündigen »Verkehrsstreife« in eine kleine Münchner Altstadtstraße. Die schmale Gasse mit einer geschätzten Länge von siebzig Metern wies immerhin eine Besonderheit auf: Sie verfügte nämlich über Parkuhren (den älteren unter den Lesern vielleicht noch ein Begriff). Diese galt es, während der kommenden sechs Stunden pausenlos zu überwachen, auf dass ja niemand die maximale Parkzeit überschreiten würde. Erst viel später erkannte ich, wie genial die Wahl dieses Einsatzorts war. Einerseits nämlich konnte unser Gruppenführer seine »Krummfinger«, wie Dienstanfänger liebevoll bezeichnet werden, von beiden Straßenenden her jeweils mit einem einzigen Blick kontrollieren und andererseits konnte sich keiner seiner Beamten, von denen ich als einziger Münchner über Ortskenntnisse verfügte, versehentlich verlaufen. Auch bestand so gut wie keine Gefahr, plötzlich in die Verlegenheit zu geraten, polizeilich tätig werden zu müssen!
Ein Problem allerdings kristallisierte sich schon während der ersten Stunde in unserem Kampf gegen das Großstadtverbrechen heraus: Auf sechs Beamte kamen leider nur fünf Parkuhren. Zunächst war guter Rat teuer, aber schon bald entwickelte sich eine Art Gesellschaftsspiel daraus, in enger Anlehnung an die bekannte »Reise nach Jerusalem«. Wer schwätzte oder anderweitig abgelenkt war (beispielsweise durch die interessierten Fragen von Anwohnern, was denn passiert sei), der verlor die Hoheit über »seine« Parkuhr und musste versuchen, eine andere unter seine Überwachungsfittiche zu bekommen. Dank unserer gediegenen Ausbildung gelang es uns zur Freude unseres Gruppenführers tatsächlich, während unseres Einsatzes Falschparkverbrechen zu verhindern. Die Findigen unter uns nutzten die Zeit, die wir im strömenden Regen standen, dazu, die nagelneuen Dienstmützen ihrer Kopfform anzupassen, was durch die Nässe enorm begünstigt wurde.
Selbstverständlich hatte dieser erste Einsatz keinerlei Einfluss auf meinen Entschluss, so bald wie möglich die Uniform gegen eine Kriminaldienstmarke auszuwechseln. Nach einem halben Jahr durfte ich den VW-Bus der Einsatzhundertschaft gegen einen BMW-Streifenwagen eintauschen und fortan als »Isar 02…« in einem Innenstadtrevier Sicherheit verbreiten. Hätte ich zu jener Zeit allerdings schon über den Erfahrungsschatz verfügt, den ich bis heute in vielen Tausend Einsätzen und Ermittlungsverfahren sammeln konnte, hätte ich wohl dafür plädiert, die Ausbildungsschwerpunkte »Klimmzüge« und »Telefonbuch« nochmals zu überdenken.
Habgier
Bereits einige Wochen nach meinem Wechsel zum Streifendienst durfte ich mit einem älteren, erfahrenen Kollegen auf Zivilstreife gehen. Es war ein ruhiger Spätsommernachmittag und wir waren schon seit mehreren Stunden unterwegs, ohne dass sich etwas Interessantes ereignet hatte. In der Nähe eines Friedhofes stellten wir unseren zivilen Streifenwagen ab und spazierten zu Fuß ein Stück an der Friedhofsmauer entlang. Eben bogen wir um eine Ecke der Einfriedung, als wir zwei junge Burschen bemerkten, die etwa fünfzig Meter weiter mit einer Beißzange an zwei Fahrradschlössern hantierten. Gerade hatten sie es geschafft, die Schlösser zu knacken, und die beiden schwangen sich behände in die Sättel. Natürlich hatten uns die Burschen bemerkt und schickten sich nun an, in der uns entgegengesetzten Richtung davonzuradeln. Wir waren unterdessen weitergegangen, ohne uns etwas anmerken zu lassen oder die Geschwindigkeit zu verändern.
Ich dachte einen Moment daran loszurennen, wenngleich ich sicher war, dass ich es nicht schaffen würde, sie einzuholen. Der Abstand vergrößerte sich zusehends. Doch während ich noch fieberhaft überlegte, wie den Dieben beizukommen wäre, griff der Kollege neben mir gedankenschnell in seine Gesäßtasche. Er zog seine Geldbörse heraus und schleuderte sie schwungvoll nach vorne. Die Geldbörse schlitterte flach über das Gehwegpflaster und blieb just in jenem Bereich liegen, wo eben noch die beiden Fahrraddiebe die Schlösser geknackt hatten. Gleichzeitig fing mein Kollege an zu schreien: »He, ihr habt euren Geldbeutel verloren!« Wie an Schnüren gezogen, ruckten die Köpfe der beiden zu uns herum, um dem ausgestreckten Zeigefinger des Kollegen zu folgen und schließlich an dem unschuldig in der Sonne liegenden Geldbeutel hängenzubleiben. Dann blickten sie sich kurz an und hatten offensichtlich denselben Gedanken: Warum sich mit zwei Fahrrädern zufriedengeben, wenn durch eine wundersame Fügung des Schicksals eine fette Geldbörse als Zugabe winkte?
Ich traute meinen Augen nicht, als die beiden tatsächlich abbremsten und in einem eleganten Bogen umkehrten. Fast gleichzeitig erreichten wir den Geldbeutel. Die Freude der beiden Fahrraddiebe an ihrer Beute war dann doch eher verhalten, als sie im Innenfach des Geldbeutels, den ihnen der Kollege freundlich lächelnd entgegenhielt, den gezackten Stern bewundern konnten. »Ihr seid’s varrekte Hund« (Ihr seid ganz schön gerissen) war der einzige Kommentar, den einer der beiden im besten Bayerisch zwischen den zusammengepressten Zähnen hervorstieß, ehe die Handschellen klickten. Dieses Kompliment aber ging meinem Kollegen runter wie Öl.
Tadel für den KGB
Kurz nach Mitternacht. Die Hälfte unserer Nachtschicht war vorüber. Kalter Rauch stand in der Wachstube und mischte sich mit dem Geruch von Bohnerwachs, staubigen Aktendeckeln und den Resten einer Fertigpizza. Wir hatten zu zweit »Null-Sechser-Wache« und nützten die Zeit, Anzeigen fertigzustellen, die wir vor Mitternacht während des Streifendienstes aufgenommen hatten. Da klingelte es an der Eingangstür. Im Türmonitor war eine schwarzgekleidete, gebeugte Gestalt zu erkennen. »Kundschaft!«, verkündete der Kollege, als er sich erhob und zum Türöffner ging. Langsam öffnete sich die Eingangstür, und eine alte, müde Frau näherte sich mühsam der Theke in der Wachstube.
Sie sah bemitleidenswert aus: ihre dünnen weißen Haare hingen strähnig in die faltige Stirn, die Augen lagen tief in dunklen Höhlen und die Hände zitterten. Ich schätzte sie auf weit über achtzig Jahre. Der Kollege eilte um die Theke herum, nahm die alte Dame am Arm und führte sie zu unserem bequemsten Stuhl. Erschöpft sank sie in die Polster und atmete mühsam. »Um Gottes willen, was ist denn passiert?«, erkundigte ich mich mitfühlend. »Brauchen Sie einen Arzt?« Die alte Dame winkte ab. Dann begann sie, mit leiser, piepsiger Stimme von ihrem Leid zu erzählen. Vor etlichen Tagen hatte sie abends eine Fernsehsendung über die Gefahren des Kalten Krieges und die Schrecken von Atomraketen gesehen. Alles hatte sie wohl nicht verstanden, in Erinnerung waren ihr russische Atomraketen geblieben, die auf Deutschland gerichtet waren und gefährliche Strahlen aussendeten.
In ihrer Angst fiel ihr ein, dass ihr im letzten Weltkrieg immer wieder eingetrichtert worden war, sich im Falle eines Bombenangriffs unter einen Türstock zu stellen, da es dort am sichersten sei. Irgendwie war danach im Kopf der alten Frau alles durcheinandergeraten. Bomben, Strahlen, Russen, Türstöcke– so hatte sie in ihrer Angst und Not den Fernseher ausgeschaltet und beschlossen, unter dem Türstock des Wohnzimmers das Ende des wohl unmittelbar bevorstehenden Angriffes abzuwarten. Die Stunden vergingen, schließlich wagte sie es, den schweren Fernsehstuhl mühsam unter den Türstock zu schieben. Bald schon hatte sie jedes Gefühl für Zeit und Ort verloren. Ihren Platz verließ sie nur kurz, um die Toilette aufzusuchen oder aus der Küche eine Kleinigkeit zum Essen zu holen. Mehrere Tage hatte sie in ihrer Verwirrtheit so ausgehalten, bis ihr schließlich die Lebensmittel ausgingen. Und so hatte sie– zum Glück– all ihren Mut zusammengenommen und sich um Mitternacht auf den Weg zur Polizei gemacht.
Mein Kollege und ich blickten uns an– die Lösung lag klar auf der Hand, wenngleich sie in keinem Ausbildungshandbuch stand und in keiner Polizeischule unterrichtet wurde: Wir mussten auf der Stelle in Moskau anrufen und dafür sorgen, dass die Wohnung der alten Frau aus dem Fadenkreuz der Atomraketen genommen wurde! Während die erschöpfte Frau ein Glas Wasser trank, machten wir uns an die Arbeit. Zunächst stellten wir das Akku-Ladegerät unserer Handfunkgeräte auf die Theke. Erwartungsgemäß zeigte das Atomstrahlen-Peilgerät durch das Aufleuchten einer roten Kontrolllampe an, dass Atomwaffen auf die Innenstadt gerichtet waren. Danach folgte Teil zwei unseres Planes, der naturgemäß wesentlich heikler war: Ich schnappte mir nämlich das Telefon und wählte die Nummer des russischen Präsidenten.
Die Nummer war mir von etlichen Anrufen geläufig; sie lautete 2–4.Ich bat den Präsidenten höflich um Entschuldigung, ihn zu dieser späten Stunde noch zu stören. Meine Beteuerung, dass es sich um etwas sehr Wichtiges handelte, besänftigte ihn jedoch sogleich. Dann erkundigte ich mich, wie er dazu käme, seine Atomraketen auf das Haus einer alten Frau zu richten. Laut und deutlich wiederholte ich alle seine Antworten. Der Präsident versicherte, dies sei ein sehr bedauerlicher Irrtum, der seinem Geheimdienst KGB unterlaufen sei. In Wirklichkeit sollten die Raketen auf das Bermuda-Dreieck gerichtet werden, da man sich dort durch Außerirdische bedroht fühle, durch eine falsche Computereingabe wurden sie jedoch versehentlich nach München gedreht. Ich verlangte, den KGB sofort in den Ruhestand zu schicken, was mir mein Gesprächspartner bereitwillig zusagte.
Immer wieder beteuerte der Präsident, dass es unter gar keinen Umständen in den nächsten hundert Jahren zu einem Krieg kommen könnte. Dann versprach er, unverzüglich anzuordnen, die auf München gerichteten Raketen zu vernichten. Sobald die Gefahr vorüber sei, werde er mich umgehend informieren. Leider hatte mein Kollege, der kurz etwas nebenan hatte erledigen müssen, von meinem Gespräch mit dem russischen Präsidenten nichts mitbekommen, weshalb ich ihm ausführlich erklärte, was ich mit dem russischen Staatschef vereinbart hatte. Erleichtert hörte die alte Dame zu.
Wir nutzten die Zeit, der Frau einen Tee und eine Wurstsemmel zu servieren. Tatsächlich rief kurz darauf der russische Präsident zurück und erklärte, dass alles geregelt sei. Er bat mich, der alten Damen sein Bedauern über die Panne auszudrücken. Nun, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Und so holte ich das Strahlenpeilgerät nochmals hervor, doch das Lämpchen des äußerst empfindlichen Gerätes leuchtete nicht mehr auf.
Dankbar und glücklich lächelte die alte Dame uns zu, als sie die Kollegen des verständigten Funkwagens abholten, um sie nach Hause zu bringen. Dort überprüften die Kollegen mit dem Peilgerät, das sie vorsorglich mitgenommen hatten, auch die Wohnung auf Strahlung. Es war alles in Ordnung. Erschöpft, aber sichtlich erleichtert und zufrieden schickte sich die alte Dame an, in ihr Bett zu gehen, dem sie aus Angst so lange ferngeblieben war. Noch am nächsten Morgen informierten wir den zuständigen Sozialdienst und baten, unser »Strahlenopfer« künftig ein wenig zu umsorgen. Wir aber freuten uns, dass wir dank unserer ausgezeichneten Beziehungen zur hohen Politik unter Umgehung des Dienstweges so rasch und unbürokratisch hatten helfen können.
Eine »folgenlose« Trunkenheitsfahrt
Die Zeiger der Uhr rückten im matten Grün der Armaturenbeleuchtung unseres alten Audis auf drei Uhr. Wieder einmal fuhren wir Zivilstreife in der Münchner Innenstadt. In immer länger werdenden Abständen gab die Zentrale ihre Einsätze durch: »Der nächste Wagen zur Nordendstraße– eine verparkte Einfahrt«; »Wer kann zum Sendlinger Tor fahren, Taxi mit Zahlungsschwierigkeiten«; »In der Ingolstädter Straße haben wir eine Ruhestörung!« Gustl, mein Streifenpartner, gähnte laut und ausgiebig. »Ist ja eine richtig aufregende Nacht«, brummte er, während er die Rücksitzlehne flacher stellte. Zum x-ten Male näherten wir uns in dieser Nacht dem Stachus, vormals der verkehrsreichste Platz Europas. Jetzt wirkte er wie ausgestorben. Die Ampel schaltete auf Rot und ich hielt unseren zivilen, unansehnlichen Dienstwagen an. Dabei beobachtete ich im Rückspiegel ein Fahrzeug, das aus einer Seitenstraße in unsere Straße einbog. Kurz darauf rollte der Wagen, ein vermutlich ehemals weißer Fiat, in dem vier junge Männer saßen, neben uns aus. Der Auspuff dröhnte und spuckte schwarze Wolken aus, während der Fahrer das Fenster herunterkurbelte und zu uns herüberblickte. Er wollte offensichtlich nach dem Weg fragen.
»Bevor du ganz einpennst, darfst du eine Runde Freund und Helfer spielen«, erklärte ich meinem Beifahrer, während ich mit dem Kopf in die Richtung des vermeintlich Ortsunkundigen nickte. Gustl kurbelte die Seitenscheibe herunter und blickte fragend zu dem jungen Burschen am Steuer hinüber. Der lachte freundlich und erkundigte sich dann im Plauderton: »Mogst a Watschn, du Depp?« Eine Sekunde lang ließ ich den Satz in mir nachhallen. Dann blickte ich etwas verwirrt zu meinem Kollegen, der im selben Augenblick den Kopf zu mir drehte. Seinem Gesichtsausdruck nach hatte er dasselbe verstanden wie ich. Ich zuckte mit den Schultern, was unter uns so viel bedeutete wie, entscheide du, das ist dein Fall. Mein Kollege entspannte sich sichtlich. Lächelnd wandte er sich dem wartenden jungen Mann zu. »Einverstanden! Lass uns um die Ecke fahren, dann reden wir weiter.« Es wurde grün, und wir bogen ab. Eine Parkbucht wurde als Stätte der Begegnung bestimmt. Wir hielten und stiegen aus. Fast gleichzeitig flogen die vier Türen des Fiats auf und die Männer– von dem vermeintlich bevorstehenden Event beflügelt– kletterten aus ihrem Fahrzeug. Hüftschwingend und breitbeinig, mit federnden Schritten, kamen sie lässig auf uns zu. Dem Aussehen nach– und es bestätigte sich kurz darauf– handelte es sich um vier Italiener im Alter von circa zwanzig Jahren. Allerdings ließ der akzentfreie bayerische Dialekt des Wortführers unschwer erkennen, dass es sich bei ihm wohl um einen »waschechten« Münchner handelte.
Ich glaubte, ein kurzes, unsicheres Aufflackern in den Augen des jungen Mannes zu erkennen, als er Gelegenheit hatte, von meinen hundertneunzig Zentimetern Einsatzlänge und meinen damals zweihundertsechzig Pfund Kampfgewicht Notiz zu nehmen. Ich wollte ihn daher nicht in Verlegenheit bringen und gönnte der Gruppe, die sich bis auf zwei Meter genähert hatte, einen ausgiebigen Blick auf meinen Dienstausweis. »Ich fürchte, das mit der Watschen müssen wir verschieben, meine Herren, denn ich glaube, das Ding, aus dem Sie ausgestiegen sind, schreit heftig nach einer Verkehrskontrolle. Darf ich dann mal um die Pässe, den Fahrzeugschein und den Führerschein bitten?« Diese Wendung der Dinge schien ihrem Herzenswunsch zu entsprechen, denn sie überboten sich förmlich darin, die Papiere zu überreichen.
»Hey, Mann, Sie glauben doch nicht etwa, dass das mit der Watschen ernst gemeint war?« Jetzt musste ich ihn leider enttäuschen. Er merkte es, als er im Zucken der gelben Blinklichter des Abschleppwagens den Fiat entschwinden sah. Das Blinklicht brach sich in den Scheiben und dem Lack eines vorbeifahrenden Autos. Ich fand, dass es irgendwie schön aussah. Der Rest spielte sich dann in den Räumen des Reviers ab und ist schnell erzählt: Fahrer: betrunken; Versicherung und TÜV: abgelaufen; Fahrzeugboden: faustgroße Rostlöcher; Bremsleitungen: undicht; Reifen: abgefahren; Auspuff: abgerissen; Stoßdämpfer: unwirksam. Kleinigkeiten wie eine defekte Hupe und drei durchgebrannte Glühbirnen fielen da schon nicht mehr besonders ins Gewicht: wegen erheblicher Mängel war die Zulassung kraft Gesetz erloschen. Die Anzeige wegen Fahrens ohne Zulassung und eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz ließ sich der streitsüchtige Fahrzeuglenker ja noch eingehen. Auch die Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins nahm er ohne Widerspruch hin. Aber mit der Anzeige wegen eines Vergehens der »folgenlosen Trunkenheitsfahrt« hatte er sichtlich Probleme.
»Auto weg– Führerschein weg– Anzeige– Geldstrafe– und da sagen Sie folgenlos? Das verstehe ich nicht!«, beschwerte er sich missmutig. Ich musste innerlich schmunzeln, als ich ihm beipflichtete, dass die gesetzliche Formulierung tatsächlich ein wenig irreführend klingt. Und trotzdem fand ich in diesem Moment irgendwie Gefallen an ihr– ich weiß auch nicht, warum!
Hundert für dich, hundert für mich…
Es gibt im Leben jedes Menschen immer wieder Höhen und Tiefen. Und es ist eine Binsenweisheit, dass derjenige, der hoch steigt, auch tief fallen kann. Der Sturz jedoch, den zwei Einbrecher in den Morgenstunden eines kalten Januartages erlebten, war von einer ganz besonderen Art. Fast hätten einem die beiden leidtun können, als sie mit hängenden Köpfen von zwei grinsenden Polizeibeamten in die Räume des Kriminaldauerdienstes geführt wurden, wo ich als frisch gebackener Kriminalbeamter Dienst verrichtete. Doch immer schön der Reihe nach.
Zunächst sah alles danach aus, als habe Fortuna beschlossen, sich bedingungslos in den Dienst des Bösen zu stellen. Knut und Ede, so wollen wir die tragikomischen Hauptdarsteller in Anlehnung an eine Komikserie nennen, in der die Ganoven nicht durch Intelligenz aufgefallen sind, hatten ein bestimmtes Ziel vor Augen, als sie gegen zwei Uhr morgens in dieser kalten Nacht die Stadt in Richtung Süden verließen.
Ein Vögelchen aus der Unterwelt hatte ihnen nämlich ein paar Tage zuvor ein kleines Liedchen ins Ohr gepfiffen, und die Melodie war offenkundig so recht nach ihrem Geschmack gewesen. Bald erreichten sie einen kleinen Vorort von München, der um diese Zeit in tiefem Schlaf lag. In einer kleinen Straße am Ortsrand waren Knut und Ede am Ziel. Behände und völlig geräuschlos nahmen sie verschiedene Gerätschaften aus dem Kofferraum ihrer Limousine, ehe sie sich zwischen den Büschen eines kleinen Spielplatzes durchzwängten. Gleich darauf lag die Straße wieder völlig ruhig da. Nichts deutete darauf hin, dass kaum hundert Meter weiter gerade die Scheibe eines Kellerfensters herausgeschnitten wurde und dass kurz darauf Ede vor Aufregung fast laut aufgeschrien hätte, als er im Schein einer Taschenlampe sah, welch fette Beute da auf sie wartete. Mit zitternden Fingern rafften sie alles an sich, stopften zwei Taschen voll, packten ihr Einbruchswerkzeug zusammen und verließen gleich darauf die Villa wieder, die sie so reichlich »beschenkt« hatte. Niemand wurde Zeuge, als sie ihr Auto beluden und– immer noch fassungslos– in Richtung München losfuhren. Nichts, aber auch gar nichts blieb von den beiden Profieinbrechern am Tatort zurück, was es ermöglicht hätte, jemals auf Knut und Ede zu kommen. Es schien einer der Einbrüche zu sein, die niemals geklärt werden können.
Außer– ja, außer es würde sich ein Kollege der Sache annehmen, der schon mehr Fälle geklärt hat, als ein normaler Polizist in seinem Leben bearbeiten kann. Und ebendieser Kollege war just in dieser Nacht gleichfalls im Süden der Millionenstadt unterwegs. Sie alle kennen ihn oder haben zumindest schon einmal von ihm gehört: Es war der Kommissar Zufall, der gegen drei Uhr in Gestalt von zwei Verkehrspolizisten Streife fuhr. Die Nacht war eintönig, kalt und unfreundlich, und die beiden Beamten sehnten den Morgen herbei, eine warme Tasse Kaffee und ihr Bett. Doch vor den Lohn hat, wie man weiß, der liebe Gott die Arbeit gestellt. Und so kam es, dass die beiden Polizisten nicht einfach vorbeifuhren, als sie in einem kleinen Waldweg ein Fahrzeug stehen sahen, dessen Innenbeleuchtung brannte.
»Wie ein Liebespärchen sieht das nicht aus«, murmelte Hans nachdenklich, »komm, lass uns mal nachschauen, was los ist!« Sanft bremste er den Streifenwagen außerhalb der Sichtweite des verdächtigen Fahrzeuges ab. Die Beamten überprüften ihre Waffen, ehe sie sich vorsichtig dem Wagen näherten. Die zwei Insassen bemerkten nicht, dass zwei wachsame Augenpaare gebannt durch die Heckscheibe des Fahrzeuges auf das starrten, was im Fahrzeuginneren geschah: Dort nämlich waren Knut und Ede dabei, ihre Beute zu teilen. Sie hatten in ihrem Hochgefühl und zugleich vor lauter Ungeduld nicht mehr warten wollen, bis sie zu Hause und in Sicherheit waren. Deshalb hatten sie bei der erstbesten Möglichkeit angehalten und nicht weiter darauf geachtet, weit genug in den Wald hineinzufahren, um außer Sichtweite der Hauptstraße zu kommen. Genau genommen hatten sie für nichts mehr Gedanken, Augen oder Ohren als für das, was sie erbeutet hatten. Zwei große, prall mit Geldscheinen gefüllte Reisetaschen standen vor den Füßen der beiden. Und mit glückseligem Lächeln machten sie sich daran, brüderlich zu teilen: »Hundert für dich, hundert für mich, hundert für dich, hundert für mich…« Ede nahm unentwegt Hundertmarkscheine aus einer der beiden Reisetaschen und verteilte sie Schein für Schein. Diese verschwanden in Plastiktüten, die die beiden auf ihren Schößen hielten.
Die Kollegen ahnten, dass das wohl nicht mit rechten Dingen zugehen konnte, und beschlossen, sich an dem regen Austausch zu beteiligen. Ein kurzer Blick, ein leises Flüstern, und dann rissen sie gleichzeitig die beiden Vordertüren des Fahrzeuges auf. »Hundert für mich«– »und hundert für mich!«, ergänzte einer der Polizisten. Geschockt ließen sich Knut und Ede ohne jegliche Gegenwehr festnehmen. Bald darauf landeten alle beim Kriminaldauerdienst: Knut, Ede, die beiden Taschen und der doppelte Kommissar Zufall. Nachdem wir den Inhalt der beiden Reisetaschen geprüft hatten, machten wir gleichfalls ungläubige Augen: rund vierhundertachtzigtausend Mark (zweihundertfünfzigtausend Euro) in gebrauchten Banknoten hatten die beiden erbeutet. Und wenn sie nicht so ungeduldig gewesen wären, hätten sie davon einige Jahre in Ruhe und in Frieden leben können. Wie sich später herausstellte, hatte ein »ehrenwerter Geschäftsmann etwas Kleingeld« beiseitegeschafft, um sich den einen oder anderen Wunsch zu erfüllen. Das Finanzamt sollte wohl nicht beteiligt werden, weshalb der Betrag in bar zu Hause angehäuft worden war. Das war irgendwie ruchbar geworden, was unsere zwei Freunde auf den Plan gerufen hatte. Als die beiden erfuhren, wie viel sie da erwischt hatten, und als ihnen klar wurde, dass die Sache nur an ihrer Ungeduld gescheitert war, brach für sie eine Welt zusammen. Die Ausdrücke, mit denen sie sich gegenseitig die Schuld zuwiesen, können aus Jugendschutzgründen hier nicht abgedruckt werden. Fortuna aber hatte nachdrücklich klargemacht, auf wessen Seite sie steht.
Abschied von der Tochter
Im nächsten Fall war es weniger der Göttin Fortuna zu verdanken als meinem mit den Jahren geschärften Instinkt für Gefahrensituationen, dass eine Wohnungsdurchsuchung nicht in einem Desaster endete. Beim Betreten fremder Wohnungen kommt es immer wieder zu brenzligen Situationen, wie jeder Polizeibeamte zur Genüge bestätigen kann. Allerdings deutete in diesem Fall nichts darauf hin, dass die beabsichtigte Wohnungsdurchsuchung etwas anderes als Routine sein könnte. Ich begleitete zwei junge Kolleginnen zu einer Mietwohnung im Münchner Westen. Wir hatten einen Durchsuchungsbeschluss, da der Angestellte einer Fotogroßhandlung, Achim P., im Verdacht stand, Waren im Wert von mehr als fünfzigtausend Euro entwendet und über Kleinanzeigen zum Verkauf angeboten zu haben. Nachdem wir kurz an der Wohnungstür gelauscht hatten, klingelten wir. Es dauerte fast einen Tick zu lange, bis sich endlich ein Mann durch die geschlossene Tür erkundigte, wer da sei. Nachdem wir uns zu erkennen gegeben hatten, bat er uns, kurz zu warten, er müsse sich schnell etwas anziehen. Bei mir schrillten die Alarmglocken. Zu oft schon hatte ich erlebt, dass solche Aufschübe dazu genutzt werden, aus dem Fenster zu flüchten, Beweismittel zu vernichten, Mittäter telefonisch zu warnen oder gar, sich für eine körperliche Auseinandersetzung mit der Polizei zu bewaffnen. Dementsprechend nachdrücklich forderte ich den Mann auf, sofort zu öffnen. Andernfalls würden wir die Tür aufbrechen. Nachdem keine Antwort erfolgte, wies ich die Kolleginnen an, ihre Waffen einsatzbereit zu halten, und verlangte nochmals laut und vernehmlich Einlass. Wieder keine Reaktion. Nun nahm ich Anlauf und warf mich gegen das Türblatt. Doch die Tür hielt stand. Auch bei zwei weiteren Versuchen zeigte sich die Tür von meinen immerhin noch hundertzwanzig Kilo Kampfgewicht unbeeindruckt. Meine Schulter schmerzte. Während ich über eine Alternative zur Selbstverstümmelung nachdachte, meldete sich die Stimme aus der Wohnung wieder. »Warten Sie, ich mach ja schon auf!«