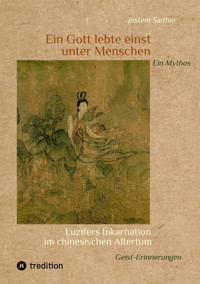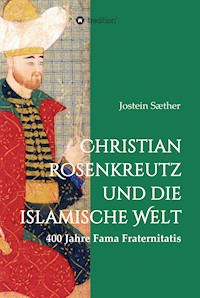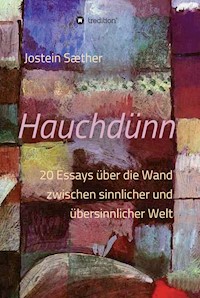
8,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die hier gesammelten Texte sind aus der Intention geschrieben, spirituell interessierten Lesern, die sich tastend, übend und forschend an die «hauchdünne» Wand, Grenze oder Schwelle zur geistigen Welt bewegen, verschiedene An- und Aussichten anzubieten. Wie in Jostein Sæthers früheren Büchern zu Meditation und Karmapraxis beschreibt er auch hier seine individuellen Annäherungsweisen zu übersinnlichen Phänomenen, sodass sie gedanklich nachvollzogen werden können. Sæther verwendet Gleichnisse für die Andersartigkeit des Übersinnlichen, um meditative Vorgänge philosophisch einzukleiden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
www.tredition.de
Jostein Sæther
Hauchdünn
20 Essays über die Wandzwischen sinnlicher und übersinnlicher Welt
Jostein Sæther, geboren 1954 in Sunndal, Norwegen, studierte Anthroposophie, Waldorfpädagogik, bildende Kunst und Kunsttheorie in Schweden. Er lebte dort 21 Jahre und arbeitete als Maler, Ausstellungsdesigner und Kunstlehrer bis zu seiner Umsiedlung nach Deutschland 1998. Seitdem arbeitet er u.a. als Schriftsteller, Blogger, Freizeitgestalter und Seminarleiter. Er hat fünf Bücher über Anthroposophie, Reinkarnation und Karma, Meditation und Geschichte geschrieben. In tredition sind folgende Titel erschienen:
Weisheit wahrnehmen. Individuation und Kulmination der Anthroposophie. 2014.Christian Rosenkreutz und die islamische Welt. 400 Jahre Fama Fraternitatis. 2015.
Jostein Sæther
Hauchdünn
20 Essays über die Wandzwischensinnlicher und übersinnlicher Welt
www.tredition.de
© 2016 Jostein Sæther
Umschlag (unter Verwendung eines Aquarells von Paul Klee: Motiv aus Hammamet, 1914. Kunsthalle Basel): Jostein Sæther
Lektorat, Korrektorat: Inka Goddon
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
978-3-7323-5144-2 (Paperback)
978-3-7323-5145-9 (Hardcover)
978-3-7323-5146-6 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Anfangsworte
1. Ich und Weltgeschehen
Kurswechsel am Goetheanum?
Eine neue Sprache für die Anthroposophie
Seminarzur meditativen Praxis
Keine geführten Gruppenmeditationen
Intellektualismus statt Erleben
Entwicklungsraum fürgeistige Forschung
2. Geistige Erkenntnis und philosophische Begründung
Was heißt eine Erkenntnis des Geistgebietes vor dem Eintritt in die geistige Erfahrung?
Was heißt eine Erkenntnis des Geistgebietes nach dem Eintritt in die geistige Erfahrung?
Rudoif Steiners Situation
Meine Situation
Wie lese ich Steiner?
Zurück zur räumlich-zeitlichen Positionierung des «Vor»
3. Philosophie und Anthroposophie
Verschiedene Annäherungen an Steiner
Steiners individueller philosophischer Gewinn
Die zwei Goetheanum-Gebäude als Gleichnis
Die freie Wechselbeziehung zweier Philosophien
4. Bewusstsein und Bewegung, Denken und Stillstand
Von der Bewegung in der Philosophie
Übersinnliches Bewusstsein als eine von sechs Kategorien
Wenn ruhendes Denken sich als Bewegung entpuppt
Übersinnliches Bewusstsein als existentialistischer Monismus
5. Skepsis und Zweifel bezüglich geistiger Erkenntnis
Zweifel und Wahrheitsbestreben
Im Pendelschlag zwischen den Kräften
6. Wohlgeruch des Geistes
Meditieren ist die freieste Tat
Der Hüter der Schwelle
7. Meditative Löcher und Bewusstseinswachheit
Zurückblickende Wiederholung einer Meditation
Das Bildhafte und das Begriffliche
Das meditative Feld
Fünf Schritte im individuellen und sozialen Feld
Kann ein Geist-Erleben unbemerkt geschehen?
8. Der meditative Modus
Das richtige Maß
Die innere Wachsamkeit
Vertrauens volle Geradlinigkeit
Das karmische Ich
9. Der Erkenntnismoment und die Problematik des Bösen
Ein spirituelles Ferment
Das Geheimnis des Bösen
10. Dag Hammarskjöld und die Wirklichkeit des Bösen
Karmische Folgen des Ersten Weltkriegs
Karmische Verschiebungen des Zweiten Weltkriegs
Menschen- und naturfeindliche Eingriffe
Das Jetzt – Schnittpunkt zwischen Zeit und Zeitlosigkeit
11. «Nichts» und «Leere» in der meditativen Begegnung mit dem Bösen
Isaak Luria und die göttliche Selbstbegrenzung
Die buddhistische Lehre vom «Nicht-Selbst»
Initiationsmärchen und Zeitleib
Nachtmensch und Tagmensch
Die Begegnung mit dem Bösen
12. Die Ungeheuerlichkeit des Menschen
Ätherische und astrale Formationen und Bilder
Mut zur Konfrontation mit dem Monströsen
13. Der Ruf der geistigen Welt
Die Freiheit der Interpretation
Das Wahrnehmen der geistigen Welt
Demut, Staunen und Geist-Erleben
14. Wer reinkarniert?
Der Zusammenhang zwischen Ich und Reinkarnation
15. Zum Schicksalsbegriff
Monden- und Sonnenkarma
Die Rechtzeitigkeit der Schicksalsgefüge
16. Karmagesetz und Ich-Wert
Ein messerscharfer Weg
Selbstbild und Ich-Strom
17. Der Tod als Sinn des Lebens
Wasser und Eis als Gleichnisse von Leben und Tod
Der Tod ist die Heckwelle des Lebens
Die Toten sind Glückswesen
Der Todesaugenblick als Sonne zwischen Tod und neuer Geburt
Liebe und Hass in Bezug auf den Tod
Die Schönheit ist wie Frischluft für die Toten
18. Der geistige Gipfel
Die Brüderlichkeitsidee des sozialen Lebens
Leitspruch des ethischen Individualismus
Der Karmaspiegel des Individuums
19. Karma zulassen
Der karmische «Staffelstab»
Die viertägige Karma-Übung
Eine karmische Hand-Regel
Ein Akt der Liebe im Bewusstsein
20. Meditative Tagträume und tagträumendes Meditieren
Halbdunkel, Stockdunkel und Ewigkeitserlebnis
Die tanzende Göttin
Die Wand zwischen sinnlicher Welt und übersinnlicher Welt ist «hauchdünn». Doch Vorsicht! – die Wand ist nichts Sinnliches.1
Stefan Brotbeck
1 Stefan Brotbeck: Heute wird nie gewesen Sein. Aphorismen. Futurum Verlag, Basel 2011. Seite 117.
Anfangsworte
Frühstücksgespräche am Familientisch haben das Entstehen der vorliegenden Essays mit angeregt. Außerdem sind Gespräche mit Freunden – zumeist ohne diesen morgendlichen, anregenden Rahmen, aber ebenso vertraut und offen – hineingeflossen in viele Seelenvollzüge, die ich sowohl tagträumerisch oder vollbewusst als auch meditativ ausgeübt habe, ehe ich zur Niederschrift ging.2 Auch Diskussionen in virtuellen Foren wie auf dem Egoistenblog von Michael Eggert haben bestimmte Formulierungen mitbestimmt, zumal mehrere der Kapitel bei ihm als Blogbeiträge ihre Erstveröffentlichung fanden.3 Einige Inhalte publizierte ich zudem auf meinem Blog.4 Ebenso haben bestimmte Anregungen, die ich beispielsweise durch Anna-Katharina Dehmelt und Kari Frid bekam während einer Tagung bzw. eines Seminars, die Art meiner Niederschrift mitgeprägt.
Die hier zusammengestellten Texte wurden nicht mit dem Zweck geschrieben, dass sie einst in einem Buch vereint werden sollten. Nichtsdestotrotz sind sie aus der einen und selben Absicht geschrieben; nämlich spirituell interessierte Leser zu unterstützen, die, ähnlich wie ich, sich tastend, übend und forschend an die «hauchdünne» – wie der Philosoph Stefan Brotbeck im vorangestellten Motto formuliert – Wand, Grenze oder Schwelle zur geistigen Welt bewegen. Wie in meinen früheren Büchern zu Meditation und Karmapraxis beschreibe ich auch hier vorzugsweise meine individuellen Ansätze und Handhabungen. Die übersinnlichen Phänomene versuche ich so zu beschreiben, dass sie gedanklich nachvollziehbar sind.
Indem ich Gleichnisse verwende, um die Andersartigkeit des Übersinnlichen hervorzuheben, möchte ich meditative Vorgänge sozusagen philosophisch einkleiden. Ich akzentuierte diesen Angleichungsversuch, nachdem die Diskussion um die Wissenschaftlichkeit der Anthroposophie Rudolf Steiners in den Medien aufflammte ab 2013 im Zuge der Herausgabe der ersten Bände der SKA (Rudolf Steiner Kritische Ausgabe) von Christian Clement.5 Viele Kritiker stellen in Frage, ob die «inneren» Themen in Steiners Werk nach denselben Kriterien erforscht werden können, wie in der Wissenschaft die «äußeren» Phänomene ergründet werden. Manche Anthroposophen fänden es sogar heute besser, wenn der wissenschaftliche Anspruch der Anthroposophie zugunsten eines künstlerischen Freiheitsstrebens verlassen werden würde.
Ich allerdings habe mich im Verhältnis zu übersinnlichen Erfahrungen und im Geist-Erleben stets als übenden Forscher verstanden. Deshalb hat es mir im Umgang mit den vielfältigen Seelenerlebnissen und Geistphänomenen geholfen, eine prüfende, untersuchende und selbstkritische Haltung einzunehmen, die dem Verhalten entspricht, das ein Forscher allemal einnehmen muss, um wissenschaftliche Anerkennung zu finden. Somit übergebe ich diese teils bruchstückhaften Texte meinen Lesern mit der Hoffnung, dass sie immerhin ein Beitrag zur Entfaltung einer Wissenschafts- und Weisheitskultur sein mögen.
Blieskastel, 3. Februar 2016
Jostein Sæther
2 Für die Grundschrift benutze ich Segoe UI Symbol, während ich für Kapitelüberschriften und Initiale die Schriftart Baar Philos vom schwedischen Künstler Lutz Baar (http://www.baar.se/art/) einsetze.
3http://egoistenblog.blogspot.de/
4http://jostein-saether.blogspot.de/
5http://www.steinerkritischeausgabe.com
1. Ich und Weltgeschehen
«Those who cannot remember the past are condemned to repeat it.»George Santayana, 1905
An der Weihnachtstagung am Goetheanum in Dornach, Schweiz, dirigierte Rudolf Steiner 1923/24 die Neugründung der 1912/13 erstmalig gegründeten Anthroposophischen Gesellschaft. Sie sollte die neu eingerichtete Freie Hochschule für Geisteswissenschaft (FHfG) fördern, damit immer mehr Menschen sich – so wie er selbst – zu geistigen Forschern ausbilden könnten. Die Geschichte dieser Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft (AAG) und ihrer Hochschule ist seit Steiners frühzeitigem Tod 1925 eine sowohl positiv-lebhafte, interessantdramatische wie tragisch-herzzerreißende, denn er hinterließ viele offene Fragen und Aufgaben, die bis heute nur bedingt in Angriff genommen worden sind. Die geschichtlichen Zusammenhänge wurden vielmals und zu unterschiedlichen Anlässen erörtert. Für die Mitglieder und leitenden Vertreter gehört es also seit jeher zum innergesellschaftlichen Einvernehmen, sich mit erinnernden, besinnenden und auf die Zukunft hinschauenden Phänomenen zu beschäftigen.
Im Arbeitsvorhaben der anthroposophischen Bewegung wird bereits auf das 100-jährige Gedenken dieser Weihnachtstagung vorbereitend hingearbeitet. Nach einer Klausurtagung von leitenden Vertretern der AAG und FHfG im Herbst 2015, bei der eine Vorbereitungsgruppe sich bildete, erfuhren die Mitglieder durch das Mitteilungsblatt der AAG6, dass man sich der krisenhaften Situation in der anthroposophischen Bewegung bewusst sei und sich den anstehenden Zeitaufgaben stellen wolle mit der Frage, wie man der Leitungsaufgabe heute und zukünftig gerecht werden könne, indem man sowohl auf die Nöte und Zustände in dem anthroposophischen Umkreis eingehe, als auch sich in einen gemeinsamen Willen einordne, während man dabei Steiners Zielrichtungen im Auge behalte.
Kurswechsel am Goetheanum?
Es bestehe dabei die Zuversicht, dass die negativen Zeittendenzen, die sich in Abschirmung, Streiten und Trägheit äußern und auch zum Zersplittern von Impulsen führen, bezwungen werden können. Die anthroposophische Bewegung, die bis heute von diesem weltweiten Negativkurs ebenfalls beeinträchtigt sei, müsse künftig quasi einen Kurswechsel vornehmen. Dabei gehe es weniger um eine kollektive Strategie, sondern vielmehr darum, die individuellen Wege zu achten, sodass die soziale Veränderung zielgerichtet, aber offen sich entwickeln könne, ohne dass im Voraus etwas ausgesperrt oder aus überlieferten Vorstellungen gesteuert werde. Aus der Klausurtagung verlautete es:
«Der Impuls, die Entwicklung der anthroposophischen Bewegung gemeinsam aufzugreifen, sprang über. Die Zeit dafür war reif. Nun kommt es entscheidend auf die nächsten Schritte an! Wie können der große Kreis der Mitglieder und Hochschulmitglieder sowie die verantwortlich Tätigen in den Lebensfeldern mit einbezogen werden? Wie springt der Funke über?»7
Dabei wurde allerdings übersehen, dass dem neu gefassten Entschluss, nicht aus überlieferten Vorstellungen zu steuern, bereits in der ersten Umsetzung entgegen gewirkt wurde, da die Vorbereitungen für eine große Michaeli-Konferenz in 2016 mit erwarteten 1000 Teilnehmern schon im vollen Gange waren, ehe sie den Mitgliedern und mitgliedschaftsfreien Interessierten angekündigt wurde. In einem nächsten Schritt sollen viele Repräsentanten für eine Teilnahme und Mitgestaltung gewonnen werden. Dass diese wiederum keine Mitglieder der AAG sein müssen, verdeutlicht das gegenwärtige Bestreben, «ein möglichst ausgewogenes Verhältnis von Generationen, Regionen und Ländern und Fachgebieten einzuladen.»
Eine neue Sprache für die Anthroposophie
Ein weiteres Stimmungsbild aus der Klausurtagung wurde mit folgenden, etwas gekürzten Worten gezeichnet:
«Es ist wohltuend, sich über anthroposophisch grundsätzliche Fragen ohne Pathos austauschen zu können. Zugleich wird ohne diese Blendung die Schwierigkeit greifbarer, den treffenden Gefühlen und klugen Überlegungen Gewicht verleihen zu können. […] man dürfe bei aller Freude an solch einem Zusammensein die Schwierigkeit nicht vergessen – und diese heiße, eine neue Sprache für die Anthroposophie zu entwickeln. Sie müsse erkennend, nachvollziehbar und engagiert sein.»8
Für die kommende Konferenz wünschte die Vorbereitungsgruppe: sich meditativ an Themen anzunähern; Menschen, die sich von der Anthroposophie gelöst haben, zum Gespräch einzuladen; Anthroposophie und Gesellschaftsengagement als eine Sache zu sehen und die Konferenz als ein Fest zu betrachten gemäß Rudolf Steiners Motto an die Jugend: «Haltet zusammen, verwandelt Erkenntnis in Andacht und feiert Feste, voller Hoffnung und Erwartung.» Für die geplante Tagung wurde die Zuversicht geäußert, «[…] dass sich viele – auch jüngere, auch die, die sich abseits stehen sehen – eingeladen fühlen.»
Seminarzurmeditativen Praxis
Wie kann ein gemeinschaftliches Vorhaben eines Kurswechsels gelingen? Was kann getan werden, damit der benannte geistige Funke auf die Gesellschafts- und Hochschulmitglieder überspringen kann? Wie klingt eine neue anthroposophische Sprache?
Ich werde beispielhaft veranschaulichen, welche Herausforderungen an die Vorstandsmitglieder der AAG und alle leitenden Vertreter herantreten, wenn sie zu einem solchen Gelingen maßgeblich beitragen wollen. Dazu schildere ich, wie sich ein Seminar gestaltete, das die Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland (AGiD) gemeinsam mit der AAG und FHfG in Kassel, Deutschland, veranstaltete. Das Seminar fand eine Woche nach der beschriebenen Klausurtagung statt. Da ich annehme, dass unter den Referenten zumindest ein Gesprächsaustausch über den Kurswechsel stattfand, kann betrachtet werden, ob die jeweilige Art des Auftretens und der Darbringung einen ersten Ausdruck dieses neu entwickelten Verständnisses erkennen ließ.
Das Seminar wollte folgende Fragen der meditativen Praxis aufgreifen:
Wie kann ich meditieren?
Was ist und wie komme ich zu geistigem Erleben?
Wie bilde ich meine individuelle meditative Kultur?
Ein aphoristisch angelegter Text von Rudolf Steiner, der in seinem Buch Die Schwelle der geistigen Welt zu finden ist, bildete die Grundlage, auf der die Referenten ihre Einleitungen zu den Plenumsgesprächen und den Übungsmomenten bauten.9
Keine geführten Gruppenmeditationen
Der erste Teil des Aufsatzes bis zum Satz «Ich empfinde mich denkend eins mit dem Strom des Weltgeschehens» wurde von den Referenten gelesen, erläutert und wiederholt kommentiert. Dieses gründliche Zurechtlegen des imaginativen Inhalts, bei der Steiner das menschliche Denken des wachen Tagesbewusstseins eingangs mit dem Bild einer Insel vergleicht, gab für manchen Teilnehmer die nötige Hilfestellung, um sich auf ein meditatives Vorgehen vertrauensvoll einzulassen. Das wiederholte Gespräch in kleineren Gruppen ermöglichte, dass jeder zu Wort kam. Somit konnte jeder seine inneren Erfahrungen mit denen der anderen vergleichen, um auch neuen Blickwinkeln zu begegnen. Der Programtext hob das Bestreben der Tagung wie folgend hervor:
«Anhand dieses Wortlautes soll nicht über Meditation gesprochen, sondern versucht werden, in die Sache selbst, in einen Vollzug einzutreten. Ziel der übenden Praxisarbeit ist es, die Frage zu beantworten: ‹Wie kann das weltverbundene Ich als geistige Tätigkeit in der eigenen Seele entdeckt werden?›»
Ich will ausdrücklich betonen, dass die eher kurzen, zumeist wenige Minuten langen Phasen, die ohne begleitendes Sprechen schweigsam vergingen, wenn jeder einzelne sich in verschiedene Teile des Texts von Steiner vertiefen sollte, von keinem der Referenten als Meditation bezeichnet wurde. Es wurde freigestellt, als was man das individuelle, innere Üben bezeichnete, empfand und betrieb. Eine Teilnehmerin drückte insbesondere ihre Befriedigung darüber aus, dass «keine geführten Gruppenmeditationen» vollzogen wurden, ohne dass sie begründete, warum dies eventuell mit anthroposophischer Meditation unvereinbar gewesen wäre. Als eine andere Teilnehmerin während eines Plenumsgesprächs von einem ihrer imaginativen Prozess-Erleben erzählte, in welchem sie das Bild «eines offenen Tempels» für ein bestimmtes Erleben benutzte, ergriff ein Referent das Wort und stellte deutlich heraus, dass er nicht damit einverstanden wäre, wenn jemand geradewegs aus der meditativen Erfahrung etwas mitteile. Er begründete dies damit, dass es sein könne, dass er oder auch jemand anders davon «schamhaft berührt» werden würde. Er führte aus, dass es unpassend sei, «sich naiv wie ein Kind nackt bloßzustellen, denn Erwachsene müssten sich verhüllen».
Intellektualismus statt Erleben
Diese für zahlreiche Anwesende einflussreiche und machtbegründende Aussage eines Referenten, der sowohl Vorstandsmitglied der AAG ist als auch der FHfG angehört, machte für mich deutlich, dass das Bestreben nach offenem Austausch meditativen Erlebens und dem Durchführen einer gemeinsamen meditativen Praxis in der Realität an etwas scheitert, was der Entwicklung bzw. dem Kurswechsel der anthroposophischen Bewegung im Weg steht. Trotz des ausgezeichnet vorbereiteten und gut geführten Seminarverlaufs und des vorausgesetzt ehrlichen Bestrebens der Referenten, sich auf jeden einzulassen und sich dem «etwas» zu stellen, was auch immer überraschend geschehen würde – entsprechend den Ausführungen Steiners, wenn es sich um Geist-Erleben handelt – mündete das Seminar in einer Art Unterricht mit festgelegtem Lehrinhalt, bei der die Fragen wegen zu vieler vorgefasster Antworten entweder nicht gestellt oder mit Intellektualismus beantwortet wurden.
Dass man Gespräche mit Menschen am Rande der Anthroposophie suche und es keiner Mitgliedschaft bedürfe, um teilzunehmen und etwas von dieser Initiative nachhause zu tragen, wurde öfters betont. Als eine weitere Teilnehmerin wiederholt Steiners Aussage in Frage stellte, dass die menschliche Seele «ein natürliches Vertrauen zu dem Denken» voraussetzen kann, wurde nicht versucht herauszufinden, warum sie kein Vertrauen zum Denken habe, sondern ihre auf naturwissenschaftliche Argumente gestützte Kritik wurde eher antipathisch zurückgewiesen. Sie erschien am folgenden Seminartag nicht mehr. Manches Mitgeteilte, was im Vergleich zu den Erfahrungen und den Sichtweisen der Referenten anders oder für sie als unbekannt erschien, hörten sie sich offen an. Einige Beiträge wurden jedoch durch einen mehr oder weniger geschickten Themenwechsel mit Missachtung belegt.
Entwicklungsraum für geistige Forschung
Mit diesem Beispiel möchte ich etwas andeuten, das sich in den Gesprächen zwiespältig zeigte. Was in Dornach bei Basel eine Woche vorher als «Achtung und Respekt vor dem freien Geist» charakterisiert wurde, erlebte ich in Kassel nur bedingt, denn immer wieder tauchte nicht nur unter den Referenten sondern auch bei einigen Teilnehmern, die sich als Anthroposophen gaben, tendenziell eine Abneigung und eine Rücksichtslosigkeit gegenüber einem andersdenkenden Menschen auf. Dieses Walten der Sympathie und Antipathie im sozialen Miteinander ist eine vorhandene Neigung, die jedoch nicht förderlich ist für das Entwickeln einer meditativen Praxis. Es ist auch nicht zufriedenstellend, wenn Referenten dem äußeren Verhalten nach nicht dazu bereit sind, sich auf Augenhöhe mit Teilnehmenden zu verständigen und zuzulassen, dass diese womöglich ganz unterschiedliche und durchaus andere meditative Erfahrungen haben als sie selbst.
Es ist eine persönliche Entscheidung, wenn jemand nicht über sein meditatives Erleben berichten mag. Es ist für das Erlernen einer meditativen Praxis jedoch wenig förderlich und zudem überholt, wenn jemand, dass jemand, der der AAG und der FHfG in leitendender Tätigkeit angehört, 90 Jahre nach Steiners Tod nur die Möglichkeit anbietet, über Meditation zu reden. Die wenigen, aber immer mehr auftretenden Erfahrungen meditativer Forschung werden dann entweder innerlich abgelehnt oder als nebensächlich außer Acht gelassen. Bezeichnend scheint mir auch das Bild, das ein Referent entwarf, indem er die von Rudolf Steiner beschriebene «Insel des Denkens im Strom des Lebendigen» zu einem «festen Kontinent des Denkens» ausbaute.
Der spanisch-amerikanische Philosoph George Santayana10 äußerte einmal sinngemäß: «Wer die Vergangenheit nicht kennt, ist gezwungen, sie zu wiederholen». Das Motiv des Sich-Nicht-Wiederholen-Müssens beschäftigte auch das betreffende Vorstandsmitglied. Was kann also jeder Einzelne und was können die Vertreter der anthroposophischen Körperschaften dazu beitragen, dass ein wahrhaftiger Kurswechsel aus dem Kreislauf der Wiederholungen herausführen kann, sodass die Bewegung spiralförmig oder ganz anders wird? Ich denke, dass Erkenntnismut mit Verzicht auf Sicherheit ein möglicher Kompass sein kann. Dann wird auch entdeckt werden können, welche Beschaffenheit und Dimension die Insel des Denkens im Strom des Weltgeschehens haben kann, und welche Schätze dort verborgen sind, wenn die individuellen «Pflanzen der Meditation» zu geistiger Forschung aufblühen werden.
Was ist nun ein geistiges Erleben?Um mich dieser Frage weiter zu nähern, wende ich mich zunächst Rudolf Steiners philosophischem Frühwerk zu.
6 Nachrichtenblatt «Was in der Anthroposophischen Gesellschaft vorgeht – Anthroposophie weltweit», Ausgabe 10/15.
7 Justus Wittich, in: «Anthroposophie weltweit», Ausgabe 10/15.
8 Wolfgang Held, in: «Anthroposophie weltweit», Ausgabe 10/15.
9 Rudolf Steiner: Die Schwelle der geistigen Welt. Aphoristische Betrachtungen 1913. Bibliographie-Nr. der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA) 17. 4. Auflage 2010.Dasselbe im Rudolf Steiner Online Archiv: http://anthroposophie.byu.edu/schriften/017.pdf
10 George Santayana (1863 - 1952) war ein spanischer Philosoph, Schriftsteller und Literaturkritiker. Er gilt als einer der einflussreichsten Vertreter der amerikanischen Philosophie des 20. Jahrhunderts. Während seiner Berliner Zeit schrieb er seine Dissertation über die Philosophie von Rudolf Hermann Lotze (1817 – 1881). George Santayana gilt ebenso als führender Vertreter des kritischen Realismus.
2. Geistige Erkenntnis und philosophische Begründung
In Rudolf Steiners Vorrede zur Neuausgabe der Philosophie der Freiheit (PdF) 1918 finden sich die folgenden drei Sätze, die in der aktuellen Annäherung an sein philosophisches Frühwerk zu gewissen Auseinandersetzungen in der öffentlichen Diskussion geführt haben:
«Es ist dies: nachzuweisen, wie eine unbefangene Betrachtung, die sich bloß über die beiden gekennzeichneten für alles Erkennen grundlegenden Fragen erstreckt, zu der Anschauung führt, dass der Mensch in einer wahrhaftigen Geistwelt drinnen lebt. In diesem Buche ist erstrebt, eine Erkenntnis des Geistgebietes vordem Eintritte in die geistige Erfahrung zu rechtfertigen. Und diese Rechtfertigung ist so unternommen, dass man wohl nirgends bei diesen Ausführungen schon auf die später von mir geltend gemachten Erfahrungen hinzuschielen braucht, um, was hier gesagt ist, annehmbar zu finden, wenn man auf die Art dieser Ausführungen selbst eingehen kann oder mag.»11
Erstens erklärt Steiner, dass bereits durch einen freien Gedankengang zu zwei grundlegenden Fragen die Einsicht gewonnen werden kann, dass der Mensch in einer tatsächlich existierenden geistigen Welt lebt. Zweitens sah Steiner 25 Jahre nach der Erstauflage der PdF seine einstige Aufgabe darin liegend, das Erkennen dieses «Drinnenlebens» philosophisch zu begründen und zwar vor einem Zugang zur Geist-Erfahrung. Drittens behauptet Steiner, dass nichts von dem, was er nach der Herausgabe der PdF als Geistiges durch seine Erfahrung gefunden hat, herangezogen werden muss, um seinen Ausführungen Verständnis entgegen bringen zu können. Demnach bräuchte die PdF also keine Anthroposophie, um als philosophisches Werk anerkannt zu werden, sondern sie müsste durch ihren Stil und ihre Argumente den eigenen Titel rechtfertigen. Demgemäß könnten seine philosophischen Betrachtungen in der PdF sich der kritischwissenschaftlichen Betrachtung stellen – wie jede Philosophie – und ihr Stand halten. Steiner betont sogar, dass es mehr um das Wie – Form der Gedankenführung – dieses Frühwerks und weniger um das Was – Inhalt des Gedankens – gehe, wenn der Leser darin den Einklang mit seinem Spätwerk entdecken möchte.
Das von Steiner kursiv hervorgehobene Wort «vor» hat mich aufmerksam gemacht. Für was steht es? Steht es für etwas Räumliches oder etwas Zeitliches? Im folgenden probiere ich zunächst die eine Variante aus, nämlich jene, dass «vor» einen zeitlichen Bezug angibt, sodass es auch «nach» gibt, was dann die Möglichkeit enthalten könnte, dass die Erkenntnis, die darauf folgt, anders sein könnte, als in der PdF vorausgesetzt. Für mich bilden sich somit aus diesen Steinerschen Sätzen einige grundlegende Fragen, die ich im bildlichen Vergleich mit einer Pflanze als Wurzelfragen bezeichne und deren Beantwortungsversuche für das Verständnis seiner 1918 formulierten Begründung hilfreich sein könnten, falls sie mit perspektivischer und positionsoffener Anschauung begleitet und über diese hinaus durch eigenes Erforschen beleuchtet werden könnten.
Was heißt eine Erkenntnis des Geistgebietes vor dem Eintritt in die geistige Erfahrung?
Zu untersuchen wäre, wie Denken, Erkennen und Erfahren bzw. Erleben sich in Bezug auf das Geistgebiet zueinander verhalten. Eine angebliche, geistige Wirklichkeit liegt zuerst jenseits des Weltbilds, das ich mit dem normalen Tagesbewusstsein hervorbringe. Wie kann ich also überhaupt etwas erkennen, was mir in der Erfahrung und dem Erleben noch unbekannt ist? Variationen dieser Frage habe ich in meinem Buch, Weisheit wahrnehmen12 (Ww, 2014), gestellt und behandelt. Sie werden nun von mir zusammengefasst zu der Frage: Wie kann ich von den abstrakten, nur gedachten Begriffen zum Erleben des geistigen Horizonts der Ideen kommen?
Dabei habe ich zu berücksichtigen, dass ich Gefahr laufe, mich zum Sklaven der Idee von einer geistigen Welt zu machen, wenn ich sie nur abstrakt denke und nicht konkret erlebe.13 Diese Phänomene treten uns in den verschiedenen Ausformungen des religiösen oder ideologischen Fanatismus entgegen, wenn bestimmte Ideen zu Intoleranz und Terrorismus führen. Die Ideen sind dann nur intellektuell und oft zwanghaft übernommen und werden in ihrem ganzen Gedanken- und Gefühlsreichtum nicht selbständig erlebt und erkannt.
Aus dieser ersten ergibt sich folgerichtig die zweite Wurzelfrage, die sich notwendigerweise auch stellen muss bei der heutigen Einordnung von Steiners Biografie und Gesamtwerk in die Philosophie-, Kultur- und Kunstgeschichte:
Was heißt eine Erkenntnis des Geistgebietes nach dem Eintritt in die geistige Erfahrung?
Etwas Erfahrenes lässt sich selbstverständlich im Nachhinein weiterverfolgen. In meinem Erkenntnisprozess kann ich nachvollziehen, wie sich das Vorher vom Nachher unterscheidet und was sich wahrnehmbar verändert hat durch meine Erfahrung.