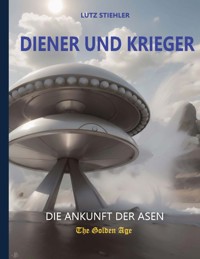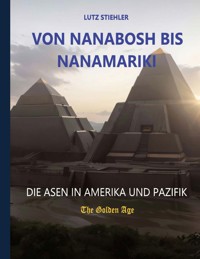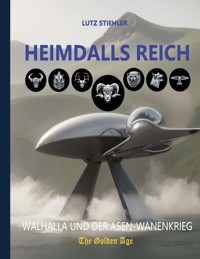
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Die Asen-Clans im Totenreich
- Sprache: Deutsch
"Heimdalls Reich", der dritte Teil der Buchreihe The Golden Age erzählt von der Ankunft einer neuen Kriegerkaste in Europa unter Anubis, der mit Heimdall identisch, den Kampf gegen Ninurtas Kar-Kriegerkasten aufnahm. Heimdalls Kriegerkaste wurde weltweit Kama genannt und hatte nicht nur in Europa Spuren während des Asen-Wanenkrieges hinterlassen. Das setzte sich fort bis zu ihren Nachfahren, die das Andenken an sie in ihren Mythen bewahrten. Auf den Asen-Wanenkrieg bezogen, standen die Kama für die Asen und die Wanen für die Kar-Kriegerkasten. Die gleichen Asen stehen in Indien für die Asuras und die Wanen für die Suryas. Der Asen-Wanenkrieg beschränkte sich also nicht nur auf Europa. In diesem Buch werden nicht nur die Hintergründe dieses Krieges beschrieben, sondern noch seine Auswirkungen bis in unsere heutige Zeit. Es deckt auf, was der Begriff Germanen wirklich bedeutet und welche Stämme in Europa von den Wanen und Kama abstammen. So haben ihre Clans verschiedene Totemtiere verehrt, die als Wächter mit den Schöpfungsorten ihrer Ahnen verbunden sind. Auch Walhalla stand für einen dieser Schöpfungsorte, um die im Asen-Wanenkrieg gekämpft wurde. So kamen aus dem mythischen Walhalla eben keine "wiedererweckte Helden", sondern es wird von bis zu tausendköpfigen Ahnenkontingenten aus den Schöpfungskammern "Nannas" erzählt. Ihre Nachfahren tragen bis heute alte tierische Familiennamen, die bisher falsch interpretiert, sich nicht von Waldtieren ableiten, sondern bestimmte Totemtiere aus dem Goldenen Zeitalter benennen. Es sind also zuerst reine Zuordnungsnamen gewesen und damit die ältesten Namen der Deutschen, bevor vor ca. 800 Jahren die ersten Vornamen aufkamen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 765
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort
Die Asen auf Hyperborea
Hyperborea und die Britischen Inseln
Taranis mit dem Sonnenrad
Cernunnos der gehörnte Ase
Das Zeitalter des Löwen
Sakar vor Sakkara - Kar-Kriegerkasten am Nil
Himmelsscheiben über dem Nil
Der Schwarze Schakal
Anubis auf „Nanna“
Die Welt der Viraj (Wera)
Veera Mahendrapuri
Die Kama und das Ungeheuer Kampe
Die Wera in Europas Kar- und Kama-Kriegerkasten
Die Wera zur Asenzeit
Var - Die Wächterin an der Weichsel
Von vermeintlichen und tatsächlichen Wera-Clans
Die Alauni und Anauni
Camulus und die Wera-Clans in Westeuropa
Das Hama-Namensphänomen
Intarabus und Vosegus im Rheinland
Die Kama an den Ufern des Rhenus
Die Kama zwischen Ems und Oder
Heimdalls Beinamen Regin und Irmin
Im Katzenreich - Kata-Clans zwischen Saale und Oder
Im Ganaland - Katzenorte zwischen Elbe und Erzgebirge
Ingwio und die Herkunft der Alamannen und Langobarden
Der Hohenstaufen als megalithischer Kultberg
Ingwios und Heimdalls Namenserbe aus der Asenzeit
Die Sphären der Asen
Walhalla und die Kama-Kriegerkaste
Walhalla als Dilmun der Asen
Die wanische Herkunft der Veneter
Die Kama in den Ostalpen
Heimdall und die Noriker
Heimdalls Krieg
Katz, Kitz und andere tierische Familiennamen
Der Garda- und Iseosee als Dilmun-Standort
Arallu unter Heimdall
Hessen - Im Land der Hasuarier
Pachtgebiet Katzenbach
Katzenbuckel - Gräberfelder und Clansitze
Heimdall als Perun
Heimdall und die Wanen in Skandinavien
Als Brutus den Riesen Alebion tötete
Heimdalls Präsenz auf den Britischen Inseln
Gallien unter den Kama
Heimdall als gallischer Lugus
Bran und der Rabe als Seelenvogel
König Lot und der Schlangenhügel von Schottland
Die Kama im Rhonetal
Carnia - Die Wanen Venetiens
Wanische Gründermythen
Wanen und Kama nordöstlich der Seine
Heimdall und die Lugier
Im Reich des weißen Ebers
Heimdall in Iberien
Mondgott Armazi und die Asen an der Kura
Das Erbe der Wanen
Das Bärengau an der Zaber – Die Zimbern
Das Erbe der Kama
Im Wolfsland
Heimdalls Identität als Widdergott
Mittelerde in Deutschland – Die Zwergenwelt
Anhang
Buch-Cover: „Nanna“ als Walhalla im Bodensee mit Totemtiersymbolen
VORWORT
Das 4. Jahrtausend v.Chr. gehörte zweifellos zum Goldenen Zeitalter, in dem die Asen weltweit Ahnenkontingente aller vier Menschenstämme über die Erde verteilten. Es war zugleich jenes, in dem größtenteils Anu (Osiris) als zweiter Asenherrscher über die Erde herrschte. Dieser weltweite Hintergrund wird heute etwa dadurch bestätigt, dass man inzwischen Pukará-Artefakte am Titicacasee entdeckte, die spektakulär mit sumerischen Schriftzeichen bedeckt sind. Und Anus Herrschaft hatte es in sich. So war Ninurta noch immer weltweit beschäftigt mit seinen Kar-Kriegerkasten aufständische Kata-Clans zu unterwerfen. Selbst Anu beteiligte sich an diesen Kämpfen mit seiner Himmelsscheibe „Pushpaka“, die in allen Erdteilen verglaste Brandstätten hinterließ.
Während Ninurtas Kriegerkasten so die Oberhand gewannen, hatte der als „arrogant“ überlieferte Asen-Herrscher (Asari) es gewagt durch sein eigenes Verhalten gegenüber seiner Mutter Inanna alle anderen kosmischen Asen-Clans gegen sich aufzubringen. So geht auf ihn und seinem altägyptischen Charakter Osiris der weltweit bekannt gewordene Inzest mit seiner Mutter Inanna zurück, die in Ägypten mit Nephthys identisch ist. Es ist zugleich nicht ihr einziger Name, unter dem Inanna am Nil wirkte, doch nur als Nephthys steht sie für das mythische Motiv des Inzests eines Weltherrschers, der seine eigene Mutter verführte oder vergewaltigte. Das Ergebnis dieses Inzests war die heimliche Geburt von Anubis, der im frühen 4. Jahrtausend v.Chr. die Weltbühne betrat und die längste Zeit an der Seite seines Vaters stand. Auf ihn geht noch ein weiteres Mythenmotiv zurück: In Schande geborene Kleinkinder wurden im Korb in einem Fluss ausgesetzt und von einer anderen Frau gefunden und großgezogen.
Anders verhält es sich bei Ninurta, der mit dem Seth Altägyptens identisch, diesen Inzest an seiner Gemahlin Inanna (Nephthys) rächen wollte. Nicht mehr bereit, die Kata-Clans für Anu zu unterwerfen, stagnierte dieser Krieg und es begann eine Phase der Konsolidierung im Interesse Ninurtas, der nun begann sein eigenes irdisches Reich zu errichten. Seine Asen-Clans dienten nur noch seinen eigenen Plänen. In Europa war das zugleich jene Zeit, wo man begann die Kar-Kriegerkasten als Wanen zu bezeichnen und Ninurta dort hauptsächlich als Yngvi und Freyr auftrat.
Die nach Alalus und Ištars Tod wieder vereinten kosmischen Asen-Clans zerfielen wieder in zwei Lager und es begann unter den menschlichen Asen-Clans ein Stellvertreterkrieg auf der Erde. Auf der einen Seite standen die wanischen Kriegerkasten Ninurtas und auf der anderen die noch nicht unterworfenen kastenlosen Kata-Clans, denen sich jetzt Anubis annahm und nachfolgend für die Stärkung ihrer Wehrkraft eine eigene Kriegerkaste auf „Nanna“ erschuf. Diese wurde weltweit unter dem neuen Namen Kama bekannt und übernahm als neuer militärischer Arm den Schutz, der noch nicht unterworfenen Kata-Clans, worauf diese sich in Alteuropa stabilisieren konnten. Später begannen sie in allen Weltregionen die Kar-Kriegerkasten zurückzudrängen und selbst ein Reich zu errichten. Diesen Krieg führte Anubis nicht nur unter seinen Wächternamen Heimdall, sondern noch unter anderen Namen, wie etwa Gullinkambi, der als Krieger erweckender Hahn von Walhalla bekannt wurde.
Während dieser Zeit hatte Anubis weltweit weitere Beinamen hinterlassen, so als Kamadeva oder als Hanuman in Indien, als Ra (Re) und Thot in Ägypten oder als Hermes in Griechenland. Doch es gab auch herbe Rückschläge, denn dieser Krieg im unwegsamen Gebiet war für keine Seite einfach. Ninurtas Reich wurde in Europa noch als Vanaheim bekannt, was dem heute diskutierten „Reich der Veneter“ entsprach.
Zu dieser kriegerischen Zeit unterstand „Nanna“ hauptsächlich Nanše (Isis) und Anubis und hinterließ weitere heute bekannte Beinamen über Götterinseln oder Götterorte auf natürlichen Inseln. Hierzu gehörte vor allem Walhalla als vermeintlicher Wiedergeburtsort gefallener Helden, was in Wahrheit von in „Nannas“ Schöpfungskammern künstlich erschaffenen Kriegerscharen erzählt. Walhallas Bekanntheit resultierte aus seinen wechselnden Standorten vor Europas Küsten und in Alpenseen, wie dem alten Rheintal-Bodensee. Denn hinter Walhalla als ausgeschmückte „Trinkerhalle“ stand nur „Nannas“ Funktion als Soma-Quelle der Asen. Ihre im Inneren befindlichen Schöpfungskammern gingen dagegen in den Mythen als elitärer Treffpunkt von Asen, Walküren und Gullinkambis widererweckte Krieger ein. Das himmlische Gegenstück von Walhalla war natürlich die zu einem Dilmun gehörende Himmelsscheibe, mit der sich besonders einäugige Asen (Götter), wie Odin oder Balor verbinden.
Odins unmittelbare Begleittiere, zwei weiße Raben und zwei weiße Wölfe, symbolisierten zur Asenzeit die unmittelbaren Angehörigen seines Familien-Clans und hatten einen erheblichen Anteil an der Familiennamensbildung im deutschen Sprachraum. In „Heimdalls Reich“ geht es also noch um Identität, welche Familiennamen für welche Clans stehen. Und das betrifft besonders fast alle tierische Familiennamen, die auf weiße Totemtiere zurückgehen.
Zu den ermittelten griechischen Beinamen von Anubis gehören nicht nur die bereits erwähnten Hermes und Thot, sondern sogar der Titan Hyperion, nach dem sein nordisches Reich Hyperborea benannt wurde. Darauf kommt man, wenn man von diesem Namen etwa Perun oder Perseus ableitet und so systematisch seinen Wirkungskreis abstecken kann. So erzählt Hyperion als „Titan des Ostens“ hauptsächlich von der Präsenz des Anubis in Asien, wo er weitere Götternamen hinterlassen hat. Über sie können wir verstehen, dass sich hinter „Hyperions Kinder“ nur seine weltweit kämpfenden Kama-Kriegerkasten verbergen und der angebliche Tod seiner Kinder, von einem letztlich verlorenen Krieg im 4. Jahrtausend v.Chr. erzählt: Der Asen-Wanenkrieg. Und da sich die Kama weltweit nachweisen lassen, ist dieser Kampf sogar ein vorzeitlicher Weltkrieg gewesen. Selbst auf griechischem Gebiet lassen sich die Kama zurückverfolgen, wo „Nanna“ als ihr Schöpfungsort längere Zeit als negativ besetztes weibliches Seeungeheuer „Kampe“ bekannt war. Man bezieht dieses weibliche Wächterwesen heute auf Tiamat oder Enchidna, die sich wiederum auf Ištars „Nanna“-Dilmun und deren weltweit gefürchtete Himmelssäulen als umgedeutete Schlangenmonster beziehen. Ungeklärt ist nur ihr Name, der variantenreich in vielen Toponymen der Erde zu finden ist und die Wortwurzel für Kampf und Kämpfer ist. Es wird also nichts anderes als eine Kriegerkaste aus dem „Nanna“-Dilmun beschrieben.
Anubis, der in Indien nicht nur mit Kamadeva identisch ist, lässt sich dort auf die weibliche Rindergöttin Kamadhenu beziehen, die als geflügelte Kuhmutter mit Surabhi gleichgesetzt, wiederum mit „Nanna“ identisch ist. Unter diesem Namen ist sie jedenfalls als „Krieger produzierendes“ Wesen bekannt geworden, mit denen in Indien ganze Heere aufgestellt wurden. Mit ihr verbinden sich eine große Anzahl von Überlieferungen, doch nur jene in denen sie als Kamadhenu erwähnt wird, erzählt aus einer Zeit, in der Anubis um die Weltherrschaft seiner Krieger-Clans kämpfte. Wo die Schlachten dieses Krieges stattfanden, wie lange dieser Krieg andauerte und welchen Ausgang er nahm, beantwortet nur die Vergleichende Mythologie. Bekannt ist jedenfalls, dass die Wanen siegten, doch danach einem überaus seltsamen Waffenstillstand zwischen den Fraktionen zustimmten: Freyr herrschte als Wane über die Kama (Asen) und die Asen über die Wanen.
Die Frage dieses Buches ist also, ob von diesem Krieg noch andere Mythologien erzählen und wenn ja, welche Details ihm noch zugeordnet werden können. Wegen den weltweiten Dimensionen dieses Konflikts konnte eine große Anzahl von Bezügen ermittelt werden. Sie offenbaren einen Abschnitt des Goldenen Zeitalters, dessen Auswirkungen bis in unsere Zeit reichen. Damit meine ich die identitäre Ahnenforschung mit bisher völlig falsch gedeuteten Stammesnamen in Europa, was erhebliche Auswirkungen auf die Familiennamensforschung hat. Insgesamt betraf dieser Krieg alle Hochkulturen des 4. Jahrtausends v.Chr., wo die wenigen auf der Erde agierenden Asen, die meisten ihrer Beinamen hinterlassen haben. Viele dieser Beinamen sind objektbezogen, beschreiben wie schon in „Diener und Krieger“ nur technische Details der Dilmun-Technologie, während die Bezüge zu bestimmten Asen nur ihre zeitweiligen Besitzstände unter den Dilmun-Systemen widerspiegeln.
Neben den weltweiten Kriegen der Kama-Kriegerkasten, wird in diesem Buch noch dem Rätsel nachgegangen, warum noch weit ältere Eigenbezeichnungen für „Menschheit“ existieren und wer sie verwendete. Der Begriff Mensch ist schließlich nur eine relativ jüngere Bezeichnung, die über das indogermanische *manus auf dem „Stammvater der Menschheit“ Manu alias Marduk zurückgeht. Noch älter sind die Eigenbezeichnung als Wa (Japan, Südamerika), Wu (China) und We (idg. *ŭ̯) im indogermanischen Sprachraum (Eurasien), die sich jeweils auf die ersten bekannten Urvölker beziehen lassen. Dieser globale Zusammenhang wurde speziell für Europa noch nicht erkannt, obwohl sich in einer späteren Variante jenes Wer und Wera (in Indien Vera) ableitet, auf die sich noch Beinamen von Ištar und Alalu beziehen. Es lässt somit relativ einfach nachweisen, dass sich europaweit die Bevölkerung lange Zeit nur als We oder Wera bezeichnete, wovon sich zum Beispiel noch das Gemeinschaftswort „wir“ und das Fragewort „wer“ ableitet. Das ist aber noch lange nicht alles, denn ausgerechnet uralte Flussnamen, wie in Deutschland die Werra beziehen sich noch heute auf diesem Hintergrund. Ein Name, der nur von den früheren Bewohnern an der Werra als Namensgeber hinterlassen wurde. Gleiches gilt für die indische Halbinsel Kathiawar, die das Kathi-Volk als frühere Kata-Clans identifiziert. Und diese haben sich selbst nur als We oder Vera verstanden. Der Name Wera wurde womöglich aus einem bestimmten Grund um die Silbe „ra“ ergänzt. Denn wie es scheint, ist damit Anubis als Ra (Re) gemeint, der unter gleichem Namen noch im Pazifik als Sonnengott bekannt war. Seine Variante Re lässt sich sogar mit einem Beinamen von Heimdall verknüpfen, der als Regin für einen Asen steht, nachdem sogar die Ostseeinsel Rügen benannt wurde.
DIE ASEN AUF HYPERBOREA
Wie keine andere vorzeitliche Region Europas, hat man das altgriechische Hyperborea mit einem Nordland gleichgesetzt, in dem man die merkwürdigsten Völkerschaften vermutete. Nur wenige Reisende wagten im frühen 1. Jahrtausend v.Chr. den Weg nach Norden, wo sie sich von den Bewohnern das Land erklären ließen. Begriffe wurden ausgetauscht, die in Lautsprache den Weg zu den Gelehrten ihrer Länder zurückfanden. Lag man bei der Interpretation der Begriffe noch fern der Wahrheit, können ēdoch diese überlieferten Namen heute helfen, die Asenzeit Eurasiens weiter aufzuhellen. Von den hellenischen Gelehrten der Antike wurde der bereits veraltete Name Hyperborea nur noch allgemein mit einem nördlichen Land gleichgesetzt, über dessen Beschaffenheit man nur wenig wusste. Zumindest verortete man dieses Nordland bis in jene Regionen, die regelmäßig im Schatten der Polarnacht verschwanden.
Nach Herodot eher im Nordosten Eurasiens gelegen, gehörten die sogenannten Arimaspen zu den Bewohnern Hyperboreas, die angeblich ihr Gold durch „Greife“ bewachen ließen. Ihnen kann ein fast gleichlautendes Volk der Arimphaei zugeordnet werden, das auf Hyperborea „jenseits der Riphäen in Lytharmis am Fluss Karambukis lebte.“ Mercator hatte den Karambukis mit dem westsibirischen Ob identifiziert, woran man sehen kann, dass der Begriff „Hyperborea“ kontinentale Dimensionen erreichte und allgemein sich in nordöstlich-östliche Richtung ausbreitete. Da der Karambukis in die Karasee mündet, könnte es durchaus der älteste Name des Ob sein. Seine uralischen Namensvarianten „As“, für „Großes Wasser“, oder „Ema“, das im Indogermanischen mit „Ama“ für „Mutter“ steht, verweisen zugleich auf seine Rolle, wonach er als ergiebige Süßwasserressource den Asen-Clans gedient haben könnte. Der Flussname Ob beginnt heute erst nach dem Zusammenfluss der Flüsse Bija und Katun, wobei letzterer Name bereits aufzeigt, welche Clans ursprünglich an diesen Flüssen siedelten.
Kata-Clans überraschen zudem in Sibirien nicht wirklich, wenn wir an inzwischen entdeckten Megalithanlagen denken, für dessen Errichtung nur weltweit sie und ihre Nachfahren in Frage kommen. Dazu begegnen uns auffällige Ortsnamen, wie Kamen, dass angeblich nach einem Bergrücken benannt ist, oder die Kamenka als Nebenfluss des Katun, der selbst wieder in der südsibirischen Katun-Kette nahe dem 4506 m hohen Kadyn-Bajy (Belucha) entspringt. Sie deuten nach meiner Meinung bereits auf einen Zusammenhang, zwischen Kata-Clans und den später erschienen Kama-Kriegerkasten hin, womit alle diese Namen in der Asenzeit wurzeln. Der Kadyn-Bajy ist gleichzeitig der höchste Berg Sibiriens, welcher mit seinen Beinamen Uch Sumer als „Dreiköpfiger“ noch einen auffälligen Bezug zu den früheren Su-Clans und Alalus Beinamen Sumali oder Sumé hat!
Offiziell will man bisher Katun von „Kadyny“ für „Dame“ oder „Herrin“ herleiten, was durchaus vermuten lässt, dass südsibirische Kata-Clans mit dieser „Frau“ ihre Muttergottheit meinten und so mit Ištar identisch wäre. Nach einer Legende war es der Name der Tochter des „Khans Altai“, die dem Katun abwärts, dem Heer ihres Vaters entkommen konnte. Dazu passt, dass der Historiker Kadnikov die Region zwischen den Flüssen Katun und Bija für ein vorzeitliches Kriegsgebiet hält, wo in einer apokalyptischen Schlacht „die guten Kräfte“ gegen „das Böse“ kämpften. Auf Flussnamen, wie den nahen Karasulk bezogen, könnte man also durchaus annehmen, dass das seit der Altsteinzeit besiedelte Sibirien zwischen den Kata und den Kar umkämpft war. Gehörte dieses Sibirien zu Hyperborea, darf an dieser Stelle hinterfragt werden, wer zu dieser Zeit die Kata-Clans gegen Ninurtas Kar-Kriegerkasten führte und welche Seite damals als „gut“ oder „böse“ galt. Einer Idee folgend, könnte Hyperborea in erster Linie nach Hyperion, dem „Titan des Ostens“ benannt sein, dessen altgriechischer Name wiederum für Anubis stehen könnte.
Der sogenannte „Hyperboreische Ozean“ wurde auf älteren Karten für den nordwestlichen Atlantik verwendet, obwohl er nach Herodots Karte keinerlei Verbindung zum eurasischen Hyperborea besaß. Heute wissen wir es besser, denn mit dem Arktischen Ozean gleichgesetzt, grenzt er an allen Nordländern der Erde. Welche noch zu Hyperborea gehörten, konnte nicht einmal Herodot angeben. Gehen wir nach der römische Bezeichnung Hibernia für Irland und Nordschottland, könnten zumindest die Britischen Inseln gemeint sein. Obwohl Herodot keine genauen Ortsangaben über Hyperborea finden konnte, muss es wenigstens einen Grund gegeben haben, dass er dieses Land in den fernen Nordosten Eurasiens verortete. Spätere Gelehrte, wie Plinius hielten weiter an dieser Vorstellung fest, selbst wenn er nur noch den Tanais (Don) als Grenze ansah, hinter dem Hyperborea beginnen würde! Heute kommt dafür nur Sibirien in Frage, dessen namentliche Herkunft bisher nicht geklärt werden konnte. Aktuell wird vorgeschlagen, dass es ursprünglich aus „Su“ für Wasser (!) und „bir“ für „wildes Land“ zusammengesetzt wurde. Weist das aber nicht auf die Su-Clans der Asenzeit hin? Denn wenn „bir“ mit dem mehrdeutigen indogermanischen *bher identisch ist, werden zwar „Glänzende“ genannt, doch es kommen eher Widder und Eber als weiße Totemtiere in Frage, die noch auf Heimdall und Yngvi (Freyr) weisen.
Bleiben wir in Sibirien, finden wir mit der Karasee einen Meeresnamen in der Arktis, der sicher noch der Asenzeit entstammt. Sie befindet sich genau dort, wo Herodot sein Hyperborea beginnen lässt. Man darf deshalb zu Recht annehmen, dass die Karasee noch für weit größere Bereiche des Polarmeeres verwendet wurde. Alle weiteren umliegenden Nebenmeernamen sind ohnehin nur neuerer Herkunft. Noch weiter nordöstlich könnte sich hingegen ein Name erhalten haben, der das Polarmeer nach den ersten Kata-Clans benannte. Er befindet sich in der Laptewsee (nach einem Forscher benannt), in die ein Chatanga genannter Fluss mündet. Dass sich sein Name auf frühere Kata-Clans bezieht, bestätigt sein Quellfluss Kotui, der am 1701m hohen Berg Kamen entspringt! Damit haben wir in Sibirien erneut einen Kamen-Namen gefunden, der in Zusammenhang mit einem Kata-Namen stehen könnte.
Für den überlieferten Ort Lytharmis gibt es heute an den Ufern des Polarmeeres nur recht wenige Hinweise. Im Mündungsgebiet des Karambukis (Ob) auf den flankierenden Halbinseln Jamal und Gydan wurden bisher keine verwertbaren Artefakte gefunden, die auf eine vorzeitliche Stadt verweisen. Das einzige bemerkenswerte Dorf ist dort unter den Namen Jar-Sale bekannt, was wenigstens auf das weltweite Himmelsbaum-Phänomen namens „Sal“ verweisen könnte. Von ihm wurde ein mythisch behafteter Raumbegriff als Saal abgeleitet, der in der Regel mit einem Dilmun vor den Küsten verknüpft ist. So befindet sich das Nenzendorf Jar-Sale ausgerechnet am Mündungsarm Chamamelskaja, der die zweite global auf der Erde agierende Kama-Kriegerkaste benennt und indogermanisch (*mel) auf einen mythischen Mühlenort verweist. Dass diese Kriegerkaste aus „Nanna“ stammt, lässt der Stammesname der Nenzen erahnen, der heute nur noch für Menschen als Selbstbezeichnung verwendet wird. Doch anders vokalisiert, weist er als „Nansin“ auf eine Herkunft aus der Asenzeit, wozu noch ihr älterer Name Samojeden passt. Dieser wird eher ein Soma bezogener Eigenname sein, als das er wie früher vermutet, für Kannibalen steht.
Nach ihren Mythen stammen die Clans der Nenzen von Riesen und Menschenfressern ab, die in der Regel ihre Frauen vergewaltigten und töteten. Doch bisweilen überlebten einige Frauen, die schließlich „übermenschliche Wesen“ in die Welt gesetzt hätten. Ihre oberste Gottheit Num wird mit Himmel übersetzt und soll die Erde erschaffen haben, was durchaus von einem teilbaren Dilmun-System erzählen könnte. Das lässt sich noch mit den Namen des Totengottes Nga bestätigen, der als sein Sohn gilt. Auf die Asenzeit Altägyptens bezogen, könnte somit Nga mit Anubis assoziiert werden, während Num für Osiris (Anu) stehen würde. Nga könnte sogar einer altindischen Naga entsprechend, von einer schlangenförmigen Himmelssäule aus Soma erzählen. Stand also Lytharmis für einen Dilmun-Standort vor dem Karambukis?
Wenigstens einmal hat man Lytharmis nach Norwegen verortet, wobei es sich um die Region am Nordkap handeln soll. Bleiben wir deshalb am Karambukis, der weiter flussaufwärts durch steinzeitliches Siedlungsgebiet fließt. Da das altnordische Wort „ārminni“ für Flussmündung steht, wissen wir vielleicht, wo wir Lytharmis suchen müssen. Dabei könnte es sich sogar um einen Ort handeln, wo ein größerer Nebenfluss in den Karambukis fließt. Welche Funktion dieser Ort hatte, könnte „lyth“ erklären, wenn wir es vom altnordischen „liða“ herleiten. Es wird mit „in Ordnung bringen“, „beugen“ oder „sterben“ gedeutet, was durchaus für einen Richterort spricht. Germanisch von „lud“ hergeleitet, wird jedoch von etwas Emporwachsenden erzählt, was einer Himmelssäule der Asen vor dem Karambukis entsprechen könnte. Das germanische „luþra“ steht zudem für einen Gefäßnamen als Trog, was die Karambukismündung als Dilmun-Standort ausweisen würde.
Die Katun-Kette mit dem 4506 m Kadyn-Bajy (Uch Sumer).donyadetochka, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-4.0
Könnte die alte Oasenstadt Bukhara (Buḫārā) eher einen früheren „Wohnort der Kar“ beschreiben? Immerhin wurde es zuvor Numijkat genannt, was auf Kata-Clans und der obersten Nenzengottheit Num im mittelasiatischen Zweistromland weist.Atilin, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0
Insgesamt gesehen, würden damit alle an den Karambukis verortete Völkerschaften Nachfahren früherer Ahnenkontingente sein und sämtlich „Nanna“ entstammten. Räumlich gesehen, trifft das auf die Arimphaei als Clan-Abkömmlinge zu, die nach Plinius mit Herodots Argippaioi identisch sind. Als nicht sesshafte Nomaden, die hauptsächlich von der Schafzucht lebten, sollen sie zuerst am Fuße hoher Berge gesiedelt haben, die sich wegen der Erwähnung der Sauromaten im südlichen Ural befanden. Es könnte zugleich jenes Riphäen-Gebirge sein, wo die Arimphaei verortet wurden. Weil beide Völkernamen mit „ar“ beginnen, werden ihre Vorfahren örtlichen Asen-Clans angehört haben, die wegen des Flussnamens Karambukis sicher einer Kar-Kriegerkaste unterstanden. Westsibirien wird demnach zwischen dem Südural und dem Altai zuerst den Kata-Clans gehört haben, bis sie sich mehrheitlich später vordringenden Kar-Kriegerkasten beugen mussten.
Als Ankunftsort uralischer Kar-Kriegerkasten kommt der Aralsee in Frage, der vor Jahrtausenden nicht nur wesentlich größer war, sondern zuerst lange zum Kaspischen Meer gehörte. Über mittelasiatische Dilmun-Standorte habe ich schon in „Diener und Krieger“ berichtet und auch dass die Asen bevorzugt das Mündungsgebiet des Amudarja (Oxus) aufsuchten. Als „Nanna“ („Sakar“) im 5. Jahrtausend v.Chr. vor der Donau stand und Kar-Kriegerkasten nach Südosteuropa vordrangen, wird dieser Dilmun zuvor noch den Aralsee aufgesucht haben, wo er eine recht erfolgreiche Kar-Kriegerkaste absetzte. Aus ihrer Herrschaftszeit über Mittelasien lässt sich zwischen Altai und Syr Darja noch die Herkunft der Karluken ableiten, die zu den Vorfahren der Karachaniden und Kara-Kitai gehören. Die Karluken sind jedoch namentlich von „Kar-lik“ abgeleitet, was türkisch „Schneehaufen“ bedeutet. Größer gedacht könnte deshalb dieser „Schneehaufen“ auf dem Schöpfungsort der Karluken-Ahnen zurückgehen, es macht einfach keinen Sinn, einen Stamm so zu benennen. Nach dem Indogermanischen Wörterbuch kann man zudem die Wortendung „luk“ oder „lik“ von „luki“ oder „leuk“ für „Licht“ und „Glanz“ herleiten, was sogar auf Lug weisen könnte, einem westeuropäischen Namen von Heimdall.
Das Riphäen-Gebirge, das nach Sturluson das Quellgebiet des Tanais war, wurde einst von Plutarch nach Mitteleuropa verortet. Da nun der Tanais als Don angesehen wird und zudem noch auf der Mittelrussischen Platte entspringt, könnte man durchaus versucht sein, die Abkömmlinge früherer Asen-Clans sogar zwischen Rhein und Donau zu verorten. Der Don wurde also mit der Donau verwechselt. Plutarchs Riphäen wären zudem mit dem sogenannten Hercynischen Wald identisch, der die Mittelgebirge östlich des Rheins und nördlich der Donau umfasst. Die Deutungen des Namens Riphäen machen also deutlich, dass man den Begriff überall dort verwenden kann, wo man nichts über den wahren Namen wusste. Deswegen bedeutet er ableitend vom altnordischen Wort „rīfa“ nichts anderes als „Randgebirge“! Ein mehrdeutiger Begriff also, der sich entweder auf den eigenen Erkenntnisstand bezog oder als eine Art Grenzgebirge angesehen wurde, hinter dem eine unbekannte Region begann. Bei Caesar begann der Hercynische Wald im Gebiet der Helvetier, von wo er sich mindestens bis in das Gebiet der Daker nach Osten ausdehnte. Dass in diesem Wald Einhorne und knielose Elche leben sollen, belegt jedenfalls, dass die Ausschmückungen damaliger Gelehrter auf eine ursprüngliche Hirschkuhdeutung des Waldnamens basieren.
Grob beschrieben, liegt östlich des Rheins und nördlich der oberen Donau nur der Schwarzwald. Hier entspringt die nach Ištar benannte Ister, die erst ab dem 3. Jahrtausend v.Chr. Danu (=Donau) genannt wurde. Plinius erwähnte noch, dass hinter dem Riphäen-Gebirge eine Region begann, in der es beständig kalt wäre und Schnee fallen würde, bevor man nach Hyperborea kam. Vorausgesetzt, dass er dieses Wissen von Reisenden erwarb, die vom Festland nach Britannien übersetzten, könnten sie tatsächlich aus einer Winterlandschaft gekommen sein, um danach auf Britannien oder Irland ein Frühlingsklima zu erleben. Der Golfstrom macht das zwar bis heute möglich, doch insgesamt passt die kalte schneereiche Landschaft viel besser auf Sibirien.
Der Ural als Grenzgebirge und der Karambukis könnten damit als östliche Grenzregion Hyperboreas gewertet werden, vor dem in noch älterer Zeit ein flacher Meeresarm lag, der bis hinunter zum Kaspischen Meer reichte. Aus dieser Epoche blieb eine Population arktischer Robben im Kaspischen Meer zurück, die niemals über Land dieses Meer erreichen konnten. Die heutige These, wonach diese Tiere der Wolga hinabgewandert wären, überzeugt nicht wirklich, zumal das Phänomen von Süßwasserrobben mit den Süßwasserdelfinen im früheren Amazonas-Binnenmeer vergleichbar ist, dass über längere Zeit mit der Karibik verbunden war. Als sich das salzige Meerwasser im westsibirischen Tiefland nach Norden zurückzog, blieb damit eine Population arktischer Robben in einem Meer zurück, was zunehmend aussüßte. Die Robben passten sich diesem veränderten Wasser an und formierten sich zu einer neuen Unterart.
Im westsibirischen Tiefland blieb hingegen eine Sumpflandschaft zurück, die sich bis in die heutige Zeit hält und lange das Uralgebirge aus östlicher Richtung abschirmte. In umgekehrter Richtung blieben im dünnbesiedelten Ostsibirien bis heute uralte Berg- und Flussnamen aus der Asenzeit erhalten. Am häufigsten im Einzugsgebiet der Lena, die nahe dem ältesten, tiefsten und süßwasserreichsten See der Erde entspringt: dem Baikalsee. Dieser See ist heute einer der bekanntesten russischen UFO-Hotspots, über den immer wieder UFOs und im See USOs gesichtet werden. Zugleich halten sich Berichte von am See verschwundenen Menschen und es wird in neueren Berichten von der Möglichkeit gesprochen, dass Außerirdische auf dem Seegrund eine Basis unterhalten könnten. Damit sind jedoch keine x-beliebigen Aliens gemeint sind, sondern nur die bis heute aktiv über der Erde und im Meer agierenden Asen, deren spektakuläre Technologie das Militär der Supermächte narrt.
Was hat nun die Lena vorzuweisen, was an die Asenzeit vor Jahrtausenden erinnert? Die Lena, ein Name der Evenki für „großer Fluss“, passiert bereits am Oberlauf einen Ort namens Katschug, der nach heutiger Deutung für eine Flussbiegung steht. Das wird jedoch davon herrühren, dass Kata-Clans in früherer Zeit ausschließlich an Flüssen siedelten, womit der evenkische Name dieses neuzeitlichen Ortes einen viel älteren Hintergrund hat. Am Unterlauf der Lena münden jedenfalls zwei Nebenflüsse ein, deren Namen so überhaupt nicht in das Umfeld Ostsibiriens passen. Zum einen trägt einer diese Flüsse den merkwürdig deutsch klingenden Namen Linde und der andere wird Muna genannt, der an einen Dilmun erinnert. Beide Flussnamen werden nirgends erklärt, was sicher am fehlenden Hintergrund liegt. Immerhin weist Muna einen Bezug zum Mond auf, was ein Dilmun-Bezug ist. Auf die Asenzeit könnte auch die Sinyaya hindeuten, deren Name vom dem jakutischen Wort „Siine“ hergeleitet wird.
Weiter sei festgehalten, dass der Baikalsee ursprünglich über die Lena abfloss und dieser See von Flüssen gespeist wird, deren Namen sich mit diversen Mythologien verknüpfen lassen. So die Selenga, die an die griechische Göttin Selene erinnert. Sie ist mit der altägyptischen Isis und Marduks Schwester Nanše identisch. Sie war im 4. Jahrtausend v.Chr. die Geliebte des Osiris, der als Anu, der Enkelsohn von Ištar ist. Bemerkenswert ist deshalb die Angara, als Abfluss des Baikalsees. Im Einzugsgebiet der Selenga wurde mittlerweile ein uraltes Siedlungsgebiet nachgewiesen, weswegen der Flussname wesentlich älter sein muss, als die bisherigen Herleitungen aus dem Mongolischen oder der Sprache der Evenki. Die mongolische Herleitung von „seleh“ für schwimmen, weist immerhin auf das globale Salbaum-Phänomen, was von der Somaabschöpfung der Asen erzählt. Für die Selenga als russische Namensversion, wäre das ein Hinweis, dass vor ihrer Mündung im Baikalsee sicher ein Dilmun stand.
Das älteste Volk am Baikalsee ist tatsächlich das der Evenki, die in der Mongolei noch Khamnigans genannt werden. In ihrer Glaubenswelt, dem „Eisernen Schamanismus“ spielen hauptsächlich mythische Vögel als Helfer der Schamanen eine Rolle. Sie werden auf schmiedeeisernen Gehängen dargestellt, was ein Hinweis sein kann, dass sich hinter diesen Vögeln nur geflügelte Wächter der Asenzeit verbergen. Die Evenki gelten zudem als Nachfahren der Khitani, die wieder mit den Kara Kitai (Karakitai) verbunden sind. Letztere haben längere Zeit über größere mittelasiatische Gebiete geherrscht und damit jene, die man Hyperborea zurechnen kann. Die Selenga-Khamnigans nennen sich jedenfalls noch Khatakin oder Katagin, womit wir im Umfeld des Baikalsees Kata-Clans nachweisen können. Ein ursprünglich großer Kata-Clan am Baikalsee weist namentliche Bezüge zu Kar-, Kama- und Ki-Kriegerkasten auf, weshalb das gesamte Seegebiet einst umkämpft gewesen sein muss. Diese Region könnte somit ohne Zweifel als das eigentliche Herz von Hyperborea angesehen werden, selbst wenn davon griechische Gelehrte nie etwas erfahren haben. Gleiches gilt für die Entdeckung der gewaltigen Megalithstätte Gornaya Shoria im Altai im Jahre 2014. Aus chinesischer Sicht könnte sie sogar für den in Chinas Westen verorteten Göttersitz Kunlun stehen, der somit ein Machtzentrum Hyperboreas gewesen sein könnte.
HYPERBOREA UND DIE BRITISCHEN INSELN
Nach dem Ende der Asenzeit war Hyperborea für Diodor eine Insel, die Apollon alle 19 Jahre besuchte, um von einem größeren kreisförmigen Tempel eine angeblich bestimmte, zyklisch wiederkehrende Sternenkonstellation zu beobachten. Für einen solchen Mythos gibt es aber keinerlei Belege, zumal vom hier benannten Stonehenge nur die regelmäßige Flugbahn einer Himmelscheibe beobachtet wurde, die aus westlicher Richtung Stonehenge überflog (siehe „Diener und Krieger“). Weil die Mehrheit der Bewohner auf der „Kithara“ spielte, hatte Diodor sie nach diesem Saiteninstrument benannt. Es verweist wegen des Ki-Bezugs zugleich auf den letzten Asenweltherrscher (Asari) Marduk, dessen ihm unterstehende Krieger-Clans als letzte über Britannien herrschten. Vom Namen „Kithara“ hat man später die Gitarre abgeleitet, die selbst in Japan „gitaa“ genannt wird.
Spätestens um 3000 v.Chr. war die runde Megalithkonstruktion von Stonehenge aufgerichtet, an dessen Erbau sicher Kata-Kasten aus dem nahen Cadbury Castle mitwirkten. Die nur 13 km von Stonehenge entfernte Stadt Salisbury bestätigt noch als „Cair Caratauc“ oder „Caer Caradog“, dass die Anlage unter dem Regime einer Kar-Kriegerkaste (Wanen) errichtet wurde. Um auf Diodor zurückzukommen, wird das unter Karneios (= Cernunnos) geschehen sein, der später in Griechenland zu „Apollon Karneios“ verschmolz. Karneios Name lässt sich indogermanisch von „nei“ für „führen“ als „Asenführer der Kar“ deuten, womit er über Ninurta mit Enmerkar identisch ist. Seine Präsenz über Hyperborea dürfte zugleich der Hauptgrund gewesen sein, weshalb Stonehenge errichtet wurde. So spricht tatsächlich einiges dafür, dass der erst im 3. Jahrtausend v.Chr. belegte Apollon dieses Machtzentrum erst nach seiner Errichtung übernahm. Apollon selbst wird mit dem altägyptischen Horus gleichgesetzt, der erst nach dem Tode seines Vaters Osiris (Anu) die Weltbühne der Asen betrat.
Diodor, der von einem regelmäßigen Besuch Apollons berichtet, wusste sogar, dass Apollons von Schwänen gezogenen Himmelswagen aus südlicher Richtung nach Stonhenge flog, was sich ebenfalls nicht mit dem natürlichen Lauf der Sonne erklären lässt. Wer also denkt, dass sich ein Sonnengott entsprechend nur der Sonne von Ost nach West über den Himmel bewegte, liegt ohnehin falsch. Für diesen Hintergrund von Stonehenge sprechen noch die vielen Steinkreise auf den Britischen Inseln. Obwohl seit etwa 8000 v.Chr. örtliche Kata-Kasten ihre Toten im Umfeld von Stonehenge in eindrucksvollen Zeremonien verbrannten, wurden auf Britannien, Irland und in der Bretagne erst dann Steinkreise errichtet, als alle drei Asen-Habitate um die Erde kreisten. Damit sind sie erst unter den wanischen Kar-Clans entstanden, die ihre unterworfenen Kata-Kasten für die Errichtung ihrer megalithischen Ahnenkultanlagen einsetzten. So etwa für die vielen Dolmen an den Küsten Westeuropas.
Am Beispiel der Steinkreisanlage von Avebury, die nur 40 Kilometer nördlich von Stonehenge liegt, bekommen wir noch einen Hinweis, aus welchem Grund er errichtet wurde. Aus dem Altenglischen von „āw-a“ für „Immer“ und „bur-a“ für „Geburt“ hergeleitet, offenbart er recht deutlich, dass die Steinkreise örtlicher Clans mit dem Glauben an die Wiedergeburt verknüpft sind. Für die Seelen verbannter Asen käme als Ort ihrer Wiedergeburt nur ein Asen-Habitat in Frage, doch was stellte die Wiedergeburt für die von ihnen selbst erschaffenen Menschen dar? Als vorbestimmtes Dienervolk sind sie immer nur für die Erde als ihre Untertanen bestimmt gewesen, wo sie körperlich den planetaren Gegebenheiten angepasst wurden. Deswegen wird der Glaube an eine Wiedergeburt eher einem irdischen Hintergrund entstammen und zwar von jenen Schöpfungsorten aus, von wo die ersten menschlichen Ahnenkontingente die Erde betraten. Das wiederum geschah aus dem „Nanna“-Dilmun heraus, dessen kuppelförmiges rundes Äußeres auf vier Standbeinen, als megalithische Steintische (Dolmen) an den Küsten nachgebildet wurden. Umso bemerkenswerter ist ausgerechnet der größte künstliche Hügel Europas, der nur 1500 m südlich von Avebury liegend, keine menschlichen Reste beinhaltet und damit keinen Grabhügel darstellt!
Der Steinkreis von Avebury. Rein namentlich symbolisiert er einen immer währenden Geburtsort, der den Glauben an Wiedergeburt wiederspiegelt.Looneytics, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3
Der kreisrunde mit weißem Kalkstein bedeckte Hügel von Silbury symbolisiert die Kuppel eines Dilmuns, der vor dem Severn und im Ärmelkanal beobachtet werden konnte. Dabei handelte es sich vom Maßstab her nicht einmal um ein Drittel von „Nannas“ wahrer Größe. Zum Vergleich: Das ebenfalls „Nanna“ symbolisierende Newgrange in Irland misst mit seinem Durchmesser von 90 m exakt ein Fünftel des vermuteten Dilmundurchmessers. Beide Anlagen stellen zugleich den von Jürgen Spanuth gesuchten „allseits niedrigen Hügel“ dar, den er mit Atlantis verband.Swindonian, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-4.0
Silbury Hill genannt, stellt dieser Hügel bis heute ein Rätsel dar, denn was er tatsächlich symbolisiert, konnte bisher nicht zweifelsfrei geklärt werden. Wegen der Nähe zu Avebury darf für beide Anlagen der gleiche Wiedergeburtshintergrund vermutet werden, worauf auch Silburys Name hindeutet. Wiederum steht „bury“ für Geburt, doch das vorstehende „sil“ steht im Germanischen und Altnordischen für ein Band oder Seil, was den vormals weißen Hügel mit einer silbrigen Himmelssäule aus Soma (Süßwasser) verbindet. Von diesem besonderen „Himmelsseil“ ist noch das Konstrukt der Seele abgeleitet, was Silbury zu einem Ort macht, wo augenscheinlich Seelen in den Himmel gelangten. Silbury ist nicht nur ein Monument, das einen Dilmun symbolisiert, sondern auch einen Geburtsort beschreibt. Und so stand der weißer „Nanna“Dilmun immer wieder vor der Mündung des walisischen Severn, wo er als künstliche Hügelinsel für die Ureinwohner Britanniens als Vorlage für den Silbury Hill diente. Von allen heutigen Theorien über den Silbury Hill, kam nur jene der Wahrheit am Nächsten, wonach der Hügel ein „Denkmal“ für die nahe Quelle Swallow Head Spring wäre, womit wenigstens sein Bezug zum Süßwasser erkannt wurde.
An dieser Stelle kommen wir auf die jahrelange Suche des Jürgen Spanuth nach einem Atlantis in der Nordsee zurück, der in seinen Büchern eine Nordseekarte abbildete, wo das frühere Helgoland denn Namen Basilea trägt. Spanuth glaubte nahe der Insel kreisförmige Strukturen auf dem Meeresboden entdeckt zu haben, die er für einen Beleg des früheren Atlantis auf Helgoland hielt. Doch maximal wird es sich wohl nur um einen Steinkreis gehandelt haben, der in Bezug zum Namen Basileia stehend, von einem Dilmun-Standort im Elbe-Eider-Mündungsgebiet erzählt. Basileia steht noch namentlich mit Theia, der angeblichen Schwestergemahlin Hyperions in Verbindung und stellte mit ihren Kindern Helios (Himmelsscheibe), Selene (mondförmiger Dilmun) und Eos (Wächterin) insgesamt ein Dilmun-System dar. Es liegt also durchaus nahe, dass Pytheas und Timaeus um 322 v.Chr. ihr erwähntes Basilia, als Göttersitz von Theia und Hyperion im Nordseeraum ansahen. Als Insel wäre sie noch von Hyperboreer oder Phaiaken bewohnt, womit sie sich eher vor der kimbrischen Halbinsel befand, als das Britannien gemeint ist. Mag auch Solinus von einer ungeheuren Größe dieser Insel geschrieben haben, er selbst lebte erst über ein halbes Jahrtausend nach Pytheas. Für Helgoland spricht tatsächlich seine Größe, denn es war früher wesentlich größer als heute, eine mittelalterliche Karte stellt sie 40-mal größer dar, als heute und war bedeckt mit Tempeln und heiligen Stätten. Es lässt sich also recht gut untermauern, dass ursprünglich ein namentlicher Zusammenhang zwischen Hyperion und Hyperborea existiert. Daraus lässt sich wieder schlussfolgern, dass man Hyperion als einstigen Herrscher über Hyperborea angesehen hat. Das gelingt uns umso mehr, wenn wir den „Titan des Ostens“ mit weiteren Göttern gleichsetzen können, die nur von den ein und denselben Asen erzählen: Anubis. Obwohl altägyptisch, verdeutlich sein Name seine Abstammung von Anu und ist zugleich mit Osiris verbunden.
Doch zunächst zurück zur Vorzeit Britanniens, wo die Verstorbenen aller Clans meistens verbrannt wurden. In diesem Zusammenhang lohnt sich noch die Herkunft des Wortes „Kadaver“ zu erklären, was sicher von einem toten Leichnam der Kata hergeleitet werden kann. So wird heute dieser Begriff mit „gefallener Körper“ übersetzt und versinnbildlicht noch einmal die Herkunft der Kata von Schöpfungsorten aus einer anderen Welt. Wie wir wissen übersetzen die Griechen „kata“ mit Herabgefallene, weswegen sich ihre toten Körper allein hinter dem Wortteil „ver“ („aver“) verbergen. Das mehrdeutige indogermanische *u̯ er beschreibt im phrygischen sogar eine „Stadt“ oder „Schloss auf dem Meer“, wozu noch Bezüge zu einer Wasserzapfstelle, einer Wasserschlange oder auch einem Wassergefäß (Krug) kommen. Ja es ist sogar mit einem Auerochsen und dem Himmel als Himmelsstier verknüpft. Jedoch nicht, weil man Kadaver dorthin zurückbrachte, sondern dort in Schöpfungskammern „neugeboren“ wurden. Der eigentliche Wiedergeburtsglaube entstand also im Wissen um die Herkunft ihrer Ahnen und der Neuankunft weiterer Kriegerkasten. Im Allgemeinen kann man deshalb die Hyperboreer als Gefolge Hyperions interpretieren, die unter seiner Regie als neue Kriegerkaste auf „Nanna“ erschaffen wurden.
Bemerkenswert ist zudem, dass wanische Kar-Clans ein anderes Wort für Leichnam hinterlassen haben und sich im englischen „Carcass“ erhalten hat! Obwohl es hauptsächlich für ein Kar-Hügelgrab verwendet wurde, liest sich hier sogar das ferne Asenland Kasskara heraus, was weltweit zuerst von Ninurtas Kar-Kriegerkasten im malaiischen Inselarchipel unterworfen wurde.
Von den Kata-Clans rund um Cadbury Castle stammen in späterer Zeit die Catuvellaunen ab, die man heute gern aus Nordgallien stammende, den Belgern angehörende „keltische“ Stämme erklärt. Es lässt sich jedoch feststellen, dass selbst die festländischen Belger (Belgae) von Kata-Clans abstammen. Zur Zeit der römischen Invasion konnten die Catuvellaunen unter Cassivellaunus noch länger ein größeres Stammesgebiet nördlich der Themse halten. Dass ihre Vorfahren von wanischen Kar-Kriegerkasten beherrscht wurden, kann man noch dem Namen eines früheren Stammesführers entnehmen, der den Römern als Caratacus bekannt war. Gleiches gilt für seine walisische Namensform „Caradog“. Ob nun „dog“ oder „tac“, wir können wegen den Römern beides auf „Tag“ beziehen, was im Indogermanischen für „tāg“ für „Anführer“, „Anordner“ oder „Gebieter“ steht. Für Caesar waren die Catuvellaunen nur eine Allianz aus Widerständlern, obwohl der Name den Grund ihres Reichtums erklärt. So steht „vell“ im Altnordischen für „geläutertes Gold“ (ausgeschmolzenes Gold) und „vella“ für kochen und sieden. Die Catuvellaunen sind zudem für ihren Reichtum an Gold bei den Römern bekannt gewesen, was damals hauptsächlich in den walisischen Dolaucothi-Goldminen gefördert wurde. Diese befanden sich im sogenannten „Tal des Cothi“, was namentlich erneut auf frühere Kata-Kasten verweist. Beherrschender Ort der Goldregion war das heutige Carmarthen, das um „Caer Fyrddin“ herum entstanden ist. Weil „Fyrddin“ von „fyrd“ und „dini“ abgeleitet für „Lager des Feuers“ steht, wird man hier das geförderte Golderz bereits ausgeschmolzen haben, um es von Verunreinigungen zu befreien. Noch im 7. Jahrhundert nannte sich ein walisischer König „Cadwallon ap Cadfan“, weil seine Untertanen Gold eingeschmolzen haben.
Nordwestlich von Carmarthen findet sich an der Küste die Hafenstadt Cardigan und noch weiter nördlich die normannische Burganlage Caernarfon. Unweit von Cair Segeint erbaut, wird es ursprünglich eine Befestigungsanlage einer wanischen Kriegerkaste gewesen sein, die erst wesentlich später von den Römern zum Kastell ausgebaut wurde. Von den Römern „Segontium“ genannt, dürfte sich dieser Name auf die Segontiaci beziehen, die diese Region seit der Eisenzeit beherrschten. Ihr Stammesname wird mit „Menschen am Ort der Stärke“ gedeutet, was sich auf einen zeitweiligen Dilmun-Standort beziehen lässt. Die Segontiaci sind dazu ursprünglich in Kent ansässig gewesen, weshalb ihre Ahnen ohnehin einem Asengefäß (an. „kæna“) mit Himmelssäule (cantel=Stütze) entstammen werden.
Obwohl die Herrschaft wanischer Kar-Kriegerkasten über Britanniens Kata-Clans sicher eine Leidenszeit war, haben besonders in und um Wales ganze Kata-Eliten überlebt. So wurde Cardigan Castle im 11. Jahrhundert von einem walisischen Fürst Cadwgan ap Bleddyn zerstört. Dieser stammte aus dem Königreich Powys in dem schon Könige wie Cattell ap Brochmail oder dessen Sohn Cyngen ap Cadell herrschten. Der US-Historiker John T. Koch vermutete die Catuvellaunen sogar auf dem Festland rund um Châlons-en-Champagne, dem früheren Catalaunum, wo angeblich ein festländischer Teil der Catuvellaunen siedelte. Offiziell soll nach heutiger Ansicht der gallische Stamm der Catalauni hier geherrscht haben, auf dessen Gebiet die berühmte „Schlacht auf den Katalaunischen Feldern“ zwischen den Hunnen unter Atilla und weströmischen Legionen ausgetragen wurde. Doch letztlich belegen solche Stammesnamen nur, dass Alteuropa zuerst den Kata-Clans gehörte. Auf Hyperborea konnten sich die Kata ähnlich lang halten, wie in Mitteleuropa und den Britischen Inseln, was sicher Anubis als Heimdall, dem größten Kata-Führer nach Alalu und Ištar geschuldet war. Die nordschottische Region Cattenes ist früher sicher noch größer gewesen, als es die Grenzen der heutigen Caithness darstellen. So trug man das nördliche Küstenland am Firth of Yorth noch als „Cattae“ in einer älteren Britannien-Karte ein und das benachbarte Sutherland wird gälisch „Cataibh“ genannt. In welcher Variante auch immer: Vor der Ankunft von Ninurtas Kar-Kriegerkasten könnte das vorzeitliche Britannien wie Kleinasien zuerst einen Kata-Namen getragen haben.
Die frühe Asenzeit auf den Britischen InselnVorlage gemeinfreies NASA-Material von Wikimedia Commons
Als Regionalname erinnert heute nur noch Cornwall an ein Regime von Kar-Krieger-kasten, was auf eine Wallstatt (Schlachtfeld) bezogen, ein Ort ständiger Kämpfe war. Die in Bedfordshire als „Clangers“ bezeichneten Leute, will man heute nur noch von einer gleichnamigen Teigtasche herleiten. Doch bezogen auf das altenglische Wort „gǣre“ oder „gā-r“ für „Speer“, herrschte hier eher ein Clan aus Speerträgern, der sicher wanische Wurzeln hatte. Das Dorf Caddington erinnert hingegen an einem Kata-Clan im Raum Bedfordshire, der Yngvi diente. Und genauso setzt sich das in den anderen Grafschaften fort, wo die Dominanz der Kata klar überwiegt. In Berkshire erinnert die Stadt Didcot (ausgesprochen als „Didkat“), sogar an eine 9000 Jahre alte Siedlungsgeschichte der Kata. Cambridgeshire kann gar mit dem neolithischen „Chatteris“ aufwarten, was als „Cateriz“ den Sitz eines Totenrichters benennt. Die Hügel der Cotswolds haben ebenfalls eine neolithische Vergangenheit, weswegen der Name keine Schafe meint, sondern von einem alten Kata-Clan berichtet. Das Wort „wold“ kann zwar mit „Wald“ erklärt werden, doch es bezieht sich nicht auf Bäume, sondern auf „walten“ oder „herrschen“.
Doch was in dieser frühen Asenzeit noch nicht existierte, war der Name Hyperborea für ein angebliches Nordland. Nach heutiger Vorstellung vielleicht mit „jenseits der Berge“ zu übersetzen, hatte sich bisher noch niemand vorstellen können, dass Hyperborea auf Hyperion als Namensgeber verweist. Der altgriechische Präfix „hyper“ deutet zumindest auf einen übergeordneten Bezug, wo neben Jenseits auch etwas Überirdisches, wie der Himmel gemeint sein kann. Leiten wir dieses Hyperborea noch vom älteren indogermanischen „bhor“ her, ist sogar etwas Hervorstehendes oder Aufgerichtetes gemeint, dass mit einer Borste vergleichbar, vielleicht eine Himmelssäule umschreibt. Ähnlich wie Atlantis, lässt sich damit das paradiesisch geschilderte Hyperborea sogar mit einen Dilmun-System gleichsetzen, womit zugleich klar ist, warum es nicht mehr gefunden werden kann.
Herodot kannte noch eine Geschichte um einen Kult mit Weihegeschenken für Delos, die angeblich nach langer Reise von Hyperoche und Laodike, zwei Jungfrauen aus Hyperborea überbracht wurden. Übersetzt man diese Namen, können jedoch ursprünglich keine Jungfrauen gemeint sein, was übrigens für alle weiteren Jungfrauen dieser Sage gilt. Vom altgriechischen „óchos“ für Träger oder Wagen stammend, muss die erwähnte Hyperoche ein „Jenseits“- oder „Himmelswagen“ gewesen sein, der sonst aus einem Dilmun das Süßwasser absaugte. Dazu passt noch die Deutung von Laodike, die über das indogermanische „dego“ hergeleitet, eine von „Stange“ und „Wasser“ (la) hergeleitete Wassersäule beschreibt, die mythisch der nordischen Midgardschlange entspricht. Die schon zuvor aus Hyperborea eingetroffenen Jungfrauen Arge und Opis hätten sogar „die Götter“ selbst nach Delos geführt, was auf das technische Vermögen der Asen bezogen, einer sicher völlig entstellten Überlieferung entstammt. Denn was soll sich denn anderes hinter „Arge“ verbergen, als ein „Schiff der Götter“, wie es von der fast gleichlautenden „Argo“ überliefert ist? Ist der Name noch vom altgriechischen „argḗs“ und „ópis“ hergeleitet, muss es sogar die weißschimmernde rundliche Form eines Dilmuns gehabt haben, auf dem selbst der uralte Name Arkona auf Rügen verweist. Für Delos würde das jedenfalls passen, denn wie ein Mythos berichtet, stand einst Poseidons „künstliche Insel“ auf „vier diamantenen Säulen“ vor der Küste: „Nanna“!
TARANIS MIT DEM SONNENRAD
Wie schon in „Diener und Krieger“ thematisiert, war das auffälligste Merkmal eines „Himmelswagens“ sein in der Mitte befindliches Sonnenrad, womit jedoch kein Speichenrad aus Holz und Eisen gemeint ist. Das älteste dargestellte Sonnenrad hatte als Tetraskele nur vier Speichen, die so gebogen wurden, dass man davon das Symbol der Swastika ableitete. Weltweit existieren noch weitere Varianten mit mehreren Speichen oder auch nur mit drei, als sogenannte Triskele. Von der Tetraskele kann man zudem auf altindischen Darstellungen rechts- und linksgedrehte Varianten sehen. Diese ältesten vierspeichigen Sonnenräder gehen alle auf das „Nanna“-System zurück, dessen himmlisches Gegenstück, die Himmelsscheibe „Pushpaka“ beim Somatransfer immer eine zur Erde gewandte rechtsgedrehte Swastika mit vier geschwungenen Speichen zeigte. Im darunter befindlichen Dilmun drehte sich in der geöffneten Kuppel während des Somatransfers ein weiteres Sonnenrad, was sich den wenigen Augenzeugen als linksgedrehte Swastika zeigte. Bevor es zum eigentlichen Transfer kam, baute sich ein elektromagnetisch herbeigeführter wirbelnder Sog, ähnlich einer Windhose auf, über dem nachfolgend das dampfförmige Soma aus dem Dilmun abgesaugt wurde.
Wie in Indien bei Abbildern von Surya, Vishnu oder Shiva wurde die Swastika noch in anderen Erdteilen auf Felsenbildern, Keramiken oder als Glücksbringer verewigt. In Europa sind dafür hauptsächlich jene Clans bekannt gewesen, die man bisher fälschlich unter der Fremdbezeichnung „Kelten“ zusammenfasste. Nach ihren Grabbeigaben haben sie nicht nur ihre Streitwagen mit der Swastika verziert, es tauchte auch inflationär als gewebtes Symbol auf Stoffresten auf, wie sie nachgefertigt im Keltenmuseum im süddeutschen Hochdorf ausgestellt werden. Ihre Farbgebung war überwiegend Königsblau, was die weitverbreitete Herrscherfarbe der späten Asenzeit war. Insgesamt wird so jedenfalls bestätigt, dass die Helvetier (Helveter) sich am liebsten in Stoffen mit Swastikasymbolen hüllten, weil diese reichlich in Fürstengräbern gefunden wurden. Deswegen kann man recht sicher sein, dass die meisten Ahnenkulte unter der Swastika abgehalten wurden, denn es stellte wie kein anderes Steinzeitsymbol den Schöpfungsort ihrer Ahnen dar.
Von den höchsten vorrömischen Gottheiten Mitteleuropas hat man Taranis mit einem Sonnenrad in einer Hand dargestellt, die andere Hand hält dazu einen Donnerkeil hoch. Er verschmolz zur Herrschaftszeit der Römer mit Jupiterdarstellungen, die wieder auf dem Unterweltsgott Dis Pater (Pluto) zurückgehen. In der Forschung bringt man noch dem gehörnten Gott Cernunnos in Verbindung oder setzte ihn mit Sucellus, einem Wald- und Fruchtbarkeitsgott gleich. Dieser führte jedoch im Vergleich zu Taranis zwei völlig andere Gegenstände mit sich, einen Wasserkrug und einen langstieligen Doppelhammer. Ikonografisch passt das zwar nicht wirklich und doch es sei noch seine fast ständige Begleiterin Nantosvelta erwähnt, wie sie etwa auf einem Altar im lothringischen Saarburg neben Sucellus dargestellt wurde. Ihr Name leitet sich nur von „Nanna“ ab, wobei Nantosvelta zugleich für Nanše, der Schwester von Marduk stehen wird. Nantosvelta wird bisher nicht richtig übersetzt, wobei die Ansätze zu einem Bach („nanto“) oder einer Göttin mit Füllhorn, „die das Tal zum Erblühen bringt“ wenigstens in die richtige Richtung weisen. Ihr bemerkenswertes Utensil ist jedoch ein Häuschen auf der Spitze eines Stabes, was insgesamt als Dilmun mit Himmelssäule gedeutet werden kann. Ihr Name setzt sich germanisch aus *nan und *dīsi im ersten Teil zusammen, wobei *nan im Wörterbuch direkt mit „Nanna“ übersetzt wird. Das folgende *dīsi benennt dazu etwas Heiliges oder eine Göttin. Verbunden mit „svelta“ (germ. *swela), wird ihr mit „sterben“ oder „verbrennen“ sogar ein Schicksal zugeschrieben, wie es von Baldurs Gemahlin Nanna bekannt ist, beide sterben ja den Feuertod!
Taranis in seiner Verschmelzung mit Jupiter, das sechsspeichige Sonnenrad symbolisierte den primären Teil seines Himmelswagens (im Zentrum einer Himmelsscheibe)
Die Göttin Nantosvelta leitet sich als Begleiterin des Sucellus direkt vom „Nanna“ Dilmun ab, dazu existiert sogar noch ein Bezug zu Baldurs Gemahlin NannaQuartierLatin1968, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0
Das lothringische Saarburg wo Sucellus mit Nantosvelta dargestellt wurde, gehörte zum früheren Siedlungsgebiet der Treverer, bei denen Taranis als eine ihrer drei höchsten Gottheiten galt. Es lag also recht nahe, dass man Sucellus über Dis Pater mit Taranis verknüpfen könnte. Zu den verschiedenen Darstellungsvarianten des Sucellus gehört auch jene, wo er mit einem dreiköpfigen Hund abgebildet ist. Und genau diese Ikonografie lässt sich mit dem griechischen Hades und seinen dreiköpfigen Wächterhund Kerberos assoziieren. Die altägyptische Entsprechung des Totengottes Hades ist Osiris, weshalb Kerberos den hundeköpfigen Anubis darstellt. Damit entspricht Sucellus nur dem Osiris, der bekanntlich mit Nanše als Isis ein Paar wurde. Selbst Dis Pater lässt sich über dem römischen Pluto mit Hades gleichsetzen, womit wir insgesamt alle auf Anu zurückführen können. Für seine Identifizierung spielt deshalb weder der gehörnte Cernunnos, noch die Jupitervarianten von Taranis eine Rolle. Jupiter geht allein auf Marduk zurück, den Bruder von Nanše (Aruru), die beide nach dem Enuma Elisch nach Ištars Tod als Tiamat, den „Nanna“-Dilmun für Anu übernahmen.
Herrschte also Anu als später vergöttlichter Taranis im 4. Jahrtausend v.Chr. über Alteuropa, dürfen wir uns zu Recht fragen, warum er sich nach dem Römer Lucan seine Herrschaft noch mit Teutates und Esus teilen musste. Bei Teutates handelte es sich um einen Götternamen, den die Römer mit Mars und Mercurius gleichsetzten. Auf Teutates und seinen Namensvarianten bezogen, benennen sie immer nur Anubis als Kriegsgott, der in Mitteleuropa noch viele weitere Namen hinterlassen hatte. In Griechenland geht Mars auf den thrakischen Ares zurück, zu dessen Attributen der Hund gehörte und zum anderen ist Mercurius mit dem griechischen Hermes identisch. Bemerkenswerterweise ist dieser als Götterbote genauso dargestellt, wie der altnordische Widdergott Heimdall.
Und Esus? Insgesamt ist es unsicher, ihn überhaupt mit jemanden anderes, als Anubis zuzuordnen, denn über ihn werden nur unsichere Gleichsetzungen mit Mars und Mercurius gesehen und gehen in diesem Fall auf einen Beinamen der Esuvier an der Orne zurück. Er befindet sich namentlich auf der Pariser Stele „Nautae Parisiaci“ als ESVS, wobei die Darstellung mit der des Mercurius-Altars in Trier vergleichbar ist. Er fällte auf beiden Abbildern einen Baum in dessen Ästen sich ein Stier und zwei bis drei Kraniche befinden. Ein Abbild befindet sich in Paris und wurde dort mit Tarvos Trigaranus beschriftet. Dabei handelte es sich genaugenommen um einen Stierkopf mit drei Kranichen, der wieder als Himmelsstier von einem Dilmun-Standort vor der Seine erzählt. Tarvos Trigaranus wird zudem mit dem mit dem irischen „Wasserstier“ Tarbh Uisge und der Gottheit Midir gleichgesetzt, die ebenfalls mit drei Kranichen dargestellt, für Götterboten stehen. Das lässt sich wiederum mit Hermes assoziieren, womit in Paris und Trier nur Anubis unter anderem Namen verehrt wurde. Sein vermeintlicher Beiname Esus wird zudem direkt mit Ase übersetzt. Belloguet sieht hier eine Verwandtschaft mit der Wurzel As, wie sie bei den indo-iranischen Asuras existiert. Anubis einfach nur als Gottheit zu bezeichnen wäre jedoch definitiv falsch, er war ein real existierender Ase, der sehr viele Beinamen auf sich vereinte. Esus gehörte nur als Beiname von Anubis dazu, wobei dieser Kriegsgott sogar hundegestaltig dargestellt wurde. Sein heiliger Baum war die Eiche in dem das Hammerzeichen Thors und der Name Hesus (Esus) geschnitten wurde. Es gab wohl noch einen gemeinsamen Hintergrund zwischen Esus und Thor, dem sicher eine Rivalität zugrunde liegt. Das Resümee lautet also: Taranis, der neben Teutates und Esus herrschte, stand in Altägypten für Osiris, wo er mit seinem Sohn Anubis über das irdische Totenreich (=Erde) herrschte.
Mit der Identifizierung des Taranis als Anu wird zugleich ersichtlich, dass alle seine bisherigen Namensdeutungen falsch sind, die ihn quasi mit Thor gleichgesetzt, als „der Donnerer“ deuten möchten, selbst wenn er in Irland als Torann bekannt wäre. In Wales und bei den Pikten ist er jedoch nur als Taran bekannt, weswegen nur an dieser Namensvariante angeknüpft werden kann. Von Bedeutung ist noch eine ihm in Britannien zugeordnete Variante IOM TANARO, doch seine Grundform Taran setzte sich nur aus Tar und An zusammen. Tar ist auf jeden Fall als Stier zu deuten und wenn An für Himmel steht, dann bedeutet der Name Taran nur „Himmelsstier“! Bezüge für die Stierdeutung finden sich im Altnordischen als tarfr, oder im Altirischen als tarb. Bisher wird Taranis noch mit TANARO verknüpft, doch das Grundwort tan erzählt eher von einer anderen Gottheit. Und zwar von Anus Nachfolger, der als letzter Asari über die Asen und die Erde herrschte. Wie schon in meinem zweiten Buch „Von Nanabosh bis Nanamariki“ thematisiert, handelte es sich dabei um Marduk, der im Alten Norden als gehörnter Loki auftrat. TANARO geht hingegen auf seinen „Danu“-Dilmun zurück, der in Pazifik als Tane noch weitere Beinamen für Marduk hinterließ.
Von der Präsenz Anus als Taranis und Anubis als widderköpfiger Teutates oder hundeköpfiger Esus blieben zahlreiche grausame Kulte in Erinnerung, die ihre Wurzeln in vorzeitlichen Kriegen während der Asenzeit haben. Zeugnisse dieser Schlächtereien wurden inzwischen auch in Deutschland gefunden, wovon die Opferstätte von Herxheim die momentan größte und älteste ist. Auf ein Alter von 7000 Jahren datiert, ist es ausgerechnet jene Zeit, als wanische Kar-Kriegerkasten für Anu fast alle Kata-Clans in Mitteleuropa unterwarfen. Taranis wurden als Kriegsgott in alter Zeit nicht nur menschliche Köpfe geopfert, sondern auch Menschen, die in einem Trog oder in einer Mulde verbrannt wurden. Wegen den dazwischen liegenden Jahrtausenden, wird es sicher in Herxheim keinen Taranis-Hintergrund gegeben haben, in einer schriftlosen Zeit halten sich einfach keine Originalnamen sehr lange.
Der wegen seines Sonnenrades als Radgott beschriebene Taranis gibt natürlich bis heute Rätsel auf, wie dieses sechsspeichige Rad zu deuten ist. Denn wenn die Swastika vierspeichig auf „Nanna“ zurückgeht, dann wird sich das dreispeichige Triskele-Sonnenrad nur in dreibeinigen Dilmun-Systemen gedreht haben. Als sechsspeichiges Himmelssymbol muss es dazu immer sichtbar gewesen sein und bezog sich wohl auf einen sechsteiligen Verschluss der Saugköpfe in den Himmelsscheiben der Dreibein-Dilmun-Systeme. Und diese wurden nun einmal häufiger am Himmel gesehen, als die größere „Nanna“-Himmelsscheibe. Zur Erinnerung: Ištars achtzackiger Stern bezog sich auf das geöffnete Verschlusssystem von „Nannas“ Dilmun-Kuppel, weshalb der Saugkopf von „Pushpaka“ ebenfalls aus acht Elementen bestand. Die anderen dreibeinigen Dilmun-Systeme besaßen demzufolge nur einen kleineren Verschluss, der dem Rad des Taranis zu Folge nur aus sechs Elementen bestand.
Heute wird angenommen, dass Taranis auf der Innenwand des Kessels von Gundestrup dargestellt wird und zwar auf dem C-Element, wo er sich mit einem halben Sonnenrad zeigt. Obwohl dieses Sonnenrad nur halb dargestellt wird, zeigt es acht Speichen, an dem sich über eine Schlange noch ein Wesen mit offensichtlichem Flügelhelm klammert. Damit lässt sich dieses Wesen als Götterbote identifizieren, wie Anubis als Hermes einer war. In Alteuropa weist diese Ikonografie nur noch Heimdall auf, weswegen dieser Ase mit Flügelhelm nur ihn offenbart.
Um jetzt wieder auf das achtspeichige Rad zurückzukommen: Es belegt, dass „Nanna“ lange Zeit nur Anu unterstand. Der bärtige Taranis zeigt dazu eine typische Armgeste, die wir noch von Inanna, der Mutter von Anu kennen, die bisweilen als „himmelsstützend“ interpretiert wird. Das Sonnenrad des Taranis wurde in Belgien zu Tausenden in Heiligtümern gefunden, wobei sicher noch die Nähe zur Rheinmündung eine Rolle spielt, von wo aus die Ahnen der Treverer über Rhein, Maas und Mosel zu ihrem späteren Siedlungsgebiet aufbrachen. Wem sich die Treverer zuordnen lassen kommen wir noch, ihre heutige Beschreibung als „keltischer“ Stamm, ist jedenfalls als Fremdbezeichnung völlig falsch. Dazu kommt noch, dass man Taranis mit Ambisagrus, Zeus, Perun (Pērkons), Horagalles oder Thor verknüpfen will, die allesamt für andere Asen standen.
Das Element C auf dem Kessel von Gundestrup soll Taranis mit einem halben Sonnenrad zeigen, links davon klammert sich ein Ase mit Flügelhelm (=Götterbotenmotiv) an dieses Rad, der in Europa der Ikonografie Heimdalls entspricht. Dieser entspricht über Hermes nur Anubis, der bei den Treverern als Teutates verehrt wurde.Gehring Sven, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-4.0
Cernunnos auf dem Kessel von Gundestrup – der Hirschgeweihgott steht für einen Charakter Ninurtas in Europa, der mit Freyr und Yngvi assoziiert werden muss!
CERNUNNOS DER GEHÖRNTE ASE
Neben Taranis wurde auf dem faszinierenden Kessel von Gundestrup der Hirschgeweihgott Cernunnos identifiziert. In der rechten Hand hält er eine Schlange in der linken einen alteuropäischen Torques (Halsreifen), einen weiteren trägt er selbst um seinen Hals. Sein goldenes Geweih weist ihn als Besitzer einer links neben ihn dargestellten Hirschkuh aus, die in Alteuropa einen weißen Schöpfungsort der Asen symbolisiert. In der nordischen Mythologie fressen zudem vier Hirschkühe die Knospen des Weltenbaums Yggdrasil, die schon rein zahlenmäßig von vier Dilmun-Systemen erzählen. Entsprechend dieses Hintergrundes symbolisiert eine weiße Hirschkuh zugleich einen Quellort und wird bis heute als Kneipen- oder Gasthofname verwendet. Wie schon in „Diener und Krieger“ beschrieben, handelt es sich bei Cernunnos um den wohl ältesten Charakter Ninurtas in Europa, wozu noch ikonografisch ein Bildnis auf dem Pilier des Nautes in Paris gehört, wo er sogar mit Stierhörnern dargestellt wird, an denen noch zwei Torques hängen. Angesichts der Verbreitung dieses Halsschmuckes in Alteuropa, kommt Ninurta eine überragende Bedeutung für den Kontinent zu, denn die Mythen von Freyr und Yngvi erzählen alle nur von seiner Präsenz und den Kämpfen seiner wanischen Kriegerkasten gegen seine Rivalen.
Gehörnt dargestellte Asen stellten am Abzu (Persischer Golf) übrigens die Regel dar, einfach jeder der sogenannten Anunnaki wurde als gehörnt dargestellt. Das setzt sich fort über Pan, den gehörnten Ziegengott und endet bei Lokis Hörnerhelm. Altägyptische Darstellungen zeigen widderköpfige Gottheiten oder Hathor mit Hörnern, die wiederum über Isis für Nanše steht. Pan und Loki stehen hingegen für Nanšes Bruder Marduk und auch ihr gemeinsamer Vater Enki wurde gehörnt dargestellt. Von Enlil ist sein Hörnerhelm bekannt und von Ninurta ein Hörnerhelm und die gehörnten Cernunnos-Darstellungen. Ištar hat man als Tiamat als Frau mit gewaltigen Hörnern abgebildet und selbst Anubis als Amurru wurden Hörnerhelme zugeordnet. Es spricht also nichts gegen eine Grundaussage, wonach alle Asen einen Hörnerbezug haben.
Doch was war der Hintergrund für diese Hörnerhelme? Können wir das ganze nur von ihren Bezügen zu einem Himmelstier, wie „Nanna“ ableiten oder steckt da noch mehr dahinter, was bisher noch nirgendwo in Betracht gezogen wurde? Bekanntlich kommt von Nichts nur Nichts, also muss es einen gemeinsamen Hintergrund geben, der sich im Alten Norden Europas bis zu den Hörnerhelmen der Wikinger zurückverfolgen lässt. Ausgerechnet ein paar ungewöhnliche, ja spektakuläre Artefakte aus dem westlichen Kaukasus bringen seit 2014 Bewegung in die Frage, wie wir die gehörnten Götterdarstellungen sehen müssen. So haben russische Wissenschaftler in der Kaukasusrepublik Adygeja einen Koffer entdeckt, der das Symbol von Heinrich Himmlers Organisation Ahnenerbe besaß! Als Fundort wurde das nördlich des Olympiaortes Sotschi befindliche Kischinski-Tal angegeben. Bereits zu diesem Namen, der deutlich auf die kosmischen Ki weist, könnte ein Zusammenhang zum Inhalt dieses Koffers vorliegen, der in einem Bauwerk des 2. Weltkrieges nahe dem Berg Boschoi Tjach geborgen wurde. Die Herkunft des Koffers ist inzwischen geklärt, denn dieses Gebiet war im 2. Weltkrieg mehrere Monate von deutschen Truppen besetzt. Zu dieser Zeit muss eine Gruppe deutscher Wissenschaftler in der Bergregion Forschungsarbeiten unternommen haben. Von dieser Expedition weiß bis heute niemand mehr etwas, obwohl im Jahr 2014 auch die BILD-Zeitung darüber berichtete. Sie hat jedoch meines Wissens ihren „Alien“-Bericht nicht mit Fotos vom Inhalt des Koffers veröffentlicht. Bis zur Wiederentdeckung dieses Koffers war der Stand, dass die geplante Kaukasus-Expedition des Sonderkommandos K (Deckname) wegen der Kriegslage nicht mehr zur Ausführung kam. Dieser Koffer belegt jedoch ein Vorauskommando, was schon aktiv an der beabsichtigten rassekundlichen und wehrwissenschaftlichen Totalerforschung des Kaukasus beteiligt war. Die nachfolgende Hauptexpedition sollte der deutsche Tibetforscher Ernst Schäfer übernehmen, der dafür einen „ganzheitlichen“ Expeditionsplan für die Aufgabenfelder Erde, Mensch, Pflanze und Tier entwickelte. Was nicht erwähnt wurde, war die Einbindung der Mythologie, womöglich musste die jedoch spätestens nach den Funden mit eingebunden werden, denn der Koffer vom Deutschen Ahnenerbe enthielt zwei massiv gehörnte Schädel humanoider Wesen!
Im Jahr 2015 kam noch ein weiterer Schädelkoffer mit einem dritten Hörnerschädel dazu, es sind die wohl spektakulärsten Funde von Himmlers Ahnenerbe-Forschern überhaupt gewesen, doch beide Koffer kamen nie aus dem Kaukasus heraus. Vorausgesetzt eine andere Kriegslage hätte es erlaubt, dass die gesamte Hauptexpedition in Marsch gesetzt worden wäre, hätten sich daran ca. einhundert Personen beteiligt, die über 100 LKW, 30 Volkswagen, Motorräder, 45 Begleitsoldaten, einen Fernschreiber und sogar über einen Fieseler Storch verfügen konnten. Von dieser bereitgestellten Ausrüstung musste sich bereits das Vorauskommando bedient haben, unklar ist jedoch, wie groß diese Gruppe war. Als die Wehrmacht den Westkaukasus kontrollierte, existierte im Dorf Djavskaya nahe dem erloschenen Elbrus-Vulkan ein deutscher Stützpunkt, von wo aus dieses Kommando ihre Forschungen durchführte. Darunter wurde in einem anderen Dorf der Region Adygeja ein zuvor entdecktes drei Meter großes Skelett wieder vergraben. Das gesamte Gebiet soll nach deutscher Vorstellung den sogenannten Aryanern gehört haben, die sie wieder den indogermanischen Ariern in Persien zuordneten. Für die Funde der drei gefundenen gehörnten Schädel werden sie jedoch keinen Bezug zu den Aryanern gesehen haben, denn außer den Hörnen, besaßen diese Schädel keinen Mund, wie beim Menschen, sondern an dieser Stelle nur kleine rundliche Öffnungen, die nur eine Aufnahme von flüssiger Nahrung erlauben. An dieser Stelle darf also tatsächlich gefragt werden, ob diese auf zwei Beine wandelnden Wesen eine Art Blutsauger waren. Dazu passt noch ein weiterer Schädelfund aus den südbulgarischen Rhodopen mit einer ähnlichen Mundpartie, doch die gesamte Form ist eine andere, zudem hatte dieser keine Hörner.
Seit 2015 ist man sich in Russland einig, dass diese Ahnenerbe-Expedition im Winter 1942/43 in einer Lawine verschüttet wurde und die wenigen Überlebenden diese Koffer bis zu einer geplanten Rückkehr versteckt haben müssen. Dazu kam es jedoch nicht mehr und die größte Entdeckung von Himmlers Ahnenerbe geriet in Vergessenheit. Mit diesen Funden lässt sich seit 2014 jedenfalls gut argumentieren, dass alle Asen ein gehörntes Äußeres hatten, wobei die Nähe zum Elbrus sogar auf den Mythos vom Feuerbringer Prometheus weist.