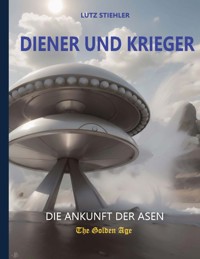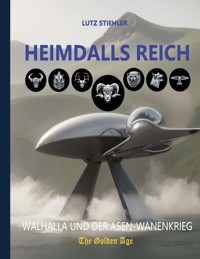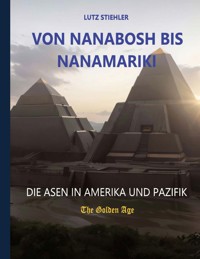
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Die Asen-Clans im Totenreich
- Sprache: Deutsch
Nach "Diener und Krieger" wird im zweiten Teil "Von Nanabosh bis Nanamariki" der Buchreihe The Golden Age erzählt, wo die Asen in Nord-, Mittel- und Südamerika wirkten und welche Spuren sie im Pazifik hinterlassen haben. Wiederum wird ein Puzzle aus Mythen, Ruinen und alten Orts- und Landschaftsnamen zusammengesetzt, was am Ende die wahre Besiedlungsgeschichte dieser Erdteile offenbart. Dabei lassen sich auch dort vor Flussmündungen, Inseln und in Süßwasserseen eine große Zahl von Dilmun-Standorten nachweisen, die teilweise direkt nach "Nanna" benannt wurden. Gleiches findet sich in alten Götter- und Stammesnamen wieder, die sich auf die Namen der vier Dilmun-Systeme beziehen und noch direkt von den ersten Kata-Clans und Kar-Kriegerkasten ableiten. Und so beginnt dieser Teil zuerst in der Karibik, deren Name noch aus der Asenzeit stammt. Bereits relativ früh errichteten die Asen einen megalithischen Machtkomplex vor Westkuba, der sich heute 600 m unter Wasser befindet. Obwohl man im Internet die spektakulären Sonarbilder des Forscherpaares Weinzweig/Zalinski einsehen kann, gibt es derzeit keine weiteren Forschungen. Auf dem Cover befindet sich eine nachempfundene Ansicht dieser Stadt, über die Anu, der Nachfolger Alalus, als "Osiris" herrschte. "Osiris" ist zudem die altägyptische Herrschertitelvariante, die sich direkt von Asar, der heute vereisten Heimatwelt der Asen ableitet. Das Buch endet zwischen den Inselwelten im Pazifik, wo "Nanna" als größter Asen-Dilmun mit Puloto, Burotu und Hawaiki gleich drei berühmte Namen hinterlassen hat. Mit ihnen verbinden sich Mythen, die immer von den gleichen Inhalten wie in Europa und Asien erzählen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 686
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buch-Cover: Visualisierung der entdeckten Unterwasserstadt vor Westkuba
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort
1. Die Asen-Clans in der Karibik
2. Der Bimini-Florida Komplex
3. „Nanna“ in der Aztekischen Mythologie
4. Itzamna, Ixchel und die Ahnen der Maya
5. Von Hurakan bis Curita-Caheri
6. Die Kosmologie der Lacandonen
7. Die Kata in Nordamerika
8. Dilmun-Systeme vor der amerikanischen Ostküste
9. Neuenglands Stonehenge
10. Der Ahnenkult der Nordwestvölker
11. Die Schöpfung am Columbia River
12. „Nanna“ vor dem Mississippi
13. Der Mythos des Großen Schlangenhügels
14. Die Götterwelt der Sioux
15. Die Wassermonster der Cheyenne und Ojibwe
16. Die Caddo-Stämme im südlichen Nordamerika
17. Das Wissen der Yuma
18. Die Schöpfung bei den südlichen Stämmen der Athabasken
19. Aus den Schöpfungsmythen der Zuni
20. Die vier mythischen Welten der Hopi
21. Die Ahnen der Nördlichen Athabasken
22. Sedna – Die Göttermutter der Inuit
23. Vom Mais und Maismenschen
24. Die Kata zwischen Titicacasee und Feuerland
25. Die Kosmologie der Tehuelche
26. Tanowa auf Feuerland
27. Von Schlangensöhnen und Wandergöttern in den Anden
28. Im Wolkenland der Zyklopensteine
29. Pacatnamu – Im Land der Moche
30. Caral und Carakas – Kar-Kriegerkasten in Südamerika
31. „Nanna“ in den Andenkulturen
32. Schöpferlegenden vom Ostrand der Anden
33. Das Cachapoya-Rätsel
34. Mythen aus dem Regenwald Amazoniens
35. Das Wesen des Sonnen- und Donnergottes Tupana (Tupa)
36. Die Himmelswelten der Yekuana
37. Die Asenzeit Neuseelands
38. Rangi und Papa – Die Schöpfung der Maori-Ahnen
39. Das Wasser der Mondgöttin Hina
40. Die Enana auf den Marquesas
41. Rapa Nui – Die Insel des Vogelmanns
42. Mythische Inseln vor und um Tonga
43. Pulotu vor Samoa
44. Pulotu als Burotu vor den Fidschi-Inseln
45. Tuvana, Papatea, Atafu – Auf den Spuren nach Burotu
46. Naareau, Fonua und der Eisenfelsen Touiafutuna
47. Kura im Pazifik
48. Der wahre Hintergrund des Yap-Steingeldes
49. Die Asen auf Hawaii
50. Schwimmende Städte vor Hawaii
51. Die Asen auf den Marianen und Marschall-Inseln
52. To-Kabinana und To-Karvuvu
53. Melanesiens künstliche Inseln
54. Das Gerät Tongafiti und die schwimmende Insel „Nuku Tere“
55. Nanamariki in Nan Madol
Anhang
VORWORT
Welche Quellen der heute noch gern zitierte Asen-Dichter Snorri Sturluson für seine berühmte Edda nutzen konnte, sie alle berichteten aus einer Zeit, wo die gesamte Erde allein den kosmischen Asen-Clans untertan war. Als einer der bekanntesten Dichter dieses Genres, beschrieb Sturluson die von ihm thematisierten Asen grundsätzlich in menschlicher Gestalt und ordnete sie wieder bestimmten Familien zu. Das ist nachvollziehbar zwar verständlich, die meisten Gottheiten der Edda sind jedoch, wie in den anderen Mythen keineswegs Wesen aus Fleisch und Blut gewesen. Ein gutes Beispiel ist der einäugige Odin, dessen Sohn Balder (Baldur) Sturluson eine Gemahlin namens „Nanna“ zuordnete. Damit lässt sich der einäugige Odin relativ leicht als Himmelsauge identifizieren, das mit „Nanna“ verbunden das erste und älteste Dilmun-System als teilbares Weltenei auf der Erde beschreibt. In diesem Sinne lassen sich auch die „Cup and Ring“-Felsbilder als Odin-Symbole identifizieren, die gleichzeitig seine regionale Himmelspräsenz über Alteuropa belegen. In Indien als „Pushpaka“ überliefert, gehörte diese größte Himmelsscheibe nach Alalus (Sumali) Tod nur noch Anu (Ravana) und wurde hauptsächlich überall dort beobachtet, wo „Nanna“ vor Flussmündungen oder in Süßwasserseen stand. Im anderen Fall auch dort, wo aufständische Kata-Clans sich gegen seine Krieger-Kasten wehrten, weshalb Anu auch immer wieder Feuersäulen gegen Bodenziele einsetzte. Auch wenn sich das recht unglaubhaft liest, diese auffälligen Orte fallen bis heute ungeklärt mit ihren verglasten Felsen aus der konventionellen Geschichtsschreibung heraus.
Unvermittelt taucht die Asenzeit deshalb immer wieder vor den Augen der Archäologen auf, wo sie zum Beispiel im Norden Israels eine 5000 Jahre alte Großstadt bei En Esur ausgruben, die mit einen ausgesprochen planvollen Grundriss überraschte. Die älteste Großstadt war sie aber nicht, denn in der Schwarzmeersteppe, vor Kathiawar oder Westkuba finden sich auf der Erde und unter Wasser noch weitere Großstadtruinen aus der frühen Asenzeit. Nach den Ergebnissen verschiedener Grabungen muss die Gegend um En Esur schon um 4000 v.Chr. besiedelt gewesen sein, was zu jener Zeit war, in der Anu über die Erde herrschte. Das lässt wiederum den Gedanken zu, dass der Name En Esur, wegen seines Zweitnamens „Ein Asawir“ von „An Asar“ abgeleitet sein könnte, womit die Stadt vielleicht von Anfang an, nach Anu benannt war. Von Asar, der alten Heimatwelt der Asen wurde schließlich auch der Titel für den obersten Asenherrscher abgeleitet, der als Asari bekannt, sich besonders in Ägypten als Osiris verewigte.
Viel treffender als „Asari Anu“ bezeichnet, spiegelt dieser Titel nicht nur die ursprüngliche Herkunft der Asen von Asar wieder, sondern erklärt zugleich warum der später auf Anu folgende Marduk diesen Titel als Asariluḫi trug. Bis das geschah vergingen jedoch fast drei Jahrtausende, in denen nur Anu über die Geschicke der Erde lenkte. Dafür stützte er sich hauptsächlich auf die unter ihm erschaffenen Kar-Kriegerkasten, zu deren kosmischen Schöpfern er selbst zur Hälfte angehörte. An dieser „Nanna“ entstammenden frühen elitären Oberschicht erinnert auch die indische Grußformel „Namaste“, die allgemein mit „Verbeugung dir“ gedeutet wird. Vor wem man sich jedoch wirklich verbeugte offenbart die Grußvariante „Namaskara“, was sich ursprünglich auf die herrschenden Kar-Kriegerkasten beziehen lässt. Richtig ausgeübt, zeigen bei dieser Grußgeste die Zeigefinger der gefalteten Hände auf die bei Frauen markierte Stelle zwischen den Augen, wo sich nach hinduistischer Vorstellung das sogenannte „Dritte Auge“ verbirgt. Wie bei Vishnus Attribut nur „Chakra“ genannt, leitete sich dieses „Dritte Auge“ von einem Himmelsauge ab, das ebenfalls zu einem Dilmun-System gehörte. Es verwundert deshalb auch nicht, dass man daraus auch die Lehre von den sieben Hauptchakren entwickelte, die als Energiezentren das Wesen der Menschen bestimmen. Dafür ordnete man sogar den Hauptchakren eine Anzahl von Blütenblättern einer Lotusblume zu, die mythologisch für den Verschluss eines Dilmuns der zweiten Generation stehen.
Von Anu und seinen ihm unterstehenden Kar-Kriegerkasten wird auch im vorliegenden zweiten Band über die Asenzeit in Amerika und im Pazifik berichtet. Die von Anu abgeleiteten „Anunna“ könnten zu dieser Zeit vielleicht für eine weitere Kriegerkaste aus dem Inneren von „Nanna“ stehen. Es ist jedoch hauptsächlich der persischen Mythologie über einen weltbeherrschenden König Jima zu danken, dass wir die „Anunna“ nur als Beinamen der Kar-Kriegerkasten ansehen können. Und zwar im Kontext, dass sie von Anfang an Anu unterstanden. So bestimmte der mit Anu gleichzusetzende König Jima (Dschamschid) einst die Erschaffung einer Kriegerkaste, die ihn und sein Reich schützen sollte, was sich damals über die ganze Welt ausbreitete. Unter dieser Kriegerkaste wurde gleichzeitig ein rigides Kastensystem eingeführt, wie es schon in „Diener und Krieger“ beschrieben ist. In den altpersischen Überlieferungen wird dieses System auch gleich in seiner Vollendung beschrieben, wo es aus einer Kriegerkaste, Priesterkaste (Lehrer) und Arbeiterkaste (Landarbeiter, Handwerker) bestand. Wie wir wissen gehörte zur Arbeiterkaste auch das Heer der Unfreien, in dem sich hauptsächlich die unterworfenen Kata-Clans wiederfanden. Kata-Clans und auch Kar-Kriegerkasten lassen sich dabei auch in Altamerika und in der Frühgeschichte des Pazifiks nachweisen.
Das Enuma Elisch vermittelt uns zumindest trotz zweifelhafter Übersetzung eine zahlenmäßige Vorstellung, wie viele „Anunna“ für Anu über die Welt wachten: „Die Gesamtheit der Anunnaki, oben und unten. Und er (Marduk) trug Anu auf, über seine Befehle zu wachen. Dreihundert Götter stellte er als Wächter in den Himmel, dann grenzte er die Wege der Erde ab. Im Himmel und auf Erden setzte er so sechshundert Götter ein.“ Wortwörtlich können diese Strophen natürlich nicht gedeutet werden, sie ergeben jedoch Sinn, wenn wir sie auf den rekonstruierten Asenhintergrund beziehen. Bisher in seiner ältesten Fassung aus dem 9. Jahrhundert v.Chr. stammend, herrschte in diesem Epos immer nur Marduk über die Welt, obwohl er der letzte von allen Asaris war. Deswegen wurde im Text Anu Marduk unterstellt, obwohl dieses Verhältnis im Abgleich mit den anderen Mythologien niemals existierte. Aus Sicht der damaligen Autoren ist das aber erklärbar, sie wussten es wegen fehlender Quellen nicht anders. Völlig unsinnig ist auch die Deutung, wonach unter den Asen dreihundert Himmelswächter benötigt wurden, wo doch sie ganz allein über das Sonnensystem herrschten! Vielmehr muss davon ausgegangen werden, dass diese dreihundert Himmelswächter sichtbar nur auf der Erde agierten und im richtigen Verhältnis gedeutet, für die Gesamtzahl aller Kar-Kriegerkasten (Anunna) stehen. Am Ende wird jedoch angegeben, dass die wahre Wächterzahl insgesamt 600 betrug, was als Kopfzahl auf einzelne Krieger bezogen, für die gesamte Erde lächerlich wenig wäre. Stehen jedoch die 600 für Kriegerkasten, wäre das vom Beginn der Herrschaftszeit Anus bis zu Marduks Weltherrschaft und der Größe des Planeten durchaus angemessen. Selbst dann, wenn diese Kriegerkasten jeweils eintausend oder 1500 Menschen zählten. Zu diesem Himmel-Erde-Verhältnis sei aber noch einmal bemerkt, dass zu Marduks Zeiten alle diese Clans den Ki unterstanden, was wir noch wörtlich aus dem Begriff der Anunna-Ki herauslesen können.
Dass sich die Kar-Kriegerkasten auch immer in der Nähe von Flussmündungen oder Süßwasserseen in Europa und Asien nachweisen lassen, kann man schon in Diener und Krieger nachlesen, dieser zweite Band der Reihe The Golden Age behandelt jedoch neben den Nachweis, dass zur Herrschaftszeit Anus (Osiris) bereits Ahnenkontingente von Kata-Clans und Kar-Kriegerkasten auf dem amerikanischen Doppelkontinent existierten auch die Inselwelt des Pazifiks, wo wir Belege für diese Clans in den Mythen zwischen Hawaii und Neuseeland finden. Mit Hilfe der Mythologie amerikanischer Ureinwohner lässt sich „Nanna“ vor amerikanischen Flussmündungen und Süßwasserseen nachweisen, gleiches gelingt auch mit dem Götterwissen der Polynesier oder Maori vor den wichtigsten Inseln des Pazifiks. Dabei ist es nicht nur Nanabush oder Nanamariki, die „Nanna“ bereits namentlich vor Amerika und im Pazifik belegen, sondern als Götter- oder Geisterinsel hatte sie dort noch viele weitere Beinamen hinterlassen. Das alles zeigt zugleich auf, wie absurd es ist nach vorkolumbianischen Entdeckern dieses Kontinents zu fahnden, wenn diese Welt schon von den gleichen Asen-Clans besiedelt wurde, die zeitgleich über die Alte Welt herrschten.
DIE ASEN-CLANS IN DER KARIBIK
Unübersehbar stellt auch die Karibik ein Namensrelikt der Asenzeit dar, die begrifflich bisher nur vom Volk der Kariben aus dem 15. Jahrhundert hergeleitet wird. Weiter zurück gelang bisher keine Recherche, niemand weiß heute woher der „karische“ Name der Kariben stammt. Wenigstens Alexander Braghine hatte in seinem Buch „The Shadow of Atlantis“ versucht, die Spur der „Kar“ aus Sicht einer transatlantischen Seefahrt der Phönizier zurückzuverfolgen, die als „Volk von Carou“ immer ihre karische Herkunft betonten. Unstrittig zuerst im östlichen Mittelmeer noch zur späten Asenzeit in Erscheinung getreten, haben sich einst die Ahnen der Phönizier in der Tat als seefahrender Asen-Clan spezialisiert, womöglich aber nur, weil ihre Heeresmacht in der Levante bei ihrem Erscheinen nur noch eine geringe Rolle spielte. Ob ihre Schiffe tatsächlich den Atlantik bewältigten, wie es Braghine vermutete, ist auf die Namensgebung der Karibik ohne Belang, dafür reichen einzelfahrende Schiffe bei weitem nicht aus, um solch einen „Car“-Nachhall in den Namen südamerikanischer Indiostämme zu erzeugen. So kommt für die Herkunft des Meeresnamens zur die Mythologie dieser Stämme in Frage, die in Südamerika bereits früh von den Asen berichtet.
Neben den Hinterlassenschaften in der Caatinga, wo während eines frühen Asenkrieges das Siedlungsgebiet eines Kata-Clans regelrecht ausgebrannt wurde, ist hier besonders die Nordküste Südamerikas interessant, wo mit dem Orinoco, einer der wasserreichsten Flüsse der Erde in den Atlantik mündet. Auch wenn sich heute die räumliche Abgrenzung der Karibik viel weiter westlich auf der Höhe der Isla Margerita befindet, werden die Asen das Wasser des Orinoco nicht ignoriert haben, weshalb die Namensherkunft der Karibik in einem Standort „Sakars“ vor seiner Mündung wurzelt.
Recht auffällig bestätigt auch Amacuro, der Name seines Deltas diese Herleitung, die sich ursprünglich durchaus aus „Kur“, dem Unterweltsdrachen (= „Pushpaka“) und dem Somabegriff Amrita zusammensetzen kann. Weiter gedacht wird ein „Sakar“-Standort vor dem Amacuro-Delta auch eine Kar-Kriegerkaste hinterlassen haben, dessen Nachfahren sich bis ins kolumbianische Entdeckerzeitalter hielten. Denn als die Erforschung der südamerikanischen Nordküste einsetzte, hielten die Chronisten dieser Zeit fest, dass man dabei auch auf einen weißen Stamm traf, der sich auffällig von den anderen farbigen Indios unterschied.
Im Ergebnis wird es deshalb am Orinoco, wie überall auf der Erde zur Asenzeit abgelaufen sein: Im Umland des Amacuro-Deltas unterwarf erst eine Kar-Kriegerkaste einen noch älteren Kata-Clan, dem man ab dem 4. Jahrtausend v.Chr. mindestens ein farbiges Ahnenkontingent zuführte. Wegen ihrer dravidischen Ähnlichkeit kommt vor der Orinoco-Mündung nur ein Intermezzo von Marduks „Danu“-Dilmun in Frage, aus dem sämtliche dravidischen Ahnenkontingente entstammen. Zeitmässig kommt dafür fast das gesamte 4. Jahrtausend v.Chr. in Frage, selbst wenn der älteste Nachweis, der mit den Kariben verwandten Maja, sich bisher erst 2000 v.Chr. in Cuello (Belize) bestätigen lässt. Nehmen wir hierbei noch die Mythen der Hopi hinzu, wonach die Azteken und Maja von ihnen abstammen würden, muss zwingend davon ausgegangen werden, dass bis zum 4. Jahrtausend v.Chr. auf dem gesamten amerikanischen Doppelkontinent nur weiße Kata-Clans siedelten.
Der letzte „karische“ Rest des Orinoco-Clans hat sich als weißhäutiger Stamm noch lange auf der Halbinsel Paria gehalten, wo die Angehörigen eine „Atlan“ genannte Siedlung bewohnten. Nach den Mythen der ebenfalls „Paria“ genannten Indios, sollen sie ursprünglich von einer Insel im Ozean stammen, die wir wieder mit einem Dilmun gleichsetzen können. Von einem Dilmun-Standort könnte deshalb in Venezuela auch der Name der karibischen Küstenstadt Cumana erzählen, der zuerst als Flussname der Sprache der karibischen Chaimas und Guaiqueres entstammte. Lautsprachlich könnte er zudem von einem Kompositum „Go-manu“ abstammen, was als „Stier Manus“ seinen Dilmun in der Karibik benennt. Dafür spricht sogar der Stammesname „Paria“, der in Indien für eine Kaste untersten Standes verwendet wird!
In den Urwäldern des Amazonas überlebte noch eine weitere Mythenvariante von „Sumé“, von dem Schwennhagen in der Sete Cidades die Reste einer Skulptur entdeckte. So besaß dieser Schöpfergott bei den Tupinambá mit „Monan (!), den „Uralten“ ausgerechnet einen Beinamen, der sich überdeutlich von „Nanna“, als Dilmun und Mondgott herleiten lässt.
Die tropische Halbinsel Paria, auf ihr lebte noch Zeit ein gleichnamiger Stamm weißer Indios
Bild von Tucanrecords für Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0
Auch er besaß zwei Söhne als Zwillingsbrüder, die als Ariconte, dem „Gott der Nacht“ und Tamondonar, dem „Gott des Tages“ überliefert sind. Bei einem „Streit“ soll es so hitzig geworden sein, dass ihre Stadt in den Himmel geschickt wurde, dabei stampfte Tamondonar so mit seinem Fuß an einer Stelle, dass vom Meer aus eine Flutwelle über das Land hereinbrach. Mit dem Hintergrund der Dilmun-Technologie wurde hier aber kein Streit ausgetragen, sondern nur „Monan“ als Weltenei in zwei Teile getrennt, die den Zwillingsbrüdern entsprechen. Dabei wurde Tamondonar mit seinem „Fuß“ als Dilmun vor der Küste abgesetzt. Der andere Teil kehrte als „fliegende Stadt“ in den Himmel zurück, womit Ariconte für eine Himmelsscheibe stand. „Nanna“ als „Monan“ war zugleich jene „weiße Insel“, von der die Tupinambá behaupten, dass von dort ihre Vorfahren abstammen und gleichzeitig mit „Caraiba“ einen Namen besaß, der sinnidentisch auf „Sakar“ verweist. Die Karibik als Meeresname wird sich deshalb unmittelbar von „Caraiba“ ableiten, womit man auch dieses Meer nach einen weiteren „Nanna“-Beinamen benannte.
An diese jüngste Epoche der globalen Asenzeit erinnert im Amazonasgebiet am Purús auch eine Katukina-Sprachgruppe, zu der noch die Sprachen Katawixi oder Kanamarí gehören. Den Kasten örtlicher Kata-Clans entstammend, leben ihre Nachkommen auch am Rio Bia oder im Dschungel von Acre, wo sie sich hauptsächlich von Mais und Maniok ernähren. Ihr Geld verdienen sie sich seit langer Zeit als Gummisammler, weshalb der Saft der Gummibäume sicher schon zur Asenzeit von örtlichen Asen-Clans genutzt wurde. Auch die Caduveo (Kadiweu) und Guató im Matto Grosso und die Katawian in Guyana erinnern noch an vorzeitliche Kata-Kasten, obwohl ihnen heute kaum noch weiße Indios angehören. Wegen des Zerstörungshorizonts in der Caatinga, muss man schon unter der Herrschaft Anus nachfolgend Ahnenkontingente aus dravidischen Schwarzmenschen unter den Kar-Kriegerkasten Amazoniens verteilt haben, von denen nach der Asenzeit sämtliche heutige Indiostämme abstammen.
Am Oberlauf des Orinoco existieren die bekannten Petroglyphen von Caicara, die sinngemäß die gleichen Himmelsaugen, wie die europäischen „Cup and Ring“-Felsbilder darstellen. Bei den Himmelsaugen handelt es sich um die sichtbare Unterseite der insgesamt vier Himmelsscheiben, die glockenförmig geformt, vom Blickwinkel der Erde aus, als Himmelsschalen bezeichnet wurden.
gemeinfreies Bild von Wikimedia Commons
In den Regenwäldern Amazoniens erinnern nicht nur Gottheiten, wie „Monan“ an die frühe Asenzeit karibischer Stämme, sondern auch der weit verbreitete Fürstentitel Kazike. Sinnverwandt mit dem japanischen Familiennamen Katsu entstammt auch er der frühen Kata-Clanzeit. Doch wie bereits „kasiki“, die portugiesische Kazikenvariante andeutet, haben am Ende nur die Ki über Südamerika geherrscht, womit sich über dem gesamten Kontinent noch viele weitere Beinamen Marduks verewigten. Die vor den Küsten stehenden Dilmun-Systeme flossen in der Karibik noch in den Zemi-Kult der Taíno ein, wofür man sich Ahnengeister mit schüsselförmigen Gefäßen auf den Kopf vorstellte. In den Cohoba-Ritualen versuchte man dazu auf astrale Reisen zu gehen. Das gesamte Kompositum mit einer Schüssel auf dem Kopf spiegelt dabei ihren Ahnenkult wieder, wo das Wissen um die Herkunft ihrer Ahnen aus einem Dilmun verarbeitet wurde.
Von ihrer Herkunft erzählen auch Mythen, die sie offensichtlich auf der Karibikinsel Trinidad hinterlassen haben. Die Insel selbst war vor 1500 Jahren noch mit Südamerika verbunden, was die Kariben möglicherweise „Iere“ damals nannten. Man erzählte sich bisher Sintflutmythen, bei denen das Wasser jedoch nicht mehr zurückging, also ähnlich der Trennungsgeschichte Trinidads von Südamerika. Das ist an sich alles nachvollziehbar und der besonderen vorgelagerten Lage dieser Insel vor dem Orinoco-Delta geschuldet. „Iere“ könnte jedoch so etwas völlig anderes bedeutet haben, bevor sich dieser Name auf ein untergegangenes vorzeitliches Land bezog. Es widerspricht jedenfalls nicht der Behauptung, dass „Iere“ das größte Land der Welt gewesen sein soll, wenn der amerikanische Doppelkontinent gemeint ist, der eine einstige Antillen-Landbrücke besaß und über die Beringia-Landbrücke noch mit Asien verbunden war. Mythisch wird es jedoch schon, wenn in dieser Überlieferung der Trinidad-Ureinwohner behauptet wird, dass sie mit Hilfe einer goldenen Platte und eines Gesangs größere Wegstrecken fliegend zurücklegen konnten. Dieser Gesang bezog sich einzig und allein auf das Ziel ihrer geplanten Reise.
An sich ist das schon aus anderen Erdgegenden (z.B. Kasskara-Mythen) bekannt, doch die wirkliche Einzigartigkeit liegt in der Legende, wonach im Goldenen Zeitalter nur „tote Menschen“ arbeiteten! Diese empfanden weder Müdigkeit noch Hunger, wären also heute perfekt für jeden Unternehmer, um maximalen Profit abzuwerfen. Dass damit wohl etwas völlig anderes gemeint ist, hat man noch nicht diskutiert. Mit dem Hintergrund eines Asen-Kontingents als Diener-Kaste, das völlig ohne Schrift gewaltige Bauwerke errichten konnte, wird sicher klar, dass nicht wirklich „tote Menschen“ gemeint sind, sondern Menschen, die sich wie Tote verhielten. Also nur arbeiteten und nicht wie Menschen lebten. Die Erinnerung blieb jedenfalls so wach in der Karibik, dass daraus der bekannte Zombie-Kult wurde. Dieser ist zugleich ein Wiedergeburtskult, denn er spielt auf die vermeintliche Fähigkeit ab, die Hüllen wiederbelebter Toter als Arbeitssklaven einzusetzen. Den Asen könnte man so etwas sicher zutrauen, doch bei Menschen, die Zombies für sich arbeiten ließen wohl weniger. Trotzdem existiert im haitischen Gesetzbuch noch ein einzigartiger Paragraph, wonach Zombie-Praktiken illegal und strafbar wären. Wie sich das alles wirklich verhielt kann man bereits an dem Detail ablesen, dass das Zeitalter der Untoten noch keine Kriegerkasten kannte. Damit fand das alles nur zur Verbannungszeit von Alalu und Ištar statt, die bereits frühzeitig mit „Nanna“ vor dem Orinoco gestanden haben müssen.
Und so überrascht es auch nicht, dass die Ureinwohner von Trinidad und anderer Stämme eine „Goldene Schlange“ kannten, vor der sich alle fürchteten. Sie trug eine Krone aus Zacken und tanzte wenn sie zornig war. Ein Gott war anwesend, der goldene Messer warf, wenn es donnerte und das gesamte Volk soll aus dem Osten gekommen sein, bis später das Land aufbrach und alles im Meer versank. Diese eher fragmentarische Überlieferung erzählt besonders wegen der Krone tragenden Goldschlange nur von einem Dilmun-Standort, von dem ein weiteres Ahnenkontingent am Orinoco abgesetzt wurde. Und wo die Asen wirkten, wurde gelegentlich auch immer wieder mit brachialer Gewalt Krieg geführt. So kannten nach Peter Marsh die in New Mexiko bekannt gewordenen Anasazi eine „feurige Himmelsschlange“, die in der Karibik eine „Schildkröten-Insel“ (= Dilmun) namens „Tulapin“ vernichtet hätte!
Trinidads indigener Name lautet jedenfalls Kairi, was bisher mit Land des Kolibris übersetzt wurde. Der Name stammt jedoch von den Kalina-Leuten, die sich im Singular als Karifuna bezeichneten. Er weist also auch auf das namensgebende Volk hin, was eine Verbindung zur Herkunft ihrer Ahnen herstellen könnte. Mit anderen Worten: Auch am Orinoco-Delta wurde schon eine Kar-Kriegerkaste abgesetzt, von dem teilweise die Kariben abstammen.
Als höchste Muttergottheit gilt bei den karibischen Taíno übrigens Atabey, die mit ihren Beinamen Sumaiko bereits wörtlich Sumé (=Alalu) zugeordnet werden kann. Damit dürfte sich auch Ištar bei den Taíno belegen lassen, denn ihre zugeschriebene Zeugung von Zwillingssöhnen ohne Verkehr beschreibt nichts anderes als ein teilbares Weltenei in zwei weiße Teilsysteme (Dilmun und Himmelsscheibe). Für einen Dilmun wird deshalb nur ihr auf der Erde wandelnder Sohn Yucáhu, als Gott der Fruchtbarkeit stehen, dem als Schöpfer auch die Erschaffung des ersten Mannes, namens Locuo nachgesagt wird. Dafür soll er für einen Moment einen Spalt im Himmel geöffnet haben, woraus schließlich dieser erste Mann hervorgekommen sein soll. Der „geöffnete Himmel“ dürfte hierbei nur umschreiben, dass auch dieser Locuo nur aus einem Dilmun-System stammte. Als irdischen Sitz erkoren die Taíno den ständig wolkenverhangenen Pico El Yunque auf Puerto Rico aus, der entsprechend der weißen Dilmun-Systeme den Thron Yucáhus (= Dilmun) als „Weißes Land“ bezeichnet. Yucáhus Zwillingsbruder Guacar versteckte sich dagegen im Himmel, was ihn nicht nur mit einer Himmelsscheibe (Himmelsschale) gleichsetzte, sondern ihn namentlich auch dem kosmischen Kar-Clan zuordnete. Für Yucáhu als „universellen Architekten“ kommt deshalb nur eine Gleichsetzung mit Enlil in Frage, während Guacar mit Ninurta (Vishnu) synchronisiert werden kann. Das Ahnenkontingent der Taíno dürfte jedoch schon rein von ihrem Namen her nur aus Marduks „Danu“-Dilmun stammen.
Noch im 15. Jahrhundert n.Ch. war in Europa die Legende von einer sagenhaften Insel Antilia so verbreitet, dass man sie für die Inselgruppen der Karibik verwendete. Im Kern soll es sich bei Antilia um eine Insel mit sieben Städten gehandelt haben, die sich später auch auf die Sete Cidades in der Caatinga übertrug.
Hispaniola aus dem Weltraum. Seine indigenen Namen „Ayiti“ und „Kiskeya“ stammen aus der Asen-Zeit, als Dilmun-Systeme der Ki vor der Küste wasserten.
Gemeinfreies Bild Wikimedia Commons
Das Ganze soll sich jedoch erst während der Maurenzeit zugetragen haben, wo sieben Bischöfe aus Porto mit ihren Anhängern über den Atlantik geflohen wären. Weil es dafür keine Belege gibt, könnten die Inhalte dieser Sage noch aus der Asenzeit stammen und erst zur christlichen Missionierungszeit eine zeitgemäße Umdeutung erfahren haben. Der Inselname lässt sich dazu noch mit einem Dilmun oder Weltenei gleichsetzen, denn nach einer bekannten Theorie, die sogar Alexander von Humboldt vertrat, soll er aus dem Arabischen stammen und von „al-Tin“ oder „al-Tennyn“ abstammen, was sie als „Dracheninsel“ bezeichnet. Ein Drache symbolisierte jedoch schon seit Tiamats Zeiten nur einen Dilmun. In diesem Sinne fällt zudem auf, dass namentlich auch Antilia einen Dilmun benennen könnte, der indogermanisch von „an-dil-la“ hergeleitet, tatsächlich eine Wasser saugende Höhle beschreibt, wobei „an“ für Höhle einen deutlichen Himmels- und Asenbezug besitzt. Entsprechend heutiger Lehrmeinungen stammten die ersten Bewohner der Antillen von den Arawak in Venezuela ab, die sich ca. 1200 v.Chr. von dort aus auf das Meer hinaus wagten und zur gleichen Zeit bereits Hispaniola erreichten. Ob dieser Zeitrahmen und diese Theorie überhaupt so stimmen, wage ich jedoch zu bezweifeln, denn das benachbarte Kuba kann sogar bis zu 10000 Jahre alte Besiedlungsspuren vorweisen!
Auf eine sehr alte Besiedlungszeit weisen zudem die präkolumbianischen Namen Kuba und Haiti hin. Von ihnen erfuhr sicher schon Kolumbus, trotzdem gab er den Inseln neue Namen, wovon sich jedoch nur das verballhornte Hispaniola bis heute halten konnte. Im westlichen Teil Hispaniolas blieb hingegen der karibische Name „Ayiti“ (Aiti) so präsent, dass sich heute der Staatsname Haiti davon ableitet. Nach der Sprache der Taíno (Taén), den Ureinwohnern dieser Insel, soll er „bergiges Land“ bedeuten, was sich als relativ späte Gleichsetzung erweisen könnte. Denn wenn wir das Altnordische Wörterbuch bemühen, erfahren wir, dass die Silbe „āi“ für „Stammvater“ steht. Als Kurzname könnte er sogar auf „Ea“ weisen, was sich wiederum mit den Ki und dem anderen indigenen Inselnamen „Kiskeya“ verknüpfen lässt. Genaugenommen mit einer künstlichen Insel der Ki, die als Dilmun weithin sichtbar vor der Küste stand. Über die Taén oder Taíno würde das nur „Danu“ bestätigen, der von Marduks Beinamen Manu her, vor der Halbinsel Samaná gestanden haben könnte. Das benachbarte Puerto Rico haben die Arawaken dazu „Borikén“ genannt, was lautsprachlich als Richtername gedeutet werden kann.
Seit 2001 hat sich sogar bestätigt, dass die größte Karibikinsel Kuba eines der größten Unterwasserrätsel vor seiner Westküste besitzt. In ca. 600 m Tiefe wurden dort ausgedehnte megalithische Strukturen entdeckt, die so ungewöhnlich waren, dass sie von den Forschern Zalitzki und Weinzweig als versunkene Stadt interprediert wurden. Weitere Forschungen deuten auf imposante Kreisstrukturen und Pyramiden hin, wie sie zum Beispiel in Teotihuacan erbaut wurden. Im Areal der Unterwasserstadt wurden dabei einige der verbauten Megalithen aus Granit untersucht, die alle noch eine auffällige glatte Oberfläche vorweisen können. Weil für solche Strukturen keine Fische in Frage kommen, hält man sich bisher mit Spekulationen bedeckt, denn auch dieser Fund würde das heutige Weltbild zerstören. Nach Wikipedia war der beteiligte Meeresbiologe Manuel Iturralde zuerst der Ansicht, dass es 50000 Jahre (!) gedauert hätte, bis die vormals an Land errichteten Megalithstrukturen im Wasser der Karibik versunken wären. Aus konventioneller irdischer Sicht kämen aber dafür nur die gern bemühten Cro Magnons in Frage, vorausgesetzt sie wurden von versierten Experten in Großsteinbauweise unterrichtet. Nicht ganz so extrem ist hingegen der BBC Bericht, wonach die Strukturen nur ein Alter von 6000 Jahren aufweisen. In diesem Fall kämen zur Herrschaftszeit Anus nur Kata-Clans und Kar-Kriegerkasten in Frage, die sich auch in Nord- und Südamerika nachweisen lassen.
Nach dem heutigen Stand nannten Kariben und Taíno (Taén) die Insel „cuban“ oder „cubana“, was an einen Asenort erinnert, dessen Name von Kubera und „Nanna“ abgeleitet wurde. Im Wortschatz der Arawak finden sich sogar noch Toponyme wie „kubaannakan“ oder „cubanacán“, die Kubera und „Nanna“ als Gefäß Anus beschreiben könnten. Damit wäre zwar ein recht ferner Ort gefunden, wo Anu, als Ravana wirkte, es wirft jedoch auch die Frage auf, wieso in dieser Gegend Anu eine Stadt errichten ließ. Denn wenn schon die größte Insel der Karibik nach dem „Nanna“-Dilmun benannt sein könnte, muss sich in seiner Nähe ein lohnenswertes Süßwasserreservoir befunden haben. Kuba kann in dieser Hinsicht kaum etwas vorweisen, doch schaut man nach Nordamerika, kommt dort nur die Mündung des Mississippi in Frage. Was nicht passt, ist die Entfernung zwischen der kubanischen Halbinsel Guanahacabibes und dem heutigen Mississippi-Delta. Und doch erklärt sich dieser Standort, wenn wir uns die Küsten der Karibik zur Eiszeit anschauen. So sind die Ausgänge des Mexikogolfs wesentlich schmaler gewesen als heute, weshalb durchaus ein Dilmun-Standort vor Guanahacabibes Sinn machte. Nach den Taíno galt dazu die Gottheit Atabey als „Göttin des Süßwassers“, während Yúcahu als Meeresgott fungierte. Als himmlischer Architekt (=Enlil) soll Yúcahu aus Edelsteine vier Sternenwesen erschaffen haben, die als Racuno, Achinao, Sobaco und Coromoauch überliefert, den vier Dilmun-Systemen der Asenzeit entsprechen könnten.
Die Halbinsel Guanahacabibes mit seinem vorgelagerten Schelfsockel. Vor seiner Küste wurde eine versunkene Megalithenstadt entdeckt, deren Alter man zurzeit auf 6000 Jahre schätzt. Im Internet existieren entsprechende Unterwasseraufnahmen.
NASA-Bild ISS025-E-13557
Bild mit freundlicher Genehmigung der Earth Science and Remote Sensing Unit des NASA Johnson Space Center
Auf Guanahacabibes hielt sich dazu noch zu Kolumbus Zeiten das Volk der Guanajatabey (auch Guanahatabey) auf, mit denen sich der Taíno-Dolmetscher nicht unterhalten konnte. Spanische Konquistadoren beschrieben dieses Volk als „Höhlenbewohner“, die sich nur von Fisch ernährten. Die Guanajatabey sollen aber vor den Aufstieg der Taíno überall dort in der Karibik gesiedelt haben, wo diese später die Macht übernahmen. Archäologen sehen deswegen die Guanajatabey als Überlebende einer sehr viel älteren Kultur an, die sich meines Erachtens auf die Kasten eines früheren Kata-Clans bezogen. Wegen Ravanas (Anu) Herrschaft über Kuba, dürfte dieser Clan einer Kar-Kriegerkaste unterstanden haben, die mit dazu beitrug, dass die Nachkommen dieses Clans Kariben genannt wurden. Dass die Kariben zuerst nur Kata-Kasten entstammen, erzählt auch der Name des nahen Yucatan, was womöglich zuerst von den Überlebenden der versunkenen Megalithenstadt besiedelt wurde. Denn wer auch immer von Kubas Westküste Richtung Mexiko in See sticht, trifft dort zuerst auf die Küste Yucatans, dessen nordöstlichstes Kap „Catoche“ heißt.
DER BIMINI-FLORIDA KOMPLEX
Warum Entdeckungen, wie die 600 Meter tief unter Wasser liegende Megalithenstadt vor Guanahacabibes, im Schatten der offiziellen Berichterstattung bleiben, dürfte den allermeisten einleuchten, denn nichts ist gefährlicher, als unser heutiges Weltbild zu gefährden! Dabei ist es völlig egal, dass das Fundament dieses Weltbildes auf einem völlig unsinnigen Konstrukt errichtet wurde, dass noch mehr unbeantwortbare Fragen generiert. Den Fragesteller speiste man meistens mit Floskeln ab, wie ungeklärt oder im Falle mehrerer Theorien mit umstritten, ohne sich irgendwo festlegen zu müssen. In diesem Sinne wurde auch mit der umstrittenen Mauer von Bimini verfahren, wo sich bisher noch immer genügend Stimmen finden, dieses J-förmige Konstrukt als natürliches Phänomen zu erklären.
Angesichts der weltweiten Asenpräsenz, könnte wegen Nan Madol und Insaru auf Lelu zur Asenzeit der Metallgehalt der Meere vielleicht höher gewesen sein, als er sich heute darstellt, wozu sicher ein weiterer Meerwasserfilter vor Bimini beitrug. Welchen Effekt die Bimini-Mauer dabei erzeugte, erkennt man an ihrer parallelen Lage zur Insel, wo das Wasser des Golfstroms künstlich vorbei gepresst wurde. Hinter dieser Mauer zur Insel hin, darf man deshalb einen Standort von „Nanna“ in seiner Funktion als Meerwasserfilter vermuten, wobei der heutige Mauerrest nur das Fundament einer damals viel höheren Konstruktion gewesen sein muss. Hundertprozentig beweisen lässt sich das natürlich nicht mehr, doch die einzigartige Lage am Rand des Golfstroms lässt kaum Spielraum für konventionelle Deutungen, wonach Bimini der Standort eines vorzeitlichen Hafens wäre.
Wie bei Frank Joseph „Der Untergang von Atlantis“ zu lesen, passt hierzu auch die Namensdeutung der früheren Lucayan-Indios dazu, die Bimini „Ort des Kranzes“ oder „Ort der Krone“ nannten, was überwiegend von einem rundlich strukturierten Objekt abgeleitet sein muss. Joseph bringt noch eine eigene Interpretation mit ein, wonach Bimini sogar vom altägyptischen Wort „baminini“ abgeleitet sein könnte, was „Ehre sei der Seele des Min“ bedeuten soll. Ob das so stimmt, lässt sich wohl heute nicht mehr klären, der Bezug zu Min weist jedoch auf Marduk, was zumindest auf jene Dilmun-Systeme verweist, die ihm als Ase und späteren Asari längere Zeit direkt unterstanden. Die Lucayan kannten dazu mit „Guanahani“ noch einen weiteren Bimini-Beinamen, der mit „Insel der Menschen“ übersetzt, auf die Fähigkeiten eines Dilmuns anspielt, menschliche Ahnenkontingente zu erschaffen. Lautsprachlich weist es jedenfalls recht eindeutig auf „Nanna“. Für offensichtlich aus Meerwasser gefiltertes Gold lässt sich sogar eine Spur zu Sitchins Übersetzung aus seinem Buch „Versunkene Welten“ zurückverfolgen, wo er das aztekische Wort „Teocuitlatl“ für Gold mit „Ausscheidung der Götter“ übersetzte. Wegen ihres Wassergottes „Atl“, kann es aber genauso gut mit „Ausscheidung des Wassers“ übersetzt werden!
Für eine Asenpräsenz auf Bimini spricht auch der frühere Name für die Bahamas, die nach dem Arawaken-Stamm der „Lucayan“ oder besser „Lukku-cairi“ benannt wurden. Besonders der Inselbegriff „Cairi“ fällt hier auf, der deutlich am altwalisischen „Cair“ für Festung oder Zitadelle angelehnt ist und über ganz Britannien und Irland verbreitet ist. Über diesem Großraum herrschte ein Ase, der Lugus genannt, Bezüge zu einem Raben-, Eid- und Lichtgott aufweist und sich namentlich über Luc und Luk mit dem irischen Schmiedegott Lugh vergleichen lässt. Dass sich hinter all diesen Namen nur ein Ase verbirgt, kann man auch mit dem Beinamen „Lamhfhada“ des Sonnengottes Lugh deuten, den man mit „der mit dem langen Arm“ deutet. Hinter dieser Umschreibung verbirgt sich jedoch nur seine Erscheinung in einer Himmelsscheibe, die eine Himmelssäule als langer Arm über einen Dilmun generieren konnte. Dazu passt noch sein einäugiger Vater Balor, dessen böses Auge die zerstörerische Kraft der Sonne entwickeln konnte. Damit entsprach er dem vergöttlichten Saugkopf einer Himmelsscheibe, der mittels Feuersäulen Bodenziele ausbrennen oder verflüssigen konnte. Mit seinen Geschwistern Indech und Elatha gilt Balor als ein Kind des Domnu, der gemeinhin als Gegenstück für die altirischen Muttergottheit „Danu“ angesehen wird. Mit „Danu“ ist jedoch nur der Dilmun Marduks gemeint, der von Manannan mac Lir, als Meeresgott verkörpert, „Domnu“ als weiteren Name für eine der vier Himmelsscheiben offenbart.
Als Gegenargumente einer künstlichen Mauer wird bisher angeführt, dass die Bimini-Mauer auf einen Korallenriff steht, was nur wenige Jahrhunderte alt sein soll und noch die bisherige Ansicht, dass die Bahamas von den Lucayan-Arawaken erst im 4. Jahrhundert besiedelt wurden. Zu den Korallenriffen sei jedoch schon bemerkt, dass sie durchaus mehrere Jahrtausende alt sein können, so etwa vor Island oder Norwegen, wo einige auf 8000 Jahre bestimmt wurden. Welche Rolle hingegen die Besiedlung der Bahamas durch die Lucayan-Arawaken spielen soll, erschließt sich für Bimini nicht wirklich, denn dann müssten sie ja auch über die Technik verfügt haben, ein solches Megalithkonstrukt zu errichten. Für sie selbst allein wäre es zudem eine völlig sinnlose Anlage gewesen, wenn sie selbst nur mit Kanus das Meer befuhren.
Für mich stellt deshalb die Unterwassermauer von Bimini einen letzten Rest einer Anlage dar, die einst einen zwischen Doppelmauer und Insel befindlichen Standort „Nannas“ als Meerwasserfilter, vor den regelmäßigen Sturmfluten der Hurrikan-Saison schützte. Gleichzeitig führte sie ihm das von Süden kommende Golfwasser zu, das immer den gleichen hohen Metallgehalt besaß. Mit noch weiteren Unterwasserartefakten vor Bimini und technisch interpretierbaren Funden auf Florida, können wir sogar von einem zusammengehörigen Komplex sprechen, wo nicht nur Gold oder Platin aus dem Golfstrom gefiltert wurde. Der wichtigste Bezugspunkt dürfte dabei die Megalithenstadt vor Kubas Westküste gewesen sein, von wo aus kleinere Mengen des Meeresgoldes auf das nahe Festland gelangt sein werden. Daran erinnern besonders entsprechende Spiegel der Azteken, die aus einer Gold-Platin-Legierung bestehend, dem Spanier Cortez geschenkt wurden. Sie selbst konnten beide Metalle nicht trennen, woran man auch erkennen kann, welch unglaublicher Fund die Platinkisten auf Ponape im Westpazifik darstellten.
Zum sogenannten Bimini-Komplex muss nach meiner Meinung auch der Lake Okeechobee gehört haben, wo man in seiner Nähe ringförmige Kanalsysteme feststellte. Die Anlagen ähneln riesiger Wagenräder, wo Kanäle, wie die Speichen eines Rades, ein inneres Zentrum mit dem äußeren Ring verbinden. Bisher konnte man sich noch keinen Reim darauf machen, was sie bedeuten, doch zusammen mit den auch in Florida hinterlassenen künstlichen Mound-Hügeln, werden diese Wagenräder nur das Sonnenrad eines Dilmuns symbolisieren, während die Mound-Hügel von seiner damals bekannten äußeren Form abgeleitet wurden. Das betrifft übrigens jeden nordamerikanischen Mound, die alle auf Dilmun-Standorte vor den Flussmündungen dieses Kontinents zurückgehen. Sehr interessant ist auch, dass der Lake Okeechobee erst vor 6000 Jahren entstand, wo zeitgleich noch Anus Stadt vor Kubas Küste existierte! Seine rundliche Form lässt noch vermuten, dass die Asen das alte Kalksteinbecken des Sees künstlich erschaffen haben, wie wir es vergleichsweise von den Baggerseen heutiger Braunkohletagebaue kennen.
In früherer Zeit wurde der See auch Lake Mayaca genannt, weil an seinen Ufern ein gleichnamiger schwarzköpfiger Indianerstamm siedelte. Sein Name wird jedoch kaum zufällig auf die Maya auf Yucatan und Kuba bezogen sein. Nach der Sprache des Hitichi-Stammes wird Okeechobee heute mit „Großes Wasser" übersetzt. Doch indogermanisch übersetzt, kann das sonst für „Wasser“ stehende „oke“ auch mit Auge („okᵘ“) übersetzt werden, was besonders vom Himmel herab so wahr genommen wird. Weil das aber keine Rolle für die frühen Bewohner Floridas spielte, könnte sich der „Augensee“ als künstlich erschaffener Dilmun-Standort auch auf ein Himmelsauge bezogen haben, was von der regelmäßigen Präsenz einer Himmelsscheibe erzählt. Als wichtiges Namens-Puzzle darf deshalb der zum Okeechobee führende Kissimmee angesehen werden, dessen Name bis heute nicht geklärt ist. Er lässt sich jedoch recht einfach auf die Ki beziehen, wobei das indogermanische „k̑ īs̆n“ für Säule, einen vermuteten Dil- ōmun-Standort im See bestätigen könnte. Gleiches ist auch über das altnordische Wort „sīma“ für Tau oder Seil möglich, was ebenfalls die Deutung einer Himmelssäule erlaubt. Im Endeffekt stellt deshalb der Lake Okeechobee ein künstlich erschaffenes Süßwasserreservoire dar, dass regelmäßig von einem Dilmun-System abgesaugt wurde.
Zum Bimini-Florida-Komplex müssen auch die Megalithstrukturen von Andros gezählt werden, deren Funktion noch nicht erkannt wurde. Bereits 1957 hatte Dr. William Bell eine Unterwassersäule südlich von Bimini entdeckt, die er als Obelisk bezeichnete. Er fotografierte sie, die nachfolgend David Zink in seinem Buch abbildete. Wie Bell berichtete, gingen vom Obelisken noch immer Strahlungsphänomene von ultraviolettem Licht aus, weshalb der 18 Meter große Obelisk durchaus eine Art Energieempfänger für die Inselanlage gewesen sein könnte. So soll Bell nach dem Tauchgang auch mehrere Male Nasenbluten gehabt haben, was vielleicht von einer hohen Strahlungsdosis verursacht wurde. Besonders die kurzwellige UV-Strahlung ist sehr energieintensiv und nachweislich gesundheitsschädigend. Zu den Bimini-Strukturen gehört auch ein Kreis aus 44 Säulenresten westlich der Insel, die insgesamt genauso alt, wie der Lake Okeechobee geschätzt werden.
Mit dem Hintergrund der Dilmun-Technologie bieten sich deshalb für die Etymologie der Bahamas und der Insel Bimini noch zwei völlig neue Herleitungen an, wo wir zunächst den Archipelnamen vom altnordisch-germanischen Kompositum „ba-hamāss“ ableiten könnten, was „leuchtendes Knie der Asen“ bedeutet. Dass sich hinter diesem Knie nur ein Dilmun und eine Variante des globalen Kniegeburtsmythos verbergen, konnte ich bereits über das Dilmun-Synonym „Sampo“ aus dem Kalevala in „Diener und Krieger“ erläutern.
Es offenbart sich wohl auch, dass sich dieses „ham“ einer ganzen Wortfamilie aus Dilmun-Elementen zuordnen lässt, wo etwa das germanische „hamla“ für Stock als Wassersäule präzisiert werden kann und davon gleichzeitig „hams“, für Schlangenhaut und Fruchtschale abgeleitet wurde. Nicht zu vergessen der Hammer („hamara“), der Thor zugeordnet, von einer Speiche des Sonnenrades abgeleitet wurde. Mit Hilfe der Dilmun-Technologie gelänge sogar die Herleitung Biminis von „bi-māni“, was nicht nur für „weißer Mond“ stehend, einen Dilmun vor der Insel beschreibt, sondern gleichzeitig über Mani den Bezug auf Min bestätigt, die beide wieder für Marduk stehen. In Bezug auf den zu identifizierenden Meerwasserfilter, bedeutet das aber nichts anderes, als das nur „Nanna“ aus dem Meerwasser vor Bimini Metalle gewann und damit alle entdeckten Megalithanlagen nur sekundärer Bedeutung sind.
Welche typischen Spuren die Asen-Clans zwischen Bimini und Florida noch hinterließen, erzählt die Legende um die „Duharho“, einem hellhäutigen bis zu 2,40 Meter großen Hünenvolk, auf das der Konquistador Lucas Vázquez de Ayllón 1520 in Florida stieß. Für die Herkunft ihres Ahnenkontingents kommt wiederum nur „Nanna“ vor den Küsten Nordamerikas in Frage.
Auch die kriegerischen Ais und Tequesta an der Ostküste Floridas sollen von ihnen abstammen, wobei besonders der Name Ais, sie als Asen-Abkömmlinge offenbart. Unter den Ureinwohnern kursierte zudem die Legende von einem Stamm aus „Rotschöpfen“, der die Golfküste bis nach Texas hinunter besiedelte. Die Duharho sollen auch ihr ganzes Land so bezeichnet haben, wobei sich ihr Name auf den altnordischen Riesen „Dūrnir“ beziehen könnte. Die sogenannten „Hallen“ dieser Riesen lassen sich dazu mit dem Inneren eines Dilmuns gleichsetzen, weshalb „Duharho“ vom germanischen „tu-harjo“ abgeleitet, eine „starke Kriegerschar“ beschreibt, die einst als Asen-Kriegerkaste von einem Ahnenkontingent aus „Nanna“ abstammt. Auch in Kalifornien könnten die Duharho ihre Spuren hinterlassen haben. So hat ein gewisser Howard E. Hill berichtet, dass ein Dr. F. Bruce Russel 1931 nahe dem Death Valley 2,40 Meter große Mumien entdeckte. Es wurden aber nur männliche Wesen gefunden.
In Silver Springs nahe Ocala wurden sogar 2500 Jahre alte Gebeine eines über zwei Meter großen Menschen gefunden, was noch bestätigen könnte, dass die gesamte Halbinsel Florida von den Abkömmlingen einer Asen-Kriegerkaste kontrolliert wurde. Deswegen darf auch zu Recht bezweifelt werden, ob der Stadtname „Ocala“ tatsächlich „große Hängematte“ bedeutet. Vielmehr wird Ocala aus „okᵘ“ für Auge und „la“ (Wasser) zusammengesetzt sein, was als „Auge des Wasser“ den Saugkopf einer Himmelsscheibe beschreibt und so erneut einen Dilmun-Standort im Lake Okeechobee belegen würde.
Bimini aus über 9000 m Meereshöhe. Westlich der Insel befinden sich die Reste von Unterwasserstrukturen, die wie vor Nan Madol zu einer Meerwasserfilteranlage gehörten.
Bild von JesseG für Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0
Zentral in Florida der rundliche Lake Okeechobee. Er ist erst 6000 Jahre alt und könnte zum Bimini-Florida-Komplex gehörend, künstlichen Ursprungs sein. Zwischen den Inseln der Bahamas und Florida „rauscht“ der Golfstrom hindurch.
Gemeinfreies Bild Wikimedia Commons
Bild mit freundlicher Genehmigung der Earth Science and Remote Sensing Unit des NASA Johnson Space Center
Rund um Ocala im Marion-Distrikt fand man auch seit den 1940er Jahren sensationelle fossile Reste von Pferden, Teleoceras-Nashörnern, Faultieren und Krokodilen. Die entdeckte Pferderasse hatte mit einem sehr breiten Maul eine auffällige Eigentümlichkeit. US-Forscher David Webb verglich dieses Maul mit einem Rasenmäher, weil es so in der Lage war unglaubliche Mengen an Gras abzuweiden. Der eindrucksvollste Fund war dazu die größte Mastodon-Art der Erde, dass 12 m Schulterhöhe maß. Möglicherweise wurde es als Fleischlieferant von den ersten menschlichen Asen-Clans auf Florida genutzt, wobei heute allgemein bekannt ist, dass nach einem Fund in Indiana das amerikanische Mastodon erst 7000 v.Chr. ausgestorben sein soll. Das heißt im besten Fall könnten sie in abgelegenen Regionen noch bis zur Bronzezeit überlebt haben.
Die Elefantendarstellungen der Maya auf Stelen in Palenque oder auch als Priestermaske und in Handschriften, werden deshalb nur das Mastodon zeigen, weil sie es im 3. Jahrtausend v.Chr. noch selbst in Florida kennengelernt haben. Bezogen auf die Taén (Taino) und die Maya auf Kuba (Mayabeque) und Florida (Mayaca), muss deshalb ihre Herkunft ausschließlich mit früheren „Danu“-Standorten in der Karibik verknüpft werden. Das lässt wiederum eine Verbindung zu den mythischen Wanderungen der Hopi zu, die wegen ihrer Verwandtschaft zu den Maya, einen sicher wesentlich kürzeren Weg nach Arizona zurücklegten. Wegen ihrer relativ jüngeren Herkunft vor ca. 6000 Jahren, spielen deshalb auch Eiszeitliche Elefantenfunde auf Yucatan keine Rolle, wie sie etwa Prof. Dr. Wolfgang Stinnesbeck von der Universität Karlsruhe in einem Beitrag auf www.uni-heidelberg.de. beschreibt. Wegen ihrer Abstammung von farbigen Ahnenkontingenten aus „Danu“, kommt nicht einmal der Import des Elefantenmotivs aus Südostasien in Frage.
Neben dem Elefantenphänomen in Mittelamerika haben die Asen-Clans noch ein weiteres großes Rätsel hinterlassen. Östlich der Bahamas in der Sargassosee, befindet sich bis heute das Laichgebiet der europäischen Aale, deren aufwendige Wanderung schon immer als eines der größeren Naturwunder angesehen wird. Nach einer der vielen Theorien, soll die Sargassosee zur Zeit des Urkontinents „Pangaea“ zuerst das Delta eines riesigen Urstroms gewesen sein, wo der Aal seit seiner Existenz leichte. Er soll diesen Ort sogar noch dann genutzt haben, als er längst Teil des ständig größer werdenden Atlantiks wurde. Alternativ könnten jedoch nur die Asen den Aal in wesentlich jüngerer Vergangenheit als Speisefisch gezüchtet haben. Die auffällige Wortähnlichkeit zwischen Aal und Alalu könnte dabei auf seine Verbannungszeit zurückweisen, als er mit „Nanna“ die Erde mit seinen Kata-Clans besiedelte. Genaugenommen könnte dieser ungewöhnliche Speisefisch eine der frühesten Züchtungen der Asen auf der Erde gewesen sein, wobei der irdische Aal von einer ähnlichen Fischart von Asar abstammen könnte. Anschließend wurde er mit „Nanna“ über nur wenige ausgewählte Bereiche der Erde verteilt, die sich immer in der Nähe früherer Meeresfilteranlagen nachweisen lassen. So etwa in der Celebessee vor der Haustüre des früheren Subkontinents Kasskara, wo der pazifische Aal sein wichtigstes Laichgebiet besitzt. Bezogen auf das östlich davon befindliche Nan Madol befinden sich östlich von Japan, den Fidschis und im Bismarck-Archipel zwar noch drei weitere Laichgebiete, doch nur die Celebessee grenzt nördlich an Mindanao, was namentlich nach Marduks „Danu“-Dilmun und seinen Beinamen Min benannt sein könnte. Für die restliche Welt war es das bereits, denn trotz ähnlich günstiger Lebensbedingungen hat es der Aal weder in den Südatlantik oder an den Küsten des amerikanischen Doppelkontinents geschafft.
„NANNA“ IN DER AZTEKISCHEN MYTHOLOGIE
Lässt sich „Nanna“ vielfältig und sogar namentlich an den Küsten der Karibik nachweisen, lädt uns das erneut ein, sich intensiv mit der aztekischen Mythologie und ihren Gottheiten zu beschäftigen. Die große bekannte Zahl an bekannten Gottheiten schreckt dabei keineswegs ab, denn es reicht bei weiten aus, wenn man sich nur mit den Gottheiten der Unterwelt Mictlán beschäftigt. Auch diese Unterwelt bezieht sich in Wahrheit nicht auf vorgebliche unterirdische Regionen der Erde, sondern steht für ein tatsächlich existierendes Totenreich, wo alle lebendigen Wesen durch einen vorbestimmten natürlichen Tod sterben. Auf den gesamten Planeten bezogen, befand sich dieser aus dem Blickwinkel der Asen „unter“ ihnen, das heißt von den Sitzen ihrer erdumkreisenden Habitate aus.
Deckungsgleich mit der von mir ermittelten Anzahl Asen, herrschten über der Unterwelt Mictlán nur 13 Gottheiten, die sich dazu auch allesamt mit der Dilmun-Technologie verknüpfen lassen. Angeführt wurde das Unterweltpantheon von zwei Schöpfergottheiten, die als Omecíhuatl und Ometecuhtli überliefert, auch alle anderen Gottheiten zeugten. Unter ihren ebenfalls bekannten Beinamen Tōnacātēcuhtli und Tonacacihuatl finden wir bereits einen ersten lautsprachlichen Hinweis auf die Kata-Ära, die wir entsprechend den aztekischen Zeitaltern, mit dem der Ersten Sonne gleichsetzen können. Auf Tōnacātēcuhtli bezieht zudem eine These, wonach sich sein Name auf ein „Herrenhaus des Herrn der Fülle“ beziehen soll, was wir ohne weiteres mit dem „Nanna“-System gleichsetzen können.
Der wichtigste Grund für diese Gleichsetzung ist die aztekische Schöpfungsgeschichte, die wie in Indien oder Mesopotamien, von vier gelandeten Dilmun-Systemen erzählt. Von den zwei Urgöttern stammen dementsprechend vier bekannte Gottheiten ab, die sich als Tezcatlipoca, Quetzalcoatl, Huitzilopochtli und Xipetótec alle an der Schöpfung beteiligten. Das sich auch die aztekische Schöpfungslegende zuerst auf das Wasser der Erde bezieht, vermittelt die Unterweltgottheit Chalmecatl als „Herr des Wassers“. Die Schöpfungslegende berichtet zudem, dass erst nach 600 Jahren der Inaktivität Tezcatlipoca und Quetzalcoatl begannen ein vertikales und horizontales Weltall zu erschaffen, was sich in dieser Form recht auffällig an dem indischen Mythos von einem vertikalen und horizontalen Triloka anlehnt! Das aztekische vertikale Universum bestand dazu noch aus zwei unterschiedlich hohen Teilsphären, wobei die höhere von vier Weltenbäumen im Wasserreich Tlalocs, dem paradiesischen Tlalocán gestützt wurde. Damit wird an dieser Stelle bestätigt, dass auf der Erde vier Dilmun-Systeme standen, über denen regelmäßig vier Himmelssäulen wirbelten.
Statt sich also wie noch Alexander Braghine mit möglichen Atlantiküberquerungen der Phönizier oder gar den Karthagern zu beschäftigen, kann man die Rätsel der Karibik-Etymologie wesentlich besser mit den Namen und Mythen mesoamerikanischer Gottheiten lösen. Dabei kommt heraus, dass sie nicht nur von der Dilmun-Technologie vor den karibischen Küsten erzählen, sondern auch von den davon abgeleiteten Gottheiten, die sich auf einzelne Elemente beziehen. So wie etwa Chicomecoatl, die mit „Sieben Schlangen“ übersetzt, auf dem Verschluss eines dreibeinigen Ki-Dilmuns verweist. Gleichzeitig erinnert sie auch an Ninurtas „sieben Winde“, wenn er sich mit seiner Himmelsscheibe dem Soma eines Dreifuß-Dilmuns bediente.
Zu den Fruchtbarkeitsgöttinnen gehört auch die mit „Schlangenfrau“ übersetzte Cihuacoatl, die mit zwei Schlangen dargestellt wird. Im Schlangenwort „coatl“ befindet sich zudem wieder jenes mythische „Atl“, das als aztekische Wassergottheit der Namensgeber der „Atlan“-Siedlung und des Atlantiks sein wird. Beachtet man dazu noch, dass im klassischen Nahuatl das Wort „hua“ mit Besitzer gedeutet wird, kann Cihuacoatl in der Rechts-Links-Lesung sogar mit „Wasserschlangen der Ki“ übersetzt werden. Das wirft auch ein erhellendes Licht auf die angeblichen 1600 Götter, die allein den Azteken nachgesagt werden. Nach einer Hypothese soll es sich dabei um Gottheiten der von den Azteken unterworfenen Stämme gehandelt haben, dem ich mich wegen ihres bekannten Geburtsmythos nicht anschließe. So gilt zunächst Chicomoztoc als ihr mythisches Ursprungsland, wo es als „Ort der sieben Höhlen“ überliefert ist. In diese Höhlen warf wieder eine Göttin ein riesiges Feuersteinmesser hinein und womit sie die Geburt (!) von 1600 Gottheiten vollendete. Rein von den Dimensionen her, wird deshalb dieser besondere Verband für mindestens ein Ahnenkontingent der Asen stehen, das nur in einem Dilmun unter den Ki erschaffen wurde.
Von einem Dilmun vor Mesoamerika erzählt auch der Titel einer mythischen Flutgeschichte der Orinoco-Indios, die Catena-Ma-Noa genannt, mit „Wasser des Noa“ übersetzt wird. Das ganze weist nicht nur begrifflich auf „Nanna“ und den dort erschaffenen Kata-Clans, sondern berichtet noch von einer „vergoldeten“ Inselhauptstadt, die einst im Meer versank. Dass es sich dabei um „Nanna“ handelt, kann man am Namen des Helden Nata erkennen, hinter dem sich nur ein Ase, als zeitweiliger Besitzer dieses Dilmuns verbirgt. Eine ähnliche Dimension weist auch der Codex Chimal Popoca auf, der unter anderem über das „Zeitalter der fünf Sonnen“ berichtete. Wie ich schon im ersten Teil „Diener und Krieger“ herausgearbeitet habe, handelt dieser Mythos nur von frühen mesoamerikanischen Dilmun-Standorten. Die Gottheit Tezcatlipoca beschreibt namentlich als „Rauchender Spiegel“ einen Dilmun, dabei fällt noch der belegte Herrschername Chimal Popoca auf, der als „Rauchender Schild“ ebenfalls diesen Hintergrund bedient.
Dass in dieser Hinsicht der aztekische Schöpfungsmythos nicht enttäuschte, war fast zu erwarten. Im Mittelpunkt steht dabei ein Wesen namens Tlaltecuhtli, um das bis heute eine geschlechtsspezifische Diskussion geführt wird. Einerseits einen eindeutig männlichen Namen tragend, wird er teilweise noch als weiblich beschrieben. Als „Herr des Erdreichs“ gilt er zumindest unzweideutig als Weltherrscher, weswegen Tlaltecuhtli die vergöttlichte Form eines Dilmuns darstellen wird. In seiner Darstellung als krötenähnlicher Alligator lässt er sich jedoch gut mit der altägyptischen Gottheit Sobek verknüpfen, hinter dem niemand anderes, als Osiris (Anu) steht. Bei den Azteken lässt sich diese Gottheit mit dem Richter Cihuacoatl, als männliche Gottheit und „weibliche Schlange“ gleichsetzen, mit Tonantzin als kröten- oder schlangenförmige „Göttermutter“ oder auch dem Sonnengott Tonatiuh, der als tauchender Adler oder waffentragender Krieger unzweideutig für einen Wächter steht. Sieht man diese Assoziationen noch als Teile eines größeren Ganzen an, haben wir hier auch die typischen Elemente eines Dilmun-Systems vor Augen, dass man namentlich nur als „Nanna“ aus Tonatiuh und Tonantzin herauslesen kann. Mit gespreizten Armen und Beinen dargestellt, symbolisiert diese Pose dazu nichts anderes, als dass Tlaltecuhtli auf vier Standbeine stand.
Im Schöpfungsmythos wird Tlaltecuhtli als gefräßiges Monster geschildert, dass seit Anbeginn der Welt auf der Erde stand und dort auch als Geburtsort aller Lebewesen fungierte. Trotzdem sollen eines Tages Quetzalcoatl und Tezcatlipoca als Schlangen vom Himmel herabgereist sein, um angeblich Tlaltecuhtli ausgiebig zu kontrollieren. Auch wenn hier nur der regelmäßige Somatransfer aus einem Dilmun beschrieben wurde: die beiden Gottheiten entdeckten außer in seinem Gesicht (= auf der Dilmunkuppel), auch Öffnungen an Ellbogen und Knien. Daraufhin wurde der immer mit offenem Mund dargestellte Tlaltecuhtli für unfähig erklärt, eine ordnungsgemäße Schöpfung durchzuführen. Quetzalcoatl und Tezcatlipoca zerrissen das Monster in zwei Teile, die anschließend die Erde und den Himmel darstellten. Mit dieser auch auf anderen Kontinenten bekannten Götterkampfszene, wird an dieser Stelle alles erklärt, was Augenzeugen wirklich vor der Küste beobachteten. So umschreibt dieser Mythos nichts anderes, als die himmlische Ankunft des „Nanna“ Systems auf der Erde, dass sich anschließend in Form eines Welteneies in zwei Teile aufspaltete. Dabei trennte sich die Oberseite als glockenförmige Himmelsscheibe von „Nanna“ ab und kehrte zu den Asen-Habitaten in den Orbit zurück. „Nannas“ weitere Funktionen als Nahrungsspender und Wiege der Menschheit verstecken sich hingegen hinter der göttlichen Bestimmung, wonach Tlaltecuhtlis Leib von allen Nahrungspflanzen als Nährboden genutzt wurde und gleichzeitig eine Kind gebärende Göttermutter darstellte. Die grausamen Menschenopfer sind hingegen im Wissen um die Herkunft ihrer Ahnen entstanden, die selbst den Sinn ihrer eigenen Existenz nicht wirklich begriffen.
Was hingegen recht einfach bestimmbar ist, war die Zuordnung Tlaltecuhtlis zu einer Gruppe aus vier Erdgöttern, die als Coatlicue, Cihuacoatl und Tlazolteotl überliefert, rein von der Anzahl für alle vier Dilmun-Systeme stehen. Deswegen überraschte es auch nicht, das Tlaltecuhtli noch als Seemonster beschrieben wurde, weil es wie die anderen Erdgötter in Wahrheit vor den Flussmündungen Mesoamerikas stand. Die Göttermutter Coatlicue zeigt dazu recht auffällige Bezüge zu Ištar, wobei ihr Tempel „Tlillancalli“, als „Haus des Dunkels“ recht sicher für das überwiegend lichtlose Innere eines Dilmuns stand. In der Ikonografie treten jedoch ebenfalls Gemeinsamkeiten zu Tage. So wird Coatlicue mit erhobenen Raubtierpranken dargestellt, wie wir sie in ähnlicher Pose auch von Ištar kennen, die ebenfalls einen Bezug zu Löwen besitzt. Auf dem „Qudšu“-Amulett aus Ugarit steht Ištar zum Beispiel auf einen Löwen, wobei sie in ihren Händen zwei Steinböcke hält. Als besonderes Element fallen dazu zwei hinter ihren Hüften hervorkommende Schlangen auf, die sich sichtbar kreuzen. Ähnliches findet sich auch bei Coatlicue, deren Name ohnehin mit „die mit dem Schlangenrock“ gedeutet wird, wobei bei beiden der Schlangenbezug für die Somaschöpfung steht.
Für eine gemeinsame Identität von Coatlicue und Ištar spricht auch ihr beiderseitiger gewaltsamer Tod. Das zeigt bei Coatlicue besonders eine Statue, wo sie nicht nur enthauptet dargestellt wird, sondern aus ihrem Hals auch zwei Schlangen herauskommen, die sicher für den immerwährenden Somatransfer stehen. Wegen ihrer angeblichen frevelhaften Schwangerschaft, wird sie in diesem Mythos von ihrer Tochter Coyolxauhqui und ihren anderen vierhundert „Brüdern“ angegriffen und enthauptet. Daraufhin sprang der schwerbewaffnete Sonnengott Huitzilopochtli aus ihrem Leib und tötete seine Schwester und viele ihrer Brüder. Coyolxauhquis abgeschlagener Kopf warf Huitzilopochtli anschließend in den Himmel, wo er augenblicklich zum Mond wurde. Dass hier nur von einem Standortwechsel „Nannas“ erzählt wird, beschreibt nicht nur ein weiterer Mythos, wonach Coatlicue den Mond geboren hätte (!), sondern noch der Umstand, dass die Azteken auch Nahua oder auf die Kata bezogen auch Nāhuatlācatl genannt werden. Davon leitete sich noch der aztekische Sprachbegriff Nahuatl ab, der ausgesprochen als „Na-wa“, sogar an die japanischen Ureinwohner, den „Wa“ erinnert. Die farbigen Abkömmlinge der Azteken, werden jedoch allesamt von dravidischen Ahnenkontingenten abstammen, die im 4. Jahrtausend v.Chr. noch von „Danu“ an den Küsten Amerikas abgesetzt wurden.
Hinter Coyolxauhquis vierhundert „Brüdern“ wird sich hingegen eine menschliche Kriegerkaste verbergen, wie sie nach der Kata-Ära weltweit überall von „Nanna“ an den Küsten aller Kontinente abgesetzt wurden. So auch unter seinen aztekischen Beinamen Aztlán, als „weißer Ort“ oder „Ort der Weißen“, über den zuerst Huitzilopochtli herrschte. Nach dem Schöpfungsmythos war es zudem Huitzilopochtli, der den Azteken (Nahua) befahl das weiße Aztlán als Dilmun zu verlassen, um sich eine neue Heimat zu suchen. Als Hintergrund kommt dafür nur die Zuführung farbiger Ahnenkontingente für mesoamerikanische Asen-Clans in Frage. Selbst Huitzilopochtli diente eine mythische Kriegerkaste, die sich ähnlich, wie im nordischen Walhalla-Mythos aus vormals gefallenen und wiedererweckten Kriegern rekrutierte. Von ihnen ist jedoch bekannt, dass sie sich mit ihren Schilden vor dem gleißend hellen Huitzilopochtli schützen mussten, was diese Kriegergruppe in einem anderen Licht erscheinen lässt. So lassen sich diese Schilde mit dem geöffneten Saugkopfverschluss einer Himmelsscheibe gleichsetzen, aus der zuvor eine Feuersäule herausschoss.
Trotz dieser Deutung ist er zugleich als Schöpfer des ersten Menschenpaares überliefert, womit er sich mit Marduk gleichsetzen lässt. Wegen seines Bezuges zu einem Sonnengott, wird Huitzilopochtli eher eine Verschmelzung aus mindestens zwei Asen darstellen, die allein auf „Nanna“ bezogen, sicher für einen Anteil Ninurtas sprechen. So wird er auch zu Zeiten, wo „Nanna“ nur „Sakar“ genannt wurde, diesen Dilmun vor karibischen Flussmündungen abgesetzt haben, weswegen Namen, wie der „Gott der Zwillinge“ Nanahuatzin (!) sich verewigten. Tatsächlich nur auf die beiden weißen Teilelemente des „Nanna“-Dilmuns bezogen, kannten die Azteken mit dem zapotekischen „Naa“ auch einen besonderen Adler, der relativ sicher als Wächter zu deuten ist. Sie selbst nannten diesen Adler Cuauhtli, der für den fünfzehnten Tag ihrer 20-tägigen Monate gilt.
Die Maya-Variante von Huitzilopochtli
Bild Daderot für Wikimedia Commons, CC-Zero
Als Nanahuatzins Zwillingsbruder gilt Tecciztecatl, dem als Mondgott wiederum weibliche und männliche Aspekte nachgesagt werden. Als alter Mann dargestellt, trug er eine besondere weiße Muschel auf dem Rücken, die als göttliches Gefäß beiderseits des Atlantiks einen Dilmun symbolisierte. Seine Zuordnung als „Sohn Tlalocs“ beschreibt dabei nichts anderes, als dass dieser Mondgott einen direkten Wasserbezug besaß. In ihrer ursprünglichen Zuordnung galten auch Nanahuatzin und Tecciztecatl als zwei Teile eines ursprünglich Ganzen, wobei der frühere Sonnengott Tecciztecatl mit seinen Schmetterlingsflügeln mehr den fliegenden Aspekt betont als sein Bruder. Er dürfte deshalb ursprünglich für das gesamte Weltenei (= Muschelsymbolik) stehen, mindestens aber für die einen Dilmun tragende Himmelsscheibe.
In den Überlieferungen der Azteken wird auch von Tonacatépetl, dem „Berg der Nahrung“ berichtet, aus dem der Samen des Maises und anderer Getreidesorten stammten. In dem überlieferten Mythos wird zwar berichtet, dass es die Azteken gewesen wären, wo sie selbst diese Samen lagerten, es kommen aber nur die Asen auf „Nanna“ in Frage, wo diese Getreidesorten für die Erde gezüchtet wurden. Bezeichnend ist jedenfalls, dass es im Mythos eine Azcatl genannte rote Ameise war, die Quetzalcoatl den Weg in das Innere dieses „Berges“ zeigte, wo schließlich eine Kammer entdeckt wurde, in der die Samen von Getreidesorten aufbewahrt wurden. Quetzalcoatl soll daraufhin mit diesen Samen nach „Tamoanchan“, dem irdischen Paradies zurückgekehrt sein, das man bisher als „Haus“, oder „Ort des nebligen Himmels“ deuten will. Im Mythos war es jedoch der Ort, wo die Götter die noch „kleinen Menschen“ mit Brei aus zerkauten Samen fütterten, worauf sie zu wachsen begannen. Nun viel Fantasie braucht man an dieser Stelle nicht mehr, um hier einen Dilmun zu erkennen, wo menschliche Ahnenkontingente aufgezogen wurden! Selbst Nanahuatzin mischte bei der Verteilung der Getreidesamen unter den Menschen mit, wofür er Tlaloc den Regengott zu Hilfe rief. Dieser schlug anschließend mit ihm zusammen auf diesen „Berg“ ein, um an die Kammer mit den Samen zu gelangen. Als sich endlich dieser für „Nanna“ stehende „Berg“ öffnete, verteilten die „vier Winde“ die Samen über die Erde, worauf sich die Menschheit von Mais und anderen Getreidesorten ernähren konnte.
Wo man einen Dilmun nachweisen kann, ist die dazugehörige Himmelsscheibe nicht weit. So lässt sich Tonacatépetl, als „Nanna“-Variante neben Tonantzin als Göttermutter auch der lautsprachlich verwandte Sonnengott Tonatiuh zuordnen, der als „Aufsteigender“ und „Absteigender Adler“ noch Bezüge zu einem geflügelten Wächter aufweist. Denn wegen seines ewigen Durstes und seiner Hitze, verkörperte Tonatiuh nicht nur eine Himmelsscheibe, sondern auch den dazugehörenden adlerförmigen Hybrid-Jet eines Wächters, der während des Somatransfers ständig das gesamte Dilmun-System umkreiste. Da es bei einem Wächter um ein eigenes Technologie-Element handelte, verwundert es auch nicht, dass dieser in Bezug auf Tonatiuh, mit Piltzintecuhtli einen eigenen Namen besaß, der bisher als „junger Tonatiuh“ erklärt wird.
Der im Zentrum herabblickende Sonnengott Tonatiuh als rötlich kreisendes Himmelsauge. Seine heraus hängende Zunge symbolisiert den Somatransfer der Asen, der rituell in „Blutdurst“ umgedeutet wurde.
Bild von Ancheta Wis für Wikimedia Commons, CC-BY-SA-2.5
Dem mythischen Quetzalpapálotl wurde in der Götterstadt Teotihuacan eine ganze Pyramide gewidmet, in der nur die weltweit bekannte Wächterin Inanna verehrt wurde.
Bild von Alfonso Mendoza Ramos für Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0,2.5,2.0,1.0
Huitzilopochtlis Dilmun stand zudem in mitten des flachen Texcoco-Sees, der früher als Mondsee „Meztliapan“ bekannt, ebenfalls das Wesen eines vergöttlichten Dilmun-Systems offenbart. In diesem Sinne beschreiben die Azteken ihren weißen Herkunftsort Aztlán auch als „Höhle“. Als symbolisches Äquivalent steht dafür die Sonnenpyramide Teotihuacáns, die über eine Höhle mit einer Quelle erbaut wurde! Nur jene Forscher, die diese Pyramide als Symbol einer archaischen Muttergottheit betrachten, kommen der Wahrheit am nächsten.
Bild von Xicoamax für Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0
In einer anderen Interpretation wird der adlerförmig dargestellte Piltzintecuhtli auch als „tauchender Gott“ bezeichnet, wenn er vom Himmel kommend die „Unterwelt“ (= Erde) aufsuchte. Neben dieser Wächterform stellte man Tonatiuh noch als schwer bewaffneten Krieger in mitten einer strahlenden Sonnenscheibe dar. Damit beschreibt diese Ikonografie nur die damals bekannte Herkunft mesoamerikanischer Kriegerkasten aus einem Dilmun-System. Entsprechend dieses Hintergrundes, kämpfte Tonatiuh jeden Tag gegen Tlaltecuhtli, um anschließend die Geister der gefallenen Krieger in das irdische Paradies zu bringen. Eine Szene, die sich erneut mit der Kriegerhalle Walhalla in der Nordischen Mythologie verknüpfen lässt. Im Umfeld eines Dilmuns, dürfte sich während des Somatransfers auch die Vorstellung entwickelt haben, dass eine Himmelsgottheit, wie Tonatiuh mit seiner herausgestreckten Zunge nach Menschenblut dürstete. Eine solche Vorstellung entstand wie so vieles auch nicht willkürlich aus dem Nichts, sondern nach meiner Meinung allein aus der Beobachtung des Somatransfers. Dabei spiegelte sich in den Dampfsäulen immer das Licht der roten Antriebsringe wieder, was in Mesoamerika als Menschenblut interpretiert wurde. Darauf kommt man aber nur, wenn man um die Herkunft seiner Ahnen aus einem Dilmun weiß. Entsprechend einer Soma saugenden Himmelsscheibe wurde Tonatiuh auch auf dem Sonnenstein im Templo Mayor in Tenochtitlán in der typischen Ikonografie eines Himmelsauges verewigt, wobei sein Gesicht von mehreren Kreisen umgeben ist. Einer der äußeren Kreise weist dazu acht Zacken auf, die völlig zu Recht an den Stern Ištars erinnern, der herabblickende Tonatiuh lässt aber nur die Deutung als Saugkopfverschluss seiner Himmelsscheibe zu.
Die schon im ersten Teil „Diener und Krieger“ behandelte Gründungssage von Tenochtitlán bringt es zudem an den Tag, dass der einst von Huitzilopochtli beschriebene Ort, in Wahrheit einen Dilmun als Feigenkaktus beschreibt, auf dem ein Adler, als Hybrid-Jet landen sollte. Das bemerkenswerteste Detail dieses Adlers war dabei, das er in dieser Szene eine Schlange in seinen Klauen hielt, was wir direkt mit dem indischen Garuda, als Schlangenfresser gleichsetzen können! Eine weitere Variante dieses Adlers ist zudem im Quetzalpapálotl erkennbar, dem als weiblich interpretierter Vogel oder Schmetterling eine ganze Pyramide südwestlich der Mondpyramide in der Metropole Teotihuacán gewidmet ist. Von allen dort gefunden Symbolen konnten bezeichnenderweise nur die Wassersymbole entschlüsselt werden, was wiederum sein Wesen als weiblicher Wächter eines Dilmun-Systems bestätigt. Sein auffällig kreisrundes Auge zeigt zudem einen seiner Herkunftsorte, wenn er für alle sichtbar aus dem geöffneten Saugkopf einer Himmelsscheibe herausflog oder wieder darin verschwand. Und wie überall auf der Erde steht hinter dieser einzigen weiblichen Wächtergöttin nur die auf jeden Kontinent nachweisbare Inanna.