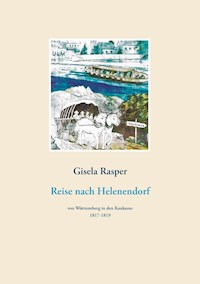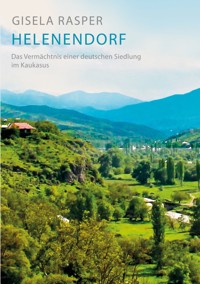
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Helenendorf, das Vermächtnis einer deutschen Siedlung im Kaukasus.
Das E-Book Helenendorf wird angeboten von BoD - Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Familiengeschichte,Schwaben im Kaukasus,Württemberger in Russland,Deutsche Siedlung im Kaukasus,Geschichte von 1817 bis 1941
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 553
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Vorwort
1. Kapitel
1819 – Die Gründung von Helenendorf
2. Kapitel
1819-1821
Der harte Alltag und Salomons Tod 1819
3. Kapitel
1821-1822
Geschichtlicher Exkurs und Maries Tod
4. Kapitel
1823-1825
Religiöse Unruhen – Umzug der Barths nach Tiflis
5. Kapitel
1826-1827
Überfall auf Helenendorfund Katharinenfeld
6. Kapitel
1828-1836
Pest und Cholera, Tod von Johann Georg Kehrer + Katharina Kuhfuß
7. Kapitel
1838 – 1852
Jakobs Neuansiedlung in Tiflis + Johann Georg Vottelers Tod
8. Kapitel
1853 – 1855
Der russisch-türkische Krieg + Bau der Kirche
9. Kapitel
1857-1864
Einweihung der Kirche in Helenendorf – erste Pastorenkrise
10. Kapitel
1865 – 1875
Fünfzigjahrfeier und zweite Pastorenkrise
11. Kapitel
1870 – 1880
Die Familien in Tiflis und der türkisch-russische Krieg 1877/
12. Kapitel
1877-1882
Rosinas Tod und Pastoren Turbulenzen
13. Kapitel
1883 – 1890
Eisenbahn – Aufschwung – Firma Vohrer
14. Kapitel
1891 – 1896
Gründung von Georgsfeld – Handelshaus Hummel
15. Kapitel
1892 – 1904
Tod von Johann-Georg Votteler – Allgemeiner Wohlstand
16. Kapitel
1907 – 1922
1. Weltkrieg und Sowjetisierung
17. Kapitel
1917-1922
Hundertjahrfeier und Konkordia
18. Kapitel
1872 – 1937
Meine Familie in Tiflis
19. Kapitel
1921- 1934
Ende der Konkordia
Verdrängung der Deutschen
20. Kapitel
1935- 19341
Das Trauma der Deportation
21. Kapitel
1930-1945
Krieg und Nachkriegszeit in Deutschland
22. Kapitel
1945 – 1955
Neuanfang in Esslingen
Vaters Heimkehr aus der Gefangenschaft.
23. Kapitel
Epilog – Helenendorfer Treffen
Gedicht vom September 1998
Verzeichnis der Bilder
Danke!
Literaturhinweis
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Kapitel: 1819 – Die Gründung von Helenendorf
2. Kapitel: 1819-1821 Der harte Alltag und Salomons Tod 1819
3. Kapitel: 1821-1822 Geschichtlicher Exkurs und Maries Tod
4. Kapitel: 1823-1825 Religiöse Unruhen – Umzug der Barths nach Tiflis
5. Kapitel: 1826-1827 Überfall auf Helenendorf und Katharinenfeld
Die Familien in Tiflis und der türkisch-russische Krieg 1877/
6. Kapitel: 1828-1836 Pest und Cholera, Tod von Johann Georg Kehrer + Katharina Kühfuß
7. Kapitel: 1838 – 1852 Jakobs Neuansiedlung in Tiflis + Johann Georg Vottelers Tod
8. Kapitel: 1853 – 1855 Der russisch-türkische Krieg + Bau der Kirche
9. Kapitel: 1857-1864 Einweihung der Kirche in Helenendorf – erste Pastorenkrise
10. Kapitel: 1865 – 1875 Fünfzigjahrfeier und zweite Pastorenkrise
11. Kapitel: 1870 – 1880 Die Familien in Tiflis und der türkisch-russische Krieg 1877/78
12. Kapitel: 1877-1882 Rosinas Tod und Pastoren Turbulenzen
13. Kapitel: 1883 – 1890 Eisenbahn – Aufschwung – Firma Vohrer
14. Kapitel: 1891 – 1896 Gründung von Georgsfeld – Handelshaus Hummel
15. Kapitel: 1892 – 1904 Tod von Johann-Georg Votteler – Allgemeiner Wohlstand
16. Kapitel: 1907 – 1922 1. Weltkrieg und Sowjetisierung
17. Kapitel: 1917-1922 Hundertjahrfeier und Konkordia
18. Kapitel: 1872 – 1937 Meine Familie in Tiflis
19. Kapitel: 1921- 1934 Ende der Konkordia Verdrängung der Deutschen
20. Kapitel: 1935- 19341 Das Trauma der Deportation
21. Kapitel: 1930-1945 Krieg und Nachkriegszeit in Deutschland
22. Kapitel: 1945 – 1955 Neuanfang in Esslingen Vaters Heimkehr aus der Gefangenschaft.
23. Kapitel: Epilog – Helenendorfer Treffen Gedicht vom September 1998
Verzeichnis der Bilder
Danke!
Literaturhinweis
VORWORT
Von Jugend an war ich fasziniert von der Geschichte meiner Familie. Zunächst waren es die Geschichten meiner Großmutter und meiner Mutter, die uns Kindern in leuchtenden Farben ihre jeweilige Jugendzeit in Georgien schilderten. Beide wuchsen in Tiflis auf, in einer deutschen Siedlung mitten im Kaukasus. Uns tat sich eine bunte Welt auf, ein Gemisch verschiedener Völker, Sprachen und Kulturen, eine exotische Welt. In dieser Kulisse wurde eine weitverzweigte Großfamilie sichtbar. Jeder hatte seine eigene Geschichte, aber im Grunde waren die meisten doch recht erfolgreich. In den über 100 Jahren nach der Einwanderung waren aus den württembergischen Kolonisten, die 1818 völlig verarmt im Kaukasus anlangten, zum Teil recht wohlhabende Bürger des russischen Zarenreiches geworden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte sich die deutsche Kolonie Neu-Tiflis, fast vollständig in das großstädtische Leben der georgischen Hauptstadt integriert. Zwar wurden weiterhin die deutschen Wurzeln gepflegt und der Kontakt nach Deutschland aufrechterhalten, aber Russland war die Heimat der Russlanddeutschen geworden. Ähnlich war es in den anderen Kolonien, nur hielt sich auf dem Land die deutsche Sprache und die deutschen Sitten etwas länger und intensiver als in der Großstadt Tiflis.
Mit der Heimkehr meines Vater 1954 aus russischer Kriegsgefangenschaft, änderte sich das Bild meiner Familiengeschichte, da mein Vater nicht aus Tiflis stammte, sondern aus Helenendorf, in Aserbaidschan., 200 km südlich von Tiflis gelegen. Da das Dorf von den anderen deutschen Kolonien ziemlich isoliert war, hatte sich hier vieles, z.B. auch der schwäbische Dialekt, reiner erhalten. Von meinem Vater erfuhr ich dann auch, wie und warum die Württemberger 1817 in den Kaukasus ausgewandert waren.
Es war eine abenteuerliche Geschichte, entstanden aus der wirtschaftlichen Not nach den Napoleonischen Kriegen, dem ständig größer werdenden Druck eines despotisch regierenden württembergischen Königs, mehrerer verheerender Missernten. Dazu kam noch zum Schluss eine immer stärker werdende religiösen Euphorie. Für uns heute ist es schwer zu begreifen, welche Anziehung die Religion damals auf den einzelnen Menschen hatte, aber auch welchen Trost sie ihm bot.
Es hatte in Württemberg schon Mitte des achtzehnten Jahrhunderts viele Menschen gegeben, die außerhalb der Kirche Trost in der Bibel suchten und fanden. Man traf sich in kleinen Gruppen und las gemeinsam die Bibel. Wer sich dazu berufen fühlte, legte sie aus. Man brauchte dazu keinen Pfarrer. Sie nannten sich »Stundenleute«, da sie sich jeweils zu ihrer Stunde trafen. Nach einer Schrift von Albrecht Bengel, der diese Gruppen »Communis Pietatis « nannte, wurden sie meist Pietisten genannt.
Die Evangelische Kirche tolerierte zunächst diese Gruppen, aber als sie immer größer und mächtiger wurden, versuchte man sie zu verbieten. Umso mehr, als sich manche sogar radikalisierten und ihre Kinder nicht mehr vom Pfarrer taufen ließen. »Ist denn vor Gott der Vater weniger wert als der Pfarrer?« sagten sie und tauften sie alleine.
Dazu kam, dass in diesen Kreisen, angesichts großer persönlicher Not, der Gedanke der » Endzeitlösung« immer mehr um sich griff. Dazu kam, dass der Philosoph und Theologe Albrecht Bengel das Ende der Welt für 1836 vorhergesagt hat. « Und diesem Mann glaubten die frommen Pietisten, weil er in seinen Schriften doch einen Ausweg aus dieser so schrecklichen Lage bot. « Viele Menschen begrüßten die Idee und hofften dadurch von ihren Qualen erlöst zu werden.
Diese pietistischen Gruppen waren die Keimzelle der Auswanderungsbewegung von 1817.Für uns heute ist das alles schwer zu verstehen, aber aus der jener Zeit heraus und der tiefen Gläubigkeit der Menschen, lässt sich dieses Verhalten nachvollziehen.
Nun gab es aber ein Problem: die in der Bibel angekündigte »Endzeitlösung« spielte in Palästina. Palästina aber gehörte damals zum osmanischen Reich und den Frommen war klar, dass die Türken keine Christen in ihrem Land dulden würden. In dieser Situation erschien eine Retterin: Juliane von Krüdener, eine baltische Adlige, die Kontakte zum Zarenhaus hatte.
In dem sie sich in Württemberg als Prophetin ausgab, bekam sie Zugang zu einigen Stunden. Und hier legte sie die Bibel etwas anders aus: Sie sagte, die Stelle in der Offenbarung, »dass die Frommen Christus in den Bergen erwarten sollten«, bedeute nicht Jerusalem, sondern die Berge des Kaukasus! Denn dort, am Berge Ararat, wo die Welt begonnen habe, solle sie auch enden. »Nicht Jerusalem sei das Ziel der Frommen,« meinte Frau von Krüdener, «sondern die Berge des Kaukasus.
Da der Kaukasus damals zum russischen Reich gehörte, sollten die Gläubigen ihr Augenmerk auf Russland richten, meinte sie. Seit über 50 Jahren war allgemein bekannt, dass die russische Regierung in ihrem Reich Ansiedlern großzügige Privilegien bot. Sie bekamen kostenlos Land, Unterstützung auf der Reise und in Notzeiten. Darüber hinaus wurden den Siedlern großzügige Kredite gewährt und Steuerfreiheit fur 30 Jahre, sowie ebenso lange Freiheit vom Militärdienst und Religionsfreiheit auf ewige Zeiten. Dazu durften sie ihre Sprache, sowie ihre eigenen Schulen behalten und sich am Ort selbst verwalten.
Wenn man bedenkt, dass zu dieser Zeit in Russland noch die Leibeigenschaft herrschte und in Württemberg ein despotischer König, der sein Volkbis aufs Letzte auspresste, dann war dieses Angebot ausgesprochen großzügig und für viele Menschen sehr verlockend
Allerdings stellte die Regierung auch Bedingungen: Nicht jeder wurde genommen, sondern nur Landwirte und die dafür notwendigen Handwerker. Dazu brauchte jede Familie, die auswandern wollte, ein Leumundszeugnis der Heimatgemeinde und den Nachweis eines Vermögens von mindestens 300 Gulden Bankassignaten. Das entspricht heute einem Wert von ca.7000- 10 000 Euro. Viele der Auswanderer besaßen noch wesentlich mehr. Wer aber das Geld nicht vorweisen konnte, wurde abgewiesen. Es waren also keine armen Leute, die auswanderten. Trotz dieser Hürden fanden sich im Sommer 1817, fast 5000 Menschen, die in den Kaukasus auswandern wollten.
Nach gründlicher Vorbereitung und Aufteilung in »Harmonien« traf man sich in Ulm an der Donau, um von hier aus bis ins Schwarze Meer, und dann über Odessa in den Kaukasus zu fahren. Diese Route auf dem Fluss erschien den Organisatoren preisgünstiger und weniger gefahrvoll als die Reise über Lübeck und die Ostsee in das Wolgagebiet, wie fünfzig Jahre vorher.
Die ersten Schiffe starteten im April 1817 in Ulm mit der Weissacher Harmonie. Im Abstand von einer Woche fuhren dann weitere Schiffe ab. Die Reutlinger Harmonie, die im August abfuhr, war die Letzte.
Dicht gedrängt, wie in einer Sardinenbüchse, saßen die Auswanderer auf diesen flachen Schiffen und fuhren die Donau abwärts bis zum Donaudelta. Diese Ulmer Schachteln, wie sie genannt wurden, bewegten sich nur durch die Strömung des Flusses fort, ohne jeden eigenen Antrieb. Daher konnten sie nur fahren, wenn sie vom Wind geschoben wurden. Sobald der Wind gegen die Strömungblies, mussten sie »Windferien« machen, manchmal Tage lang. Auf diese Weise dauerte die Fahrt bis zum Delta oftmals bis zu drei Monaten.
Im Delta, auf einer Insel bei Ismaël, verfügte die russische Regierung dann für alle Schwaben eine Quarantäne von vier Wochen, da sie das Einschleppen von Seuchen fürchtete. Dies erwies sich als böse Falle, der viele Menschen zum Opfer fielen
Vom Donau-Delta aus, fuhren die Auswanderer nach Odessa, ins Winterquartier, entweder auf dem Land- oder auf dem Seeweg. Bei ihrer Ankunft erfuhren sie, dass die russische Regierung sie um Odessa herum ansiedeln wollte. Auf sehr fruchtbarem Boden, auf dem es bereits eine ganze Reihe deutscher Siedlungen gab.
Aber damit stieß man bei den frommen, aber auch sturen Schwaben auf taube Ohren: Sie hatten es sich in den Kopf gesetzt, in den Bergen, in der Nähe des Berges Ararat zu siedeln. Um ihren Wunsch durchzusetzen, schickten sie, mitten im Winter, eine Abordnung zum Zaren nach Moskau. Durch Vermittlung jener Frau von Krüdener gelang es ihnen, beim Zaren vorgelassen zu werden. Das allein ist ja schon sehr erstaunlich! Bei der Audienz war Zar Alexander I. dann so beeindruckt von dem festen Willen der Schwaben, dass er, trotz der ausdrücklichen Bedenken seiner Offiziere, ihrem Wunsch nachgab.
Und so begann im Frühjahr 1818 der zweite Teil der Reise der Schwaben nach Osten. Von den ursprünglich 1400 Familien war fast ein Drittel verstorben, ein weiteres Drittel blieb dann in der Ukraine, dem früheren Südrussland. Nur 400 Familien wollten weiterziehen, in den Kaukasus. Dazu kamen dann noch 100 Familien von den bereits in der Ukraine Ansässigen, sodass schließlich 500 Familien in den Kaukasus weiterreisten.
Gut organisiert und von Regierungsmitgliedern begleitet, zog sich dann über viele Wochen ein Wagenzug von zehn Kolonnen mit je 50 Familien durch die ganze Ukraine. Weiter ging es am Asowschen Meer entlang, über Rostow am Don und Wladikawkas über den Kaukasus, bis nach Tiflis. Dort kamen die ersten Kolonnen im September 1818 an.
In Tiflis wurden die meisten Kolonnen in sieben verschiedenen Kolonien angesiedelt. Nur die letzten drei Kolonnen durften nicht in der Nähe von Tiflis bleiben, sie mussten rund 200 Kilometer weiter südlich bis nach Elisabethpol, dem heutigen Gandscha, reisen. Die Auswanderer protestierten sehr heftig dagegen, da sie in der Nähe ihrer Brüder bleiben wollten. Aber es nützte nichts, dieses Mal blieb die Regierung hart. Sie wollte jetzt auch im muslimischen Teil ihres Herrschaftsgebietes christliche Kolonien ansiedeln, nachdem ursprünglich überhaupt keine Kolonien im Kaukasus geplant waren.
Auf einer Hochebene zwischen dem Großen und dem Kleinen Kaukasus, in der Nähe der Stadt Elisabethpol wurden drei Kolonien gegründet: Annenfeld, Katharinenfeld und 30 Kilometer weiter südlich Helenendorf. Mittlerweile war es bereits Winter geworden. Da die Bearbeitung des Landes erst im Frühjahr möglich war, wurden die Auswanderer in Elisabethpol bei christlichen Armenier- Familien untergebracht. Hier verbrachten sie den Winter. Am Osterdienstag im Jahre drauf, 1819, wurde dann Helenendorf gegründet.
Hier endete die »Reise nach Helenendorf«, die ich vor einigen Jahren in dem gleichnamigen Buch dargestellt habe. Jetzt kommt die Geschichte der Ansiedlung, von deutschen christlichen Familien, in einer ihnen völlig fremden Umwelt. Im Mittelpunkt unserer Geschichte steht die Familie Kehrer. Johann Georg, ein Schuster aus Betzingen, und seine Frau Marie geb. Grötzinger, mit ihren sieben Kindern. Die beiden ältesten, Barbara und Katharina, sind bereits verheiratet. Barbara hat in Odessa den verwitweten Matthäus Votteler mit seinem kleinen Sohn Christof geheiratet und bereits nach 9 Monaten, noch unterwegs, den kleinen Gottlieb geboren. Zur Familie Kehrer gehören jetzt noch die zwölfjährige Agnes und die vier Söhne Hansjörg, Philipp, Jakob und Gottlob.
Dazu kommen die Freunde: die Familie Josef Kühfuß, dessen Tochter Eva unterwegs starb und fast zum Schluss, kurz vor Elisabethpol, auch seine Frau. Übrig blieb sein Sohn Johann Georg, der 1819 Katharina Kehrer heiratete.
Zur Familie Salomon Votteler, dessen Frau gleich 1817 auf der Reise starb, gehörte sein Sohn Johann Georg, der 1817 in Odessa Rosina Riesch geheiratet hatte, und sein Neffe Matthäus. Die Tochter Margarete heiratete 1819 in Elisabethpol, auf einer Doppelhochzeit mit Katharina, den Dolmetscher Dimitri, einen Lehrer. Zur Familie Votteler gehörte noch der Sohn Michael.
Die Familie Barth aus Altbach bei Esslingen bestand aus dem Ehepaar Jakob und Christina Barth, dem Sohn Friedrich, der Tochter Margarete, die noch in Odessa auf der Reise starb, dem Sohn Gottlob und der kleinen Christina.
Im Sommer 1817 führen unsere Vorfahren in den Ulmer Schachteln (flache Boote, die nur mit der Strömung fuhren, ohne eigenen Antrieb) die Donau hinab bis zum Delta, dann über das Schwarze Meer in die Nähe von Odessa. Hier überwinterten sie bei bereits ansässigen Deutschen. Im Sommer 1818 fuhren 500 Familien im Planwagen weiter in den Kaukasus.
In Tiflis und Umgebung wurde sieben von den 10 Kolonnen angesiedelt. Nur die letzten drei Kolonnen mussten, unter großem Protest, noch mal 200 km weiter südlich bis nach Elisabethpol fahren.
Hierüberwinterten sie und gründeten dann im Frühjahr 1819 die drei Siedlungen Helenendorf, Annenfeld und Katharinenfeld.
Katharinenfeld wurde später mehr in der Nähe von Tiflis wieder neu gegründet, da die klimatischen Verhältnisse an der ersten geplanten Stelle sehr ungünstig waren.
Zur Erinnerung: Der lange und mühsame Reiseweg unserer Vorfahren war insgesamt 4500 Kilometer lang! (Foto Eduard Ohngemach). Nachzulesen in meinem ersten Buch »Reise nach Helenendorf, von Württemberg in den Kaukasus«, im gleichen Verlag erschienen.
Die Ausbürgerung aus Württemberg
Die Ausbürgerung aus Württemberg, aber einen russischen Pass bekamen sie erst sehr viel später
1. KAPITEL
1819 – DIE GRÜNDUNG VON HELENENDORF
Am 13. April 1819 wurde Helenendorf gegründet.
Es war der Dienstag nach Ostern, um 10 Uhr vormittags. Unbarmherzig brannte die Sonne von einem wolkenlosen, blauen Himmel auf einen großen Platz im Kaukasus, auf einer Hochebene zwischen dem Großen und dem Kleinen Kaukasus. Das Land war einige Jahre vorher von Russland erobert worden. Hier, an diesem Ort sollte eine deutsche Siedlung entstehen. Damals nannte man es noch Kolonie. Dieses Dorf war dann 120 Jahre lang die Heimat der Kaukasus-Schwaben.
Im Süden grüßten die erhabenen Gipfel des Kleinen Kaukasus-Gebirges, die jetzt im Sonnenglast schemenhaft, aber neugierig, auf das kleine Stückchen Erde herabblickten. Bis vor einigen Monaten war dies hier ein trostloses Stück Erde gewesen, wo es nur in der Nähe eines Flusses und im Gebirge grüne Flecken gab.
Aber an diesem 13. April 1819 strömten unzählige Menschen, Wagen, Kutschen und Pferde auf diesen Platz. Von allen Seiten kamen sie, um die Gründungsfeier der neuen Kolonie mitzuerleben. Es waren nicht nur die zukünftigen Bewohner der Siedlung, sondern auch Regierungsbeamte, Soldaten sowie viele neugierige Einheimische.
Vorsichtig stieg Marie Kehrer mit ihrem Jüngsten, dem kleinen Gottlob an der Hand aus ihrem Wagen und blickte erstaunt auf die blühenden Wiesen ringsum. Überall drängen sich die Frühlingsblumen in leuchtenden Farben zusammen: weiße, gelbe, lilafarbene. Man konnte sich nicht sattsehen an dieser Pracht, die nach der Schneeschmelze im Frühjahr die sonst braun-gelbe Wüste erblühen lässt.
Meine Güte, dachte Marie, das ist ja fast wie bei uns auf der Alb. »Schau, Gottlob, solche Blumen hatten wir auch zu Hause. « Wehmütig dachte sie an ihre Heimat, rief sich aber gleichzeitig wieder zur Ordnung: Unsere Heimat ist jetzt hier. Seit zwei Jahren haben wir auf diesen Tag gewartet.
»Jetzt sind wir angekommen«, seufzte sie und schaute sich um: Aber trotz der blühenden Wiesen sah hier alles nicht sehr gastfreundlich aus, denn außer ein paar Büschen gab es hier absolut nichts. In der Ferne, im Gebirge sah man wohl Wald, aber hier ringsum nichts als kahle Wüste, die aber eben sehr schön blühte. Gottlob wollte Blumen pflücken, aber Marie hielt ihn davon ab.
Einerseits freute sie sich sehr, dass es jetzt endlich losging mit dem Aufbau der Siedlung. Seit Monaten hatten sie darauf gewartet. Anderseits aber wurde ihr manchmal fast schwindelig, wenn sie daran dachte, was alles noch vor ihnen lag. Es war ja nichts vorbereitet, es gab keine Häuser, nur die nackten Grundstücke, die ihnen durch das Los zugeteilt worden waren. Dort mussten jetzt zuerst große Erdlöcher gegraben und dann mit Holzbalken und Schilf bedeckt werden, um eine Zuflucht vor der Sonne zu haben. Dann musste das Grundstück gerodet und später darauf ein Haus gebaut werden. Das alles stand wie ein riesengroßer Berg Arbeit vor ihr. Außerdem fühlte sie sich in letzter Zeit oftmals nicht so recht wohl. Meist ließ sie sich nichts anmerken, denn sie wollte die Freude ihrer Familie und der Freunde nicht trüben. Sie gab sich jetzt einen Ruck, schickte ein Stoßgebet zu Gott, nahm den kleinen Gottlob an die Hand und sagte :
»Komm Gottlöble, jetzat ganga mr uf en großa Platz, do sind ganz viel Leut und auch der Papa und die andere sind do.«
Schon Wochen vor der Feier hatte sich auf dem Gelände, auf dem die Kolonie entstehen sollte, etwas bewegt: Landvermesser der russischen Regierung hatten, nach vorgefertigten Plänen, die Straßen der neuen Kolonie vermessen und die Grundstücke abgesteckt. Von Nordwesten nach Südosten waren fünf sehr breite Parallelstraßen geplant. Jede war ungefähr anderthalb Kilometer lang. In der Ortsmitte wurde ein großer Platz vorgesehen, um den herum die Kirche, die Schule und andere Gemeinschaftsbauten entstehen sollten.
Auf diesem Platz, dem späteren Gemeindeplatz, sollte heute die Gründungsfeier stattfinden. Suchend schaute sich Marie um. »Da, da »rief Gottlob plötzlich und deutete auf seine Geschwister. Die entdeckten jetzt auch ihre Mutter und kamen angerannt. Marie strahlte, als ihre Rasselbande auf sie zukam. Jetzt sah sie auch Johann Georg, der sie liebevoll anlächelte.
Hier wurde jetzt das Gedränge immer größer. An der Stelle, an der später die Kirche stehen sollte, hatten die Soldaten eine Tribüne für die Honoratioren errichtet. Das mit Wiesenblumen geschmückte Gestell bot einen feierlichen Rahmen auf dem sonst kahlen Platz.
Auf dem Podest standen die Regierungskommissare der letzten 3 Kolonnen, sowie Martin Vollmer, Johannes Wuchrer und Lehrer Krauß. Daneben stand der Dolmetscher Dimitri, der seit kurzem mit Salomon Vottelers Tochter Margarete verheiratet war. Er kam aus Kiew, war Lehrer und hatte in den vergangenen Monaten als Dolmetscher Teile seiner Wehrpflicht abgeleistet. Jetzt aber hatte er eine Anstellung im Gymnasium in Tiflis erhalten, so dass er Margarete heiraten konnte. Die Hochzeit hatte erst vor zehn Tagen stattgefunden. Anschließend war das junge Paar ins Gebirge gefahren.
»Da ist dr Dimitri« rief Agnes plötzlich ganz aufgeregt. »Ha so ebbes « rief Salomon Votteler, »des isch abber schee!!« Denn wo Dimitri war, war sicher auch seine Tochter Margarete. Seit dem Tod seiner Frau auf der Schiffsreise, war ihm Margarete besonders ans Herz gewachsen und er war nicht sehr erfreut, sie so schnell hergeben zu müssen. Aber er wollte ihrem Glück nicht im Wege stehen.
In diesem Augenblick tauchte eine strahlende Margarete hinter der Tribüne auf und kam auf die Kehrer-Gruppe zu. Das war eine Freude! Alle lagen sich in den Armen und redeten durcheinander. Dimitri winkte ihnen von oben freudig zu. Salomon hielt noch seine Tochter im Arm, als ganz plötzlich wunderschöner Chorgesang erklang.
Sofort wurde es still.
»Großer Gott wir loben dich, Herr wir preisen deine Stärke« Nach der ersten Strophe fielen alle mit ein. Wie ein gewaltiger Jubelschrei stieg der Gesang gen Himmel. Es war fast so, als ob auch die Engel miteinstimmten. In diesem Augenblick waren alle glücklich und erfüllt von den allerschönsten Vorstellungen.
Alle Mühsal der Reise war vergessen! Jetzt waren sie angekommen.
Sobald das Lied verklungen war, trat der Regierungskommissar, der die 10. Kolonne begleitet hatte, nach vorne und begann seine Ansprache. Dimitri übersetzte. Agnes stieß Barbara an: »Des isch jo onser Kommissar.« Barbara nickte, legte aber gleichzeitig den Finger an den Mund. Agnes verstand und schwieg.
»Meine lieben Freunde« begann der Kommissar sichtlich ergriffen. »Ich glaube, so darf ich euch nennen, nachdem wir gemeinsam monatelanglang unterwegs gewesen waren und so manches Abenteuer überstanden haben. Ich denke nur an die Lawinengefahr im Gebirge!
Manchmal habe ich fast nicht mehr geglaubt diesen Tag heute zu erleben. Vor allem aber erfüllt mich große Bewunderung für euren Mut, eure Ausdauer und euer Vertrauen auf Gott, der euch dann schließlich doch zum Ziel geführt hat. Wir - damit meine ich alle zuständigen Offiziere im Fürsorge- Komitee in Odessa- waren damals sehr erstaunt, dass ihr es gewagt habt, mitten im Winter eine Abordnung zum Zaren nach Moskau zu schicken. Und noch erstaunter waren wir, und konnten es kaum glauben, dass es euch gelungen ist, beim Zaren vorgelassen zu werden und dann auch noch seine Erlaubnis zur Ansiedlung im Kaukasus zu erlangen. So etwas hatte es in der russischen Geschichte noch nicht gegeben! Das war schon ganz außerordentlich. «
Breites Grinsen auf manchen Gesichtern!
»Jetzt wünsche ich euch nur noch, dass euch dieser Mut und die Ausdauer auch beim Aufbau eurer Kolonie erhalten bleiben. Denn vor euch liegt eine sehr schwere Aufgabe. Nicht umsonst wollte euch die Regierung um Odessa herum ansiedeln. Der Kaukasus ist ein wunderschönes Land, aber auch seit Jahrhunderten von den verschiedensten Völkern und Stämmen umkämpft.
Aber ich bin überzeugt, dass ihr mit eurem Gottvertrauen, mit eurem persönlichen Mut und vor allem mit eurer gegenseitigen Hilfsbereitschaft diese Aufgabe meistern werdet.
Ich wurde während unserer Reise immer wieder überrascht von dem liebevollen Umgangston eurer Familien untereinander, aber auch von der gegenseitigen Hilfe in Notfällen. Ich hoffe sehr, dass diese Nächstenliebe auch weiterhin ein wichtiger Bestandteil eurer Gemeinschaft bleibt. Denn solch ein gewaltiges Aufbauwerk, wie es hier geplant ist, das funktioniert nur durch die Liebe Gottes und die Liebe untereinander.
Gleichzeitig überbringe ich euch auch die persönlichen Grüße von unserem Kaiser, von Zar Alexander L, der euch alles Gute und Gottes Segen beim Aufbau eures Gemeinwesens wünscht. Der Zar war sehr erfreut, als er erfuhr, dass ihr den neuen Ort, nach seiner von ihm sehr geliebten Schwester, Helena Pawlowna benennen wollt. Auch versprach er euch weiterhin die Unterstützung der Krone. In Elisabethpol ist ein Bataillon Kosaken stationiert, dessen Aufgabe es ist, den Einwohnern von Helenendorf und von Annenfeld beim Aufbau ihrer Kolonien zu helfen, sie aber auch gegen Angriffe von außen zu schützen. Außerdem, fügt er hinzu, hat das Fürsorgekomitee in Odessa beschlossen, dass euch am Anfang Armenier bei der Feldarbeit helfen sollen.«
Am Ende seiner Rede beugte er sich nach hinten und ließ sich ein großes Schild geben. In schwarzen Buchstaben stand auf weißem Grund das Wort »Helenendorf« in deutscher und in russischer Sprache. Der Kommissar fuhr fort »Als Gruß der russischen Regierung übergebe ich eurem Vorsteher heute dieses Ortsschild. Ihr habt noch viel vor euch, aber wir sind sicher, dass ihr alle Aufgaben genauso gut schaffen werdet, wie ihr den bisherigen Weg geschafft habt. «
Nachdem Dimitri diesen Satz übersetzt hatte, fügte der Kommissar auf Deutsch hinzu: »Gott segne euer Werk«, und übergab das Schild an Martin Vollmer, der dann das Schild hochhielt.
Alle klatschten begeistert, hatten sie es jetzt doch schwarz auf weiß: dies war ihr Helenendorf.
Daraufhin dankte Martin Vollmer dem Herrn Kommissar, der russischen Regierung und dem verehrten Zaren Alexander für die großzügige Unterstützung, während ihrer Reise und auch jetzt beim Aufbau. Denn die Regierung hatte nicht nur versprochen, das monatliche Nahrungsgeld so lange weiterzuzahlen, bis die Menschen sich selbst ernähren können, sie wollte auch beim Aufbau der Wirtschaften und der Anschaffung der Tiere durch preiswerte Kredite helfen.
An dieser Stelle fingen alle Zuschauer an zu klatschen und einige riefen laut: »Spasiba, Majestät«.
Da grinsten die Herren Kommissare.
Jetzt stieg Lehrer Krauß auf einen Hocker. Sofort wurde es wieder still. »Grüß Gott meine lieben Mitbrüder und Mitschwestern, Grüß Gott liebe Kinder und ein herzliches Grüß Gott an alle Fremden, die an unserer Gründungsfeier teilnehmen. Wir singen jetzt gemeinsam das Lied: »Geh'aus mein Herz und suche Freud in dieser schönen Sommerzeit.«
Alle stimmten mit ein, Männer, Frauen, Kinder. Es war wieder gewaltig, wie es da über die Köpfe brauste und gen Himmel schallte. Ehrfurchtsvoll schauten die Fremden zu. Dass die Schwaben so schön singen konnten, stimmte sicherlich manch einen Einheimischen versöhnlich. Johann Georg war zu Marie getreten und legte liebevoll den Arm um sie. Dankbar schaute sie zu ihm auf und lächelte.
»Jetzt sind wir am Ziel unserer Reise«, sagte Lehrer Krauß. »Wir danken Gott, dass er uns bis hierhergeführt hat. Wir danken aber auch der russischen Regierung, dass sie uns so tatkräftig dabei unterstützt hat. Leider haben es nicht alle Brüder und Schwestern bis hierhergeschafft, aber ich denke, dass auch sie alle jetzt bei uns sind. Wir stehen hier auf dem zukünftigen Gemeindeplatz, einem Platz inmitten unserer Gemeinschaft, an dem auch die zukünftige Kirche stehen soll. Vorerst werden uns die Soldaten ein Bethaus bauen, in dem ich den Schulunterricht abhalten werde und in dem wir unsere Stunden abhalten können, denn mit dem Bau der Kirche lassen wir uns noch etwas Zeit. Jetzt ist es erstmal wichtig, dass alle unsere Mitbrüder und Mitschwestern ein festes Dach über dem Kopf erhalten und dass wir unsere Wirtschaften aufbauen. Ihr wisst, dass es hier im Sommer sehr heiß werden kann und der Planwagen ist kein geeigneter Ort. Deshalb solltet ihr gleich anfangen, entweder Erdhütten zu bauen oder ein kleines Lehmhäuschen zu erstellen. Ihr habt gehört, dass uns die russische Regierung auch dabei unterstützen wird.
An dieser Stelle möchte ich auch noch allen Soldaten und den Dolmetschern ganz herzlich dafür danken, dass sie uns alle sicher an unser Ziel gebracht haben. Sie hatten es mit so vielen Menschen sicherlich nicht immer ganz einfach und dazu waren sie monatelang von ihren eigenen Familien getrennt. Es gab ja auch eine Reihe von brenzligen Situationen, wobei ich nur an die Situation im Gebirge mit der abgehenden Lawine erinnere oder an den Überfall an der Kura in Kartli. Das alles hätte auch ganz anders ausgehen können. Deshalb danken wir ihnen allen von ganzem Herzen. «
Wieder klatschen alle.
»Jetzt ist es auch dringend notwendig, dass wir unsere Dorfspitze bestimmen. Deshalb bitte ich Im Anschluss an diese Versammlung alle erwachsenen Männer nach vorne, damit wir unseren Schulz und die beiden Beisitzer wählen können. Wir beten jetzt alle gemeinsam das Vaterunser, mit dem ich diese Versammlung dann schließe.«
Gleich nach dem Gebet strömten die Menschen, unter lebhaften Gesprächen, auseinander. Alle waren sehr bewegt und wollten sich mitteilen. Johann Georg sagte zu Marie: »Ihr geht schon mal auf unser Grundstück. Wir Männer müssen noch hierbleiben, um unsere Regierung zu wählen«, dabei grinste er. »Matthäus und ich bringen später die Wagen auf das Grundstück.«
Da tauchte Barbara, Maries älteste Tochter, auch schon auf. Sie hatte ihren kleinen Sohn, den neun Monate alten Gottlieb, vor den Bauch gebunden und hielt an jeder Hand einen fünfjährigen Jungen. Die beiden Jungen, Philipp, der kleine Bruder von Barbara und Christof, der Sohn ihres Mannes waren seit dem Tod von Christofs Mutter und der späteren Heirat von Barbara und Matthäus Votteler unzertrennlich. Seitdem wohnten die beiden Jungen abwechselnd mal in dem einen oder dem anderen Wagen.
Barbara kam jetzt mit den drei Kindern zu Marie. Gemeinsam luden sie noch Margarete und Dimitri zum Essen ein und machten sich dann auf den Weg zum Grundstückder Familie Kehrer, das in der Kirchenstraße in der Nähe der geplanten Kirche lag. Auf dem Weg bemerkte Barbara, dass sich ihre Mutter ab und zu an den Rücken griff.
» Muadder, hasch du Schmerza?« »Ja beim Stehen, da tut mir der Rücken weh.« »Ich hab? noch von der Salbe, die mir der Andriß gegeben hat. Wenn Matthäus den Wagen gebracht hat, hole ich sie und dann reibe ich dich ein.« Langsam gingen die Frauen und Kinder auf ihre Grundstücke, während sich die Männer um die Tribüne scharten.
Die Honoratioren oben auf dem Gestell steckten die Köpfe zusammen und begannen eifrig zu diskutieren. Es dauerte nicht lange bis Dimitri, als neutrale Instanz, das Ergebnis verkündete. »Wir schlagen der Versammlung vor, bis zum Ende des Jahres, folgende Männer an die Spitze zu wählen: als Schulzen Johann Jakob Krauß, als ersten Beisitzer Martin Vollmer und als zweiten Beisitzer Christian Hummel. Weitere Posten, wie Kassierer und Protokollführer bestimmen wir dann bei der 1. Sitzung. Wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause, damit ihr euch untereinander bereden könnt. Anschließend werden wir abstimmen.«
Allgemeines Stimmengemurmel erhob sich. Die meisten Männer nickten zustimmend, sie waren mit dem Vorschlag einverstanden. Einer rief aus der Menge: »Sind denn die Kandidaten auch damit einverstanden? Sonst wählen wir sie und sie wollen das Amt gar nicht annehmen? «
Alle lachten. Dimitri ergriff wieder das Wort: »Wir haben sie natürlich vorher gefragt, alle sind damit einverstanden. Also schreiten wir jetzt zur Abstimmung: Wer damit einverstanden ist, dass Jakob Krauß Schulze und Martin Vollmer und Christian Hummel Beisitzer werden, möge bitte seine Hand heben. Wer damit nicht einverstanden ist, möge bitte einen Gegenvorschlag machen.«
Alle Hände gingen hoch. Dimitri sagte lachend: »Na das ist ja wunderbar, alle wurden einstimmig gewählt. Jetzt frage ich die Betroffenen: nehmt ihr die Wahl auch an?« Die drei Männer nickten.
Jetzt erhob sich der Regierungskommissar, der vorher gesprochen hatte, ging auf Jakob Krauß zu, schüttelte ihm die Hand und sagte auf Deutsch: »Herzlichen Glückwunsch!«
»Danke«, erwiderte Jakob, »und danke für die Unterstützung der russischen Regierung.« Dann beglückwünschte er auch die Beisitzer zu ihrer Wahl.
Langsam löste sich die Versammlung auf und die Männer verteilten sich auf die Grundstücke oder holten die Wagen vom Platz vor der Kolonie. Nach einiger Zeit kamen Johann Georg und Matthias jeweils mit ihren Wagen auf das Kehrersche Grundstück, wo die anderen schon warteten.
Daraufhin ging Barbara hinüber in ihre Küche, wie alle die zwei Kochmulden nannten, die Johann Georg neben der Grube ausgehoben hatte. Neben dem »Kochherd« stand ein grob gezimmertes Regal in dem die Kochutensilien lagen. Hier, in der provisorischen Küche, hatten die Jungens in den beiden Kochstellen bereits Holz aufgeschichtet und angezündet. In der einen Kochstelle, die umgeben war von den großen Batzensteinen, war das Holz bereits zu Kohle runtergebrannt, sodass Barbara gleich die vorbereiteten Spieße auflegen konnte.
In den vergangenen Wochen hatten die meisten Familien schon mal angefangen auf ihrem Grundstück die Grube auszuheben, um vor der großen Hitze etwas geschützt zu sein. Die Gruben waren in der Regel 5 mal 5 Meter groß und eineinhalb Meter tief. Die beiden Schwiegersöhne von Johann Georg und Marie, sowie alle Kinder halfen fleißig mit bei den Ausschachtungsarbeiten. Bei diesem trockenen und sehr festen Boden war das eine Knochenarbeit und dauerte mehrere Wochen
Plan von Helenendorf, heute Göygöl
Die Siedlung bestand zunächst aus 5 Parallelstraßen: der Talstraße, der Stadtstraße, der Kirchen- und der Helenenstraße und der Gartenstraße. Alle Grundstücke waren gleich groß: die Straßenseite betrug ca. 20 Meter, in der Tiefe waren es vierzig Meter.
Bei dieser schweren Arbeit kamen manch einem Zweifel, ob das wohl richtig war mit dieser Auswanderung! Und manch einer wollte zwischendurch sogar aufgeben!
Aber dann fand sich doch immer wieder jemand, der die Zweifler anspornte und ihnen Mut machte, so dass manche Grube schon bis zum Fest fast fertig wurde. Johann Georg hatte sogar bereits einen Teil der Grube mit Holzbalken belegt und mit Schilf bedeckt, was in der großen Hitze schon etwas Schutz vor der Sonne bot.
»Das ist jetzt vorläufig unsere neue Wohnstube«, erzählte Agnes ganz stolz. »Aber später kommt dann über die Grube unser Häuschen und dann ist das unser Keller! « »Und das Häuschen kriegt dann noch ein Dachgeschoß, und dort dürfen wir dann schlafen,« fügte Hansjörg stolz hinzu.
Auch mit der Herstellung der Bausteine für die Kolonisten-Häuschen, wie sie später genannt wurden, hatten viele schon angefangen. Johann Georg hatte, während des Winters in Elisabethpol begonnen, die Holzumrandung für die Lehmsteine herzustellen. In diese »Holzschachteln ohne Boden«, wie die Kinder sie nannten, wurde dann der Lehm aus dem Aushub, vermischt mit Schilfund Wasser, eingefüllt. Dann mussten die Bausteine trocknen. Bei den Kehrers lagen neben der Grube schon mehre Reihe von diesen Batzensteinen, wie sie genannt wurden.
»Das Schilf für die Steine und das Dach, haben wir unten am Fluss gesammelt«, erzählten Christof und Philipp fast gleichzeitig. »Aber ihr wart nicht allein«, warf Agnes ein. »Nein«, sagte Philipp, »auch Agnes, Hansjörg und Jakob waren dabei. Und der Papa hat es dann vom Fluss mit dem Wagen nach oben gebracht.« »Und einmal ist der Wagen fast umgekippt«, berichtete Christof ganz eifrig. Agnes versetzte ihm einen leichten Stoß: »Das wollten wir doch niemandem sagen!« Christof wurde rot und hielt sich die Hand vor den Mund. »Aber es ist ja nichts passiert«, tröstete Agnes ihn!
Zur Feier des Tages sollte es heute Spießbraten geben. Den hatten die Schwaben von den Einheimischen abgeguckt. Aber statt des Lammfleischs wurde Schweinefleisch genommen, das sie bei den Armeniern in Elisabethpol gekauft hatten. Der Schweinenacken wurde in 4 cm große Würfel geschnitten, auf lange Spieße gesteckt und dann über dem Holzfeuer gegart.
Im Winter hatte sich Johann Georg von seinem zukünftigen Nachbarn, dem Schmied Jakob Barth 10 Spieße machen lassen, im Tausch gegen ein paar elegante Schuhe für dessen Frau Christina. Jakob Barth durfte später noch weitere Spieße schmieden, denn diese Art der Fleischzubereitung wurde von allen Kolonisten sehr geschätzt.
Gegen 14 Uhr war der Spießbraten fertig und Marie bat zu Tisch, den die Kinder mittlerweile in der Grube, unter dem Schilfdach, gedeckt hatten. Es war ein alter Tisch, der bei Terdjimanians im Schopf stand und nicht mehr gebraucht wurde. Mit viel Mühe hatten die Männer den Tisch in die Grube geschafft. Es gab auch fünf Hocker und zwei kleine Sessel, die Johann Georg im vergangenen Winter in Alexanderhilf hergestellt hatte. Die bekamen jetzt die Erwachsenen. Die Kindersetzten sich mit Kissen auf den Boden. Mit den vielen Gästen, denn neben Barbara und Matthäus waren auch Salomon, sowie Margarete und Dimitri eingeladen, wurde es etwas eng unter dem Schilfdach. Aber unter großem Gelächter, denn bei 1.50 m Raumhöhe, mussten alle Erwachsenen ihren Kopf einziehen, fand schließlich jeder einen Platz.
Marie musste schmunzeln, als sie diese lustige Festgesellschaft in der improvisierten »Wohnstube« sah. Laut sagte sie: »Wer hat denn mal gesagt: Raum ist in der kleinsten Hütte? Das stimmt wirklich!!«
Nachdem sich alle gesetzt hatten, ergriff Johann Georg das Wort: »Ihr Lieben, jetzt sind wir endlich am Ziel unserer Sehnsucht und wir wollen Gott danken, dass er uns so gut bis hierher geleitet hat. Die Rede von unserem Kommissar heute Vormittag hat mir gut gefallen. Hat sie doch gezeigt, dass die Regierung uns nicht für verrückte Spinner hält, sondern uns mit unserem geistigen Ansinnen ernst nimmt und versprochen hat, uns bei unserem Aufbauwerk zu unterstützen. Damit stehen wir aber noch ganz am Anfang und es liegt noch viel Arbeit vor uns.
Wir lassen uns aber unsere Zuversicht nicht nehmen und erfreuen uns jetzt erst einmal an dem Festessen, dass unsere Frauen zubereitet haben. Außerdem sind wir glücklich, dass Margarete und Dimitri an diesem Tag noch bei uns sind. Lasst uns das Tischgebet sprechen.«
Nach dem Gebet wurde das Essen verteilt. Von dem gebratenen Fleisch, das gut einen Tag vorher mit Zwiebeln, Pfeffer und Salz eingelegt wurde, ging ein wunderbarer Duft aus. »Das riecht ja köstlich«, rief Dimitri aus. »Ihr habt ja schon richtige kaukasische Sitten angenommen«. »Na, ja«, meinte Johann Georg, »wenn ebbes guat isch, soll ma des aanemme. Und diese Art das Fleisch zu braten ist doch geradezu ideal. «
Zu dem Fleisch gab es Reis. Auch hier hatte Marie von Frau Terdjimanian eine kaukasische Sitte abgeschaut: Früh am Morgen wurde der Reis angekocht und dann unter Kissen und Decken warmgehalten. Bis zum Essen war er dann gar. Nur das frische Gemüse fehlte noch. Dafür gab es saure Gurken, die Marie im Herbst eingelegt hatte.
Nach dem Gebet begann beim Essen ein fröhliches Geschnatter und ein lustiges Hin- und Her der Kinder. Marie betrachtete ihre Familie und fast schämte sie sich ihrer Gedanken vom Vormittag, als sie an der Richtigkeit der Auswanderung gezweifelt hatte. Wo meine Familie ist, da ist meine Heimat, dachte sie jetzt. Bitte, lieber Gott, bewahre sie vor allem Übel.
Salomon saß neben seiner Tochter Margarete, hatte den Arm um sie gelegt, sah sie liebevoll an und fragte : «Und wie geht es euch so? Freust du dich auf dein Leben in Tiflis? « Margarete strahlte ihn an: »Ja, sehr. Dimitri ist ein wunderbarer Mann und er hat vorgeschlagen, dass ich gleich, wenn wir nach Tiflis kommen einen Kurs als Krankenschwester machen soll. »Also, dass Dimitri dir erlaubt, einen Beruf zu erlernen, finde ich ja sehr großzügig von ihm. Das würde auch nicht jeder Mann machen.,« meinte ihr Vater. »Dimitri sagt aber, dass die eigene Krankenschwester im Haus ihm und unserer Familie vielleicht mal etwas nützen könnte!« Salomon lachte: »Ja, so kann man das auch sehen.«
»Und wie geht es hier voran?«, wollte Margarete wissen. »Du siehst ja, weit sind wir noch nicht und es wird auch ein ganzes Weilchen dauern, bis sich jeder eingerichtet hat.« »Helfen euch denn die Soldaten nicht? In Tiflis sollen Kosaken beim Bau der Häuser helfen.« »Uns helfen sie nur beim Heranschaffen des Materials, z.B. liefern sie uns das Holz, das wir brauchen, aber bauen müssen wir alleine. Aber wir helfen uns untereinander und zum Teil helfen uns auch unsere armenischen Freunde. «
»Hier sieht es ja schon richtig gemütlich aus«, meinte Margarete, während sie sich umschaute. »Und wie geht es so in der Gemeinde?«, fragte sie. »In unserer Familie und in der Freundschaft geht's gut, aber in der Gemeinde gibt es ein paar Kameraden, die nie zufrieden sind, sie haben sehr oft etwas zu meckern oder widersetzen sich sogar den Anordnungen. Dazu kommt noch, dass sie mit ihrem Geld, das wir jeden Monat von der russischen Regierung kriegen, nicht auskommen und dann immer andere anbetteln. «
»Und werden die nicht bestraft?« »Bis jetzt noch nicht. Ich sprach neulich mal mit Lehrer Krauß über diese Fälle und er meinte, dass wir erstmal die Gründungsversammlung abwarten sollten. Vielleicht ändern diese Leute ja ihr Verhalten von allein. Wenn nicht, müssen sich die Oberen etwas einfallen lassen, denn sonst vergiften solche Leute noch unsere ganze Gemeinde.«
»In Elisabethtal, das ist nicht weit von Tiflis, gab es unlängst auch solch einen Fall, da hat ein Mann hässlich über eine andere Familie geredet und unwahre Sachen behauptet. Der kam dann 3 Tage in den Karzer und musste sich bei der anderen Familie entschuldigen.« »Das ist richtig«, meinte Salomon, »denn sonst gibt es keinen Frieden in der Gemeinde.«
Jetzt trat Barbara zu Margarete. »Willschst du au amol mit deiner Schwipp-Schwägerin schwätza?«, fragte Salomon sie. «Wart amol, i gang weg, nocha kaschst du da nasitza.« Er deutete auf seinen Sitz und erhob sich. »Danke«, sagte Barbara, »ich will doch auch mal hören, ob Margret schon Pläne für ihr Leben in der Stadt hat.«
»Sag mal, euer kleiner Gottlieb ist ja schon ganz schön groß geworden. Dimitri hat mir ausführlich erzählt, wie ihr damals nachts nach Mosdok ins Krankenhaus gefahren seid.«
»Ja, das war auch eine verrückte Sache, aber zum Glück ist er dann ja ziemlich schnell gekommen.«
»Der ist ja auch schon bald ein dreiviertel Jahr alt. – Und mit Christof geht alles gut?«
»Ja, sehr gut, der hat sich ja von Anfang an über das Baby gefreut. Außerdem ist der ja fast immer mit Philipp zusammen, die zwei sind schon fast wie Zwillinge. Aber erzähl mal, wie geht es dir?«
»Danke, sehr gut, ich bin sehr glücklich, aber nicht nur mit Dimitri, sondern auch, weil ich Krankenschwester werden darf, darauf freue ich mich besonders. Am
1. Mai soll der Kurs schon losgehen.«
»Das ist ja ganz großartig, das freut mich wirklich«, meinte Barbara. »Aber was machst du dann, wenn du ein Baby bekommst?« »Da mach ich mir mal noch keine Gedanken, da wird sich sicher eine Lösung finden.«
In diese gemütliche Runde platzte plötzlich Michael, der siebzehnjährige Sohn von Salomon. Von oben rief er: »Vadder, Hansjörg- Vetter, kommet amol, da gibt’s a Schlägerei zwischen unseren Leuten und zwei Tataren. «
Alle Männer erhoben sich und strebten nach draußen. Die Kinder wollten auch mit, aber Marie und Barbara hielten sie zurück.
»Ihr bleibet do, des isch nix for eich. « Um sie zu beruhigen erzählte ihnen Barbara eine Geschichte.
Marie, Agnes und Margarete kümmerten sich um das Geschirr und die Essensreste. Das Geschirr wurde in Kehrers Wagen gepackt und am Abend in ihrem Quartier gespült, denn auf dem Grundstück gab es noch kein Wasser.
Jetzt hörte man von oben Stimmen und Geschrei. Der Streit schien nicht weit weg zu sein. »Was jetzt wohl da wieder los war?«, sinnierte Marie, »können die Menschen nicht friedlich miteinander umgehen?« »Denk mal an die Geschichte von Kain und Abel, ich glaube, solange es Menschen gibt, wird es auch immer wieder Streit und Kriege geben,« wand Margarete ein.
Nachdem alles aufgeräumt war, ging Marie in ihren Wagen und legte sich einen Augenblick hin. Es war zwar sehr heiß unter der Plane, aber da konnte sie ausgestreckt liegen und sich ausruhen. Es strengte sie doch alles sehr an. Sie verstand das gar nicht, denn früher, zu Hause konnte sie den ganzen Tag im Garten oder auf dem Feld schaffen, ohne müde zu werden. »Da war aber auch keine solche Hitze«, gab Barbara zu bedenken. Weil sie sich schon längere Zeit Sorgen um ihre Mutter machte, achtete sie sehr drauf, dass Marie sich genug ausruhte und sich nicht übernahm.
Nach einem Weilchen kamen die Männer zurück. Die Söhne vom Beck hatten wohl versucht, ihre Pferde außerhalb ihres Grundstückes weiden zu lassen. Das gefiel zwei Aserbeidschanern nicht, da das wohl ihr Grundstück war. Sie wollten die Schwaben runter jagen. Die widersetzten sich und so kam es zum Streit. Die älteren Männer konnten den schlichten, in dem sie den jungen Schwaben klarmachten, dass sie nur auf ihren Grundstücken bleiben dürften. Widerwillig gehorchten sie und brachten ihre Pferde zurück auf ihr eigenes Grundstück.
Auf dem Heimweg sagte Johann Georg zu Salomon: »Wir müssen bei der nächsten Versammlung unbedingt, darauf hinweisen, dass unsere Leute die Grundstücke der Einheimischen respektieren und nicht meinen, alles gehöre ihnen.«
» Ohje «, seufzte Salomon, »ich seh? schon, dass dies noch öfter Konflikte geben wird. «
»Das war ja klar«, gab Johann Georg zu bedenken, »schließlich sind wir hier in ihr Land eingedrungen. Das geht natürlich nicht ohne Schwierigkeiten ab, vor allem, wenn so jugendliche Hitzköpfe damit zu tun haben. «
Mittlerweile hatten Dimitri und Matthäus den Frauen berichtet, worum es bei dem Streit ging. Jetzt setzten sich alle wieder unter das Schilfdach, auch Marie gesellte sich dazu. Barbara teilte Gläser aus und Matthäus holte zwei Flaschen Wein aus einer Vorrichtung unter dem Wagen, wo sie in einer gut gepolsterten Kiste etwas kühler lagern konnten.
In dem Moment schauten, von oben, zwei lachende Gesichter in die Grube. «Ha, ihr hänts jo gmitlich«, meinte Hannsjörg Kühfuß.
»Oh, die Katharina und der Hansjörg«, erschallte es von mehreren Seiten, während die beiden Jungvermählten langsam die Leiter herunterkletterten. Die jungen Leute sprangen auf und umringten die beiden. »Ha, des isch schee, dass ihr au no nei guget. Ihr könnt noch ein Glas Wein mit uns trinken. Wie wars denn so im Gebirge?« wollte Johann Georg wissen.
»Die Landschaft ist wunderbar und der Wald einfach herrlich, aber die Leute leben schon arg einfach da oben«, berichtete Hansjörg.
Jetzt stießen alle an auf ein glückliches Gedeihen der neuen Kolonie Helenendorf
Auch die Kinder bekamen etwas Wein mit Wasser verdünnt, wobei sie das Trinkwasser aus Elisabethpol in einer Milchkanne mitgebracht hatten. Dort wurde täglich frisches Quellwasser aus dem Gebirge in großen Kanistern in die Stadt gebracht und verkauft. Salomon hatte schon mit einem der Männer, die im Gebirge wohnen, verhandelt. Von der kommenden Woche an, sollen auch einige Wagen durch Helenendorf fahren. Die Versorgung mit Brauchwasser zum Waschen, und auch für die Pflanzen musste aus dem Fluss kommen. Man konnte den alten Kanal, der durch das Dorf führte, wieder ausbauen, er war nur ziemlich verschlammt, aber sonst noch gut zu verwenden. Wahrscheinlich musste später noch ein zweiter Kanal durch das Dorf gegraben werden, denn der eine würde nicht für alle reichen. Geplant war auch, dass in den Längsstraßen rechts und links kleine Kanälchen gebaut würden, damit die Bäume, die man hier zum Schutz vor der Sonne pflanzen will, genügend Wasser hätten.
Über all diese Dinge wurde jetzt bei Kehrers eifrig diskutiert. Dafür wurde auch öfter Dimitris Rat eingeholt, derüber die Erfahrungen in Tiflis oder in den anderen Kolonien berichten konnte. Salomon fragte: »Stimmt das, dass in Tiflis das Militär jedem Kolonisten ein kleines Häuschen gebaut hat.?«
»Warum dort und bei uns nicht?«, warf Johann Georg ein? »Ich vermute, dass denen das Geld ausgegangen ist«, antwortete Dimitri. »Aber ihr kennt doch das russische Sprichwort: Russland ist groß und der Zar ist weit.« Jetzt lachten alle : »Und das gilt dann als Ausrede?«, fragte Barbara. »Eher als Erklärung«, antwortete Dimitri. »Aber ich habe gehört, dass das Militär euch auch helfen soll, zumindest sollen sie die Baumaterialien anliefern. Das ist doch auch schon mal gut, wenn ihr nicht mühsam alles alleine beischaffen müsst.« »Das stimmt,« meinte Salomon, «trotzdem ist es seltsam, dass die solche Unterschiede machen. Sind wir weniger Wert, als die Menschen in Tiflis?«
»Ich habe noch eine andere Frage«, sagte Johann Georg. »Ich habe gehört, dass das Land, das wir zum Anpflanzen von Getreide oder auch Wein bekommen, sowie die Wiesen im Gebirge, dass das im Mir-System verteilt werden soll? Stimmt das?«
»Ja, das stimmt.« »Was ist denn das für ein System?«, fragte Barbara
»Das ist etwas kompliziert«, sagte Dimitri. »Mir bezeichnet so viel wie die Dorfgemeinschaft, ist aber gleichzeitig auch eine Agrarordnung. Es beruht auf dem Grundsatz, dass das Land der Gemeinde gehört, also nicht einem einzelnen und auf der Tatsache, dass der Boden in einer Gemeinde nicht überall gleich gut ist. Und um Ungerechtigkeiten in der Bodenbeschaffenheit auszugleichen wird das Land In bestimmten Zeitperioden, alle 5 oder 10 Jahre, immer wieder neu verteilt. Der Nachteil war nur, dass die Wirtschaften einmal durch die Aufteilung immer kleiner wurden und dass Familien, die keine oder wenig Söhne und dafür Töchter hatten, benachteiligt wurden. Denn nur die männlichen Mitglieder einer Familie wurden berücksichtigt. «
»Na, das ist aber total ungerecht!« warf Barbara empört ein. »Wenn also eine Familie nur Töchter hat, bekommen die viel weniger als eine Familie z.B. mit 5 Söhnen?« »Das stimmt,« pflichtete Dimitri bei, und deshalb geht man langsam auch ab von diesem System. Bei der Ansiedlung in Südrussland ging man zur Minoritätsregelung über, d.h. der Jüngste erbt den ganzen Hof Bei euch gibt es jetzt so eine Mischung von beiden Systemen: Hof und Gartenland gehört einer Familie, egal wieviel männliche Mitglieder die Familie hat. Die Wirtschaft wird dann auch an den Jüngsten vererbt, aber das Weide- und das Weinland wird im Mirsystem aufgeteilt. Das ganze Land aber gehört euch nur fideikommissarisch. Ihr dürft es vererben, aber nicht beleihen und nicht verkaufen.«
»Ja, das wissen wir«, wandte Johann Georg ein, »aber wir wussten nicht, dass das Weideland uns persönlich nur so lange gehört, wie wir es bewirtschaften. Und sehr seltsam finde ich die Aufteilung nur nach der Zahl der männlichen Mitglieder. Das ist doch in hohem Maße ungerecht.« »Ja, das ist auch ungerecht«, bekräftigte Dimitri »und ich hoffe nur, dass das System bald mal ganz aufgegeben wird.«
»Und die Margarete macht jetzt eine Ausbildung zur Krankenschwester?«, fragte Barbara und wechselte damit das Thema. »Wie lange geht denn solch ein Kurs?« »Zunächst mal 3 Monate, dann muss man ein halbes Jahr praktisch arbeiten und dann gibt es noch einen Anschlusskurs von 3 Monaten.«
»Also in einem Jahr bist du dann eine fertige Krankenschwester?«, fragte Agnes. »Musst du da auch die ganzen lateinischen Namen der Krankheiten und der Medikamente auswendig können?« »Natürlich, muss sie das. Bei uns wird bald nur noch lateinisch geredet!« warf Dimitri mit einem Grinsen ein. »Es ist nur ein Glück, dass ich an der Universität auch Latein gelernt habe, sonst würde ich mir richtig dumm vorkommen!!« »Jetzt übertreibst du aber«, sagte Margarete und boxte ihn liebevoll in die Seite.
»Schade, dass ihr so weit weg wohnt, sonst könnten wir euch mal um Rat fragen, wenn einem von uns was weh tut?«, meinte Marie.
»Freust du dich schon auf die Schule?«, wollte Salomon von seinem Schwiegersohn wissen.
»Eigentlich ja. Bevor ich im März zur Hochzeit herkam, war ich einige Tage in Tiflis gewesen. Ich hatte mir das Häuschen angeschaut, das wir dort durch einen Freund gekauft haben und dann auch die Schule besucht. Der Direktor ist ein sehr verdienter Offizier und entsprechend soll er auch die Schule führen. Ich habe gehört, dass er streng sei, aber auch gerecht, höre einem zu und sei auch manchmal bereit seine Anordnungen zurückzunehmen, wenn er merkt, dass sie nicht ankommen. Ich hoffe, mit ihm gut auszukommen«,
»Wir haben den Winter über auch fleißig russisch gelernt«, sagte Agnes, »Herr Terdjimanian hat jeden Tag mit uns gearbeitet. Dürfen auf eure Schule auch Mädchen gehen?«, fragte sie jetzt weiter.
»Nein leider noch nicht, aber ich denke, dass es in einigen Jahren auch ein Gymnasium für Mädchen geben wird. In Stuttgart gibt es das ja bereits und zwar von Katharina Pawlowna gegründet.«
»Mädchen brauchen doch nichts zu wissen,« warf Michael, der neben Agnes saß, mit einem Grinsen ein. »Gelehrsamkeit schadet nur ihrer Schönheit und hindert sie daran gute Hausfrauen zu werden!«
»Aua«, machte er, nach einem kräftigen Rippenstoß von Agnes. »Männer zu verprügeln, gehört sich aber auch nicht.« »Männer?«. Agnes schaute ihn mit hochgezogener Augenbraue fragend an und alle lachten.
Jetzt wurden auch die Jüngsten unruhig. Barbara, die ihren Gottlieb auf eine Decke gesetzt hatte, blickte fragend zu Marie. Diese nickte und sagte: «I denk, jetzat macha ma Schluss fir heit. Morgen ist auch wieder ein Tag. Es war schön, euch wieder mal gesehen zu haben«, sagte sie zu Margarete und zu Dimitri gewandt. »Bleibt ihr noch ein paar Tage hier?«
»Ja, bis Donnerstag früh, dann müssen wir uns wieder auf den Weg machen. Am Montag ist wieder Unterricht und man braucht ja, selbst mit einer schnellen Kutsche gut 4 Tage bis Tiflis.« »Außerdem fängt am 1. Mai der Kurs an«, warf Margarete ein »und da muss ich unbedingt da sein.«
Jetzt halfen alle mit, die Gläser in einen Korb zu stellen und Johann Georg ging noch mal zur Feuerstelle und schüttete etwas Wasser auf die Glut, damit, während ihrer Abwesenheit kein Feuer entstehe.
Die Kinder schleppten die Hocker und die Stühle wieder in den Wagen, denn sie über Nacht dort draußen zu lassen, wäre leichtsinnig. Deshalb wollte Johann Georg auch so schnell wie möglich sein Häuschen bauen, damit sie nicht immer abends zurück nach Elisabethpol müssten. Im Moment waren sie aber froh über diese Möglichkeit, denn eigentlich hatten alle genug von dem Leben im Planwagen und freuten sich, dass sie noch ein Weilchen die Zivilisation bei den Terdjimanians, ihren Gastleuten in Elisabethpol, genießen durften.
Bevor sie auf den Wagen stiegen, sagte Margarete zu Barbara: »Könntest du mir mal, bitte, den kleinen Gotthilf geben?« »Aber gerne«. Sie nestelte ihr Tuch auf und reichte Margarete den schlafenden Buben.« Verzückt betrachtete Margarete das kleine Kerlchen.
»Na «, meinte Barbara, »möchtest du auch gerne so etwas Kleines?« »Ja, schon, aber bisher hat es noch nicht geklappt, obwohl wir uns große Mühe geben. Aber eigentlich ist es ja gar nicht so schlecht, sonst könnte ich ja diesen Schwesternkurs nicht mitmachen. Aber ich hoffe, dass es dann mal klappt.«
Margarete und Dimitri fuhren mit den Kehrers zurück, sie übernachteten zwar bei ihren eigenen Gastgebern, besuchten aber jetzt nochmal die Terdjimanians, hatten sie doch hier, gemeinsam mit Katharina und Hansjörg Kühfuß die Doppelhochzeit gefeiert
Nachdem die kleinen Kinder ins Bett gebracht worden waren, saßen die Erwachsenen noch zusammen und es begann ein lustiges deutsch-russisches Palaver, wobei Dimitri oftmals dolmetschen musste. Dabei erwähnte Johann Georg aus der Rede des Kommissars, dass ihnen Armenier beim Aussäen des Getreides helfen sollten. »Das würde ich nicht machen«, sagte Herr Terdjimanian.« Alle schauten ihn fragend an. »Warum?«
»Die Menschen, die zur Armee gehen«, meinte er, »haben meist keine Ahnung von Landwirtschaft, die wollen schnell fertig werden und streuen dann das meiste Getreide in ein Loch statt es gleichmäßig auszubringen. « »Ach du liebe Zeit «, sagte Dimitri, »dann ist es besser, ihr macht das selbst.«
Die Terdjimanians hatten sich mit ihren Gästen nicht nur gut verstanden, sondern es war daraus sogar eine lebenslange Freundschaft geworden. Noch Jahre später besuchten sich die beiden Familien und halfen einander, wo es nötig war. Vor allem aber erhielten die Schwaben wertvolle Tipps für ihr Leben in dem für sie ungewohnten Klima und dem fremden Kulturkreis.
Wahrend ihrer langen Reise hatte Katharina ein Tagebuch geführt. Seit ihrer Hochzeit mit Hansjörg Kühfuß aber hatte Agnes diese Aufgabe übernommen.
An diesem Abend schrieb Agnes:
Jetzt haben wir alle so lange auf diesen Tag gewartet und jetzt ist er schon vorbei. Irgendwie komisch! Schön, dass die Margarete und der Dimitri wieder da waren. Für mich ist das schon komisch, dass ich jetzt Tagebuch führen muss, nachdem Katharina das fast zwei Jahre lang gemach that. Aber zum Glück bleibt Kathija jetzt in Helenendorf und ich hoffe, dass wir uns doch immer wieder mal sehen.
Sehr schön finde ich ja, dass die Barths ihr Grundstück gegenüber von uns bekommen haben. Ich habe den Frieder heute auch schon mal gesehen, gerade als er mit seinem Vater zum Platz gegangen ist. Er ist ja ein sehr hübscher Kerl mit seinen schwarzen lockigen Haaren. Ich erinnere mich noch an unsere 1. Begegnung in Betzingen vor 2 Jahren. Und dann in Odessa, als sein Vater mit Hansjörg Frick vorausgeritten war, um das Land anzusehen. Jakob Barth war dann ja der Meinung, wir sollten in der Ukraine bleiben. Das für uns vorgesehene Land sei nicht sehr günstig, meinte er. Aber leider kam er zu spät, da Tataren ihn gefangen genommen hatten. So traf er uns schon fast im Kaukasus und da wollte natürlich niemand mehr umkehren. Wir sind zwar jetzt angekommen, aber es gibt doch noch sehr viel zu tun. In der Familie bin ich ja jetzt die Älteste, nachdem die Katharina eine eigene Familie hat. Und da Philipp sehr oft bei Barbara ist, sind wir jetzt oft nur noch zwei große und zwei kleine Kinder. Schon ein komisches Gefühl, wo wir sonst immer so viele waren.!!
2. KAPITEL
1819-1821
DER HARTE ALLTAG UND SALOMONSTOD 1819
Nach diesem schönen Gründungsfest begann für die Helenendorfer wieder der harte Alltag.
Tag für Tag führen sie von Elisabethpol in ihre zukünftige Kolonie und arbeiteten fleißig an dem Aufbau ihrer Wirtschaft. Langsam wuchs der Berg an Lehmbatzen und schon im Juni konnten die Kehrers anfangen, die Grundmauern zu legen. Der Keller war mittlerweile mit Holzbalken ganz abgedeckt, so dass man schon eine Vorstellung von dem künftigen Heim bekommen konnte.
Marie hatte mit Hilfe der Kinder Kartoffeln, Möhren, Zwiebeln und Kraut gesetzt und einen Kräutergarten angelegt. Durch Anregung von Frau Terdjimanian wusste sie, welche Kräuter in diesem Klima gut gedeihen würden. Sie hatten auch schon Obststräucher und Obstbäume gesetzt.
»Schau mal Agnes, die Bäumchen und die Sträucher, die wir im April gesetzt haben, sind sogar angegangen,« sagte Marie.
»Wann tragen die denn Früchte«, fragte Agnes.«
»Die »Sträucher vielleicht schon im nächsten Jahr, aber bei den Bäumchen dauert es sicher noch einige Jahre. Trotzdem erinnern mich die Sträucher und das Gemüse sehr an daheim. Das ist richtig schön!« »Ich hol nochmal Wasser«, sagte Agnes und ging vor das Tor zu dem kleinen Kanälchen, das vor ihrem Haus floss. Als sie zurückkam sagte sie zu Marie:
«Wir haben ja Glück, dass unser Kanälchen schon gebaut ist, die Vottelers in der Stadtstraße haben noch keins. « »Ja, wir sind die erste Straße, aber die andern kommen dann auch bald dran. «
»Der Hans-Jörg hat gesagt, dass wir auf der Straße auch Bäume pflanzen sollen. « »Ja, und zwar zwei Birnbäume und zwei Nussbäume. « »Dürfen wir die dann auch ernten?« »Ha, freili, des sind doch onsere Beim.«
Die Männer machten sich dann auch an das Einsäen von Getreide. Johann-Georg und Salomon merkten schnell, dass sie mit ihren Eisenpflügen, die sie mitgebracht hatten, nicht sehr weit kamen, denn der trockene Boden darf nur geritzt werden. Das erfuhren sie von einem Armenier, der ihnen dann auch zeigte, wie solch ein armenischer Pflug aussah. Der heißt Tschut und besteht aus einem gegabelten Baumstamm. Der längere, etwa 2 m lange Teil, dient zum Bespannen der Ochsen. Der kürzere Teil ist mit einer Eisenspitze versehen und wird über den Boden geführt. Dieses primitive Gerät war ideal für das mit Dornen bewachsene Gelände. Zunächst wurde der Boden nur geritzt, dann wurde eingesät und noch einmal quer geritzt. Dann musste das gesäte Getreide mit Wasser begossen werden. Dazu musste das Wasser aus dem Kanälchen vor dem Haus in Eimern nach hinten in den Garten gebracht werden. Das war eine sehr mühselige Sache. Aber da immer alle mithalfen, auch die Kleinen mit ihren Eimerchen, machte es auch wieder Spaß. Erstaunlicherweise war die Ernte von Getreide und Weizen dann sehr gut, vermutlich, weil der Boden noch relativ jungfräulich war.
Auch das soziale Leben kam langsam in geordnete Bahnen. Da das Bethaus noch nicht fertig war, begann Lehrer Krauß mit dem Unterricht auf einem überdachten Platz im Freien. Es war natürlich alles sehr improvisiert: die Schüler saßen zwar auf Bänken, hatten aber noch keine Tische. Trotzdem waren Agnes, 13 Jahre alt und Hansjörg, 8 Jahre alt sehr froh, dass jetzt endlich wieder die Schule losging. Auf dem gleichen Platz fanden dann auch die Gottesdienste und die täglichen Stunden statt sowie die wöchentliche Vorbereitung der Konfirmanden.
Es waren fast 20 junge Menschen, die in zwei Jahren konfirmiert werden sollten. Die Zahl war so hoch, weil es ja seit 3 Jahren keine Konfirmation mehr gegeben hatte. Agnes freute sich sehr, dass ihre Freundin Anna Kühfuß mit dabei war. Auch Friedrich Barth, die Brüder Reitenbach und Johannes Hummel, der in Lauingen so tapfer den Dieb gestellt hatte, wurden konfirmiert, obwohl sie auch etwas älter waren.
Ende Juni gab es im Freundeskreis eine gewaltige Erschütterung durch den plötzlichen Tod von Salomon Votteler. Als der Älteste war er für alle immer der ruhende Pol gewesen. Falls es Unstimmigkeiten gab, Salomon fand immer eine Lösung. Er war auch gar nicht krank gewesen, sodass kein Mensch mit seinem plötzlichen Ende gerechnet hatte.
Salomon wollte das schöne Wetter ausnützen und begann in seinem Garten das Erdreich umzugraben, um später Zwiebeln zu setzen. Plötzlich wurde ihm schwarz vor Augen. Er versuchte noch, sich auf eine Kiste zu setzen, schaffte es aber nicht. Er sank bewusstlos zu Boden. Rosina hatte das zufällig von der Küche aus beobachtet und rannte laut schreiend zu ihrem Schwiegervater. Auf ihr Rufen hin kam auch Johann Georg aus dem Schuppen.
»Schnell hol den Andriß, dr Vadder isch bewusstlos«, rief sie ihm entgegen. Inzwischen setzte sich Rosina auf den Boden und bettete das Haupt von Salomon in ihren Schoß. Sie versuchte, die Schlagader zu fühlen, aber Salomons Herz hatte aufgehört zu schlagen. Rosina umfasste seine Hände und begann den 23. Psalmen zu sprechen. Dabei traten ihr die Tränen in die Augen denn seit dem Tod ihrer Mutter unterwegs auf der Reise, war Salomon wie ein Vater zu ihr gewesen. Er hatte sie so herzlich in seine Familie aufgenommen, dass sie sofort das Gefühl hatte, dazu zu gehören. Und jetzt hatte sein Herz aufgehört zu schlagen. Sie streichelte seinen schon ergrauenden Schädel und flüsterte ihm zu. »Bald bischt du bei deiner Frau. «