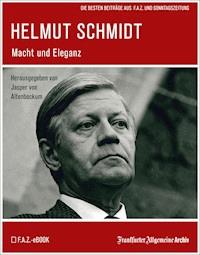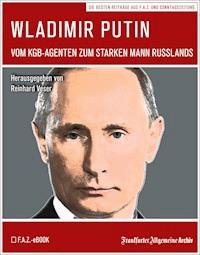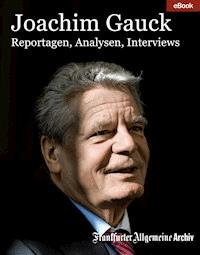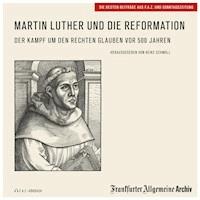Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ohne Guiness ist Irland für viele kaum vorstellbar. Wir klären daher zuerst, wo der Einsatz des dunklen Stout als allgegenwärtiger Sorgenbrecher seinen Ursprung hat. Im ersten Kapitel gehen wir weiterhin der Frage nach, was es bedeutet, Ire mit Leib und Seele zu sein: Wir widmen uns dem Essen, Trinken, Musik, Tanz, Kunst und Literatur als den konstituierenden Elementen des irischen Selbstverständnisses, bevor wir von Süden nach Norden die Insel erkunden. Die Autoren dieses Buches berichten von den irreal schönen Buchten West-Corks, von den Inseln im Westen, dem Shannon und den Kanälen in der Landesmitte, von Dublin und seinem Umland im Osten und schließlich von Belfast, der viktorianischen Perle im Norden. Die irischen Konstanten Guinness, Tanz und Literatur haben sich dabei, obwohl zu Recht hochgradig im Klischeeverdacht stehend, tatsächlich als ständige Begleiter entpuppt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Irland
Ansichten einer Insel
F.A.Z.-eBook 19
Frankfurter Allgemeine Archiv
Projektleitung: Franz-Josef Gasterich
Produktionssteuerung: Christine Pfeiffer-Piechotta
Redaktion und Gestaltung: Hans Peter Trötscher, Birgitta Fella
eBook-Produktion: rombach digitale manufaktur, Freiburg
Alle Rechte vorbehalten. Rechteerwerb: [email protected]
© 2013 F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main.
Titelgestaltung: Hans Peter Trötscher. Foto: © Kurt Tutschek / Fotolia
ISBN: 978-3-89843-253-5
Inhalt
Vorwort
Iren mit Leib und Seele
Essen: Die Kartoffel ist eine heilige Knolle – Von Jakob Strobel y Serra
Trinken: Das Geheimnis der sieben heiligen Schlucke – Von Jürgen Roth
Dichten: Die Welthauptstadt des Wortes – Von Elsemarie Maletzke
Caledonian Set: Der irische Tanz hat Platz auf einem Teller – Von Alexander Bartl
Malen: Die Kunsttankstelle neben dem Pub – Von Regine Reinhardt
Irlands Süden
West Cork: Kosmische Kosmetik, energetisches Obst – Von Martin Glauert
Dingle: Tiger, Kater und ein Leopard – Von Andrea Diener
Irlands Westen
Achill Island: Ansichten einer Insel – Von Christiane Zwick
Clare: Liebesspiele in Lisdoonvarna – Von Elke Sturmhoebel
Valentia Island: Letzte Tankstelle vor Amerika – Von Regine Reinhardt
Mayo: Der Heilige und Marilyn Monroe – Von Michael Bengel
Irlands Osten
Dublin 1: Träumer, Trickser und Erzähler – Von Elsemarie Maletzke
Dublin 2: Biertrinken im Namen der Weltliteratur – Von Uwe Ebbinghaus
Powerscourt: Sherry in der Schubkarre – Von Uwe Ebbinghaus
Irlands Norden
Am Shannon-Erne-Waterway: Leider sieht auch niemand die gelungenen Manöver – Von Andreas Obst
Ulster: Bürgerkriegsschau-plätze zu Touristenattrak-tionen – Von Renate Schostack
Belfast: Partys in den Palästen des Empire – Von Regine Reinhardt
Am Shannon
Roscommon: Prunkvolle Gemälde für das Vieh – Von Regine Reinhardt
Buch- und Internet-Tipps
Das sollten Sie lesen
Das sollten Sie klicken
Vorwort
Von Hans Peter Trötscher
Die Iren haben viel Erfahrung im »schlechte Zeiten durchmachen«. Hatten sie sich doch erst bis vor kurzem zum vermeintlich stolzen »keltischen Tiger« gemausert! Die internationale Finanzkrise zeigte hingegen, dass man allein auf Banken und Immobiliengeschäfte gestützt keinen nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg haben kann. Die Iren nehmen die Krise nicht auf die leichte Schulter. Aber eine Lektion aus ihrer Geschichte ist, dass es weitaus schlimmer kommen kann.
Denn die »schlechten Zeiten« vergangener Jahrhunderte haben ungleich stärkere Spuren hinterlassen. Als Mitte des 19. Jahrhunderts aufgrund der Kartoffelfäule die Bevölkerung ganzer Landstriche verhungerte oder – im besseren Fall – auswanderte, erwarb sich Irland den Ruf, das Armenhaus des britischen Empire und ganz Europas zu sein. Von den britischen Herren wurde Irland regiert wie eine Kolonie. In der Zeit der großen Hungersnot versagten sie vollkommen. Den irischen Pächtern stand nur so wenig Land zur Verfügung, dass sie ihre Familien fast ausschließlich mit Kartoffelanbau ernähren mussten. Die nasskalte Witterung der Jahre 1845 bis 1849 hatte zwar in ganz Europa zu Ernteausfällen geführt, ein aus Amerika eingeführter Schädlingspilz vernichtete aber in Irland die komplette Ernte. Obwohl die Iren buchstäblich verhungerten, exportierten die Briten weiterhin irisches Getreide und verursachten so den Tod von einer Million Menschen und die Auswanderung von weiteren zwei Millionen. Noch heute hat Irland fast zwei Millionen Einwohner weniger als 1841.
Gute Zeiten – schlechte Zeiten: Ein Betrunkener gönnt sich eine Pause an einem Seitenportal der »Bank of Ireland«. F.A.Z.-Foto / Barbara Klemm.
Bis heute ist die Zeit der großen Hungersnot in Irland präsent und ein lebendiger Teil der Musik- und Popkultur. Viele alte und neue Songs handeln von den Folgen der Not und der massenhaften Auswanderung.
Das Famine-Memorial am Ufer des Liffey in Dublin legt Zeugnis ab vom unbeschreiblichen Elend, das im 19. Jahrhundert in Irland herrschte. Für die britischen Herren war die grüne Insel nichts weiter als eine nahe gelegene Kolonie. F.A.Z.-Foto / Wolfgang Eilmes.
Mag sein, dass auch der reichliche Genuss des dunkel gemälzten Stout als probater Sorgenbrecher hier seinen Ursprung hat. Im ersten Kapitel gehen wir daher der Frage nach, was es bedeutet, Ire mit Leib und Seele zu sein: Wir widmen uns dem Essen, Trinken, Musik, Tanz, Kunst und Literatur als den konstituierenden Elementen des irischen Selbstverständnisses, bevor wir von Süden nach Norden die Insel erkunden. Die Autoren dieses Buches berichten von den irreal schönen Buchten West-Corks, von den Inseln im Westen, dem Shannon und den Kanälen in der Landesmitte, von Dublin und seinem Umland im Osten und schließlich von Belfast, der viktorianischen Perle im Norden. Die irischen Konstanten Guinness, Tanz und Literatur haben sich dabei, obwohl zu Recht hochgradig im Klischeeverdacht stehend, tatsächlich als ständige Begleiter entpuppt. Erstem wird sich mit einer derartigen Hingabe gewidmet, dass man sich irgendwann fragt, warum zum Teufel trinkt Leopold Bloom eigentlich Cidre?
In und vor Paddy Egans Pub in Moate ist die Zeit stehen geblieben. Wer Iren und irische Lebensart kennen lernen möchte, ist hier bestens aufgehoben. Foto: Joe Cashin / Tourismireland.
Iren mit Leib und Seele
Essen: Die Kartoffel ist eine heilige Knolle
Doch der Götter gibt es viele: Irland hat die Lust am guten Essen entdeckt
Von Jakob Strobel y Serra
Bisher waren die eher rustikalen Gerichte Irish Stew und Beef in Guinness die einzigen Geschenke Irlands an die kulinarische Welt. Das wird sich nun ändern.
Nie im Leben, sagt der alte Mann am Tresen und schüttelt seinen karottensaftroten Kopf vor Abscheu und Empörung. Lieber verhungere er, als dieses Teufelszeug anzurühren. Sein Leben lang habe er nur die gute irische Küche gegessen, warum solle er das jetzt ändern. Er trinke ja auch nur Guinness und nichts anderes, ohne tot umzufallen, hier, das sei sein drittes, und sehe er nicht blendend aus, na also. Seit seine Tochter mit diesem Italiener zusammenlebe, sei es ganz schlimm, der quatsche von nichts anderem als vom Essen und verstehe nichts, weder ihn noch Irland. Eine richtige Mahlzeit für einen richtigen Kerl, das sei seine Leibspeise, die Trinität der irischen Küche: ein anständiges Stück Schinken mit Kohl und Kartoffeln, alles schön lang in Wasser gekocht, drei Stunden Minimum, und dann mit einer Petersiliensauce aus der Tüte serviert. Das und nicht diese komischen Sachen aus der Hexenküche der irischen Küchenrevolution, von der jetzt alle redeten, das allein sei der Himmel auf Erden, Gott möge ihm verzeihen, cheers!
In Dublins Ausgehviertel Temple Bar findet sich einheimische Gastronomie gleichberechtigt neben Restaurants mit Spezialitäten aus aller Herren Länder. F.A.Z.-Foto / Wolfgang Eilmes.
Die Revolution der irischen Küche ist in vollem Gange, doch sie stößt auf Widerstand. Dass sich die Massen noch nicht erhoben haben, zeigen allein schon die epidemisch verbreiteten Billigsupermärkte aus Deutschland, all die Aldis und Lidls, deren Baracken sich an den Ortsrändern als grelle Sirenen des schlechten Geschmacks aufplustern. Dort decken sich die Menschen mit der heiligen Speise der Iren ein, die am liebsten in Zehn-Kilo-Säcken gekauft wird und seit Jahrhunderten Tag für Tag auf den Tisch kommt: Kartoffeln, manchmal mit Kraut, manchmal mit Hering, manchmal mit Fleisch, in Notzeiten ohne alles, kulinarischer Monotheismus in reinster Form. Die beiden einzigen nennenswerten Geschenke der keltischen Cuisine an die schlemmende Menschheit sind Beef in Guinness, eine Variante des Boeuf Bourgignon mit Dunkelbier, und der Eintopf Irish Stew, in dem Kartoffeln, Gemüse und das Fleisch altersschwacher Nutztiere mit viel Geduld und wenig Raffinesse zu einer geschmacksneutralen Pampe weichgekocht werden.
Die Kartoffel ist Irlands Fluch und Segen. Kein anderes Land war jemals so abhängig von einem einzigen Lebensmittel wie die Grüne Insel von der indianischen Knolle. Bevor sie im siebzehnten Jahrhundert auf ihrem Siegeszug durch Europa auch Irland erreichte, aßen die Menschen dort zwar bescheiden, dafür aber abwechslungsreich. Die wunderbaren irischen Meeresfrüchte zum Beispiel waren derart verbreitet, dass sie als Armenspeise galten und in den Spelunken Anschläge hingen, die jedem Feinschmecker bis heute das Herz brechen: »Hier gibt es für einen Penny einen Strohhalm, für zwei Penny ein Bier und umsonst einen Hummer oder Lachs.« Damals lebte eine knappe Million Menschen glücklich und wohlgenährt auf der Insel. Dank der Kartoffel und einiger anderer Dinge wurden aus ihnen bis zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts acht Millionen. Dann aber brach die Braunfäulnis wie eine biblische Plage über Irland herein und vernichtete eine Kartoffelernte nach der anderen. Zwischen 1845 und 1848 verhungerten eine Million Iren, zwei Millionen mussten auswandern, drei Millionen lebten elend von der staatlichen Fürsorge – eine Katastrophe, von der sich das Land bis heute nicht erholt hat. Die Bevölkerungszahl verharrt seither bei vier Millionen, und »The Great Famine« wurde zu einem nationalen Trauma, das die Beziehung der Iren zum Essen für hundertfünfzig Jahre auf eine simple Formel brachte: Es muss genug dasein.
Die Iren freundeten sich langsam mit dem Gedanken an, dass der Sinn des Essens nicht allein in der Sättigung liegen und die Nahrungsaufnahme auch Spaß machen könnte. Besonders leidenschaftlich hat diese Idee Kevin Dundon verinnerlicht, der mit seinem betonierten Dauerlächeln eine Art irischen Jamie Oliver gibt, Verfasser eines populären Kochbuchs mit dem patriotischen Titel »Full on Irish« ist und sich an der King‘s Bay im Süden der Insel das Landschlösschen Dunbrody House als kulinarische Bastion in der Eintopf-Diaspora zugelegt hat.
Während sich im örtlichen Pub, einem düsteren Hexenhäuschen mit krumm getrunkenem Tresen und ein paar alten, seeuntüchtigen Fischern daran, das gastronomische Angebot in Erdnüssen und Schokoriegeln erschöpft, wird im Gourmetrestaurant von Dunbrody irische Haute Cuisine im Geist der neuen Zeit zelebriert – ohne Hokuspokus und kulinarische Kabinettstückchen, doch technisch auf höchstem Niveau, neugierig auf die Geschmäcker dieser Welt und dabei doch immer trunken vor Liebe zur irischen Heimat. Die karamelisierten Jakobsmuscheln aus dem Meer vor dem Herrenhaus ruhen auf einem Kopfkissen aus Süßmais und haben als Spielgefährten schwarze Trüffel und frische Brunnenkresse aus dem eigenen Garten. Auch das Filet vom Petersfisch wurde aus der tosenden irischen See gefischt, doch seine Begleitung, ein Hummer-Erbsen-Risotto, ist vom Fernweh beseelt und bricht mit der Tyrannei der Kartoffel als Sättigungsbeilage. Fragt man die Familie Dundon indes nach ihrer Lieblingsspeise, so hört man: irischer Räucherlachs mit Schwarzbrot und Zwiebel.
Die irischen Küchenrevolutionäre sind also keine Jakobiner. Sie führen das gute heimische Nutzvieh nicht aufs Schafott, sondern weiterhin brav ins Schlachthaus, stehen auch sonst auf einer dicken Humusschicht und predigen das Motto »From Farm to Fork«, von der irischen Erde direkt auf die Gabel. Alles andere wäre auch Häresie, denn Irland ist nicht nur mit Gottesfürchtigkeit gesegnet, sondern auch mit dem milden Golfstrom und einem prallvollen Meer, einem guten Boden und sehr viel Regen. Und die Schafe aus Wicklow auf ihren Salzwiesen, die Rinder aus Wexford im fetten Gras, die Austern aus der Gischt, die Saiblinge aus den Bächen, all die Knollen und Wurzeln, Pilze und Beeren scheinen nur darauf gewartet zu haben, endlich nicht mehr als »Irish Stew« auf den Tisch zu kommen.
Dass Irland Bauernland ist, sieht man sofort. Es ist wie ein Sinnbild von Ackerbau und Viehzucht, wie eine Kinderzeichnung von Landmanns Land, in der jetzt erstaunliche Karrieren wie die des John Hempenstall möglich sind: fünfundsechzig Kühe, sechs Kinder, keine Perspektive in der globalisierten Landwirtschaft. Also ließ sich der Mann mit dem zerzausten Haar und den Löchern in den Socken zum Käsemacher umschulen. Er kreierte den milden Blauschimmel-Brie »Blue Wicklow«, hat damit berauschenden Erfolg, verkauft seinen Käse bis nach Australien, hängt der »Slow Food«-Bewegung an und ist trotz allem ein gottesfürchtiger Mann geblieben, der dem Besucher fast verschämt eine Kostprobe schenkt und noch immer ungläubig über seinen Erfolg staunt wie ein Bub auf dem Bolzplatz über seinen Glückstreffer.
»From Farm to Fork«: Auf dem Naas-Bauernmarkt in Kilkenny macht offensichtlich schon das Einkaufen gute Laune. Neben genuin Irischem ist auch Mediterranes erhältlich. Foto: James Fennell / Tourismireland.
Dass man Irland »die Grüne Insel« nennt, ist indes eine heillose Untertreibung. Irland ist die grünste aller grünen Inseln. Es ist voller grüner Wiesen und Weiden, die von dunkelgrünen Hecken und grün bemoosten Bruchsteinmauern durchzogen sind, voller Häuser mit grünen Efeu-Kleidern, voller Sträßchen mit grün lackierten Traktoren und grünen Spalieren aus Farnen, voller Gartencenter für acht Millionen grüne Daumen, umspült von einem grünen Meer, dem anscheinend etwas schlecht geworden ist, weil es der Wind so heftig schüttelt. Das Land hingegen ist eine einzige Beruhigung. Die grünen Hügel schlendern in einem geruhsamen Auf und Ab zum Horizont, ohne Eile, ohne Dramatik, sparsam dekoriert mit hingetupften Schafen und Rindern, Tieren also, die ein ausgesprochen ausgeglichenes Gemüt besitzen – Stiere passten hier nicht hin. Es ist eine Landschaft wie mit einem Ruhepuls von fünfzig, ein Abbild der traditionellen irischen Küche, niemals übermütig, niemals verschwenderisch, niemals tollkühn, niemals kämpferisch, ein Eintopf, in dem alles seinen Platz hat und nichts weggeworfen, nichts an den Rand gedrängt wird, weil dieses Land weiß, was Not bedeutet.
Man spürt, dass die Zeit der Entbehrung Irland noch in den Knochen steckt. Wie ein kalter Hauch, wie eine dumpfe Drohung weht sie über verfallende Gehöfte und elende Dörfer mit Bauernkaten, finster und stumpf, keine Orte der Freude, zum Glück gibt es Neubaugebiete. Und riesenhaft thront über allem eine Kirche, grau wie Asche, ein Menetekel der Vergänglichkeit. Sie sieht aus wie ein Sarg, weil kein Geld für einen Kirchturm da war und die Glocke an einem rostigen Gerüst neben dem Pfarrhaus hängt. Doch Geld war da für ein protziges Marienmahnmal neben der Kirche: die Muttergottes schneeweiß und lebensgroß, angebetet von einem knienden Kind, eine Maria in Miniatur, das Geschenk eines Dorfbewohners als Erinnerung an seine Eltern – ein Monument der Frömmigkeit wie aus einer fremden Zeit, als Gott noch nicht tot war. Dann aber liest man das Datum: geweiht im Marienjahr 1988, vom Bischof höchstselbst. Gott lebt in Irland.
Gleich zwei Kirchen für ein paar hundert Einwohner, mächtig wie Kathedralen, gekrönt von keltischen Kreuzen, glaubt Inistioge nötig zu haben, das gern vorgezeigt wird als irisches Bilderbuchdorf. Es liegt idyllisch an einem Fluss, wird pittoresk von putzigen Häusern in lustigen Farben und den Efeu umkletterten Ruinen des »Schwarzen Schlosses« verziert, hat sich einigen Ruhm als Filmkulisse erworben und trotzdem keine Lust auf Musealisierung. Inistioge ist keiner jener blankpolierten, zugrunde verhübschten Orte, in denen das Leben der Bewohner zur Dienstleistung am Tagesgast geworden ist. Hier hat man keine Scheu vor Schmuddelecken, Terrassen aus blankem Beton und seltsamen Antiquariaten, die sich nicht um den Geschmack der breiten Touristenmasse scheren. Das Schaufenster eines Antiquars ist mit der Schallplatte »I eat cannibals« eines Herrn Toto Coelho geschmückt, wer auch immer das sei. Das Cover zeigt fünf Disco-Schnecken in affektierten Posen mit Plastikkostümen und Wischfeudelfrisuren, Geschöpfe aus den Tiefen der siebziger Jahre – die Zeit scheint zu rasen in diesem Dorf, wenn schon die Siebziger antik sind. Viel spürt man davon allerdings nicht.
Wie eine Zementierung der Zeit, wie ein Fanal der Unveränderlichkeit thront hingegen ein paar Kilometer weiter der graue Koloss des neunhundert Jahre alten Castle of Kilkenny über der Stadt, die in aller Welt für ihr mildes Bier gerühmt wird. Doch der Geist der Revolution fegt längst auch durch die Straßen von Kilkenny, dessen Häuser sich seit Jahrhunderten so kunterbunt anmalen, als gehe ihnen das irische Grün ganz gewaltig auf die Nerven. Es gibt Delikatessenläden mit selbstgemachten Pralinés und »Family Butchers« mit verlockenden Auslagen voller Rind und Schwein, in die sich freilich nie ein Wachtelchen oder ein Kaninchen verirrt, so weit ist die Revolution noch nicht. Proppenvoll ist die Filiale der Supermarktkette Superquinn, einer Art Anti-Aldi für die gehobenen Stände, die ausschließlich Ökologisches und Biologisches verkauft. Vernünftig sind die Horden von Schulkindern, die in der Mittagspause nicht zweitausend Kalorien Fish and Chips in sich hineinstopfen, sondern am Mozzarella-Baguette knabbern – trotzdem wütet die Geißel der spätkapitalistischen Völkerschaften auch in Kilkenny: dicke Kinder, dicke Menschen überall. Und selbst in den Pubs wie dem Traditionslokal »Langton‘s« ist das Essen bemerkenswert gut: Als Mittagstisch wird ein fabelhaftes Lammkotelett mit Grünkohl und Kartoffelpüree serviert, allerdings in der altirischen Reinversion: ohne einen Hauch von Sauce, ohne eine Spur von Raffinement, ohne eine einzige, winzige Nadel vom Rosmarinstrauch.
Die Küchenrevolte stecke eben noch in den Kinderschuhen, sagt Michel MacCurtain und vollendet seufzend sein Velouté aus Jerusalem-Artischocken, das er mit einer Mousse aus geräuchertem irischen Lachs serviert. Er selbst ist den Kinderpantoffeln trotz seiner jungen Jahre längst entwachsen, kocht im Marlfield House, einem Schlosshotel im opulenten Regency-Stil, eine bravourös modernisierte irische Küche und beglückt seine Gäste mit Kreationen wie einem Koriander-Krabben-Salat, den er auf einem Podest aus marinierter Roter Bete anrichtet und von einem Karotten-Orangen-Püree umspielen lässt. Die irische Küche sei eine Bauernküche ohne kreatives Potential, einfach und gut und basta, da könne man nicht viel machen, sagt MacCurtain landesverräterisch.
Gastronomische Sturheit und kulinarische Vaterlandsliebe haben indes auch ihr Gutes: Die Traditionen gehen nicht verloren, und so werden die Iren wohl noch in tausend Jahren ihr dunkles Orakelbrot »Barm Brack« backen, »das beste Brot der Welt«, so schwärmt die beinahe beängstigend beseelte Catherine Fulvio, die in der Grafschaft Wicklow ihr kleines Landhotel Ballyknocken samt Kochschule betreibt und zur Garde der jungen irischen Küchenrevoluzzer zählt. Beim klassischen »Barm Brack« sei immer ein Ring, ein Holzstückchen, eine Münze und ein Faden mitgebacken worden, sagt sie, so habe sie es von ihrer Mutter gelernt, so mache sie es bis heute. Wer die Scheibe mit dem Ring erwischt, wird bald heiraten. Wer das Holz bekommt, kann sich auf ein langes Leben freuen. Die Münze verspricht Reichtum, der Faden aber Armut und Kartoffeln. Er wird immer seltener gezogen.
Reisetipps: Irland jenseits der Kartoffel
Anreise: Verschiedene Fluggesellschaften, darunter Aer Lingus (www.aerlingus.com), Lufthansa (www.lufthansa.com) und Ryanair (www.ryanair.com), bieten mehrmals täglich Flüge von allen größeren Flughäfen Deutschlands nach Irland an. Die Insel besitzt fünf internationale Flughäfen: Dublin, Belfast, Cork, Kerry und Shannon.
Dunbrody Country House Hotel: Arthurs-town, County Wexford, Telefon: 00353/51/ 389600, Web: www.dunbrodyhouse.com.
Marlfield House: Gorey, County Wexford, Telefon: 00353/942/1124, Web: www.marlfieldhouse.ie.
Ballyknocken House: Glenealy, County Wicklow, Telefon: 00353/404/44627, Web: www.ballyknocken.com.
Aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 14.12.2006
Trinken: Das Geheimnis der sieben heiligen Schlucke
Kein irischer Pub ohne Guinness. Ob es die Menschen nutzlos macht, wie James Joyce schreibt, oder in eine weiche Stimmung bringt, wie Brendan Behan schwärmt, kann man nur im Selbstversuch erfahren. Einen besseren Ort als Dublin gibt es dafür nicht.
Von Jürgen Roth
Trink es mit den Augen!« Fergal Murray, Braumeister im Stammhaus von Guinness in Dublin, hebt das Glas und nimmt einen Schluck. Dann setzt er es behutsam auf dem rötlich schimmernden Holztresen ab und sagt: »Weiche Textur. Es ist die weiche Textur.«
Die weiche Textur, die sei es. Das sei es, was die Biertrinker der Welt, unabhängig davon, welchen Alkoholgehalt das Guinness habe –, in Afrika trumpft es, da die Leute nach »Impact« verlangten, mit acht Prozent auf – an jenem Stout schätzten und was die Gemeinde seiner Verehrer seit mehr als zweihundertfünfzig Jahren zum Schwärmen bringe. Auch deshalb, weil man, ergänzt Murray, an Geschmacksmoden keinerlei Konzessionen mache. Brauer, bleib bei deiner Rezeptur. Murray erläutert, es sei ihm sogar ausdrücklich untersagt, mit anderen als den glänzend bewährten Geschmackstönungen zu experimentieren.
Das Guinness ist eine Weiterentwicklung des klassischen englischen Porter, eines dunklen, röstmalzigen Vollbieres, und dennoch ist Guinness eine urirische Angelegenheit. Sein Erfinder, besser: sein Schöpfer, Arthur Guinness, wird adoriert wie ein Nationalheiliger. Das zumindest suggerieren die öffentliche und die mit einem gewissermaßen unaufdringlichen Aplomb unterbreitete Meinung des Unternehmens, das nach wie vor in Dublins ältestem Arbeiterviertel produziert, in den Liberties, westlich des Cathedral Districts.
Einer von den sieben heiligen Schlucken wurde schon getan. Gedenken wir dem Braugenie Arthur Guiness mit jedem weiteren Schluck des samtigen Stout. Foto: Jaap van den Beuckel / Tourismireland.
Wir unterstellen Fergal Murray nicht, dass er schnöde werbliche Interessen verfolgt, wenn er uns zum Toast auffordert: »Gedenkt dieses Mannes! Gedenkt Arthur Guinness‘! Nicht des Bieres! Welch ein Genie! Welch ein Genie!« Wir sind artig und nehmen den zweiten Schluck. »So schmeckt ein Jahrhunderte lang gewachsenes Erbe«, betont Murray noch einmal, und er hat ja recht. Erbe hin oder her, es schmeckt, quirlig, leicht sämig, solide im Körper, feinfühlig und gleichwohl stark bittergehopft, auf den Aromahopfen zur Abrundung kann man getrost verzichten. Es schmeckt bereits zur Mittagszeit, und zwar vorzüglich, zweifelsohne – was wir allerdings schon vorher wussten.
Ein Guinness zu trinken ist ein gesamtsensorisches Erlebnis, ein komplexer Akt der Perzeption, versucht uns Murray zu vermitteln. Man müsse sehen, was ein Guinness ausmache, »ein Guinnesstrinker trinkt zuerst mit dem Auge, denn ein Guinness ist ein Kunstwerk.« Der Erschaffung des Kunstwerkes durch das Zapfen sei daher ein gerüttelt Maß an Aufmerksamkeit zu schenken. Man befolge also geflissentlich folgende sechs Schritte: Erstens, das saubere Glas konzentriert beäugen. Zweitens, das Glas mit vier Fingern und dem Daumen umklammern. Drittens, das Glas im Fünfundvierzig-Grad-Winkel unter den Zapfhahn halten und bis zum Rand füllen. Viertens, das Glas absetzen, zwei Minuten nicht berühren und »dabei beobachten, wie das Bier zum Leben erweckt wird«, wie sich der cremige Schaum durch die erwachenden und aufsteigenden Bläschen zu bilden und zu stabilisieren beginnt. Fünftens, kurz bis zur Oberkante nachzapfen. Sechstens, das Glas auf den Tresen stellen.
Und schließlich, siebtens: trinken – unbedingt in gerader Körperhaltung, den Ellbogen fünfundvierzig Grad abgewinkelt. Andernfalls entrate der Ritus des Trinkens der Würde und des Stolzes. Im Übrigen, beendet Fergal Murray seinen Vortrag, werde ein Glas Guinness in exakt sieben gleichen Zügen geleert, was sich hinterher an sieben gleichmäßig angeordneten Schaumringen ablesen lassen müsse.