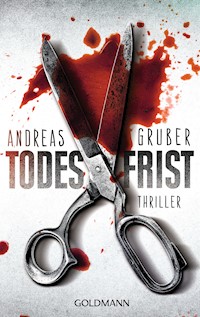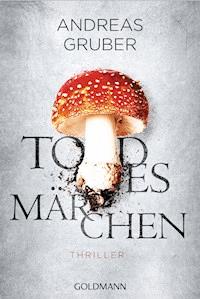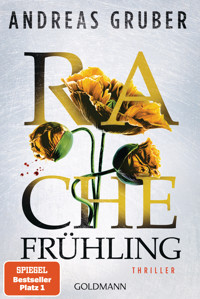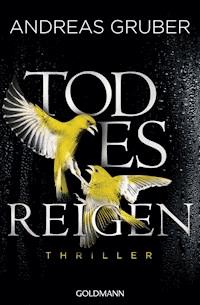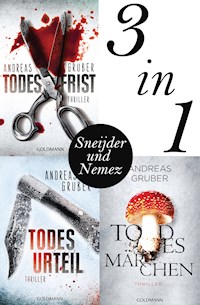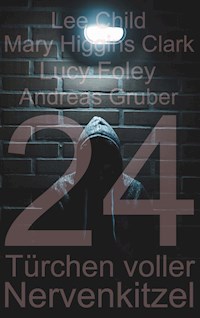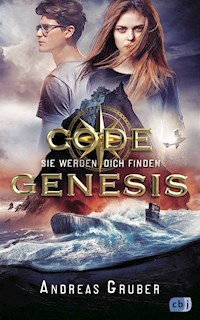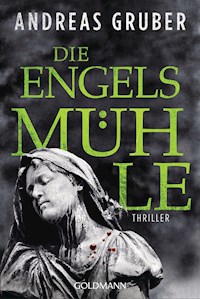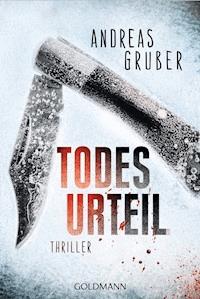14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Herz-Reihe
- Sprache: Deutsch
Eine verschwundene Frau und eine Insel, die ein tödliches Geheimnis birgt ...
Die Wiener Privatdetektivin Elena Gerink ist auf der Suche nach einem zu Unrecht freigesprochenen Mörder, der sich vor fünfzehn Jahren ins Ausland abgesetzt hat. Nach schwierigen Recherchen führt sie der Fall schließlich nach Griechenland. Dorthin sind auch Elenas Mann Peter und sein Kollege Dino Scatozza unterwegs – beides Entführungsspezialisten des österreichischen BKA. Unter Zeitdruck versuchen sie eine vermisste junge Urlauberin zu finden, die zuletzt auf einer Party der Athener High-Society gesichtet wurde. Als sich die Spuren beider Fälle auf einer kleinen griechischen Privatinsel kreuzen, ermitteln Elena, Peter und Dino dort gemeinsam weiter … und werden in die düstere Vergangenheit der Insel hineingezogen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 679
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
Die Wiener Privatdetektivin Elena Gerink ist auf der Suche nach einem zu Unrecht freigesprochenen Mörder, der sich vor fünfzehn Jahren ins Ausland abgesetzt hat. Nach schwierigen Recherchen führt sie der Fall schließlich nach Griechenland. Dorthin sind auch Elenas Mann Peter und sein Kollege Dino Scatozza unterwegs – beides Entführungsspezialisten des österreichischen BKA. Unter Zeitdruck versuchen sie eine vermisste junge Urlauberin zu finden, die zuletzt auf einer Party der Athener High Society gesichtet wurde. Als sich die Spuren beider Fälle auf einer kleinen griechischen Privatinsel kreuzen, ermitteln Elena, Peter und Dino dort gemeinsam weiter … und werden in die düstere Vergangenheit der Insel hineingezogen.
Weitere Informationen zu Andreas Gruber sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
Andreas Gruber
Herzfluch
Thriller
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Originalausgabe November 2025
Copyright © 2025 by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Ein Projekt der AVA international GmbH
Autoren- und Verlagsagentur
www.ava-international.de / www.agruber.com
Covergestaltung: UNO Werbeagentur, München
Covermotive: FinePic®, München
Th · Herstellung: ik
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-30499-7V001
www.goldmann-verlag.de
für Sebastian Aster
zur Erinnerung an die vielen produktiven Gespräche in diversen Kaffeehäusern
»Was man verstehen gelernt hat, fürchtet man nicht mehr.«
– Marie Curie –
Prolog
Samstag, 19. September
Die Musik auf der Poolparty war extrem cool. Der DJ spielte schon seit einiger Zeit alte groovige Nummern von ZZ-Top, die Anna aus dem Autoradio ihres Vaters kannte.
O Gott, mein Vater!, dachte sie. Wenn der wüsste, wo sie sich herumtrieb. Und vor allem, was sie anhatte. Beziehungsweise was sie nicht anhatte. Mit den Hotpants und dem kurzärmeligen Hemd, das sie vorne ganz leger verknotet hatte, sah sie aus wie eines der Groupies, die sie von den alten ZZ-Top-Videos kannte. Die anderen Mädels auf der Party sahen zwar auch nicht schlecht aus, aber mit ihren glitzernden Riemen-High-Heels, die sie gestern aus einer Boutique an der Strandpromenade geklaut hatte, war sie der Blickfang auf der Party.
Und scheiß drauf, was ihr Vater dachte! Sie war zwanzig und konnte tun und lassen, was sie wollte. Im Lauf des Abends hatte sie ihrer Schwester schon einige Fotos von dem Areal und der Party geschickt, doch die hatte wieder einmal ihr Handy nicht an und reagierte nicht.
Anna blickte auf die Uhr. Es war eine halbe Stunde vor Mitternacht. Als sie wieder aufsah, rempelte sie jemand an und schüttete einen Teil von seinem Cocktail über ihren Unterarm.
»Fuck! Arschloch! Kannst du nicht aufpassen?«, rief sie dem Kerl nach, doch der Typ verstand sie natürlich nicht. Sie konnte von Glück reden, wenn hier jemand Englisch konnte. Außerdem war der Kerl zu bekifft, um mitzubekommen, dass er nur noch die Hälfte in seinem Glas hatte und – weil er sich auf dem Weg zum Pool völlig lächerlich zur Musik bewegte – gerade auch noch den Rest verschüttete.
Anna leckte sich die Flüssigkeit vom gebräunten Unterarm. Sex on the Beach, aber mit einem Schuss zu viel Wodka.
Wäre nicht schlecht, dachte sie. Wobei sie den heute schon gehabt hatte. Zwar nicht am Strand, aber im Büro des Gastgebers. Der Fick war gar nicht übel gewesen, aber viel zu kurz.
Anna entfernte sich von der Bar, bevor sie der nächste Typ anrempelte, und ging wie der Kerl vorhin über die weiße breite Marmortreppe ins Freie hinaus. Vor ihr lag der große Innenhof der Villa mit dem modernen Infinity-Pool. Dieser Bereich war in Richtung Strand offen, und wenn man im Schwimmbecken trieb und über die spiegelglatte Wasserfläche und den Beckenrand hinausblickte, sah man das Meer. Jedenfalls war der Ausblick fantastisch. Die Sterne funkelten am Himmel, und irgendwo draußen auf hoher See blinkten die Positionslichter eines Schiffs.
Obwohl es schon so spät war, herrschte hier draußen eine irre Hitze. Es ging nicht das geringste Lüftchen, und die Steinplatten auf der Terrasse, die sich den ganzen Tag in der Sonne aufgeheizt hatten, gaben immer noch reichlich Wärme ab.
Eigentlich hätte Anna sogar ausrechnen können, wie viel Energie da abgegeben wurde, immerhin kannte sie die physikalische Formel dafür. Doch im Moment waren für sie noch Sommerferien, bevor im Oktober das Physikstudium an der TU Wien weitergehen würde. Bis dahin wollte sie es noch ordentlich krachen lassen.
Nun stand sie ein paar Meter vom Pool entfernt. Das Ding war riesig. Weiße Fliesen mit stylischen blauen Streifen dazwischen und abwechselnd blauer, gelber und violetter Beleuchtung. Fünf Meter breit und gute zwölf Meter lang. Beeindruckende sechzig Quadratmeter – manch einer hatte nicht einmal eine Wohnung, die so groß war.
ZZ-Top spielten den nächsten Song – offenbar hatte der DJ dieselbe Vorliebe wie ihr Vater –, und die Jungs und Mädels am Beckenrand rissen die Arme hoch, grölten, shakten mit ihren Drinks und spielten Luftgitarre.
Anna grinste. Angeblich waren auf dieser Party viele Prominente vertreten – von Influencern, Models, Sportlern, Starköchen und angesagten DJs bis zu Selfmade-Millionären und Politikerinnen –, aber sie kannte keinen einzigen davon und konnte höchstens erraten, wer hier Teil der High Society war. Doch so, wie diese Typen sich gaben, gehörten offenbar alle dazu.
Schließlich übertrieb es eines von den jungen Mädels, stolperte, und als es ein Junge auffangen wollte, wurde er unabsichtlich mit in den Pool gerissen. Die beiden klatschten mit ihren Drinks samt Schuhen und Kleidung ins Wasser.
»Yeah! Party!«, brüllten ein paar andere, hechteten hinterher und taten so, als wollten sie die beiden retten.
Plötzlich rannten alle wie auf Kommando um sie herum zum Pool, nahmen Anlauf und sprangen mit Kleidung ins Wasser. Wie die Lemminge, dachte Anna. Die Oberfläche wurde wie in einem gigantischen Whirlpool aufgewühlt, und beinahe wäre Anna von einer Gruppe junger Männer mitgerissen worden.
Doch jemand packte sie rechtzeitig am Arm und zog sie sanft zurück. Anna fuhr herum und blickte in die Augen eines attraktiven Mannes Mitte dreißig in eleganter weißer Leinenhose. Er war Anna an diesem Abend schon mehrmals aufgefallen, vor allem sein knackiger Arsch. Aber auch von vorne konnte er sich sehen lassen. Er hatte schulterlanges schwarzes Haar, einen Dreitagebart und faszinierende dunkle Augen, die ihn ein bisschen wie einen sexy Straßenkater wirken ließen. Das eng geschnittene weiße Slim-Fit-Hemd ließ seinen flachen, durchtrainierten Bauch und Brustkorb mehr als deutlich erahnen. Außerdem roch er verdammt gut.
Und du Idiotin hast dich vom Gastgeber knallen lassen.
»Du siehst nicht so aus, als wolltest du mit all diesen Verrückten im Pool landen«, sagte er in fast akzentfreiem Englisch.
»Nein … und danke, dass du mich gerettet hast«, antwortete sie.
»Leonidas«, sagte er und gab ihr die Hand.
»Anna … Anna Klein.«
»Aus Deutschland?«
»Österreich«, stellte sie richtig.
»Klein … so wie small?«, fragte er.
Anscheinend konnte er sogar ein bisschen Deutsch. Sie nickte. »Yes, Anna Small«, sagte sie lachend.
»Klein bist du aber nicht gerade.« Er lächelte sie an.
Nein, das war sie bei Gott nicht, und trotzdem überragte er sie fast um einen halben Kopf.
Während sie ihm erzählte, dass sie seit über zwei Monaten mit Rucksack von Gibraltar aus an der Mittelmeerküste entlang durch Südeuropa trampte und schließlich hier gelandet war, betrachtete er ihre Beine.
»Mit diesen Schuhen?«, fragte er.
»Idiot.« Lachend boxte sie ihm gegen die Schulter und spürte seine harten Muskeln. Er hatte nicht einmal zurückgezuckt, sondern sah sie nur herausfordernd an.
Die Schuhe waren natürlich völlig unbrauchbar für eine Rucksackreise. Wahrscheinlich ließ sie die hier und besorgte sich je nach Bedarf neue Accessoires. So wie sie es seit Beginn ihrer Reise getan hatte.
»Seit über zwei Monaten unterwegs?«, fragte er. »Ist das nicht kostspielig?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nicht wenn man so aussieht wie ich«, sagte sie und grinste ihn an.
Während sie sich weiter unterhielten, fielen ihr zwei Dinge auf. Erstens, dass die Poolparty neben ihnen immer mehr aus dem Ruder lief – und zweitens, dass auf der Treppe beim Übergang zum Indoor-Bereich ein junger Mann etwas abseits neben der Glastür stand und mit seinem Handy filmte. Allerdings nicht den Exzess im und um den Pool herum, vielmehr hielt er seine Kamera direkt auf sie gerichtet. Anna konnte sein Gesicht hinter dem Handy nicht genau erkennen, doch der Spanner interessierte sich offenbar mehr für sie als für die wilde Meute im Pool.
Sie versuchte, den Kerl zu ignorieren und sich auf Leonidas zu konzentrieren. Mit seinen stechenden Augen, dem kantigen Kinn und dem verschmitzten Lächeln war er sowieso die viel interessantere Wahl.
Der DJ spielte den nächsten Song von ZZ-Top und drehte dabei noch einmal eine Spur lauter, um das Gegröle im Pool zu übertönen.
Leonidas beugte sich zu ihr und rief ihr ins Ohr. »Möchtest du einen Drink?«
Sie nickte. »Gerne, aber etwas Nicht-Alkoholisches.« So wie die Party sich gerade entwickelte, war es sicher besser, einen klaren Kopf zu bewahren.
»Cola oder Kaffee?«, fragte Leonidas.
»Wenn, dann Coke Zero.« Sie strahlte. »Aber Kaffee wäre genial. Schwarz, ohne Zucker, bitte.« Wegen ihres Diabetes musste sie verdammt aufpassen.
Er lächelte. »Kommt sofort.« Im nächsten Moment verschwand er geschmeidig in der Menge, die zum Pool strömte und die Idioten im Wasser anfeuerte.
Sie wich gerade noch weiter zurück, als plötzlich ein ekelhafter Geruch von faulen Eiern zu ihr herüberströmte. Sie konnte die Quelle nicht richtig ausmachen. Der Gestank nach Schwefel schien mit einem Mal überall in der Luft zu liegen. Aber nicht nur sie merkte das, sondern offenbar auch alle anderen Gäste, die sich angewidert umsahen.
ZZ-Top verstummte, dann erklang eine andere, viel langsamere Nummer. Der DJ hatte sich nun offenbar für einen Song von den Eagles entschieden, um die Stimmung nicht weiter anzuheizen. Anna erkannte die langsamen und betörenden Gitarrenklänge von Hotel California. Sie zog ihr Handy aus der Gesäßtasche, drückte die Wahlwiederholung und presste es an ihr Ohr. Ihre Schwester ging immer noch nicht ran. Schade, du versäumst was. Als die Mobilbox endlich ansprang, steckte sie sich den Zeigefinger ins andere Ohr. »Hallo, Große, ich habe dir ein paar Fotos geschickt … das ganze Areal ist unglaublich … hier ist echt die Hölle los …« Sie verstummte und rümpfte die Nase. »O Mann! Wahnsinn!«
Obwohl sie im Freien stand, wurde der Gestank immer schlimmer.
On a dark desert highway, cool wind in my hair …
Schlagartig bildete sich in der dichten Wand aus Menschen ein schmaler Korridor vor ihr, durch den sie zum Pool sehen konnte. Die Gäste wichen zurück, um Platz zu machen. Denn einige der Leute im Wasser versuchten röchelnd und schnaufend, an Land zu kommen, wurden teilweise an den Armen herausgezogen. Hustend krochen sie auf allen vieren über den Boden.
»Ich habe gerade einen netten …«, setzte Anna erneut an, verstummte aber wieder, als sich einer der Kerle übergab.
Angewidert verzog sie das Gesicht. Da haben sich wohl einige ein bisschen überschätzt, dachte sie mit einer Spur Schadenfreude. Dann reckte sie den Hals und blickte zur Bar, wo Leonidas gerade zwei Tassen Kaffee vom Barkeeper entgegennahm.
»Also, ich habe einen echt netten …« Als sie wieder in Richtung Pool blickte, sackte eine junge Frau im Bikini direkt vor ihr auf die Knie und erbrach sich vor ihren Füßen. Anna schrie auf.
»Scheiße!« Erschrocken wich sie zurück und bemerkte, dass viele andere Gäste ebenfalls röchelnd nach Luft rangen. »Ich muss Schluss machen … hier stirbt gleich jemand.« Sie ließ das Handy sinken.
Binnen Sekunden kam Panik auf.
Aber die Eagles spielten unbeeindruckt weiter.
Such a lovely place … such a lovely place …
1. Teil
Ein neuer Fall
Vier Tage später Mittwoch, 23. September
1. Kapitel
Elena Gerink stand neben dem Behandlungstisch und streichelte den Kopf von Wallace. Die Hündin blickte sie mit wässrigen Augen treuherzig an. Ihr Leib zitterte. »Glaubst du, sie ahnt etwas?«, fragte Elena.
Jan, ihr Tierarzt, nickte. »Tiere spüren das.«
Das hatte sie befürchtet, und zwar ab dem Zeitpunkt, als sie Wallace heute Morgen in die Hundebox geschoben und mit dem Auto quer durch Wien in die Tierklinik gebracht hatte.
»Aber es ist das Beste für sie.« Jan zog fünf Milliliter des Narkosemittels auf.
Elena hielt Wallaces Kopf, streichelte ihr über die Schnauze. Das Tier zuckte nicht einmal, als Jan ihr das Serum intramuskulär in den Oberschenkel injizierte.
Wallace war vierzehn Jahre alt, ein stolzes Alter für einen Dobermann. Elena hatte sie vor zehn Jahren bei einer ihrer Dienstreisen aus Italien mitgenommen. Die Hündin war vom ersten Augenblick ihrer Begegnung in sie verschossen gewesen und hatte ihr damals sogar das Leben gerettet.
Während Jan das nächste Präparat vorbereitete, streichelte Elena über den Körper der Hündin. Die beruhigte sich, atmete immer langsamer. Schließlich fielen ihr die Augen zu. Elena berührte ihre Schnauze. Eine Träne lief ihr über die Wange, aber sie wischte sie nicht weg. Sie wollte den Körperkontakt zu Wallace nicht unterbrechen.
Das schwere silberne Halsband mit Wallaces eingraviertem Namen glänzte im Deckenlicht. Das hatte die Hündin schon gehabt, als Elena ihr zum ersten Mal begegnet war. Ebenso die kupierte Rute, obwohl das Amputieren der Schwanzwirbel schon lange verboten war. Auch ihre Ohren waren operiert, damit sie wie Pfeilspitzen in die Höhe ragten. All das hatte ihr vorheriger Besitzer ihr angetan. Wallace war dazu bestimmt gewesen, ein Anwesen zu bewachen, und durch das Kupieren hatte sie weniger Körpersprache und sollte aggressiver wirken, da sie weder die Ohren anlegen noch den Schwanz einziehen konnte. Elena hatte das arme Tier damals gerettet und mit zu sich nach Wien genommen.
Zehn Jahre lang war der Dobermann treu an ihrer Seite gewesen, und Wallace hatte eine schöne Zeit bei ihr gehabt. Doch jetzt hatte die Hündin einen inoperablen Tumor, der ihr Schmerzen bereitete. Elena hatte den Besuch beim Tierarzt ohnehin schon viel zu lange hinausgezögert.
Jan blickte auf die Uhr. Sieben Minuten waren vergangen. »Sie schläft jetzt tief und fest.« Er setzte die nächste Spritze an, diesmal in die Vene.
»Was … gibst du ihr?« Elenas Stimme versagte beinahe.
»Fünfundzwanzig Milliliter T61 … ein hochdosiertes Muskelrelaxans, das zur Muskellähmung führt«, erklärte er. »Gab es schon, als ich an der Uni studiert habe.«
Jan zog die Spritze raus.
»Und spürt …?«, krächzte Elena.
»Nein, sie spürt nichts«, sagte er.
Elena hatte immer noch ihre Hände auf Wallaces Körper. Nach einer Minute hörte die Hündin auf zu atmen. Ihr Brustkorb hob und senkte sich nicht mehr, und Elena spürte regelrecht, wie ihr starkes Herz zu schlagen aufhörte.
Jan ließ noch eine weitere Minute vergehen, dann hörte er Wallaces Herz mit dem Stethoskop ab. »Es ist vorbei«, sagte er.
Elena ließ ihre Hände noch eine Weile auf dem prächtigen schwarzen Fell der Hündin, dann nahm sie sie weg und wischte sich die salzigen Tränen von Wange und Lippen.
Wallace lag so friedlich da, mit geschlossenen Augen, als würde sie schlafen.
Was danach kam, erledigte sie wie in Trance. Sie nahm den Hundeausweis wieder an sich, ebenso das Halsband, bezahlte die Rechnung, drückte Jan wortlos die Hand, warf noch einen Blick auf den Tisch aus Alu, sah Wallaces Körper reglos darauf liegen und verließ die Praxis mit der leeren Hundebox. Jan würde sich wie besprochen um die Urne und die Verbrennung im Wiener Tierkrematorium kümmern.
Im Warteraum saßen bereits die nächsten Leute mit ihren kleinen Patienten – Katzen, Hunde, Hasen und Meerschweinchen. Elena hörte es an dem Bellen, Miauen und Gequieke, sah aber keinem von den Besitzern in die Augen. Sie wollte nur raus.
Auf der Straße atmete sie einmal tief durch. Die Sonne kletterte gerade über die Hausdächer. Sie ging zum Wagen und verstaute die leere Box im Kofferraum, als sie eine Nachricht von ihrem Mann auf ihr Handy bekam.
Gerade gelandet – alles okay. Wie geht es Wallace?
Sie hatte nicht die Kraft für ein Telefonat und auch nicht für lange Nachrichten. Also tippte sie nur kurz und knapp 23. September, 8.10 Uhr, fügte ein Bild von einer Regenbogenbrücke hinzu und drückte auf Senden. Dann brach sie so richtig in Tränen aus.
Nachdem sie ins Auto gestiegen war und sich die Sonnenbrille aufgesetzt hatte, wollte sie gerade das Handy ausschalten, als sie über WhatsApp ein Video von einer ihr unbekannten Nummer erhielt. Die Nachricht dazu lautete:
Möchte Sie gern engagieren.
Falls das kein Fake war, war eine solche Kontaktaufnahme eher ungewöhnlich, da die meisten Leute anriefen und um einen Termin baten. Der Absender hieß Grabowski. Im Moment hatte Elena zwar keine Lust auf einen neuen Auftrag, war aber trotzdem neugierig, was dieser Grabowski ihr geschickt hatte.
Sie tippte das Video an und sah einen etwa siebzigjähren, gutaussehenden und gepflegten Herren im weißen Hemd, der sich das Handy offenbar direkt vors Gesicht hielt. Er hatte eine Halbglatze mit grauem Haarkranz und lange, dichte graue Koteletten. Seine Augen waren klar, sein Blick freundlich, das Kinn kantig. Im Hintergrund sah Elena die Bücherwand einer Bibliothek.
»Mein Name ist Balthasar Grabowski«, sagte er mit angenehm sonor klingender Stimme. »Sie kennen mich nicht, Frau Gerink, aber ich möchte Sie gern engagieren. Alles Weitere möchte ich unter vier Augen mit Ihnen besprechen. Gern bei einer Tasse Kaffee und, falls Sie jetzt Zeit haben sollten, bei einem Frühstück in meinem Haus in Baden.«
Elena kannte die Kurstadt Baden, die nur fünfundzwanzig Kilometer südlich von Wien lag und von ihrem jetzigen Standort aus mit dem Auto in einer halben Stunde erreichbar war.
Grabowski nannte ihr die genaue Adresse und beendete das Video mit den Worten: »Ich hoffe, Sie nehmen sich die Zeit für dieses Gespräch, und bedanke mich bereits im Voraus für Ihr Entgegenkommen.«
Anscheinend war Balthasar Grabowski ein richtiger Gentleman mit erstklassigen Manieren. Sie sah sich das Video ein zweites Mal an und betrachtete diesmal den Hintergrund genauer. Bei den Büchern handelte es sich um Sachbücher, die Brockhaus Enzyklopädie und zahlreiche in Leder gebundene Reader’s-Digest-Ausgaben.
Normalerweise hätte sie in den nächsten Tagen keinen neuen Auftrag angenommen, aber soeben wurde ihr bewusst, dass sie für ein paar Minuten mal nicht an Wallace gedacht hatte.
Das ist jetzt genau das Richtige. Du musst auf andere Gedanken kommen.
Sie steckte das Handy in die Halterung, startete den Wagen und gab die Badener Adresse in ihr Navi ein. Das Gerät berechnet eine Fahrzeit von fünfunddreißig Minuten. Nachdem sie aus der Parklücke ausgeschert war, wählte sie Grabowskis Nummer.
2. Kapitel
Peter Gerink schlüpfte in seine Lederjacke und ging von dem Gate des Wiener Flughafens Schwechat, wo sie gerade gelandet waren, direkt in Richtung Ausgang und Gepäckband. Er hatte noch den Druck vom Sinkflug in den Ohren und versuchte zu gähnen, damit das dumpfe Rauschen endlich verschwand und er wieder normal hören konnte – doch da war nichts zu machen.
Er erreichte das Band, an dem die anderen Passagiere seines Flugs vom Airport Heraklion auf Kreta bereits auf ihre Koffer warteten. Die ältere kleine Dame, die zwei Sitzplätze gebucht und mit ihrer dreifarbigen Katze in der Tierbox neben ihm gesessen hatte, war ebenfalls dort. Er stellte sich neben sie und schob, während er wartete, seinen Unterkiefer hin und her.
Sie blickte zu ihm auf und musterte ihn neugierig über den Rand ihrer Brille. »Druck auf den Ohren?«
Er nickte, woraufhin sie in ihre Tasche griff und ihm wortlos eine Packung Kaugummis hinhielt.
»Danke.« Er schob sich einen davon in den Mund und kaute darauf herum. Tropical Island mit saurem Nachgeschmack.
»Sie haben während des Flugs so gut geschlafen, da wollte ich Sie nicht wecken«, sagte sie.
»Wie rücksichtsvoll«, murmelte er.
»Waren Sie im Urlaub?«
Jetzt geht die Fragerei los. Er schüttelte den Kopf. »Beruflich.«
»Aha.« Sie musterte seine Jeans, die schwarzen etwas staubigen Lederschuhe und sein T-Shirt. »Alfredo und ich verbringen immer den ganzen Sommer auf Kreta.«
Gerink sah sich um. »Alfredo?«
Sie nickte zur Katzenbox, in der das Tier gerade wach wurde und sich putzte.
»Verstehe.«
Endlich kamen die ersten Gepäckstücke. »Das dort ist mein Koffer.« Die Dame deutete auf einen monströsen blau-weiß gestreiften Hartschalenkoffer.
Gerink verstand. Er wartete, bis das Ding sie erreicht hatte, dann hob er es vom Band und fuhr den Griff aus.
»Vielen Dank, Sie sind ein reizender junger Mann.«
Junger Mann! Gerink musste innerlich grinsen. Er war sechsundvierzig, hatte graue Haare an den Schläfen und sah nach drei Tagen ohne Rasur, kaum Schlaf und mit den Augenringen bestimmt noch älter aus.
Da schob sich von der Seite ein Mann in seinem Alter an ihn heran, der optisch das genaue Gegenteil von ihm war. Dino Scatozza war Sizilianer – eigentlich Halbsizilianer, da er mit einem österreichischen Vater und einer italienischen Mutter in einem Fischerdorf bei Syrakus aufgewachsen war und die Sommerferien in Catania bei seinem Großvater verbracht hatte, der in den Fünfzigerjahren ein berühmter Holzschnitzer und Stuhlflechter gewesen war.
Bei Scatozza hatten die ewige Warterei in Heraklion und die zwei Stunden Flug keine Spuren hinterlassen. Er duftete vierundzwanzig Stunden am Tag nach Rasierwasser, hatte ein permanentes Gewinnerlächeln im Gesicht, und sein dunkles Haar war stets perfekt mit Gel zurückgeklebt.
»Da, Alter. Hat beim Zoll länger gedauert.« Scatozza griff unter seinem Sakko nach hinten in den Hosenbund und reichte ihm seine Glock mit dem Magazin.
Mann, doch nicht hier vor all den Leuten! Gerink ließ die Waffe rasch unter der Lederjacke in seinem Schulterholster verschwinden. Scatozza hatte seine eigene private Waffe – eine Walther PPK, 7,65 Millimeter mit sechs Schuss – anscheinend schon vorher verstaut.
Die Dame riss ungläubig die Augen auf.
»Ist okay.« Scatozza zwinkerte ihr mit seinen unwiderstehlichen schwarzen Kulleraugen zu. »Wir sind von der Polizei.«
Nun warf die Dame Gerink einen fragenden Blick zu. »Das kann jeder behaupten.«
»Diesmal hat er ausnahmsweise mal recht«, sagte Gerink. »Bundeskriminalamt.«
»Entführungsspezialisten«, fügte Scatozza hinzu.
»Geht’s noch ein bisschen detaillierter?«, fuhr Gerink seinen Partner an.
»Mamma mia!«, entfuhr es Scatozza genervt. »Komm mal wieder runter.«
»Wurde jemand entführt?«, fragte die Dame.
»Dazu können wir leider nichts sagen«, antwortete Gerink rasch, ehe Scatozza einen weiteren Kommentar abgeben konnte.
Plötzlich riss die Frau die Augen auf, als machte es Klick in ihrem Hirn. »Ich weiß!« Sie senkte die Stimme. »Der kleine Junge aus Niederösterreich … richtig?«
Gerink warf Scatozza einen warnenden Blick zu. Der nahm die blaue Spiegelsonnenbrille aus dem Ausschnitt seines weit aufgeknöpften Hugo-Boss-Hemds, klappte die Bügel mit einer lässigen Handbewegung auf und schob sich die Brille auf die Nase. »Dazu können wir leider nichts sagen.«
»Ich hoffe, Sie waren erfolgreich«, sagte die Dame.
Gerink antwortete nichts darauf, Dino ebenso wenig. Die Dame schnappte ihren Koffer, packte Alfredos Box und marschierte zum Ausgang.
Gerink sah ihr nach. Nein, wir waren nicht erfolgreich. Ihr dreitägiger Auslandseinsatz hatte rein gar nichts gebracht. Der sechsjährige Oliver Teuber aus St. Pölten war vor vier Monaten im Mai während des Urlaubs mit seinen Eltern in einem gemieteten Ferienhaus auf Santorín spurlos verschwunden. Scatozza und er hatten weder ihn noch seine Leiche finden können – und auch die griechische Polizei hatte bisher nicht die geringste Spur.
»Deine Koffer kommen«, murrte Gerink, als er aus dem Augenwinkel sah, wie zwei gewaltig große braune Lederkoffer aufs Förderband geworfen wurden. Einer davon war bestimmt ausschließlich mit Kosmetikartikeln gefüllt – und dafür zahlte Scatozza auch gern die Übergepäckgebühren.
Während Scatozza kommentarlos zu seinem Gepäck marschierte und es vom Band wuchtete, schrieb Gerink eine Nachricht an Elena. Kurz darauf kam ihre Antwort.
23. September, 8.10 Uhr.
Mehr stand da nicht. Er runzelte die Stirn, dann sah er das Bild von der Regenbogenbrücke und begriff die Nachricht. Sogleich traten ihm Tränen in die Augen.
Verdammt! Elena hatte es also hinter sich gebracht, und er wusste, dass ihr diese Entscheidung nicht leichtgefallen war. Ebenso wusste er, dass er Elena jetzt nicht anzurufen brauchte. Sie würde sowieso nicht rangehen.
Wallace war zwar Elenas Hündin gewesen, aber die Dobermanndame war ihm genauso ans Herz gewachsen wie ihr. Elena und er hatten das Tier vor zehn Jahren nach einem Fall, an dem sie gemeinsam gearbeitet hatten, aus der Toskana mitgenommen. Auch damals waren Scatozza und er wegen eines Entführungsfalls im Ausland gewesen – mit dem kleinen Unterschied, dass sie seinerzeit erfolgreich gewesen waren, ein Menschenleben gerettet hatten und nicht, so wie jetzt, mit leeren Händen heimkamen.
Als Gerink sah, wie Scatozza mit seinen beiden Koffern antrabte, fuhr er sich rasch mit dem Handrücken über die Augen und steckte das Handy weg.
Scatozza stützte sich lässig auf den ausgefahrenen Griff. »Was ist passiert, amico mio? Wurde deine Reisetasche zerquetscht?«
»Wallace …«, presste Gerink hervor.
»Ah, merda!« Scatozza wurde plötzlich ernst und drückte ihm die Schulter. »Tut mir leid, Alter!«
Gerink atmete tief durch. »Schon gut, war nicht zu ändern.«
»Ich dachte ja immer, dass Elena das arme Tier eines Tages zu Tode streicheln würde … oh scusa«, fügte er rasch hinzu, da er offenbar selbst bemerkt hatte, dass der Kommentar kacke war.
Gerink versuchte zu lächeln. Scatozza war nun mal so einfühlsam wie ein Bulldozer. Dann ging er zum Band, zog seine schmale Reisetasche herunter und schulterte sie.
Gemeinsam gingen sie in die Ankunftshalle, passierten die Shops in Richtung Ausgang und winkten nach der automatischen Glasschiebetür zwei Taxis her. Er würde gleich heim zu Elena fahren. Dino hingegen würde vermutlich zuerst einen Abstecher zur Textilreinigung machen, dort seine Schmutzwäsche abladen, danach zu seiner neuen Freundin fahren, mit der er seit fast einem halben Jahr zusammen war, und erst dann einen Blick in sein Haus werfen – aber auch nur deshalb, um wieder einmal seine Pflanzen zu gießen.
Während die zwei Taxis anrollten, läuteten gleichzeitig ihre beiden Handys. Gerink hatte den normalen klassischen Klingelton eines alten Telefons gewählt, Scatozza die Melodie eines Adriano-Celentano-Songs. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro …
Gerink konnte diesen italienischen Scheiß nicht mehr hören.
»Deine geliebte Schwägerin«, bemerkte Scatozza mit einem verächtlichen Blick auf das Display.
Sie gingen gleichzeitig ran. Tatsächlich hatte ihre Chefin, die Dezernatsleiterin des BKA, eine Konferenzschaltung mit ihnen eingerichtet. Typisch Elenas Schwester, dachte Gerink, gönnt uns nicht einmal eine freie Minute.
Lisa Eisert verzichtete auf jegliche Begrüßung. »Ich habe gesehen, dass eure Maschine endlich gelandet ist.«
Scatozza warf ihm einen vielsagenden Blick zu, der so viel bedeutete, wie dass sie nicht einmal pissen konnten, ohne auf Schritt und Tritt überwacht zu werden.
»Ist das BKA abgebrannt?«, fragte Gerink.
»Das hättet ihr wohl gern«, antwortete Eisert. »Familie Teuber wartet bereits seit einer Stunde im Besprechungszimmer auf euch.«
»Du weißt doch, dass wir …«, begann Scatozza.
»Ja, ich weiß, dass ihr nichts habt, aber die lassen sich nicht abwimmeln. Die wollen mit euch persönlich reden.«
Da gibt es nicht viel zu reden, dachte Gerink bitter.
»Kann sich das Bundeskriminalamt nicht gegen ein Elternpaar durchsetzen?«, fragte Dino zynisch.
Der erste Taxifahrer hupte und zog fragend die Schultern hoch, da sie immer noch neben der Fahrbahn standen.
»Die drohen mit Anwalt und Presse, wenn wir ihnen nicht sofort den Stand der Ermittlungen mitteilen«, sagte Eisert. »Kommt also rasch her.«
»Ist das eine Dienstanwei…?«, wollte Gerink wissen.
»Ja.« Es machte Klick im Lautsprecher. Eisert hatte das Gespräch beendet.
»Maledetto!«, fluchte Scatozza und blickte auf seine Armbanduhr.
Gerink bedeutete dem hinteren Taxi, dass sie es nicht mehr brauchten.
Während Scatozza den Kofferraum des ersten Taxis öffnete und seine beiden Gepäckstücke hineinquetschte, nahm Gerink seine Reisetasche von der Schulter und warf sie auf den Rücksitz. Er stieg hinten ein. Mittlerweile hatte sich der Kaugummi fast komplett aufgelöst, und er schluckte den Rest.
Sein Kollege stieg vorne ein. »Josef-Holaubek-Platz eins«, knurrte er. »Aber lassen Sie sich ruhig Zeit.« Und als Scatozza die Tür schwungvoll zuknallte, machte es Plopp in Gerinks Ohren, und er konnte endlich wieder normal hören.
3. Kapitel
Balthasar Grabowskis Haus lag nur ein paar Kilometer vom Zentrum der Badener Kurstadt entfernt im Helenental. Hier waren die Villen, die teilweise noch aus der K.-u.-k.-Zeit stammten, von Wald und Bergen umgeben.
Neben Grabowskis Haus stand ein metallicschwarzer Pajero im Carport, frisch geputzt und funkelnd. Elena parkte ihren Wagen, ein Elektroauto von Mercedes, daneben.
Sie stieg aus. Es duftete nach Blumen und frisch gemähtem Rasen. Der Garten mit den Rosenhecken, die runden Blumentröge auf dem Kopfsteinpflasterweg, der zum Haus führte, und die Blumenkisten unter den Fenstern der zweistöckigen Villa sahen genauso gepflegt aus wie Grabowski auf dem Video. So rüstig, wie der Mann gewirkt hatte, hielt er den Garten womöglich noch selbst in Schuss, und das mit viel Liebe zum Detail.
Während Elena sich dem Haus näherte, stieg ihr der Duft von Kaffee und frischem Gebäck in die Nase.
Da sie gleich von der Tierarztpraxis hergefahren war, trug sie immer noch Jeans, ein enges schwarzes T-Shirt und Turnschuhe. Für Wallaces letzte Reise hatte sie sich nicht besonders schick gemacht. Aber selbst wenn sie vorher heimgefahren wäre und sich umgezogen hätte – sie besaß kaum wirklich elegante Klamotten und erst recht keine Röcke oder Stöckelschuhe, wie so viele ihrer Freundinnen. Blieb zu hoffen, dass Grabowski ihr Auftreten egal war.
Er stand auf der Terrasse neben einem reichlich gedeckten Tisch. Mit schwarzer Anzughose, polierten Lackschuhen und demselben Hemd wie auf dem Video. Er war bestimmt knapp einen Meter neunzig groß, sah echt fit aus und wirkte unter seiner Kleidung muskulös.
»Sie sind früher da, als Sie angekündigt haben«, stellte er fest.
»War kaum was los auf der Autobahn.« Sie betrat die Terrasse.
Grabowski gab ihr mit festem Druck die Hand, und Elena registrierte seine straffe und sehr aufrechte Haltung.
»Wo ist Ihr Hund?« Neugierig reckte er den Kopf. »Sie können ihn gern mit in den Garten nehmen …« Er deutete zur vollen Wasserschüssel auf dem Boden.
Offenbar hatte er zuvor gründlich über sie recherchiert. Immerhin gab es im Internet einige Interviews und bebilderte Homestorys von ihr. »Wallace ist heute Morgen über die Regenbogenbrücke gegangen«, sagte sie knapp und versuchte, sich ihre Gefühle nicht anmerken zu lassen. Auch wenn dieses Märchen Mumpitz war, hatte die Vorstellung dennoch etwas Tröstliches, dass die verstorbenen Haustiere auf einer saftig grünen Wiese auf ihre Besitzer warteten, um mit ihnen – wenn es so weit war – gemeinsam ins Jenseits zu gehen.
»Oh, das tut mir leid.« Offenbar kannte er diese Erzählung und wusste, was sie meinte. Er sah sie mitfühlend an. »Ich hatte zwar nie ein Haustier, beruflich aber immer wieder mit Schäferhunden zu tun.«
»Was haben Sie gemacht?«
»Ich war Ausbilder beim österreichischen Bundesheer … am Truppenübungsplatz in Allentsteig, danach in der Martinek-Kaserne in Baden und zuletzt an der Militärakademie in Wiener Neustadt. Mittlerweile bin ich im Ruhestand.« Schlagartig wurde er ernst. »Außerdem weiß ich, wie es sich anfühlt, wenn man ein geliebtes Wesen verliert. Umso mehr danke ich Ihnen, dass Sie hergekommen sind.« Er deutete zum Tisch. »Frühstück?«
Sie hatte zwar keinen Hunger, aber der gedeckte Tisch sah verführerisch aus. »Ja bitte«, sagte sie höflichkeitshalber. Eine Kleinigkeit im Magen konnte nicht schaden.
Sie setzten sich, und Grabowski goss Kaffee in eine Tasse und frisch gepressten Orangensaft in ein Glas. Hier in Baden war das Wetter viel besser als in Wien. Ein herrlicher Spätsommertag, noch einmal angenehmer dadurch, dass die Terrasse im Schatten einiger hoher Kiefern lag, die erfrischend nach Harz dufteten.
Sie steckte die Sonnenbrille auf ihre blaue Harley-Davidson-Schirmkappe und legte diese neben einem Stapel Zeitungen auf den Tisch. Dann fuhr sie sich mit den Fingern durch die strubbelige brünette Kurzhaarfrisur und machte es sich auf dem knarzenden Rattanstuhl bequem. »Wie sind Sie ausgerechnet auf mich gekommen? Und worum geht es bei diesem Auftrag?«
Grabowski schnitt ein Brötchen auseinander und schmierte Butter und Marmelade drauf. »Feigenmarmelade – selbstgemacht«, erklärte er.
»Über eine Empfehlung?«, hakte sie nach.
»Nein, ich habe selbst im Internet recherchiert. Sie sind als Kind mit Ihren Eltern nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs von Warschau nach Wien gekommen – eine gebürtige Kaminska.« Er sah auf.
Erstaunt hob sie eine Augenbraue. Diese letzte Information stand zumindest nicht auf ihrer Webseite.
»Und haben seither eine beeindruckende Karriere hinter sich«, fuhr er fort. »Abgeschlossenes Jurastudium, Gerichtsjahr, haben danach kurz in einem Versicherungsbüro und einer Wirtschaftskanzlei gejobbt und waren bereits mit siebenundzwanzig Juniorpartnerin in der Detektei Koslowski.«
Sie nickte. Koslowski war damals schon weit über sechzig gewesen, ein alter Kauz, der jedes Risiko scheute, aber brillant kombinieren konnte. »Er hat mir alles beigebracht, was ich heute weiß.«
»Nicht so bescheiden, Frau Gerink. Sie haben sich vor dreizehn Jahren mit einer eigenen Detektei selbstständig gemacht und haben seither einen ausgezeichneten Ruf in der Branche.«
»Danke für die Schmeicheleinheiten«, sagte sie frei heraus, »aber jetzt erzählen Sie doch bitte auch etwas über sich und Ihr Anliegen.«
»Natürlich.« Er biss von dem Marmeladenbrötchen ab. »Eine junge Frau wurde ermordet. Meine sechzehnjährige Enkelin Nina.«
»Oh …« Elena hatte sich auch ein Brötchen mit Schinken, Käse, Tomaten und Paprikascheiben belegt und hielt kurz inne. »Das tut mir leid.«
»Vor fünfzehn Jahren«, ergänzte er.
»Vor fünfzehn Jahren?«, fragte sie nach.
Er nickte. »Am siebten April.«
»Und ich soll für Sie den Mörder finden?«
Grabowski lächelte. »Nein, ich weiß, wer der Mörder ist. Ich kann es nur nicht beweisen.« Während sie aßen, sprach er weiter. »Ein heute zweiundvierzigjähriger Mann namens Thomas Dannenberg, der damals siebenundzwanzig war. Ein Wiener. Er wurde des Mordes angeklagt und freigesprochen.«
Dannenberg ist so alt wie ich, dachte sie unwillkürlich. Außerdem klingelte bei dem Namen etwas bei ihr. Sie konnte sich dunkel an den Prozess erinnern. Damals hatte sie bei Koslowski gearbeitet und im Jahr darauf Peter kennengelernt, der sie dazu ermutigt hatte, sich wiederum ein Jahr später selbstständig zu machen.
Grabowski wischte sich die Finger mit der Serviette ab und nippte am Kaffee. »Ninas Mord ist bis heute ungeklärt.«
»Warum wollen Sie jetzt nach fünfzehn Jahren etwas unternehmen?«, fragte sie.
»Das ist nicht das erste Mal.« Er lehnte sich zurück. Offenbar hatte er sein Frühstück schon beendet. »Ich wollte damals nach dem Freispruch einen Privatdetektiv engagieren, der mir seinerzeit von vielen Seiten empfohlen worden war.«
»Wen?«, fragte Elena neugierig.
»Einen Wiener – Peter Hogart.«
Sie zog eine Augenbraue hoch. »Ah ja, kenne ich.«
»Doch der hatte keine Zeit. Er musste damals, wenn ich mich recht erinnere, wegen eines anderen Falls nach Prag reisen. Aber er empfahl mir zwei andere Detektive, die ich hintereinander im Abstand von einem halben Jahr engagiert habe, doch beide blieben erfolglos.«
»Haben Sie Peter Hogart danach dann auch noch engagiert?«
Er schüttelte den Kopf. »Nachdem bei diesen Recherchen nichts herauskam, musste ich beruflich für zwei Jahre ins Ausland. Zuerst nach Zypern, dann auf die Golanhöhen und später als Beobachter in den Kosovo. Als ich von den Einsätzen zurückkam, habe ich versucht, mit dem Mord an meiner Enkelin abzuschließen, statt neue Nachforschungen anzustellen. Ich musste das, was passiert war, verdrängen. Andernfalls wäre ich langsam daran zerbrochen. War deswegen auch in Therapie – heimlich, ohne dass meine Kollegen beim Bundesheer je etwas davon erfahren haben.«
»Aber letztendlich haben Sie es trotzdem nicht geschafft, wirklich loszulassen, oder?«, vermutete Elena. »Andernfalls säße ich jetzt nicht hier.«
Er nickte. »Jetzt bin ich fünfundsiebzig und sterbenskrank.« Sein Blick war fest, seine Haltung aufrecht. »Ich habe mich gegen eine Fortführung der Chemotherapie entschieden. Die würde das endgültige Ende nur um ein paar Monate hinauszögern, und ich wüsste nicht, wofür das gut sein sollte. Stattdessen habe ich damit begonnen, Keller und Dachboden aufzuräumen, um meinen Nachlass in kleinen Schritten zu organisieren. Dabei ist mir ein Album in die Hände gefallen … mit Fotos von Ninas Geburt bis zu ihrem fünfzehnten Lebensjahr. Da kam alles noch einmal hoch.«
Elena konnte das gut nachvollziehen. Ihre Mutter war vor zwei Jahren mit siebenundsiebzig an Leukämie gestorben und hatte in den Monaten vor ihrem Tod ebenfalls noch alles geregelt und ihre gesamte Wohnung aufgeräumt.
Grabowski schob den Stapel Zeitungen zur Seite. Darunter kam ein in Kunstleder gebundenes Fotoalbum zum Vorschein, das er ihr reichte.
Elena wischte sich die Finger mit der Serviette ab, blätterte das Buch weiter hinten auf und sah einen Teenager mit Zahnspange, entzückend rundem Gesicht und langen roten Haaren, die der Wind durcheinanderwirbelte. Genauso wie Elena hatte auch Nina eine Stupsnase und zahlreiche Sommersprossen. Die Aufnahme war vermutlich an der Balustrade der Aussichtsplattform vom Donauturm gemacht worden. Andere Fotos zeigten Nina beim Autodromfahren im Prater, in einem Wagon der Geisterbahn, auf einer Schaukel am Spielplatz und ein paar Seiten davor mit Anorak, Mütze und Handschuhen auf einem Schlitten. Freundinnen waren auf keinem einzigen Foto zu sehen. Nina war stets allein, nur Grabowski war manchmal mit auf den Bildern.
Elena schlug das Album wieder zu. »Ein sympathisches und fröhliches Kind – ich verstehe, dass die Erinnerung schmerzvoll ist.«
Er nickte. »Ich möchte diese eine Sache vor meinem Tod erledigt wissen … und deshalb möchte ich jetzt noch einmal jemanden engagieren.«
Elena beendete auch ihr Frühstück. »Wofür genau?«
Er sah sie eindringlich an. »Beweisen Sie, dass Dannenberg den Mord begangen hat.«
Sie dachte kurz darüber nach und nickte schließlich. Anders als im amerikanischen Recht, wo jemand für ein Verbrechen, von dem er einmal freigesprochen worden war, nie mehr wieder angeklagt werden konnte, war das in Österreich unter bestimmten Umständen sehr wohl möglich.
»Um Dannenberg erneut anzuklagen«, erklärte sie ihm, »müsste sich die Beweislage ändern. Das heißt, es müssten zum Beispiel neue Beweise auftauchen wie neue DNA-Spuren, neue Zeugenaussagen … oder ein Geständnis des Täters erfolgen. Nur dann könnte man den alten Fall noch einmal aufrollen.«
»Den Fall noch einmal vor Gericht bringen?« Er schüttelte den Kopf. »Darum geht es mir nicht. Zumal ich den Ausgang des Prozesses sowieso nicht mehr mitbekommen würde. So lange lebe ich nicht mehr. Ich will nur die endgültige Gewissheit haben, dass er es war.«
»Und wenn er es nicht war?«
»Er war es. Es muss so sein. Eine andere Möglichkeit ist undenkbar. Und wenn die Öffentlichkeit erfährt, dass er meine Nina doch ermordet hat, ist sein Ruf zerstört und ich habe meine Genugtuung. Übernehmen Sie den Auftrag?«
Elena beugte sich nach vorn. »Kann ich noch nicht sagen, ich brauche noch mehr Informationen.«
»Was wollen Sie wissen?«
»Haben Sie die Unterlagen der beiden Detektive noch, die Sie damals engagiert haben? Dort könnte ich vielleicht ansetzen.«
»Leider nicht. Nachdem ich vor Jahren beschlossen hatte, mit der Sache abzuschließen, habe ich die Unterlagen verbrannt. Ich dachte, damit könnte ich meine Seele von dem Kummer befreien.«
Hat aber nicht geklappt, führte Elena den Gedanken zu Ende. Von zahlreichen anderen Fällen wusste sie, dass das nie einfach war.
Grabowski griff in die Brusttasche seines Hemds und holte zwei alte vergilbte Visitenkarten heraus, die er Elena über den Tisch schob. Offenbar hatte er bereits damit gerechnet, dass sie ihn nach den Detektiven fragen würde.
Sie betrachtete die Karten. Auf der ersten stand der Name ihres ehemaligen Chefs. »Koslowski? Wirklich?«, entfuhr es ihr.
»Er hat den Fall in jenem Jahr angenommen, in dem Sie bei ihm zu arbeiten begonnen haben.«
»Ich wusste gar nicht, dass er jemals an einem Mordfall gearbeitet hat – und dann auch noch an diesem«, gab sie zu. Andererseits hatte der alte Koslowski in seiner Kanzlei nie herumerzählt, woran er gerade selbst dran gewesen war.
»Kein Wunder«, sagte Grabowski, »schließlich hatte ich ihn damals um absolutes Stillschweigen gebeten.«
»Koslowski ist mittlerweile gestorben«, sagte Elena. »Seine Detektei wurde aufgelassen, und an die alten Unterlagen ist nicht mehr ranzukommen. Falls sie überhaupt noch existieren, was ich bezweifle.«
»Das ist mir leider klar.«
Nun betrachtete Elena die Visitenkarte des zweiten Kollegen. Weyland. Sie kannte den Detektiv. Weyland war sogar noch aktiv, soviel sie wusste, und hatte keinen besonders guten Ruf in der Branche. Aber zumindest war sein Büro hier in Baden. »Danke.« Sie schob die beiden Karten zurück.
»Übernehmen Sie den Auftrag?«
»Haben Sie eine Kopie der Polizeiakte von dem Mordfall?«
»Ich war damals zwar Ninas Erziehungsberechtigter«, seufzte er, »war jedoch aus Sicht der Staatsanwaltschaft als Verwandter zu weit entfernt, um vom Tod meiner Enkelin direkt als Opfer betroffen zu sein. Da sie zu dem Zeitpunkt schon sechzehn war, bekam ich keine Akteneinsicht in die Ermittlungsergebnisse.«
»Nicht einmal mit Ihren Kontakten zum Militär?«
Mit einem zynischen Lächeln schüttelte er den Kopf. »Keine Chance. Nach Dannenbergs Freispruch habe ich erfahren, dass es außer den offiziellen Ermittlungsergebnissen, die im Prozess verwendet wurden, auch noch ursprüngliche erste Polizeiprotokolle gab, die gleich nach dem Fund von Ninas Leiche gemacht wurden. Auch davon wollte ich eine Kopie haben, habe sogar Rechtsanwälte eingeschaltet, die Unterlagen jedoch nie erhalten.«
»Verstehe.« So etwas war nicht unüblich, Elena kannte ähnliche Fälle. Staatsanwaltschaft und Ermittler der Mordgruppe ließen sich nie gern in die Karten schauen, schon allein aus der Angst vor eventuellen Nachahmungstätern. Und solange der Fall noch ungelöst war, hatte man sowieso keine Chance auf Einsicht.
Grabowski sah Elena eindringlich an. »Übernehmen Sie den Auftrag?«
»Wollen Sie gar nicht wissen, was es kostet, mich zu engagieren?«
»Ist mir gleichgültig. Ich kann mein Vermögen sowieso nicht mitnehmen.«
Elena erklärte ihm trotzdem die Konditionen des Standardmodells für so einen Auftrag. »Eine Pauschale von neunhundert Euro pro Tag beziehungsweise tausend Euro im Ausland. Zuzüglich Spesen und Wochenendzuschlag. Kosten für Leihwagen, Unterkünfte und eventuelle Flüge übernimmt der Auftraggeber. Sie erhalten natürlich Belege über sämtliche Ausgaben.«
Grabowski zuckte nicht einmal mit der Wimper. »Einverstanden.«
»Bei einer so alten, komplexen und möglicherweise auch gefährlichen Angelegenheit – es geht immerhin um einen mutmaßlichen Mörder – ist eine Akontozahlung von zehntausend Euro notwendig«, schloss sie.
Auch diesmal reagierte Grabowski nicht sonderlich überrascht. Nur ein schmales Lächeln überzog für einen Augenblick sein Gesicht. »Das ist für mich okay.«
»Es gibt aber keine Garantie, dass ich etwas herausfinde«, gab sie zu bedenken.
»Doch, das werden Sie«, widersprach er. »Und wollen Sie wissen, warum ich mir da so sicher bin? Ich habe während meiner Laufbahn sehr viele ehrgeizige Menschen kennengelernt und kann einschätzen, wer das Zeug hat, sich in einer Sache zu verbeißen, ohne aufzugeben, wer kompromisslos dranbleibt und, wenn es sein muss, kreativ handelt. So jemand sind Sie.«
»Ich hoffe, Sie überschätzen mich nicht.«
»Keineswegs. Ich brauche nicht lange, um mir einen genauen Eindruck von jemandem zu verschaffen. Jetzt finde ich es sogar schade, dass ich es damals, nach meiner Rückkehr aus dem Kosovo, nicht noch einmal probiert und Sie engagiert habe, als Sie sich mit Ihrer eigenen Detektei schon selbstständig gemacht hatten.«
Besser wäre es gewesen, dachte sie, da mittlerweile die meisten Spuren und Hinweise vermutlich nicht mehr existierten.
Er warf einen Blick auf sein Handy und las ihr die IBAN vor, die er offenbar auf ihrer Webseite gefunden hatte. »Richtig?«, fragte er formhalber und wollte die Anzahlung wohl gerade schon über seine Banking-App anweisen lassen.
»Moment, nicht so schnell …«, unterbrach sie ihn.
Er hielt inne und sah auf. »Was möchten Sie noch wissen?«
Die wichtigste Frage von allen hatte sie sich für den Schluss aufgehoben. »Warum sind Sie so sicher, dass Dannenberg der Mörder ist?«
Grabowski lächelte, aber diesmal war es ein kaltes Lächeln, das so wirkte, als würde er sich an sein schlimmstes Erlebnis erinnern. »Nachdem die Richterin am Ende der Verhandlung das Urteil der Geschworenen verkündet hatte, nämlich den Freispruch in allen Anklagepunkten«, sagte er mit trockener Kehle, »ist Dannenberg – gerade mal seit einer Minute ein freier Mann – an meinem Tisch im Gerichtssaal vorbeigegangen, hat sich lächelnd zu mir gebeugt und mir etwas ins Ohr geflüstert, das ich niemals im Leben vergessen werde.«
Elena beugte sich näher zu ihm.
Grabowski senkte die Stimme. »Blöd, dass die Kommoden in meiner Küche so spitze Ecken haben. So war die kleine Schlampe leider schon tot, als ich ihr den Schraubenzieher ganz tief in die Vagina gerammt habe.«
Elena schluckte. Dannenberg schien ein durch und durch sadistisches Arschloch zu sein. »Haben Sie das der Staatsanwaltschaft mitgeteilt?«
»Hätte das etwas geändert?«
Sie neigte den Kopf. »Möglicherweise.«
»Nun, ich habe lange darüber nachgedacht, ob das genügt, um den Fall nochmal neu aufzurollen, habe mich dann aber entschieden, es bleiben zu lassen. Schließlich weiß ich bis heute nicht, ob sich Dannenberg nur einen bösen und geschmacklosen Scherz mit mir erlaubt hat. Stattdessen habe ich damals die beiden Detektive engagiert, um mehr zu erfahren.«
»Was aber nichts gebracht hat. Und jetzt wollen Sie endgültig die Wahrheit erfahren.«
»Sind Sie nun an dem Fall interessiert?«, krächzte Grabowski.
»Danke für das Frühstück. Auf meiner Webseite steht übrigens noch die alte Kontonummer, die Bank ist vor drei Wochen in Konkurs gegangen.« Sie erhob sich und reichte ihm ihre Visitenkarte mit ihren neuen Bankdaten.
4. Kapitel
Gerink öffnete die Glastür zum großen Besprechungszimmer im dritten Stock des Bundeskriminalamts. Der mit modernen weißen Möbeln eingerichtete Raum war klimatisiert. Es roch nach Kaffee. Scatozza ging als Erster hinein, Gerink folgte ihm.
»Tag«, sagte Scatozza nur knapp, setzte sich hin und griff gleich zu einer Tasse und der Kaffeekanne.
Gerink nickte Lisa Eisert kurz zu, dann gab er Herrn und Frau Teuber die Hand und setzte sich zu ihnen an den Tisch. Das junge Ehepaar war sechsundzwanzig – eine Jugendliebe aus der Schulzeit, wie Gerink bei ihrer ersten Begegnung erfahren hatte. Oliver war ihr einziges Kind. Sie arbeitete halbtags in einem Reisebüro, er in einer Autowaschanlage an einer Autobahnraststätte. Beide blond, sportlich und groß. Optisch das perfekte Paar wie aus dem Katalog.
Theoretisch hätten die beiden vom Alter her seine eigenen Kinder sein können, aber Elena und er hatten nie welche bekommen. Das hieß, Elena war zwar einmal schwanger gewesen, hatte das Baby aber in der elften Schwangerschaftswoche kurz vor Weihnachten verloren. Insofern wusste er, was Verlust bedeutete. Außerdem war es seine Aufgabe als Entführungsspezialist, sich in die Lage von anderen Personen hineinzuversetzen. Und jetzt sah er ein junges und verzweifeltes Paar, das sich monatelang die Augen ausgeheult hatte, mittlerweile auf dem Zahnfleisch daherkam, entsetzlich aussah und kurz davorstand, dass ihr letzter Hoffnungsfunke in Trauer, Wut und Zorn umschlug.
»Ich verstehe Ihren Kummer, und es tut mir leid«, begann Gerink, »aber wir …«
»Wir haben bereits von Ihrer Vorgesetzten erfahren, dass Ihre Reise nichts Neues gebracht hat«, fuhr Herr Teuber dazwischen.
Lisa Eisert stand mit verschränkten Armen mit dem Rücken zum Fenster. Wie zur Bestätigung nickte sie kurz, zog eine Augenbraue hoch und strich sich die grauen Strähnen hinters Ohr. Sie war erst Mitte fünfzig, trug aber schon seit über fünfzehn Jahren den Spitznamen Grauer Wolf im BKA, hielt sich gern zurück und überließ anderen das Reden.
»Ersparen Sie uns also dieses freundliche, beschwichtigende Gewäsch.« Herr Teuber knackte mit den Fingerknöcheln. »Sagen Sie uns lieber, wie es nun weitergeht.«
Okay, dachte Gerink. Das Stadium der Wut war also bereits erreicht. Bevor er etwas darauf erwidern konnte, ergriff Scatozza das Wort.
»Viele Paare in Ihrer Situation gehen an die Öffentlichkeit. Sie könnten einen Aufruf auf Facebook, YouTube oder Instagram starten«, schlug er vor. »In einer griechischen Talkshow auftreten oder …«
»Was für ein Quatsch!«, fuhr Herr Teuber dazwischen.
Gerink warf seinem Partner einen Blick zu. Er wusste, worauf Scatozza hinauswollte. Oliver war in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus dem Ferienhaus verschwunden, während seine Eltern kurz zum Arzt gefahren waren, weil sich die Mutter beim Nachtschwimmen einen Seeigel eingetreten hatte. Für die halbe Stunde hatten sie den Jungen in seinem Zimmer gelassen, weil er tief und fest geschlafen hatte. Scatozza hatte die Theorie, dass die Eltern die Leiche ihres Sohnes nach einem unbeabsichtigten tragischen Badeunfall möglicherweise selbst irgendwo losgeworden waren. Und nun versuchte er, die beiden aus der Reserve zu locken.
Doch Gerink hielt nichts von dieser Theorie. Die Teubers verhielten sich nicht wie Eltern, die den Tod ihres Sohnes selbst verursacht hatten, das Verbrechen vertuschen wollten und jetzt so taten, als würden sie extrem darunter leiden, nur damit sie frei von jedem Verdacht blieben. Sie litten wirklich und hofften immer noch auf eine harmlose Erklärung, wie beispielsweise die, dass Oliver nachts einfach nur wach geworden war, seine Eltern suchen wollte, sich dabei verlaufen hatte und möglicherweise noch am Leben war … irgendwie und irgendwo.
Es wurde Zeit, Klartext zu reden.
»Wir haben noch einmal alle dokumentierten Spuren gründlich überprüft«, übernahm Gerink das Gespräch, »aber laut Polizeibericht befanden sich Olivers Fingerabdrücke im Inneren des Hauses auf keiner Tür, die nach außen führte.«
»Am Griff der Fenster?«, fragte Frau Teuber.
»Nein.«
»Dann hatte er vielleicht eine Decke oder ein Handtuch …«
»Nein, nichts davon hat gefehlt.«
»Aber irgendwie muss er aus dem Haus gekommen sein«, schrie Frau Teuber fast schon hysterisch.
»Wir gehen davon aus, dass jemand die Tür von außen geöffnet hat und …«
»Nein!«, schrie Frau Teuber. »Unser Junge wurde nicht entführt.« Sie starrte ihren Mann an. »Sag doch auch was.«
Herr Teuber nickte. »Bis jetzt hat niemand Kontakt mit uns aufgenommen«, pflichtete er seiner Frau bei.
Gerink atmete tief durch. »Es fällt mir schwer, das zu sagen, aber wir gehen davon aus, dass jemand Ihren Sohn entführt … und möglicherweise ermordet hat.«
»Nein, nein, nein!«, schrie Frau Teuber. »Er hat sich nur verlaufen. Ich weiß, dass er irgendwo ist, Hunger hat, Durst hat, ständig weint, nach mir ruft und darauf wartet, dass ihn endlich jemand findet.«
Vier Monate lang? Gerink warf Lisa Eisert einen hilfesuchenden Blick zu.
»Die griechische Kripo sucht weiter nach Ihrem Sohn«, versuchte sie, die Situation zu entspannen.
Scatozza senkte den Kopf, massierte genervt seine Schläfen, dann sah er auf und räusperte sich. »Sie müssen sich langsam mit dem Gedanken abfinden, dass Ihr Sohn tot ist.«
Frau Teuber schrie auf.
»Ich weiß, es klingt sehr hart«, sagte Gerink mit einem bemüht ruhigen Ton, »aber ich bin derselben Meinung wie mein Kollege. Aus Erfahrung wissen wir …«
»Nein!«, fuhr die Frau sie an. »Ich scheiße auf Ihre Erfahrung. Wir wissen, dass er noch lebt. Ich bin seine Mutter. Ich spüre das!« Mit Tränen in den Augen kramte sie in ihrer Handtasche herum und zog einen weißen Stoffhasen mit großen Knopfaugen, langen Schlappohren und einer Karotte in der Pfote hervor, den sie vor ihnen auf den Tisch setzte. »Das ist Meister Löffel, sein Lieblingsstofftier.« Dann holte sie einen Stapel Fotos heraus, auf denen Oliver zu sehen war.
Gerink kannte all diese Bilder bereits zur Genüge, da er sie während ihrer ergebnislosen Suche tagelang allen möglichen Zeugen gezeigt hatte. Der Junge hatte einen leichten Silberblick, eine Augenbraue war dünner, ihm fehlte rechts unten ein Milchzahn, und oben hatte er einen anderen schief abgebrochenen Zahn. Der Bengel war ein süßer unschuldiger blonder Engel, etwas pummelig und mit pausbäckigem Gesicht.
Gerink hätte keinen der Gedanken, die ihm in den Sinn kamen, jemals in Gegenwart der Eltern laut ausgesprochen, aber manche Pädophile standen auf genau solche Kinder. Und wenn die Kleinen in einem Schuppen, einem Boot, einem Keller oder einer Lagerhalle tagelang auf einer schäbigen Matratze vergewaltigt wurden und danach an inneren Verletzungen oder einer Infektion starben, wurden ihre Leichen wie Müll entsorgt. Die Täter weinten ihnen keine Träne nach. Das war leider Gottes eine schonungslose Wahrheit, mit der sie es immer wieder zu tun bekamen.
»Wir haben in Gegenwart der griechischen Polizei mit Spürhunden die Gegend abgesucht«, sagte Gerink stattdessen sanft, »alle Nachbarn sowie das gesamte Personal der benachbarten Hotels befragt und Kontakt mit allen Gästen aufgenommen, die damals, wie Sie, ihren Urlaub in den umliegenden Ferienhäusern verbracht haben.« Er sortierte die Fotos zu einem Stapel und schob ihn der Frau zurück. »Es besteht kaum Hoffnung, dass er noch …«
»Auch ich weiß, dass Oliver noch am Leben ist«, fiel Herr Teuber ihm mit gefasster Stimme ins Wort, während seine Frau in Tränen ausbrach.
»Er wäre jetzt, im September, in die Volksschule gekommen …«, schluchzte sie. »Sie müssen ihn finden! Er ist doch noch so klein …« Sie versuchte zu atmen, bekam aber keine Luft, bis ihr Mann sie schließlich in die Arme nahm und beruhigte.
Eisert bedeutete Scatozza und ihm, dass sie den Raum verlassen sollten.
Gerink stand auf und legte Frau Teuber die Hand auf die Schulter. »Wir bleiben dran.« Dabei versuchte er, ein zuversichtliches Lächeln hinzubekommen – allerdings war er noch nie gut darin gewesen, andere zu belügen.
Indessen drückte Eisert eine Taste am Telefon und beugte sich über den Tisch zum Lautsprecher. »Sie können jetzt hereinkommen.«
Gerink nickte Scatozza zu, und sie verließen den Raum. Scatozza nahm die Kaffeetasse mit. Zum Glück sagte er nichts mehr. Frau Teuber stand auch so schon kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Vor der Tür begegneten sie der jungen Psychologin des BKA, die Eisert wohl gerade gerufen hatte und die auf dem Weg zu den Eltern war. Gerink hoffte bloß, dass sie der Familie keine sinnlosen neuen Hoffnungen machte, sondern ihr einen Weg zeigte, mit dem Verlust umzugehen.
Allerdings waren die beiden jetzt keine Familie mehr, korrigierte er sich in Gedanken, sondern nur mehr ein verheiratetes Paar. Es war so traurig. Er spürte einen Druck auf der Brust und atmete tief durch. Am liebsten hätte er ja selbst daran geglaubt, dass der Junge noch lebte, doch alles, was ihn die Erfahrung der letzten fünfundzwanzig Jahre gelehrt hatte, besagte das Gegenteil. Die einzige sinnvolle Handlung, die ihnen jetzt noch blieb, war, Olivers Mörder zu finden und die Leiche des Jungen heimzubringen.
Scatozza schielte zu ihm herüber. »Nimmt dich das so mit?«
»Dich nicht?«
»Wäre ich sensibel, wäre ich Künstler, Therapeut oder Medium geworden, aber sicher nicht bei der Polizei gelandet.«
Gerink zog nur eine Braue hoch, sagte aber nichts. Sensibel und Kripo schlossen sich seiner Meinung nach nicht zwangsläufig aus, aber ein dickes Fell war bei ihrem Job schon ganz nützlich.
Er hörte, wie Eisert ein paar Worte hinter der geschlossenen Tür sagte, dann trat auch sie in den Gang. »Das hat ja super geklappt«, sagte sie zynisch mit einem Seitenblick auf Scatozza, nachdem die Tür wieder zugefallen war.
»Dino hat recht, irgendwann müssen sie es erfahren«, verteidigte Gerink seinen Partner. »Seit vier Monaten füttern wir ihre Hoffnung. Wie lang soll das noch so weitergehen? Die müssen ihr Leben wieder auf die Reihe kriegen, sonst zerbrechen sie daran.«
»Und nur deswegen mussten wir herkommen?«, knurrte Scatozza.
Gerink ließ die Aussage unkommentiert und sah zu Eisert. Die straffte ihren dunkelblauen Businessblazer, dann bedeutete sie ihnen, ihr zu folgen.
Während sie zu ihrem Büro marschierten, senkte sie die Stimme. »Nicht nur deswegen. Auf euch wartet ein neuer Fall.«
»Wir waren noch nicht einmal zu Hause, um unsere Koffer auszupacken«, maulte Scatozza. »Die stehen unten am Empfang beim Portier.«
»Dort sind sie vorerst gut aufgehoben«, sagte Eisert.
»Und worum geht es?«, fragte Gerink ebenso mies gelaunt.
»Dienstreise ins Ausland.« Mit der Magnetkarte öffnete Eisert ihre Bürotür und ließ sie eintreten.
Scatozza fläzte sich auf einen Stuhl. »Hoffentlich diesmal in ein etwas angenehmeres Land.«
Gerink sah das genauso. Die Zusammenarbeit mit den griechischen Behörden hatte alles andere als reibungslos funktioniert. Allerdings würde er sich hüten, den Teubers jemals etwas davon zu erzählen, was sie auf Santorín durchgemacht hatten.
Lisa Eisert hatte Scatozzas Frage zwar gehört, hüllte sich aber weiterhin in Schweigen.
Kein gutes Zeichen.
Die beiden Ermittler warfen sich einen vielsagenden Blick zu – also doch wieder dieses vermaledeite Griechenland.
5. Kapitel
Die gesamte Badener Innenstadt roch nach Schwefel, was an den Heilquellen lag, die in der Fußgängerzone aus den Springbrunnen sprudelten. Baden war bekannt für sein Casino, das Stadttheater und seine verschiedenen Kuranstalten, dementsprechend alt und gediegen war die Bevölkerung. Jugendliche auf Skateboards würde man hier kaum antreffen.
Elena stand vor einem uralten Wohnhaus mit kunstvollen Stuckarbeiten, dessen Baujahr eine Tafel neben dem Eingang auf das Jahr 1772 datierte.
Weylands Adresse stimmte noch, wie Elena am Türschild erkannte. Allerdings musste sie gar nicht läuten, da die zweiflügelige wuchtige Eingangstür aus Holz sperrangelweit offen stand. Soeben schleppten zwei junge Frauen kartonweise Unterlagen aus dem Haus und stapelten diese in das Heck eines Kastenwagens, der vor dem Gebäude im Halteverbot stand.
Danach eilten die beiden Frauen wieder zurück. Elena betrat ebenfalls den Gang, in dem es kühl war und nach feuchtem Verputz roch, und folgte den Damen in die im Erdgeschoss gelegene Detektei Weyland.
Weyland selbst stand im Vorraum, klein und untersetzt, im Anzug mit gelockerter Krawatte und Schweiß auf der Stirn. Er beendete soeben ein Telefonat und gab den Frauen Anweisungen. »Diese Unterlagen dort … und diese da hinten auch noch.«
»Hallo?«, rief Elena.
Weyland fuhr herum und starrte sie mit entsetzt geweiteten Augen an. »Sind Sie vom …?« Hastig blickte er auf seine Armbanduhr.
»Mein Name ist Elena Gerink, ich bin Detektivin mit eigener Kanzlei in Wien.«
»Ah ja, ich kenne Sie. Wurden Sie auf mich angesetzt?«
»Was? Nein.« Lächelnd sah Elena sich um. »Sind Sie auf der Flucht? Brauchen Sie einen Unterschlupf? Ich könnte …«
»Haha, witzig. Was wollen Sie?«
»Ich dachte, Sie könnten mir bei einem Fall weiterhelfen …«
»Ganz schlechtes Timing«, unterbrach er sie. »Jeden Moment taucht die Finanzpolizei mit einem Hausdurchsuchungsbeschluss hier auf.«
»Wurden Sie angezeigt?«
»Na, selbst habe ich mich jedenfalls nicht verpfiffen.«
»Ein unzufriedener Klient?«, vermutete sie.
»Ja, der hat mich da reingeritten.«
»Was haben Sie zu befürchten?«, fragte sie.
Weyland riss die Augen auf. »Was habe ich nicht zu befürchten?«
Elena verstand. Weyland besaß eine große Detektei, ohne Partner, aber mit vielen Angestellten. Sie hatte ihn zwar erst jetzt persönlich kennengelernt, wusste aber von seinem eher schlechten Ruf, von seinen nicht ganz legalen Ermittlungsmethoden, dass er nicht immer alles ordnungsgemäß verbuchte und seinen Klienten manchmal mehr verrechnete, als tatsächlich angefallen war. »Ich habe früher in der Kanzlei Koslowski gearbeitet …«
»Ja, kannte den alten Knaben, netter Kerl.« Hastig kramte er Ordner aus einem Schrank und packte sie einer seiner Helferinnen auf die Arme, die augenblicklich damit nach draußen verschwand.
»Jetzt hat mich Balthasar Grabowski engagiert.«
»Wegen seiner Enkelin?«
»Genau, ich soll die Sache noch einmal aufrollen.«
»Ich erinnere mich. Grabowski hat mich damals ein paar Monate nach Dannenbaums Freispruch engagiert.«
»Dannenberg«, korrigierte sie ihn.
»Ja, genau. War ein halbes Jahr an der Sache dran, konnte Dannenberg aber nichts nachweisen, obwohl ich davon überzeugt war, dass er den Mord begangen hat. Das roch man zehn Meilen gegen den Wind. Und obwohl alles gegen ihn sprach, haben ihn die Geschworenen für unschuldig befunden.«
»Warum konnten Sie nichts gegen ihn finden?«
Weyland wühlte in einer Schublade und fischte Gehaltslisten heraus, die er diesmal der anderen Dame in die Hand drückte. »Die Ermittlungen waren nicht so einfach«, erzählte er weiter, »weil Dannenberg bereits zwei Monate nach seinem Freispruch Österreich verlassen hatte.«
»Wann genau war das?«
Weyland hielt kurz inne und legte den Kopf schief. »Der Freispruch muss Ende September gewesen sein, soweit ich mich erinnere.«
»Das heißt, Ende November lebte er schon im Ausland«, überlegte Elena. »Wissen Sie noch, wo das war?«
»Italien, und da war nur noch schwer an ihn ranzukommen.«
»Haben Sie Ihre Unterlagen von damals noch?«
Weyland richtete sich zur vollen Größe von einem Meter sechzig auf und streckte den Bauch raus. »Ja, hier irgendwo«, keuchte er und ließ die Arme kreisen.
»Dürfte ich mir eine Kopie davon machen?«
»Sie können gern die Originale haben – hier muss sowieso alles weg.«
»Alles?«, wiederholte sie. »Die Finanz prüft doch nur die letzten sieben Jahre.«
»Haben Sie eine Ahnung, was die hier alles finden könnten«, schnaufte er. »Leider weiß ich nicht, wo die Dannenberg-Unterlagen sein könnten. Viel Spaß beim Suchen.«
»Wo haben Sie denn vor vierzehn Jahren Ihre Ergebnisse abgelegt?«
Er hielt kurz inne. »Hm … damals gab es die Detektei schon seit knapp zehn Jahren, und ich hatte gerade ausgebaut … hm, muss dort drüben in dem Raum neben der Küche sein, irgendwo in den hohen Metallschränken.« Er deutete durch einen Rundbogen in den hinteren Trakt der Kanzlei.
»Danke.«
»Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie Dannenberg erwischen … und Grüße an den alten Grabowski.« Dann lief auch Weyland mit einem Stapel Papiere nach draußen.
O Gott! Bescheiß nie das Finanzamt, sagte sie sich. Und bescheiß nie deine Klienten! Sie betrat den Nebenraum – ein ebenfalls bereits zur Hälfte leer geräumtes Büro –, blickte sich um und sah die hohen Metallschränke. Die Vorhängeschlösser waren schon geöffnet, die Schubladen aber noch voll. Vermutlich war die Räumung dieser Schränke als Nächstes dran.
Nachdem sie alle Laden aufgezogen hatte, erkannte sie das System, nach dem Weyland seine Akten ablegte. Es gab offene Fälle, abgeschlossene Fälle und abgebrochene Fälle. Darunter hatte er für jedes Jahr eine eigene Rubrik angelegt und die Ordner darin dann wiederum alphabetisch nach den Namen der Klienten sortiert.
Elena nahm sich die abgebrochenen Fälle vor und blätterte so lange zurück, bis sie die vierzehn Jahre alten Aufträge fand. Unter G stieß sie schließlich auf Grabowski.
Es waren zwei dicke Hängeordner mit jeder Menge Klarsichtfolien, in denen sich Listen, Protokolle, Notizen, verschiedenste Ausdrucke und Fotos befanden. Sicherheitshalber warf sie einen Blick in ein paar der Unterlagen, bis sie auf die Namen Nina Grabowski und Thomas Dannenberg stieß. Zum Glück war Weyland genauso old school wie Koslowski und hielt offenbar nicht viel von digitaler Datenerfassung.
Hastig klemmte sie sich beide Ordner unter den Arm. Als sie den Raum verlassen wollte, hörte sie durch die offenen Türen den Tumult, der von der Straße hereindrang. Mehrere Personen, unter anderem Weyland, riefen aufgeregt durcheinander.
Elena warf einen Blick durchs Fenster und sah zwei Wagen, die vorher noch nicht da gewesen waren, jetzt aber unmittelbar vor dem Haus parkten. Finanzpolizei stand auf einem der Autos.
Scheiße!