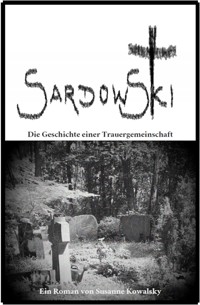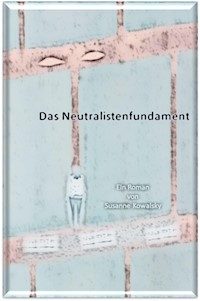Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Spätherbst fährt ein Mann über 100 Kilometer auf seinem Fahrrad zu einem Hochsitz, klettert hinauf und wartet dort auf den Tod. Während sein Körper zusehends verfällt, schreibt er ein Tagebuch. Die Geschichte ist an eine wahre Begebenheit aus dem Jahre 2008 angelehnt. In "Hoch hinaus wollte ich" rücken jedoch ein Jäger und seine Ehefrau in den Vordergrund, die ein einfaches Leben mit einem klassischen Rollenverständnis führen. Monate nach dessen Ableben findet der Jäger den Verstorbenen, als er die Leiter zum Hochsitz reparieren will. Er kommt ins Fernsehen, ist stolz darauf und darf das Tagebuch, das bei dem Toten gefunden wurde, behalten. Er gibt es seiner Frau, die zum ersten Mal über das Leben, den Tod und ihre Ehe nachdenkt. "Hoch hinaus wollte ich" beschäftigt sich mit der Gesellschaft, dem Schicksal eines Einzelnen und wie dieser durch seinen Tod Einfluss auf ein einfaches Ehepaar Anfang der 2000er Jahre nimmt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 88
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hoch hinaus wollte ich
Ein Roman von Susanne Kowalsky, der auf einer wahren Geschichte basiert.
Impressum
Text: © Susanne Kowalsky
Der Originaltext ist von 2016 und ist nur in gedruckter Form verfügbar. Der vorliegende Text wurde 2024 überarbeitet. Die Rechte des Originaltextes sowie die überarbeitete Version liegen bei Susanne Kowalsky.
Umschlaggestaltung: © 2016 Susanne Kowalsky
Verlag: Susanne Kowalsky, Höhenweg 53, 46519 Alpen
Kontakt: [email protected]
Vertrieb: epubli, ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Vorwort
»Hoch hinaus wollte ich« schildert das Schicksal eines Verstorbenen.
Pressemitteilungen vom Februar 2008 über einen ungewöhnlichen Leichenfund ließen Susanne Kowalsky nicht mehr los. Zunächst wollte sie einen anderen, bereits begonnenen Roman beenden, aber das war nicht möglich. Zu sehr beschäftigte sie der Tote, der in ihrer Erzählung anonym bleibt, weil er stellvertretend für viele Menschen steht, die Tag für Tag mit wesentlich weniger Mut durchs Leben gehen.
Die vorliegende Version weicht in Teilen leicht vom ursprünglichen Text ab. In dem 2016 veröffentlichten Kurzroman fehlt in Kapitel 10 eine kleine Passage, die in der ebook-Version nun enthalten ist.
Der Text Nach meinem Tode ist das Heft an meine Tochter zu übergeben. Was sie damit macht, bleibt ihr überlassen. stammt aus dem Originaltagebuch des Verstorbenen, wie er 2008 in der Presse veröffentlicht worden war. Diese Stelle (Kapitel 1, vorletzter Satz) ist mit * gekennzeichnet.
Kapitel 1
»Du glaubst nicht, was mir heute passiert ist.« Er lief gleich durch, behielt die verdreckten Gummistiefel an, marschierte geradewegs über den Teppich und legte erst im Wohnzimmer seine dicke Jacke ab. Aus dem Eckschränkchen holte er zwei Pinnchen und einen Klaren. Seine Frau war ihm wie ein treuer Hund hinterhergelaufen und stand nun zutiefst verblüfft vor dem Sofa, bereit, die Jacke wegzuräumen.
»Lass liegen«, sagte er. »Zum Wohl!«
Er war Jäger. Ursprünglich hatte er endlich die beiden maroden Sprossen an der Leiter zum Hochsitz reparieren wollen. Dazu war es aber nicht gekommen, weil er die merkwürdige Leiche entdeckt hatte mit dem kleinen, in Plastik gewickelten Buch, das daneben lag. Die Polizei hatte es ihm überlassen, weil niemand Interesse zeigte. Nicht einmal die einzige Tochter, die man ausfindig machen konnte. Auch sonst kümmerte sie der Tod ihres Vaters nicht. Um die Beerdigung wollte sie sich ebenso wenig kümmern. Aber das ging ihn wohl kaum etwas an und er machte sich auch nicht sonderlich viel Gedanken darüber. Wesentlich interessanter war für ihn die Tatsache, im Fernsehen gelandet zu sein. Nicht, dass er keinen Respekt vor dem Tod gehabt hätte oder gar in irgendeiner Form sensationslüstern gewesen sei. Aber eine Leiche findet man eben nicht alle Tage, erst recht nicht unter diesen seltsamen Umständen. Und es ist schon etwas Besonderes, interviewt zu werden, jedenfalls für einen Jäger. Es wurde ein richtiger Aufwand betrieben. Man sollte möglichst viel von dem Fundort sehen, ohne dabei die gesamte Umgebung zu sehr in den Hintergrund zu rücken. Gleichzeitig wollte man ihn selbst im Großformat zeigen. Er wurde sogar geschminkt, damit er natürlich wirkt. Diesen Widerspruch in sich nahm er widerstandslos hin. Die Fernsehleute wissen sehr genau, wie man das macht, jemanden zur Geltung kommen zu lassen. Nach ein paar Probeaufnahmen, die vorwiegend auch zur Findung der idealen Kameraeinstellung dienten, brachte er es fertig, locker und unaffektiert zu erzählen, was passiert war. Das hätte er ohne Schminke nicht anders gemacht. Mit dieser Einstellung stand er den Presseleuten von den Lokalblättern gelassen gegenüber.
Die Tage vergingen ohne besondere Vorkommnisse. Alles war wie immer.
»Ja, danke. Das ist nett. Wenn es eh keiner haben will.«
»Mit wem telefonierst du da?«
»Psst! Bitte? Nein, entschuldigen Sie. Ich meinte meine Frau.«
Kurze Zeit später legte er auf. Er war verärgert. Musste sie immer dazwischen quatschen, wenn er telefonierte? In mancherlei Hinsicht sind alle Frauen gleich.
»War das wieder das Fernsehen?«
»Nein.« Er nahm die Autoschlüssel und fuhr kommentarlos weg.
Nach eingehenden Untersuchungen war die Polizei zu dem Schluss gekommen, dass ein Fremdeinwirken an seinem Tod hundertprozentig ausgeschlossen werden konnte. Die Spurensicherung brauchte das Heftchen nicht mehr. Der Jäger hatte nach seiner Zeugenvernehmung außerordentlich neugierig darauf reagiert, sodass man beschlossen hatte, ihn zu kontaktieren, ob er es haben wolle. Warum sollten sie es ihm auch nicht geben? Selbst Presse und Fernsehen durften kurze Einblicke daraus veröffentlichen.
Seine Frau war ratlos. Was sollte sie mit dem Abendessen machen: zubereiten oder nicht? Ihr Mann konnte aufgewärmte Mahlzeiten nicht ausstehen. Wie sie es hasste, wenn er einfach wortlos wegging. Aus der Abstellkammer holte sie schließlich Eimer und Schrubber und begann zu wischen. Noch bevor alle Böden glänzten, kam er zurück.
»Hier, kannst du haben. Ist mal was anderes.« Bei diesen Worten sah ihr Mann sie mit einem Blick an, den sie bisher noch nicht kannte.
»Was ist das?«
»Hat der aufgeschrieben, den ich gefunden habe.«
»Ich muss noch zu Ende wischen.«
»Du mit deiner Wischerei. Das kannst du ein anderes Mal machen.«
Schrubber und Eimer legte sie daraufhin verdutzt weg, nahm die Aufzeichnungen und vergaß alles um sich herum.
»Nach meinem Tode ist das Heft an meine Tochter zu übergeben. Was sie damit macht, bleibt ihr überlassen.«*
Sie saß fassungslos am Küchentisch, das kleine Buch aufgeklappt.
Kapitel 2
»Na? Ist es spannend, was sich der Verrückte da zusammengedichtet hat?«
Es kam keinerlei Reaktion.
»Wo starrst du denn hin? Warum sagst du nichts?«
Sie gab ihm keine Antwort. Einen Moment wartete er, bevor er sich erneut an seine Frau wandte: »Was ist jetzt? Du bist doch sonst keine Leseratte. Scheinst ja ziemlich gebannt zu sein. Nun sag‘ schon! Was hat der denn da aufgeschrieben die ganze Zeit über?«
Als seine Frau wieder nicht reagierte, winkte er ab und kümmerte sich um sein Gewehr. Er hielt es stets sorgsam verschlossen in dem rustikalen Dielenschrank, der zweifach gesichert war. Die Schlüssel dazu trug er fast immer bei sich. Nachdem er es beinahe liebevoll auseinandergenommen hatte, reinigte er jedes Einzelteil mit akribischer Sorgfalt. Als gäbe es nichts Wichtigeres auf der Welt.
Mittlerweile war sie am fünften Tag seines Leidens angelangt, dem Leiden eines Mannes, der einen entsetzlichen Entschluss gefasst hatte. Sie sah aus dem kleinen Fenster, als ihr klar wurde, dass sie kein Mitleid mit ihm haben musste. Es war sein ganz persönlicher Weg, den er beschritten hatte, einer, der gewollt war. Nein, er sollte ihr nicht leidtun, denn für ihn bedeutete es Erlösung. Für sie, die sich bisher überwiegend mit dem Haushalt und ihrer Familie beschäftigt hatte, gab es ab sofort eine radikale Änderung ihrer Weltanschauung.
20. November – Der erste Tag in Freiheit
Heute bin ich losgefahren, auf dem alten Fahrrad. Es ist das Einzige, was mir noch geblieben ist. Ein langer, harter Weg liegt hinter mir und ein noch härterer vor mir. Es ist schon ziemlich kalt. Ich bin froh, dass ich meine Handschuhe dabei habe. Vorsichtshalber habe ich auch die lange Unterhose angezogen. Glücklicherweise hat es heute nicht geregnet, sonst hätte ich mein Vorhaben vielleicht noch ein weiteres Mal aufgeschoben. Obwohl ein Aufschub wohl kaum etwas gebracht hätte. Ich hätte gleich im Oktober handeln sollen als klar war, dass ich diesen gottverdammten Antrag stellen sollte. Er kommt einem offiziellen Todesurteil gleich. Vielleicht hätte ich noch mal überlegen sollen. Aber wozu? Im Merkblatt steht ja schwarz auf weiß: »Ausschluss vom Wohngeld«. Endgültig, sogar amtlich abgestempelt. Mehr kann man an Gründlichkeit nicht erwarten. Die Behörden sind gnadenlos. Und nicht nur die. Alle haben mich verlassen. Was soll ich also noch hier?
Die Flucht nach vorn ist in vollem Gange. Ich fühle mich wie ein gejagtes Tier, das es geschafft hat, in letzter Minute zu entkommen. Der erste Tag in Freiheit hat begonnen.
Es ist schon wieder dunkel. Im Dunkeln los, im Dunkeln angekommen. Ich gehe davon aus, dass ich niemandem weiter aufgefallen bin. Ich falle ja sowieso niemals irgendjemandem auf. Wieso dann gerade jetzt? Ich darf mich nicht verrückt machen. Ich muss immer an mein Ziel denken. Mit dem klaren Ziel vor Augen wird es mir leicht fallen, von einer Umkehr abzusehen.
Das Fahrrad habe ich ziemlich weit in den Wald geschoben. Durch die Lauferei sind trotz des Windes unterwegs meine Füße warm geblieben. Mir war der Vorderreifen geplatzt. Stell dir das mal vor! Mir gelingt in letzter Zeit gar nichts mehr. Einem anderen wäre das nicht passiert. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall habe ich einen geeigneten Platz gefunden, an dem ich für mich sein kann. Ein schöner Platz in Nähe der Baumwipfel. Der Nadelwald ist dicht und dunkel. Es gibt kaum ein Durchdringen. Sicherlich wird das Fahrrad niemand entdecken, bevor es Frühjahr ist, und dann bin ich längst da.
Irgendein Penner, einer wie ich, einer, der keine richtige Bleibe hat, wird wohl mal da hinten übernachtet haben. Die Matratze, die der Penner hinterlassen hat, könnte mir den Abschied vielleicht ein wenig angenehmer machen. Ich hatte damit gerechnet, nur mit der alten Steppdecke auskommen zu müssen.
Die Matratze ist aus Schaumstoff. Es war sehr leicht, sie mit hochzunehmen. Ob ich durchhalte? Ich bin gerade mal zwölf Stunden unterwegs und bereits jetzt plagt mich der Hunger. Das Frühstück habe ich mir erspart. Wo hätte ich es auch einnehmen sollen? Am Nachmittag war mir richtig schwindelig. Ich habe einfach weiter in die Pedale getreten. Bis hierher waren es bestimmt einhundert Kilometer. Vielleicht auch mehr. Seit langem habe ich endlich mal wieder eine Leistung erbracht. Das war gut so. Der Schwindel hat sich irgendwann gelegt. Er kam erst wieder, als ich die Matratze auf den Hochsitz gebracht habe. Das wird wohl meine letzte körperliche Arbeit gewesen sein, eine Fünf-Minuten-Arbeit. Wieder nichts Richtiges. Ich bin unendlich erschöpft. Dennoch plagt mich innere Unruhe. Ist es Sünde, was ich hier mache? Besonders gläubig war ich nie. Der Herr möge mir vergeben. Ich weiß mir leider keinen anderen Rat mehr. Alles ist so sinnlos. »Der Glaube versetzt Berge«, heißt es in der Kirche. Vielleicht wäre alles einfacher, wenn ich religiös wäre. Stattdessen sehe ich die Dinge mit weltlichen Augen. Mit 58 gibt mir niemand mehr die Möglichkeit für einen Neuanfang. Daran zu glauben wäre vollkommen naiv.