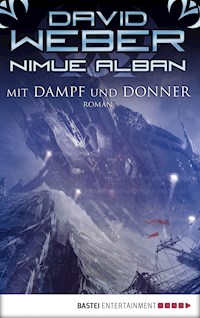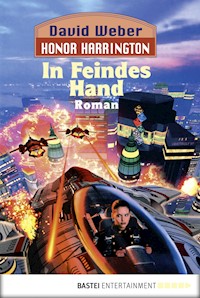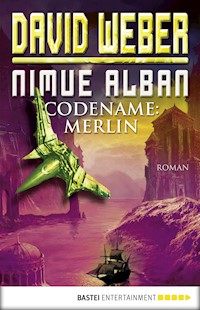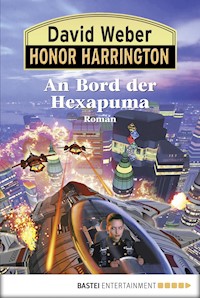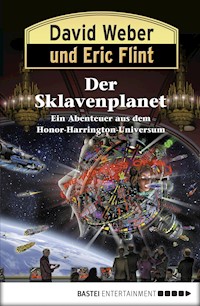
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Honor Harrington
- Sprache: Deutsch
Erewhon ist nicht gut zu sprechen auf das Sternenkönigreich von Manticore, denn die Regierung High Ridge behandelt den Bündnispartner wie einen armen Verwandten. Das alte Problem, der Sklavenplanet, ist noch immer ungelöst, und es zeichnen sich bevorstehende Übergriffe der Sklavenhändler von Masada ab. Verzweifelt versucht Königin Elizabeth, die Situation zu entschärfen, und schickt Captain Zilwicki und ihre Nichte nach Erewhon. Dort angelangt, bekommen die beiden es mit Victor Cachat zu tun, einem Top-Agenten der Republik Haven, und entdecken überdies, dass die Delegation der Solaren Liga in dunkle Machenschaften verstrickt ist. Zu allem Überfluss treten nicht nur die Fanatiker von Masada auf den Plan, sondern auch noch der Audubon Ballroom - angeführt von dem skrupellosen Ex-Sklaven Jeremy X. Auftakt der Reihe über das "Honorverse" - das Honor-Harrington-Universum
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 973
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
DerSklavenplanet
Ein Abenteuer aus demHonor-Harrington-Universum
Ins Deutsche übertragen vonDietmar Schmidt
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstveröffentlichung
Titel der amerikanischen Originalausgabe: Crown of Slaves
© 2003 by David M.Weber & Eric Flint
Published by arrangement with
Baen Publishing Enterprise, Wake Forest, NC
© für die deutschsprachige Ausgabe 2006/2014 by
Bastei Lübbe AG, Köln
This Work was negotiated through Literary Agency
Thomas Schlück GmbH; 30827 Garbsen
Titelillustration: David Mattingly / Agentur Thomas Schlück GmbH
Umschlaggestaltung: Tanja Østlyngen
Lektorat: Gerhard Arth / Stefan Bauer
E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN: 978-3-8387-0970-3
Sie finden uns im Internet unterwww.luebbe.de
Bitte beachten Sie auch: www.lesejury.de
Für Andre Norton
Andre, du hast schon vor langer Zeit bewiesen,
dass es nichts mit physischer Statur zu tun hat,
wenn man ein Riese ist. Du hast die Schritte eines Riesen
gemacht und mehr als ein halbes Jahrhundert lang anderen
die Kunst des Geschichtenerzählens gelehrt,
und wir gehören zu den vielen, die die Gunst genossen,
deine Schüler zu sein.
Es wird Zeit, dass wir der Lehrerin unseren Dank sagen.
Teil I:Manticore
1
»Ich bin wirklich nervös, Daddy«, wisperte Berry mit einem fast verstohlenen Blick auf die prächtig uniformierten Soldaten. Auf ganzer Länge des Korridors, der zum privaten Audienzzimmer von Königin Elisabeth III. führte, schienen sie Spalier zu stehen.
»Unnötig«, entgegnete Anton Zilwicki barsch, während er unerschüttert zu der großen Flügeltür am Ende des Ganges weiterging. Die beiden Türflügel bestanden wie auch viele Möbel im Mount Royal Palace aus Ferran. Schon aus dieser Entfernung, die noch immer beträchtlich war, konnte Anton mühelos nicht nur die charakteristische Maserung erkennen, sondern auch die traditionellen Schnitzmuster. Ferranholz stammte aus dem Hochland seines Heimatplaneten Gryphon, und in seiner Jugend hatte er, wie die meisten gryphonischen Highlander es irgendwann taten, recht oft mit dem Material gearbeitet.
Ein Teil von ihm – seine rationale, berechnende Seite, die eine wichtige Komponente seiner Persönlichkeit ausmachte – freute sich beim Anblick des Holzes. Die hölzernen Türen und noch mehr die Schnitzarbeiten wiesen subtil darauf hin, dass die Winton-Dynastie ihre Untertanen in den gryphonischen Highlands ebenso sehr wertschätzte wie gebürtige Manticoraner. Gleichzeitig aber musste Anton daran denken, wie sehr er als Junge die Arbeit mit dem Holz verabscheut hatte. Der Stamm des Wortes ›Ferran‹ war ein nicht sonderlich kunstvoll verbrämter Hinweis auf seine auffälligste Eigenschaft, sah man von der hübschen Maserung und der satten Farbe einmal ab.
Die gewaltigen harten Muskeln in Antons Unterarmen waren das Produkt seines Gewichtheberprogramms als Erwachsener; doch schon als Junge war er sehr kräftig gewesen. Von Schwächlingen ließ sich Ferran nicht bearbeiten. Das Zeug war beinahe so hart wie Eisen und von Hand ungefähr genauso leicht zu formen.
Antons Lippen zuckten. Genau diese Eigenschaft – oder ein Charakteristikum, das aufs Gleiche hinauslief – wurde ihm nicht nur gelegentlich, sondern immer wieder vorgeworfen. Zum Teufel mit dir, Zilwicki! Hart wie Stein und ungefähr genauso leicht zu bewegen!
Zuletzt am gleichen Morgen, wenn er ehrlich war, und zwar von seiner Geliebten Cathy Montaigne.
»Ich glaube, Mommy hatte Recht«, flüsterte Berry. »Du hättest deine Uniform anziehen sollen.«
»Sie haben mich auf Halbsold gesetzt«, knurrte er. »Und da soll ich ausgerechnet diese alberne Paradeuniform tragen – die unbequemste Kleidung, die ich besitze? Wie ein Pudel, der Männchen macht, damit Herrchen ihm verzeiht?«
Die Nervosität, mit der Berry die Gardisten betrachtete, war nun eindeutig der Verstohlenheit gewichen; insbesondere galt das jedoch für die Blicke, die sie auf die vier Soldaten warf, die ihnen in einigen Schritten Abstand folgten. Offensichtlich rechnete die Halbwüchsige bereits damit, dass das Leibregiment sie auf der Stelle festnahm, und zwar wegen …
Wie immer der komplizierte juristische Ausdruck auch lautete, der das Vergehen bezeichnete, sich in Gesellschaft des respektlosen Rüpels Anton Zilwicki zu befinden und zudem seine Adoptivtochter zu sein.
»Die Queen hat dich aber gar nicht aufs Trockene gesetzt«, zischte sie hastig, als könnte sie mit dieser Gegenerklärung die eigene Unschuld unterstreichen. »Das hat Mommy dir den ganzen Morgen gesagt. Ich hab sie gehört. Sie war ziemlich laut.«
Was Anton augenblicklich durch den Kopf ging, war eine milde Freude, weil Berry mit ›Mommy‹ Cathy Montaigne meinte. Technisch betrachtet war sie natürlich nicht ihre Mutter. Berry und ihr Bruder Lars waren von Anton adoptiert worden, und da Cathy und er nicht verheiratet waren, konnte man Cathy offiziell allenfalls als … ja, als was bezeichnen?
Erneut zuckten seine Lippen. Daddys Freundin vielleicht. Geliebte vielleicht, wenn man einen gehobeneren Ausdruck suchte. Cathy bezeichnete sich selbst in passender Gesellschaft gern als ›Antons Betthäschen‹. Die frühere Gräfin of the Tor amüsierte sich wie ein Kind, wenn die gequälten Ausdrücke auf die Gesichter der feinen Gesellschaft krochen.
Berry und Lars, in dem Höllenloch aufgewachsen, das man das Alte Viertel in der Erdhauptstadt Chicago nannte, bedeuteten die rechtlichen Fragen nichts. Nachdem Antons Tochter Helen sie in den Katakomben unterhalb Chicagos gefunden und ihnen das Leben gerettet hatte, waren Berry und Lars von den Zilwickis aufgenommen worden und hatten dort die erste Familie gefunden, die sie je besaßen. Und immer, wenn Anton sah, als wie selbstverständlich sie diese Familienzugehörigkeit mittlerweile betrachteten, freute er sich.
Seine Freude konnte er auf ein andermal verschieben. In diesem Moment waren eher strenge väterliche Anweisungen gefragt. Deshalb verkniff er sich sein Lächeln, blieb abrupt stehen und blickte seine Tochter warnend an. Die vier Soldaten, die plötzlich und unerwartet anhalten mussten und beinahe in ihre Schützlinge hineingelaufen wären, beachtete er gar nicht.
»Na, und?«, wollte er wissen. Er bemühte sich gar nicht erst zu verhindern, dass seine Bassstimme durch den weiten Korridor rumpelte, obwohl der breite Highlandereinschlag seine Worte vermutlich unverständlich machte, bevor sie dem Haushofmeister zu Ohren kamen, der an der Flügeltür stand.
»Die Monarchin steht im Zentrum der Dinge, Mädchen. Dafür erhält die Krone meinen Gehorsam. Einen Gehorsam, der bedingungslos ist, solange die Dynastie die Rechte ihrer Untertanen achtet. Es gilt aber auch das Gegenteil. Ich verurteile Ihre Majestät nicht für das Tun ›ihrer‹ Regierung, vergiss das nicht. Wir leben in einer konstitutionellen Monarchie, und wie die Dinge im Augenblick stehen, wäre es albern, Ihrer Majestät das Fehlverhalten der Regierung vorzuwerfen. Aber gelobt wird sie dafür auch nicht.«
Als er sah, wie Berry schluckte, hätte er beinahe aufgelacht. Für ein ehemaliges Straßenkind aus der Chicagoer Unterwelt war Macht eben Macht, und zum Teufel mit ›dem Gesetz‹. Kein Gesetz und kein Gesetzeshüter hatten Berry vor dem Entsetzlichen beschützt, das sie durchgemacht hatte. Und auf der Welt, von der sie stammte, hätten sowohl Gesetz als auch Gesetzeshüter selbst dann nicht gehandelt, wenn sie gewusst hätten, was Berry angetan wurde. Erst die nackte Gewalttätigkeit von Antons Tochter Helen, des jungen havenitischen Geheimdienstoffiziers namens Victor Cachat und eines Dutzends mörderischer Ex-Sklaven aus dem von Jeremy X angeführten Audubon Ballroom hatten sie ein für alle Mal aus ihren Leiden gerettet.1
Dennoch war es die Aufgabe des Vaters, seine Kinder zu erziehen, und Anton schreckte vor dieser Pflicht ebenso wenig zurück wie vor jeder anderen.
Hinter ihm räusperte sich ein Soldat, eine nicht besonders höfliche Erinnerung: Die Königin wartet, du Idiot!
Eine großartige Gelegenheit zur Fortsetzung der Lektion, sagte er sich. Anton starrte den Soldaten – den Sergeant, der ihre kleine, vierköpfige Eskorte kommandierte – mit seinem einschüchterndsten Blick an.
Und einschüchternd war dieser Blick allemal. Anton war zwar kein hochgewachsener Mann, aber so breit und außerordentlich muskulös, dass er aussah wie ein Zwergenkönig aus der Sage. Der kantige Kopf und die dunklen Augen – hart wie Achate in solchen Momenten – unterstrichen diesen Eindruck. Die Soldaten, die seinem Blick begegneten, fragten sich in diesem Moment zweifelsohne, ob Anton mit bloßen Händen Stahlstangen verbiegen konnte.
Was er tatsächlich konnte. Wahrscheinlich fiel den Soldaten nun plötzlich ein, dass der grotesk untersetzte Mann, der sie so warnend anblickte, früher einmal der Wrestling-Meister des Sternenkönigreichs in seiner Gewichtsklasse gewesen war.
Die vier machten einen halben Schritt zurück. Die rechte Hand des Sergeants zuckte sogar ein winziges Stück zur Dienstwaffe, die an seiner Seite im Holster steckte.
Das genügte. Anton legte es schließlich gar nicht darauf an, einen Zwischenfall zu provozieren. Er nahm langsam den Blick von den Soldaten und wandte sich wieder seiner Tochter zu.
»Ich bin kein verdammter Adliger, Mädchen. Und du auch nicht. Deshalb bitten wir nicht wie Höflinge um Gefälligkeiten – und wir beugen auch nicht das Knie. Man hat mich aufs Trockene gesetzt, und die Königin hat keinen Einwand erhoben. Also kann sie damit genauso gut leben wie die Schuldigen oder ich. Und darum hängt die Uniform im Schrank und bleibt auch dort. Verstanden?«
Berry war noch immer nervös. »Soll ich mich denn nicht vor der Königin verneigen oder so?«
Anton lachte rau. »Weißt du denn überhaupt, wie man sich ›verneigt‹?«
Berry nickte. »Mommy hat es mir beigebracht.«
Antons warnender Blick kehrte mit ganzer Macht zurück. Hastig fügte Berry hinzu: »Aber nicht so, wie sie es macht – oder es jedenfalls gemacht hat, bevor sie eine Bürgerliche wurde.«
Anton schüttelte den Kopf. »Verneigen ist etwas für offizielle Anlässe, Mädchen. Wir haben eine formlose Audienz. Stelle dich einfach schweigend vor Ihre Majestät und sei höflich, das genügt.« Er wandte sich ab und setzte sich wieder Richtung Audienzsaal in Bewegung. »Außerdem traue ich es dir nicht zu, dass du es richtig machst. Ganz bestimmt nicht, wenn Cathy es dir gezeigt hat, mit dem ganzen Geschnörkel und Tralala einer Adligen.«
Seine Lippen zuckten wieder; seine gute Laune kehrte zurück. »Wenn sie in der Stimmung ist – was nicht oft vorkommt, das gebe ich zu –, wird angesichts ihrer kunstvollen Verneigung jede Herzogin grün vor Neid.«
Als sie den Eingang erreicht hatten und ein wütend funkelnder Haushofmeister den Türflügel aufzuziehen begann, hatte Antons Zurschaustellung von highlandertypischem Eigensinn Berry ein wenig beruhigt. Ohne Zweifel war sie zu dem Schluss gekommen, dass der königliche Unmut, den ihr Vater schon bald auf sich herabbeschwor, sich so gründlich auf ihn konzentrieren würde, dass sie vielleicht ungeschoren davonkam.
Wie sich dann aber zeigte, empfing die Königin des Sternenkönigreichs sie mit einem Lächeln, das so breit war, dass es schon fast ein Strahlen genannt werden konnte. Vor dem Hintergrund von Elizabeth Wintons mahagonibrauner Haut leuchteten die weißen Zähne. Soweit Anton sagen konnte, zeigte das mit spitzen Zähnen besetzte aufgerissene Maul im Gesicht von Ariel, dem Baumkatzengefährten der Queen, sogar eine noch größere Fröhlichkeit an. Anton war kein Experte für Baumkatzen, doch auch er wusste, dass sie normalerweise die Gefühle des Menschen widerspiegelten, mit dem sie sich verbunden hatten. Und falls das katzenhafte Wesen, das es sich auf der dick gepolsterten Rückenlehne des Sessels der Königin gemütlich gemacht hatte, verärgert oder wütend war, so gab es dafür zumindest keine Anzeichen.
Obwohl er nur widerstrebend erschienen war, erwärmte sich Anton gegen seinen Willen für die Königin. Letzten Endes war und blieb er ein Kronenloyalist, auch wenn seine einstmals simple politische Philosophie sich in den Jahren, seit er Cathy Montaigne kannte, stark differenziert hatte. Wie auch immer, nach allem, was er von dieser Königin seit ihrer Thronbesteigung gehört hatte, war er mit ihr einverstanden.
Sein Wissen stammte freilich aus der Distanz. Er war Königin Elisabeth III. nie vorgestellt worden, sondern hatte sie allenfalls bei einer Hand voll großer offizieller Zusammenkünfte aus der Ferne erblickt.
Anton bemerkte, dass die junge Frau, die neben der Königin saß, eine beinahe unmerkliche Bewegung zu der kleinen Konsole an ihrer Sessellehne machte. Als er rasch zur Seite blickte, entdeckte Anton einen diskret in die Vertäfelung eingelassenen Bildschirm in der Wand der Kammer. Das Display war dunkel, doch er vermutete, dass die Königin und ihre Gesellschafterin ihn beobachtet hatten, während er den Korridor durchquerte – und in diesem Fall hätten sie auch sein kleines Gespräch mit Berry gehört. Jedes einzelne Wort, es sei denn, die Audiosensoren waren erheblich schlechter, als man sie im Königspalast des auf dem Gebiet der Elektronik fortschrittlichsten Reichs der erforschten Milchstraße erwarten sollte.
Darüber war er keineswegs verärgert. Als er noch Werftingenieur der Navy war, hätte ihn die Bespitzelung vielleicht erbost. Doch nach seinen vielen Jahren als Offizier im Nachrichtendienst – was er im Grunde nach wie vor war, wenngleich nun auf sozusagen freiberuflicher Basis – hatte er sich eine gleichgültige Haltung angeeignet, was Überwachung anging. Solange man seine Privatsphäre achtete, die er mit seinem Zuhause gleichsetzte, war es ihm ziemlich egal, wer ihn in der Öffentlichkeit belauschte und beobachtete. Welche Fehler er auch hatte, ein Heuchler war er nicht, und er selbst verzichtete schließlich auch nicht auf Überwachung.
Am Lächeln der Königin erkannte er zudem, dass die Queen nicht beleidigt war. Eher wirkte sie amüsiert. Er spürte, wie Berry sich entspannte, als sie zu dem gleichen Schluss gelangte wie er.
Doch Anton achtete kaum auf Berry. Während sie sich langsam den kunstvoll verzierten Sesseln näherten, die Elizabeth Winton und ihrer Gesellschafterin als formlose Throne dienten, konzentrierte sich Anton ganz auf die junge Frau neben der Queen.
Zuerst meinte er, die junge Frau noch nie gesehen zu haben, nicht einmal auf Archivbildern oder in einem Hologramm. Als er näher kam, gelang es ihm jedoch, ihr Antlitz mit einem Gesicht in Verbindung zu bringen, das er auf Bildern gesehen hatte, welche aufgenommen worden waren, als sie noch ein junges Mädchen gewesen war. Schon bald hatte er durch logische Schlussfolgerung ermittelt, wer sie war.
Ihr Alter lieferte den letzten Hinweis. Anton war kein Modeexperte, doch selbst für ihn war offensichtlich, wie außerordentlich teuer die junge Frau gekleidet war – Kleidung, wie sie eine Adlige getragen hätte, die der Königin als Beraterin diente. Dazu aber war die Frau viel zu jung. Gewiss, durch das Prolong war es recht schwierig geworden, einem Menschen sein Alter anzusehen, doch Anton war sich sicher, dass diese Frau nicht viel älter war als die Teenagerin, als die sie ihm erschien.
Folglich musste sie zur Königsfamilie gehören oder nahe verwandt sein, und es gab nur eine Kandidatin, auf die sämtliche Kriterien zutrafen. Dass die Haut des Mädchens so viel heller war als bei einer typischen Winton, stellte nur das Tüpfelchen auf dem i dar.
Ruth Winton also, die Tochter Judith Wintons, der Schwägerin der Königin. Ruth war von einem masadanischen Freibeuter gezeugt, aber von Michael Winton, dem jüngeren Bruder der Königin, adoptiert worden, als er Judith heiratete, nachdem sie der Gefangenschaft entkommen war. Wenn Anton sich richtig erinnerte – und er hatte ein phänomenales Gedächtnis –, so war Ruth Winton nach Judiths Flucht zur Welt gekommen und Michael der einzige Vater, den sie kannte. Sie musste mittlerweile ungefähr dreiundzwanzig Jahre alt sein.
Wegen ihrer Herkunft gehörte sie nicht der Reihe der Thronfolger an, doch davon abgesehen war sie ohne jeden Vorbehalt Königin Elisabeths Nichte. Anton wunderte sich über ihre Gegenwart, doch er widmete der Frage nicht mehr als einen flüchtigen Gedanken. Immerhin wusste er nicht einmal, weshalb er vor die Königin treten sollte; der Befehl, vor ihr zu erscheinen, war für ihn vollkommen überraschend gekommen. Er zweifelte allerdings nicht, dass er die Antwort schon bald erfahren würde.
Berry und er erreichten einen Punkt auf dem Fußboden, den Anton als gebührend von der Königin entfernt betrachtete. Er blieb stehen und verbeugte sich höflich. Neben ihm folgte Berry hastig und nervös seinem Beispiel.
Hastig, ja – aber für Antons Geschmack dennoch bei weitem zu kunstvoll. So viel er von seiner ländlichen Herkunft auch zurückgelassen hatte, als er Gryphon vor so vielen Jahren den Rücken kehrte, das streitlustige Plebejertum eines Highlanders besaß Anton noch in vollem Ausmaß. Niederknien, Kratzfüße und Kotau machen, gekünstelte Schnörkel vor gekröntem Haupt, das waren Laster der Edelleute. Anton schenkte der Krone seine Treue und seinen Respekt, aber mehr konnte sie verdammt noch mal nicht erwarten.
Er musste ein wenig finster dreingeschaut haben. Die Königin rief lachend aus: »Aber ich bitte Sie, Captain Zilwicki! Das Mädchen hat sich wunderschön verbeugt. Ein wenig ungeübt vielleicht, aber man bemerkt Cathys Touch. Für mich unverwechselbar, ihr Stil. Cathy hat mich damit in solche Schwierigkeiten gebracht. Sie und ich zogen uns den furchtbaren Zorn unseres Benimmlehrers zu, weil wir aus seinen Lektionen eine Ballettstunde machten. Natürlich war es allein ihre Idee. Nicht dass ich nicht liebend gern mitgemacht hätte.«
Anton hatte von dem Zwischenfall gehört; Cathy hatte ihn einmal erwähnt. Sie sprach nur selten davon, doch als Mädchen war sie sehr eng mit der heutigen Königin befreundet gewesen; die Beziehung war zerbrochen, als ihre politischen Ansichten sich auseinander entwickelten. Selbst dabei war jedoch keine persönliche Feindschaft entstanden. Und nicht nur Anton hatte bemerkt, dass seit Cathys Rückkehr aus dem Exil stets ein warmer Ton zwischen ihr und Königin Elisabeth herrschte, wenn sie einander begegneten.
Gewiss, diese Begegnungen waren recht selten und ereigneten sich nur in großen Abständen, denn die Königin befand sich in einer unangenehmen politischen Lage. Während Elizabeth persönlich ebenso sehr wie Cathy eine Gegnerin der Gensklaverei war – wie auch die Regierung Manticores offiziell –, ließen sich Cathys mannigfaltige politische Feinde keine Gelegenheit entgehen, auf Cathys offiziell zwar dementierte, aber dennoch wohlbekannte Verbindungen zum Audubon Ballroom hinzuweisen und sie zu verurteilen. Trotz Manticores Position gegenüber der Sklaverei war der Ballroom im Sternenkönigreich nach wie vor als Terrororganisation verboten, und der Anführer, Jeremy X, wurde regelmäßig als skrupellosester Meuchelmörder der Galaxis verunglimpft.
Weder Cathy noch Anton hatten dieses Bild vom Audubon Ballroom – und die Königin ebenfalls nicht, da war sich Anton ziemlich sicher –, doch Privatansichten waren eine Sache, offiziellen Positionen eine andere. Ob Elisabeth III. nun mit der Einstellung ihrer Regierung gegenüber dem Ballroom einverstanden war oder nicht, es blieb bei der offiziellen Position. Deshalb musste sich die Königin hüten, Cathy eine formelle politische Würdigung zuzuerkennen, auch wenn sie ihre freundschaftliche persönliche Beziehung aufrechterhielten, wann immer sie einander auf gesellschaftlichen Ereignissen ›zufällig‹ begegneten. Andererseits – da war Anton sich sicher – wäre niemand entzückter gewesen als Königin Elisabeth, wenn Cathy die Gräfin von New Kiev als Vorsitzende der Freiheitlichen Partei ablöste.
Elizabeth lachte wieder auf. »In was sie mich alles hineingezogen hat! Eine Klemme nach der anderen. Meine Lieblingseskapade – dafür ist sie monatelang des Palastes verwiesen worden, meine Mutter war so wütend – war, als …«
Sie verstummte abrupt. Das Grinsen ließ nach, und ihre Miene wirkte beinahe angestrengt, doch der neckische Ausdruck verschwand nicht vollständig.
»Ja, ich weiß, Captain Zilwicki. Und jetzt ist sie wieder des Palastes verwiesen worden – politisch, wenn auch nicht persönlich –, und zwar nicht auf Anordnung der Königinmutter, sondern auf meinen Befehl hin. Und das ist, wie es sich fügt, auch der Grund, aus dem ich Sie hergebeten habe: Auf eine recht komplizierte Weise hängt beides zusammen.«
Die Queen winkte knapp dem Haushofmeister. Der Mann hatte offenbar darauf gewartet, und er und einer der wachestehenden Soldaten holten zwei von den Stühlen, die an der Wand standen, und stellten sie vor die Königin und ihre Gesellschafterin.
»Setzen Sie sich bitte, Captain. Alle beide.«
Interessant, dachte Anton. Zwar kannte er das höfische Protokoll nicht aus eigener Erfahrung, aber er wusste eine Menge darüber. Er kannte sich mit den meisten Dingen aus, die Bereiche berührten, welche ihm wichtig waren. Gewiss fehlte es ihm in einigen der feineren Punkte an Kenntnis, doch die Sitzordnung war relativ einfach. Wenn jemand vor die Monarchin zitiert wurde, erhielt man entweder einen Platz angeboten, sobald man den Raum betrat, oder man stand während der gesamten Audienz. Der Unterschied war recht krass und zeigte, welchen Stellenwert man besaß oder ob man in der Gunst der Königin stand, oder auch beides.
Durch dieses Halb-und-halb-Arrangement signalisierte die Königin ihm wohl, dass es sich um eine Halb-und-halb-Angelegenheit handelte. Jeder, auf dessen Schultern nicht die unvermeidliche Last des höfischen Protokolls ruhte, hätte vielleicht einfach gesagt: Schauen wir mal, ob wir uns einig werden.
Antons Sinn für Humor war nicht so offensichtlich wie der seiner Geliebten Cathy Montaigne, doch es fehlte ihm daran keineswegs. Als er sich nun setzte, musste er den Impuls unterdrücken, der Königin zu entgegnen: Gut, Sie mischen, ich hebe ab.
Kaum saßen sie, als Elizabeth Winton auf die junge Frau neben sich wies und sagte: »Das ist meine Nichte Ruth, wie Sie wahrscheinlich schon geschlussfolgert haben.«
Anton nickte zuerst der Queen zu, um ihre Vermutung zu bestätigen, dann der königlichen Nichte.
»Sie werden nur selten ein Bild von ihr gesehen haben – in den letzten vier Jahren kein einziges –, weil wir sie stets aus dem Rampenlicht gehalten haben.« Ein wenig steif fügte sie hinzu: »Das hat übrigens keineswegs die Ursache – egal was die Medien sich zusammenspekulieren –, dass das Haus Winton auch nur die geringsten Schwierigkeiten mit Ruths Abkunft hätte oder sich gar dessen schämte. In den ersten Jahren wollten wir Ruth vor möglichem Schaden bewahren. Ihr Vater – der Vergewaltiger ihrer Mutter, sollte ich wohl sagen – konnte wie viele masadanische Fanatiker entkommen, nachdem der Earl von White Haven als Reaktion auf den masadanischen Angriff gegen Grayson den Planeten Masada besetzt hatte. Wir fahnden zwar nach wie vor nach diesen Leuten, doch wie Sie wohl noch besser wissen als ich, ist es uns bislang nicht gelungen, sie aufzuspüren.«
Die Königin verzog das Gesicht, und Zilwicki stimmte ihr innerlich zu. Einem disziplinierten, harten Kern aus der masadanischen Abart der Kirche der Entketteten Menschheit war es gelungen, in den Untergrund zu gehen und dort zu bleiben. Dass sie nach über fünfzehn T-Jahren manticoranischer Besatzung immer noch unentdeckt geblieben waren, sagte einiges aus, worüber kein Geheimdienstoffizier wirklich nachdenken wollte. Insbesondere, seit ihre Verschwörung zur Ermordung sowohl der Königin als auch des Protectors von Grayson vor vier Jahren um Haaresbreite erfolgreich gewesen wäre.
»Wer weiß was diese Irrsinnigen getan hätten?«, fuhr die Königin fort und bestätigte ihm damit, dass sie an das Gleiche dachte wie er. »Das ist natürlich lange her, und wir machen uns heute keine großen Sorgen mehr. Doch seitdem …«
Elisabeth legte den Kopf ein wenig schräg und bedachte Ruth mit einem milden, schiefen Lächeln. »Seitdem haben wir auf Ruths eigenen Wunsch die Geheimhaltung fortgesetzt. Wie sich herausstellt, hat meine Nichte – das ist für mich noch immer ein bisschen schockierend – den für die Wintons höchst untypischen Wunsch, in einer anderen Eigenschaft zu dienen, als die übliche Laufbahn beim Militär, dem Diplomatischen Korps oder der Kirche einzuschlagen.«
Anton musterte das Mädchen sorgfältig. Er bedachte, was er bereits über sie wusste, während er Elizabeths Worte verdaute.
Mit seiner Brautwahl hatte der damalige Kronprinz und Thronerbe Michael Winton besonders in den reaktionären Kreisen der Aristokratie einigen Staub aufgewirbelt. Als Thronerbe war er gesetzlich verpflichtet gewesen, eine Bürgerliche zu ehelichen, wenn er denn überhaupt heiraten wollte, doch allgemein war erwartet worden, dass er wartete, bis sein Neffe die Position des Thronerben einnahm, und dann jemand aus seinen eigenen Kreisen heiratete. Gewiss hatte niemand damit gerechnet, dass er eine ausländische Bürgerliche heiraten könnte – ganz gewiss aber nicht eine mittellose Bürgerliche auf der Flucht, die von einem Planeten wie Grayson stammte. Ganz besonders aber heiratete ein manticoranischer Kronprinz keine schwangere Bürgerliche, die ihren masadanischen Sklavenherren nur dadurch entkommen war, dass sie mehrere Morde beging und ein Sternenschiff entführte.
Michael jedoch war in vollem Maße mit dem für das Haus Winton typischen Eigensinn ausgestattet. Vor allem aber hatte seine Schwester ihm vorbehaltlos den Rücken gestärkt. Und so hatte er, ob es allen nun passte oder nicht, Judith geheiratet und Ruth adoptiert.
Natürlich nicht ohne gewisse Sondervorkehrungen. Michael war mittlerweile weder Thronfolger noch Prinz, da sein Neffe Roger mittlerweile so alt war, dass man ihn zum Erben seiner Mutter erklärt hatte, und sie hatten die offizielle Eheschließung verschoben, bis Roger seinen Platz eingenommen hatte. Michael war jetzt der Herzog von Winton-Serisburg, wodurch Judith zur Herzogin wurde, obwohl der Titel nur auf Lebenszeit galt und nicht an Ruth vererbt wurde. Dennoch hatte Michael bei der Adoption von Judiths Tochter ausdrücklich erklären müssen, dass Ruth nicht in der Thronfolge der Krone von Manticore stand. Dass man sie normalerweise mit dem Titel einer Prinzessin belegte, war reine Höflichkeit, obwohl Anton den starken Verdacht hatte, dass Elizabeth beabsichtigte, dem Mädchen bei passender Gelegenheit einen eigenen Adelstitel zu verleihen.
Ungeachtet ihrer tatsächlichen Herkunft war Ruth Winton eine Winton, und das Haus Winton hatte wie die meisten fähigen und intelligenten Herrscherdynastien der Geschichte eine lange Tradition, dass ihre jungen Abkömmlinge in den Staatsdienst gingen, normalerweise entweder ins Diplomatische Korps oder zum Militär; im letzteren Fall wurde meist die Navy bevorzugt, da sie Manticores Hauptteilstreitkraft darstellte. Einige wenige mit einer Neigung dazu entschieden sich auch für eine Laufbahn als Geistliche. Das Sternenkönigreich besaß keine Staatskirche, doch das Haus Winton war seit jeher Mitglied der Zweitreformierten Katholischen Kirche. Im Laufe der Jahrhunderte waren viele Wintons Geistliche geworden, und einige hatten sogar das Zölibat auf sich genommen, das für die Priesterschaft der Zweitreformierten Katholischen Kirche optional war, aber mehr oder minder von jedem erwartet wurde, der das Bischofsamt anstrebte.
Eine ganze Reihe von Puzzlestücken fügten sich in Antons Kopf zusammen. »Sie will in den Geheimdienst – Sie haben Recht, Eure Majestät, das ist ein wenig schockierend –, und sie möchte von mir ausgebildet werden. Der letzte Teil leuchtet ein, aber der Rest grenzt an Irrsinn. Auf keinen Fall könnte sie das Handwerk auf offiziellem Wege lernen. Die Flottenakademie würde bei dem Gedanken ersticken, und der Special Intelligence Service bekäme wahrscheinlich einen kollektiven Herzanfall. Sie könnten die Leute natürlich dazu zwingen, doch sie wären dann so sehr auf Sicherheit bedacht, dass sie Ihrer Nichte das Gehirn nur tüchtig durcheinander rühren würden.«
Königin Elisabeths ausdruckslose Miene verriet ihr unterdrücktes Erstaunen. Neben ihr wisperte die junge Ruth: »Ich habe dir doch gesagt, dass er der Beste ist.«
Anton fuhr fort: »Die Idee ist trotzdem verrückt. Gewiss, Eure Majestät – und ich will damit nicht respektlos erscheinen –, Ihre Dynastie könnte natürlich ein Mitglied gebrauchen, das sich mit dem Spionagegewerbe auskennt. Nicht so sehr zum eigenen Erlangen von Informationen sondern vielmehr, um den Mist und Müll erkennen zu können, aus dem nach vier Jahren Regierung High Ridge die so genannten ›Nachrichtendienstberichte‹, die Sie erhalten, wahrscheinlich bestehen. Sowohl vom ONI als auch vom SIS. Ich möchte damit nicht respektlos erscheinen. Eurer Majestät gegenüber nicht, heißt das.«
Er schwieg kurz, dann sagte er: »Trotzdem bleibt das Sicherheitsproblem bestehen. Hier auf Manticore ist es natürlich nicht so gravierend, aber meine Arbeit zwingt mich oft, den Planeten zu verlassen. Manchmal muss ich Orte aufsuchen, wohin ich nicht einmal einen Straßenköter mitnehmen möchte, geschweige denn eine Prinzessin. In ein paar Tagen zum Beispiel …«
»Von Ihrer bevorstehenden Reise weiß ich, Captain«, unterbrach Elizabeth ihn. »Um genau zu sein ist diese Reise der Anlass unserer kleinen Zusammenkunft.«
Erneut überschlugen sich Antons Gedanken, und erneut fügten sich Puzzlestücke zusammen. Bei solchen Gelegenheiten meinten Menschen, die ihn nicht kannten, dass seine Gedankenprozesse übermenschlich schnell abliefen. Anton hingegen hielt sich für einen langsamen Denker, nicht zu vergleichen mit dem quecksilbrigen Verstand seiner Geliebten Cathy. Doch weil er so methodisch und gründlich dabei war, alle möglichen Aspekte schon im Vorfeld zu durchdenken, durchschaute er, sobald er die letzte Schlüsselinformation erhielt, auch komplexe Zusammenhänge mit einer Geschwindigkeit, die nur wenige andere Menschen nachvollziehen konnten. Die Ladung vor die Königin war am Tag zuvor vollkommen unerwartet eingetroffen, und Anton hatte darauf auf die Art und Weise reagiert, auf die er in solchen Gelegenheiten immer reagierte – indem er Stunden damit verbrachte, alle möglichen Variablen zu wälzen, die vielleicht eine Rolle spielten.
Ein kleines Grinsen konnte er sich nicht verkneifen. »Sie haben also beschlossen, High Ridge mit dem Finger ins Auge zu stechen, hm? Gute Idee, Eure Majestät.« Aus dem Augenwinkel bemerkte er, dass sowohl der Haushofmeister als auch die beiden Offiziere im Raum ihn wütend anstarrten. Ein wenig verspätet ging ihm auf, dass es wahrscheinlich gegen das Protokoll verstieß, wenn ein bürgerlicher Spion der Königin zu ihrer machiavellistischen Verschlagenheit gratulierte.
Hm. Wahrscheinlich war es sogar ein ernsthafter Verstoß. Anton stellte indessen fest, dass es ihm egal war, und er sah keinen Grund, weiter auf dem Punkt herumzureiten.
»Ein ausgezeichneter Zug, wenn Sie meine Meinung interessiert, und zwar in mindestens dreifacher Hinsicht. Sie erinnern jeden daran, dass die Wintons Sklaverei verabscheuen und mindestens ebenso sehr Neokolonialismus im solarischen Stil. Sie treten der unangenehmen, gegen das Sternenkönigreich gerichteten Propaganda entgegen, die noch in den Köpfen der solarischen Bürgerlichen verankert ist – von denen es ungezählte Billionen gibt, auch wenn die Leute das anscheinend immer wieder vergessen –, und Sie schieben ganz raffiniert Cathy Montaignes Wahlkampagne an, ohne je offiziell für sie Stellung bezogen zu haben oder gar offiziell ihren Verweis aus der Gegenwart der Königin und dem Oberhaus zurückzunehmen – o ja, das ist verschlagen; gut gemacht, Eure Majestät.«
Die nächsten Worte donnerten aus ihm heraus wie ein Güterzug: »Ganz zu schweigen, dass es eine Tat der Gnade ist, High Ridge einen Finger ins Auge zu stechen. Mit den Feinheiten der Zweitreformierten kenne ich mich zwar nicht so gut aus, aber meiner Überzeugung nach sollten Sie allein schon deswegen am Ende ins Himmelreich vorgelassen werden.«
Er räusperte sich. »Wobei ich Eurer Majestät gegenüber nicht respektlos erscheinen will.«
Einen Moment lang war der Raum wie erstarrt. Sowohl die Königin als auch ihre Nichte saßen steif vor ihm und stierten ihn an. Der Haushofmeister schien kurz vor einem Herzinfarkt zu stehen, die beiden Offiziere ebenfalls. Die wachestehenden Soldaten überlegten sich offenbar, wie wahrscheinlich es sei, dass sie bald jemanden auf der Stelle festnahmen. Neben ihm schien seine Tochter Berry hin und her gerissen zwischen dem Drang, sich unter ihrem Stuhl zu verstecken, und eilends aus dem Raum zu fliehen.
Und dann brach Elizabeth Winton in Gelächter aus. Es war kein leises, vornehmes Lachen, sondern ein heiseres Prusten, wie es mehr in ein Varieté passen wollte als in einen königlichen Palast.
»Himmel, Sie sind gut!«, rief sie aus, als das Lachen verebbt war. »Ich habe zwei volle Tage gebraucht, um meinem … inneren Kreis diesen Gedanken einzubläuen.« Sie drückte den Unterarm ihrer Nichte knapp und liebevoll. »Außer Ruth natürlich.«
Die Erwähnung Ruths lenkte Antons Gedanken auf eben diese Variable, und er benötigte nicht mehr als zwei oder drei Sekunden, um auch den Rest zu ergründen. In groben Zügen zumindest. Was ihn an der Ladung der Königin am meisten verwundert hatte, war die Frage, welchen Grund sie hatte, um auch Berrys Erscheinen zu erbeten.
»Eure Majestät, es ist wahrscheinlich keine gute Idee«, sagte er abrupt. »Wo Ihre Nichte und Berry ins Spiel kommen, meine ich. Ich gebe zwar zu, dass der Gedanke einen gewissen Charme aufweist, weil es vermutlich keinen älteres Trick mehr gibt. Trotzdem …«
Indem er sich nachdrücklich zu Gedächtnis rief, dass es seine Monarchin sei, mit der er da sprach, gelang es Anton, die finstere Miene zu unterdrücken, die auf sein Gesicht treten wollte. »Charmant hin oder her, und egal, ob es funktionieren würde oder nicht – und ich möchte Eurer Majestät gegenüber nicht respektlos erscheinen –, aber auf keinen Fall werde ich zustimmen. Ich war Vater, bevor ich Offizier im Nachrichtendienst wurde, und ich hatte noch nie Mühe, die Reihenfolge meiner Prioritäten im Auge zu behalten.«
Erneut erstarrten die Gesichter des Haushofmeisters und der Offiziere. Elizabeth hingegen bedachte Anton nur mit einem langen, nachdenklichen Blick. »Nein, das stimmt«, stimmte sie ihm zu. »Einen schönes Tages müssen Sie mir einmal in allen Einzelheiten erzählen, was in Chicago passiert ist, aber ich weiß genug über die Affäre, um den Kern begriffen zu haben. Zwei Dreckschweine zwangen Sie sich für Ihre Vaterpflichten oder Ihre Laufbahn zu entscheiden, und Sie haben den beiden das Ganze ziemlich übel genommen.«
Anton sagte sich, dass man es normalerweise nicht als passend ansehe, wenn eine Monarchin ihren Botschafter in der mächtigsten Sternnation der Galaxis und einen ihrer ranghöchsten Admirale als ›Dreckschweine‹ titulierte. Nicht dass Elizabeth Winton sich darum irgendwelche Gedanken zu machen schien.
»Haben Sie überhaupt gezögert?«, fragte sie.
»Keine Sekunde.« Er zuckte ganz leicht die massigen Schultern. »Strandgutsammler ist gar kein übler Job, wenn einem nichts anderes übrig bleibt.«
»Gut. Ich glaube nämlich, dass ich am ehesten einem Mann trauen kann, der keine Angst davor hat, am Strand auf dem Trockenen zu sitzen, wenn er muss.«
Erneut zuckte er die Schultern. Diesmal sah es so aus, als schüttle er eine Last ab. »Das mag sein, Eure Majestät, aber ich bin trotzdem nicht einverstanden. Vielleicht ist es längst nicht so gefährlich – sehr wahrscheinlich sogar nicht –, aber wir sprechen hier immer noch von meiner Tochter. Und …«
Weiter kam er nicht. Anton hatte vergessen, dass auch Berry über eine rasche Auffassungsgabe verfügte. Vielleicht hatte sie nicht wie Anton die Gewohnheit, jede Situation systematisch zu analysieren, doch auch sie hatte sich gewundert, weshalb man sie ausdrücklich in die Ladung vor die Königin einschloss.
»Ach, das ist doch Kacke!« Sie errötete. »Ah … ’tschuldigung, Daddy … und, äh, tut mir wirklich leid, Eure Majestät. Das Wort, meine ich.«
Von der Nervosität, die das Mädchen zuvor beherrscht hatte, gab es keine Spur mehr. »Aber trotzdem ist es Ka … Blödsinn. Mein Leben gehört mir, Daddy, auch wenn ich erst siebzehn bin … Aber ich habe Prolong nicht so früh bekommen wie Ruth … äh, Prinzessin Ruth … Also sehe ich wahrscheinlich sogar ein bisschen älter aus als sie, und wer würde den Unterschied schon merken, weil du ja nie zugelassen hast, dass ein Bild von mir an die Öffentlichkeit kommt, weil du von Berufs wegen parano … – sehr vorsichtig bist, meine ich.«
Einen Augenblick lang glaubte Anton allen Ernstes, sie würde ihm sogar noch die Zunge rausstrecken. Hin und wieder hatte sie das schon getan. Doch Berry gelang es, daran zu denken, wo sie war, und sie richtete sich so graziös auf, wie man es als Siebzehnjährige vermag, und schniefte indigniert.
»Ich finde, ich wäre ein großartiges Double für die Prinzessin. Für mich wäre es sehr aufregend, das steht ja wohl fest, und sie käme endlich mal raus in die Welt.«
Ruth und sie tauschten ein Lächeln gegenseitiger Anerkennung. Anton blickte hilfesuchend die Königin an, doch Elizabeth grinste ihn nur an.
Er ließ die Schultern sinken. »Verdammt«, knurrte er.
2
Am nächsten Tag war Berry mit der Situation schon erheblich weniger zufrieden, denn sie musste zum Mount Royal Palace zurückkehren und sich in der königlichen Klinik melden.
Von Anfang an hatte Anton darauf bestanden und Elizabeth Winton schließlich überzeugen können, dass die ursprüngliche Idee der Königin, nämlich Berry als Ruths Double einzusetzen, nicht durchführbar sei. Oder genauer gesagt, dass sie nur kurz funktionieren könne und höchstwahrscheinlich negative politische Rückwirkungen nach sich ziehe.
»Heutzutage geht das nicht mehr so einfach«, argumentierte er. »Um den Austausch aufzudecken, braucht nur jemand eine DNA-Probe von einem der beiden Mädchen an sich zu bringen, und das wird früher oder später gelingen. Mit moderner Technik erhält man eine brauchbare Probe aus den Schweißspuren, die man auf einem Türknauf hinterlässt. Ja, gewiss, Berry ist auf Alterde geboren, sodass ihre DNA ebenso sehr ein Mischmasch ist wie die jedes Menschen in der ganzen Milchstraße. Ruth hingegen ist graysonitisch-masadanischer Herkunft, und diese genetische Variante hat so viele eindeutig bestimmbare Merkmale, dass sie mit Leichtigkeit zu identifizieren ist.«
Die Königin runzelte die Stirn. »Ich dachte, Sie wären einverstanden, Captain?«
Er schüttelte den Kopf. »Sie denken zu geradlinig. Sie brauchen überhaupt kein echtes Double, Eure Majestät. Sie brauchen nur eine Ablenkung. Zu keiner Gelegenheit – niemals – werden Sie oder ich oder sonst jemand, der direkt in die Affäre verwickelt ist, vortreten und sagen: ›Dieses Mädchen ist Ruth Winton und dieses Berry Zilwicki.‹ Sie brauchen nur bekannt zu geben, dass Ruth Winton Captain Anton Zilwicki und Professor W. E. B. Du Havel auf der Reise begleiten wird, die sie antreten, um der Familie und den Freunden des Märtyrers Hieronymus Stein das Beileid der Anti-Sklaverei-Liga auszusprechen. Ruth komme mit, um für das Haus Winton zu sprechen. Das ist alles. Irgendwo – aber nicht in einem Kommuniqué der Dynastie – erwähnen wir beiläufig, dass Captain Zilwicki auf der Reise von seiner Tochter Berry begleitet wird.«
Er blickte die beiden Mädchen an. »Berry stecken wir in die teuersten Klamotten, die wir finden können, und Ruth trägt das unförmige Teenagerzeug, das Berry gewöhnlich anhat, wenn sie nicht versucht, das Herrscherhaus zu beeindrucken. Das ich als Lumpen bezeichnen würde, wenn es nicht doppelt so teuer wäre wie gute Kleidung.« Er ignorierte das leichte Protestkeuchen seiner Tochter. »Bevor wir aufbrechen, lassen wir etwas durchsickern – gerade noch rechtzeitig für die Paparazzi. Während wir durch das Tor in den Abflugbereich wechseln, wird Berry neben mir gehen, gekleidet wie eine Prinzessin, und die Leibgardisten werden sich verhalten, als würden sie sie beschützen. Ruth kommt mit nonchalanter Miene hinterher.«
Elizabeths Gesicht leuchtete auf. »Ah, ich verstehe. Wir werden ihnen nicht sagen, dass Berry Ruth wäre und umgekehrt – niemandem sagen wir das. Wir lassen sie von selber auf diese Idee kommen.«
»Genau. Was die Sicherheit angeht, erfüllt das unseren Zweck. Es gestattet Ihnen aber auch, später vom Haken zu schlüpfen, wenn die Verwechslung auffliegt – und dazu kommt es irgendwann, machen Sie sich nichts vor. Wenn die Leute sich empören, dass die manticoranische Krone sich zu arglistiger Täuschung herablasse, können Sie achselzuckend entgegnen, es sei nicht Ihre Schuld, wenn die Reporter nachlässig recherchierten.«
Die Königin schüttelte den Kopf. »Ich stimme Ihren Argumenten zu, Captain, aber Sie übersehen eine substanzielle politische Komplikation. Die manticoranische Krone kann damit leben, wenn man ihr vorwirft, hinterlistig, verschlagen und raffiniert zu sein. Offen gesagt würde ich es genießen. Der Vorwurf, der mich wirklich treffen würde, wäre der, dass wir bereit sind, das Leben einer Bürgerlichen zu gefährden, um ein Mitglied des Königshauses zu schützen. Diesen Vorwurf könnte ich mir nicht leisten, und zurzeit schon gar nicht. Mehr als je zuvor stützt sich die Stärke der Krone heute auf die Ergebenheit des einfachen Volkes.«
Anton bestätigte ihr, wie zutreffend ihre Bemerkung sei, indem er leicht den Kopf neigte.
»Ich bin neugierig, Captain«, fuhr Elizabeth Winton fort. »Es ist schon richtig, Ihre Variante lässt mich vom Haken schlüpfen, falls unser kleines Manöver aufgedeckt wird. Dennoch sind wir uns beide darüber im Klaren, dass wir eine Bürgerliche benutzen, um eine Prinzessin zu schützen. Belastet Sie das nicht? Das hätte ich eigentlich erwartet, Captain, denn schließlich stammen Sie von Gryphon. Manticoranische Kronenloyalisten würden es ohne Zweifel mit Freuden tun, aber die Highlander sind ein … störrischer Menschenschlag.«
Anton grinste. »Ja, das sind wir, was? Der Grund, weshalb es mir nicht auf der Seele liegt, Eure Majestät, ist der, dass meine Tochter darauf bestanden hat.« Er blickte Ruth noch einmal an. Ihre Mutter wurde von einem Mann geschwängert, der seine Frauen als Leibeigene betrachtete. »Ich sagte, dass ich ein Vater sei, kein stinkender masadanischer Patriarch. Die können alle zur Hölle fahren.«
Ruths Wangen schienen ein wenig zu glühen, doch sie verzog keine Miene. Anton hatte seine Bemerkung ohne Hintergedanken gemacht, doch er begriff im gleichen Moment, dass er seine Position als einer der Helden der Prinzessin zementiert hatte. Ihm sank leicht das Herz. Ein anderer Mann hätte sich vielleicht an dem Gedanken gefreut, sich die Gunst des Königshauses zu erwerben. Anton Zilwicki – ›Daddy Dour‹, wie seine Tochter Ruth ihn wegen seiner mürrischen Strenge manchmal nannte – sah nur die Schwierigkeiten und Komplikationen, die ihm daraus entstanden.
Wenn ich mir überlege, wie einfach mein Leben mal gewesen ist. Ungebundener Witwer und unbekannter Nachrichtendienstoffizier der RMN, das war alles. Und jetzt? Meine Geliebte ist die berüchtigste Akteurin auf dem politischen Parkett des Sternenkönigreichs, und jetzt gieße ich auch noch Hofintrigen in den Cocktail!
»Wir können noch etwas tun, um die Chancen zu erhöhen, dass der Tausch so lange wie möglich unentdeckt bleibt«, fügte er hinzu. Kurz musterte er die Mädchen. »Vorausgesetzt, dass die beiden dazu bereit sind, natürlich – und, ohne Sie kränken zu wollen, Eure Majestät, dass Sie bereit sind, dafür zu bezahlen.«
Königin Elisabeth lachte glucksend. »Eine nanotechnische Umwandlung? Sie gehen wirklich großzügig mit dem Geldbeutel der Krone um, Captain Zilwicki!«
Anton gab keine Antwort, die über ein schmales Grinsen hinausging, was ihm wie eine bessere Erwiderung vorkam, als wenn er gesagt hätte: Sicher, es kostet ein kleines Vermögen – aber für Sie ist es nur ein Taschengeld.
Elizabeth musterte die beiden Mädchen ebenfalls. Sie wirkte ein wenig unschlüssig, obwohl Anton recht sicher war, dass sie nicht wegen der Kostenfrage zögerte. Bioskulptur wäre günstiger gewesen, doch Bioskulptur ging nur knapp bis unter die Haut – im wahrsten Sinne des Wortes –, und in diesem Fall wäre ein tiefer gehender Eingriff nötig. Obwohl Berry und Ruth, von Berrys dunkelbraunem und Ruths goldblondem Haar abgesehen, vom gleichen Typ waren, waren sie nicht gleich groß. Und während man sie beide niemals als untersetzt bezeichnet hätte, war Ruth merklich feinknochiger als Berry. Einem beiläufigen Beobachter wären die Unterschiede kaum aufgefallen, doch sobald jemand sich die Mühe machte, ihre Holobilder miteinander zu vergleichen, musste er sie sofort bemerken.
Es sei denn natürlich, die Unterschiede wurden umgekehrt, bevor die HD-Kameras sie je aufzeichneten.
Freilich hatte auch diese Methode ihre Nachteile, und Elizabeth Winton war sich ihrer eindeutig bewusst. Selbst wenn man beiseite ließ, dass es zuallermindest unangenehm für die Patientinnen wurde, wenn man die Operationen in der kurzen noch zur Verfügung stehenden Zeit durchführte, waren nanotechnische Körperabwandlungen selbst unter den besten Umständen verstörend. Zwar waren die Veränderungen leicht rückgängig zu machen, doch die meisten Leute störten sich sehr daran, wenn ihr Körper die Gestalt wechselte, während sie zusahen. Umso schlimmer, wenn die Probanden zwei sehr junge Frauen waren, deren Körperentwicklung durch das Prolong ohnehin verzögert wurde und die sich noch an die Körper gewöhnen mussten, die sie von Natur aus besaßen.
»Die Entscheidung liegt bei dir, Ruth – und natürlich auch bei Ihnen, Berry«, sagte die Königin. »Ich warne euch beide, spaßig wird das nicht.«
»Aber sicher machen wir es!«, piepste die Prinzessin augenblicklich.
Berry, der auffiel, dass Ruth Wintons Miene längst nicht so zuversichtlich wirkte, wie ihre Worte klangen, hatte einen Augenblick lang gezögert. Sie verstand nur sehr wenig von Nanotechnik, und mit deren Anwendung auf die menschliche Physis kannte sie sich noch weniger aus. Doch als die Prinzessin ihr einen still bittenden Blick zuwarf, war das Thema für sie erledigt.
»Sicher machen wir das«, stimmte sie zu und bemühte sich nach Kräften um einen selbstsicheren Ton. Und hoffte, dass ihre Miene nicht so leicht zu durchschauen wäre wie die Ruths.
Zu Berrys Erleichterung erwies sich die ›Klinik‹ als vollständig ausgestattetes, modernes Minikrankenhaus. Nicht ganz zu ihrer Erleichterung erwies sich Dr. Schwartz, die Ärztin, die sich nach ihrer Ankunft um sie kümmerte, als zwar sehr freundlicher, aber beunruhigend jugendlich wirkender Mensch. Nach ihrem Aussehen hätte Berry nicht für möglich gehalten, dass die Frau schon so alt war, um überhaupt die Universität abgeschlossen zu haben.
Zu ihrer völligen Bestürzung ließ die Ärztin selbst die grundlegendsten Methoden zur Patientenberuhigung vermissen.
»Wird es wehtun?«, hatte Berry sie nervös gefragt, während sie der Ärztin durch einen Korridor folgte, der übermäßig schmucklos und steril wirkte.
»Wahrscheinlich«, antwortete Dr. Schwartz unbekümmert. Sie bedachte Berry mit einem Lächeln, das weniger mitfühlend ausfiel, als es Berrys Meinung nach möglich gewesen wäre. »Was erwarten Sie? Eine komplette nanotechnische Körperabwandlung in nur vier Tagen!« Dr. Schwartz schüttelte den Kopf, als könnte sie die Torheit nicht fassen. »Wir erhöhen Ihre Körpergröße um fast einen ganzen Zentimeter, wissen Sie. Und die Prinzessin verkleinern wir um den gleichen Wert.«
Das Lächeln war definitiv nicht so mitfühlend, wie es hätte ausfallen sollen, fand Berry ärgerlich. Als sie hörte, was die Ärztin als Nächstes sagte, vertiefte sich dieser Eindruck.
»Es bleibt nicht aus, dass Sie Beschwerden empfinden, wenn wir Ihre Knochen auseinander nehmen und neu zusammensetzen. Veränderungen am Muskelgewebe sind nicht so schlimm, aber Knochenabwandlungen sind eine ganz andere Geschichte. Dennoch denke ich, dass Sie sehr viel schlafen werden.«
Fünf Sekunden später führte Dr. Schwartz Berry in ein täuschend unauffällig wirkendes Zweibettzimmer.
Ruth lag bereits im anderen Bett. Sie sah ein bisschen gelassener aus, als Berry zumute war, aber nur ein kleines bisschen. Berry fühlte sich eigenartig getröstet, als sie erkannte, dass die andere genauso nervös war wie sie.
»Nun gut, Ms Zilwicki«, sagte Dr. Schwartz energisch. »Wenn Sie sich das Nachthemd anziehen und ins Bett hüpfen würden, können wir mit den Vorbereitungen anfangen.«
»Ah … wie sehr wird das jetzt wehtun?«, fragte Berry, während sie sich anschickte, den Befehl zu befolgen. Es war, das räumte sie vor sich selbst ein, ein bisschen spät, um diese Frage noch zu stellen, doch Dr. Schwartz schien sie nichts auszumachen.
»Wie ich schon sagte«, entgegnete die Ärztin, »sind Modifikationen der Knochen stets mit Beschwerden verbunden. Mir ist natürlich klar, dass wir Arzte unsere Patienten stets ein wenig nervös machen, wenn wir mit Wörtern wie ›Beschwerden‹ um uns werfen, aber Sie sollten es wirklich nicht so sehen. Schmerz ist eine der effizientesten Methoden des Körpers, uns etwas mitzuteilen.«
»Wenn es Ihnen nichts ausmacht«, erwiderte Berry, »wäre es mir recht, wenn er mir so wenig mitteilen würde wie nur irgend möglich.«
»Ganz meine Meinung«, warf Ruth aus ihrem Bett ein.
»Nun, wir tun natürlich, was wir können, um die Beschwerden zu minimieren«, versicherte Dr. Schwartz ihnen. »Tatsächlich ist der Eingriff nicht besonders schwierig. Das Aufwändigste ist die korrekte Programmierung der Nanniten, und da wir die kompletten Krankenakten von Ihnen beiden vorliegen haben, ging es diesmal sehr zügig. Ich weiß noch, wie wir einmal einen Eilauftrag für den SIS erledigen mussten, ohne dass wir Zugriff auf die Krankenakte des Kerls hatten, auf den wir unsere Nanniten einstimmen sollten. Nun, das war eine Herausforderung! In Ihrem Fall allerdings …«
Sie machte eine lässige, abschätzige Geste, dann sah sie Berry mit einem Stirnrunzeln an, weil diese ihr offenbar nicht schnell genug die Kleider abstreifte und sich das Nachthemd überzog. Berry begriff, und die Ärztin nickte zufrieden, als sie sich sputete.
»In Ihrem Fall haben wir selbstverständlich alle Informationen, die wir brauchen«, fuhr Schwartz fort. »Ein Problem ist nur der Zeitfaktor. Sobald wir die Vorbereitungen an Ihnen vorgenommen haben, führen wir die Feinabstimmung der Nannys durch und injizieren sie Ihnen. Danach«, sagte sie mit einer Fröhlichkeit, die Berry bei sich ziemlich beängstigend fand, »werden die Nannys beginnen, Sie auseinander zu nehmen und wieder zusammenzusetzen. Wenn uns zwei Wochen zur Verfügung stehen würden, wäre es wahrscheinlich nicht schlimmer als eine, sagen wir, mittelschwere Grippe. Innerhalb des Zeitraums, den wir nutzen können, fällt die Umwandlung wohl leider ein wenig strapaziöser aus.«
Sie zuckte mit den Achseln.
»Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Sie in den kommenden Tagen sehr viel schlafen werden. Eine nanotechnische Abwandlung kostet sehr viel Körperenergie. Wir werden die Beschwerden mit Medikamenten lindern, aber wir müssen gleichzeitig Ihre Reaktionen auf die Modifizierungen überwachen können, und deshalb dürfen wir sie nicht mit stark wirksamen Mitteln verfälschen. Das gilt besonders, wenn die Veränderungen so rasch erfolgen sollen. Deshalb fürchte ich, dass Sie später nicht besonders gern an die Zeit zurückdenken werden, die Sie nicht schlafend verbringen.«
Sie lächelte wieder, erneut mit diesem aufreizenden Mangel an Mitgefühl; Berry seufzte bedrückt auf. Als sie sich unbekümmert freiwillig gemeldet hatte, war ihr die Sache erheblich unkomplizierter erschienen.
Nachdem sie sich das Nachthemd zugeknöpft hatte, hielt sie inne. Sie zauderte nicht etwa, das versicherte sie sich mit Nachdruck. Sie empfand jedoch etwas, das dem Zaudern unangenehm ähnlich war, und in der Nachbarschaft ihrer Leibesmitte schienen eine erkleckliche Anzahl von Schmetterlingen umherzuflattern.
»Aha, Sie sind so weit, wie ich sehe! Gut!«, lobte Dr. Schwartz sie und lächelte sie noch fröhlicher denn je an. Berrys Schmetterlingspopulation wuchs exponenziell an. »Dann wollen wir doch einfach anfangen, nicht wahr?«
Die nächsten Tage waren beträchtlich elender, als eine nichtsahnende Seele nach den unbeschwerten Zusicherungen der Ärztin angenommen hätte. Tatsächlich aber hatte Berry in ihrem Leben schon weit Schlimmeres durchgestanden. Diese Lebenserfahrung hatte Berry zu einer misstrauischen Seele gemacht, wie man sie argwöhnischer nicht fand, ohne dass sie ihre freundliche und wohlwollende Art verlor.
Bis auf Prinzessin Ruth.
Im Laufe dieser erbärmlichen Tage lernte Berry die manticoranische Royal recht gut kennen, denn wenn sie nicht gerade schliefen, hatten sie außer Reden nichts zu tun. Und während Berry rasch zu dem Schluss gelangte, dass sie Ruth gern haben würde – sehr sogar –, fand sie zugleich die Unterschiede zwischen ihren Persönlichkeiten mehr als nur ein wenig amüsant.
Einige dieser Unterschiede waren offensichtlich – Berry neigte dazu, still zu sein, Ruth zur Ausgelassenheit. Doch ein tiefer gehender Unterschied, der gleichwohl nicht sofort offensichtlich war, bestand in ihren unterschiedlichen Lebenseinstellungen. Gewiss, Berrys Lebenserfahrung hatte von ihrer kindlichen Unschuld nur furchtbar wenig übrig gelassen, doch sie pflegte trotzdem das Universum und seine Bewohner auf heitere Weise zu betrachten. Ruth allerdings …
›Paranoid‹ sei nicht der richtige Begriff dafür, entschied sich Berry schließlich. Dieses Wort umfasste Angst, Sorge, Verdrießlichkeit – wohingegen die Prinzessin ein denkbar lebhaftes Temperament besaß. Doch wäre die Fügung ›optimistischer Paranoiker‹ nicht ein albernes Oxymoron gewesen, so hätte sie Ruth sehr gut beschrieben. Für sie schien festzustehen, dass ungefähr die Hälfte aller lebenden Menschen nichts Gutes im Schilde führte, auch wenn dieses Wissen sie nicht sonderlich zu belasten schien – weil sie genauso sicher war, dass sie mit den verdammten Mistkerlen fertig würde, wenn sie versuchten, sich mit ihr anzulegen.
»Wie um alles in der Welt hat die Queen es eigentlich geschafft, dich dreiundzwanzig Jahre lang unter dem Deckel zu halten?«, fragte Berry schließlich.
Ruth grinste. »Weil ich ihr geholfen habe. Ungefähr als ich sechs war, habe ich begriffen, dass es besser ist, nicht im Rampenlicht zu stehen.« Sie streckte die Zunge heraus. »Ganz zu schweigen davon – bah –, dass ich dadurch nicht mehr eine Million Stunden bei langweiligen offiziellen Anlässen stillzusitzen und mich anzustrengen brauchte, wie eine Prinzessin auszusehen – was ›ungefähr so helle wie ein Esel‹ bedeutet.«
»Sind die Einzelheiten über die Flucht deiner Mutter deshalb so lange vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen gehalten worden?«
»O nein.« Ruth schüttelte nachdrücklich den Kopf. Ihre Gebärden fielen normalerweise immer nachdrücklich aus – wenn sie nicht vehement ausgeführt wurden. »Gib mir bloß nicht die Schuld an dieser Idiotie! Wenn sie mich gefragt hätten – haben sie aber nicht, weil ich erst ein paar Jahre alt war, aber sie hätten’s tun sollen –, dann hätte ich ihnen gesagt, sie sollen es von den Dächern brüllen. Aber so wurde die Wahrheit erst Allgemeinwissen, nachdem Jelzins Stern sich der Manticoranischen Allianz angeschlossen hatte, und die manticoranische Öffentlichkeit machte eine Nationalheldin aus meiner Mutter. Ha! Das Gleiche wäre von Anfang an passiert, auch vor der Unterzeichnung des Bündnisvertrages! Du kannst dir verdammt sicher sein, dass mit der nackten, ungeschminkten Wahrheit über die Brutalität, mit der auf Masada die Frauen behandelt werden, überhaupt nie die Frage gestellt worden wäre, ob man eher mit Grayson oder mit Masada ein Bündnis eingehen sollte.«
Sie runzelte grimmig die Stirn. »Und das ist natürlich auch genau der Grund, warum die Idioten es nicht getan haben. ›Staatsräson‹. Ha! In Wirklichkeit mussten die Bürokraten sich bei den geistig umnachteten Barbaren von Masada ›alle Möglichkeiten offen halten‹ – noch so eine schöne vage Phrase –, bis das Foreign Office sich ein für alle Mal entschieden hatte, das Bündnis mit Grayson zu suchen! Und deshalb musste natürlich die gesamte Episode unter den Teppich gekehrt werden.«
Berry lachte. »Mein Vater sagt, dass die ›Staatsräson‹ öfter missbraucht worden ist, um schiere Dummheit zu kaschieren, als jede andere fromme Phrase, die es gibt. Und wann immer Mommy – äh, Cathy Montaigne, meine ich – versucht, ihn zu etwas zu bewegen, das er nicht tun will, dann sagt er sofort, er will sich alle Möglichkeiten offen halten.«
»Und was sagt sie dann?«
»Oh, sie wirft ihm wieder an den Kopf, dass er sich wie eine Ratte windet. Und dann versucht sie immer, mich und Helen – wenn sie Urlaub von der Akademie hat – auf ihre Seite zu ziehen.«
Fromm fügte Berry hinzu: »Ich bin natürlich immer auf ihrer Seite. Keiner kann sich besser rausreden als Daddy. Helen beruft sich immer auf den Ehrenkodex der Akademie, der ihr angeblich verbietet, Position zu beziehen, und dann wirft ihr Mommy augenblicklich vor, sie würde sich ebenfalls herauswinden.«
Berry blickte nun vollkommen engelhaft drein. »Und selbstverständlich stimme ich ihr auch dann immer zu.«
Ruth beäugte sie merkwürdig. »He, sieh mal«, sagte Berry defensiv, »was wahr ist, ist wahr.«
Dann bemerkte sie, dass sie falsch verstanden hatte, was die Musterung durch die Prinzessin bedeutete.
»Wir werden Freundinnen sein«, sagte Ruth unvermittelt. »Dicke Freundinnen.«
Sie sagte es nachdrücklich, vehement sogar. Dennoch entging Berry nicht die Tiefe der Einsamkeit und Unsicherheit, die sich hinter den Worten verbargen. Ruth, da war sie sich nun sicher, hatte in ihrem Leben noch nicht viele enge Freundschaften gekannt.
Berry lächelte. »Aber sicher.«
Auch sie meinte es ernst. Berry verstand sich darauf, Freundschaften zu schließen. Insbesondere enge.
»Sir, bitte sagen Sie mir, dass Sie mich auf den Arm nehmen«, bat Platoon Sergeant Laura Hofschulte vom Queen’s Own Regiment kläglich.
»Ich wünschte, es wäre so, Laura«, seufzte Lieutenant Ahmed Griggs und lehnte sich in seinen Sessel, während er sich mit den Fingern durch das dichte, rötliche Haar fuhr. Sergeant Hofschulte war sein Zugfeldwebel, und sie dienten seit fast zwei T-Jahren zusammen. In dieser Zeit hatten sie einander gut kennen gelernt, und zwischen ihnen herrschte ein gegenseitig empfundener, tiefer Respekt. Diese Tatsache erklärte vermutlich den gequälten, ungläubigen Blick einer … – Verratenen war vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck, kam dem aber schon sehr nahe –, mit dem Hofschulte ihn nun ansah.
»Ich bin mir nicht sicher, wessen Idee das ist«, fuhr Griggs nach kurzem Zögern fort. »Colonel Reynolds machte auf mich den Eindruck, als stammte sie von Ihrer Majestät persönlich, aber mir klingt es mehr danach, als wäre das Ganze auf dem Mist der Prinzessin gewachsen.«
»Sie war es, oder vielleicht auch Zilwicki«, entgegnete Hofschulte finster. »Der Mann ist ein berufsmäßiger Spion, Sir. Gott allein weiß, in welch verdrehten Bahnen er mittlerweile denkt!«
»Nein, ich glaube nicht, dass er es war«, widersprach Griggs. »Wie Sie schon sagten, er ist ein berufsmäßiger Spion. Und ein Vater. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mann, der so beschützerisch ist, wie er sein soll, seine Tochter derart exponiert. Nicht, wenn die Idee von ihm stammt, heißt das.
Es spielt aber auch keine Rolle, wer es sich ausgedacht hat«, fuhr er forscher fort. »Wichtig ist nur, dass wir es in die Tat umsetzen müssen.«
»Nur um es noch einmal klarzustellen, Sir«, sagte Hofschulte. »Wir sausen als Leibwache der Prinzessin nach Erewhon, sollen es aber so aussehen lassen, als würden wir Berry Zilwicki beschützen, die jeder für die Prinzessin halten soll?«
»Genau.« Griggs grinste schief, als er das Gesicht sah, das sie zog. »Und vergessen Sie nicht, wie heikel unsere Beziehungen zu Erewhon im Augenblick sind. Ich bin mir sicher, dass man für unsere Bedürfnisse zwar sorgt, doch man ist auf Erewhon dermaßen sauer auf unsere Regierung, dass diese Zusammenarbeit sehr widerwillig ausfallen wird. Und von unseren Bedenken über die Nähe zu Haven werden sie sich auch nicht besonders beeindrucken lassen. Nicht nachdem die Hälfte ihrer Wähler glaubt, dass das Sternenkönigreich wegen rein innenpolitischer Vorteile willens ist, die ganze Allianz in die Tonne zu treten.«
Hofschulte nickte, doch ihre Miene zeigte ein wenig Unbehagen. Gewiss, die Treue des Queen’s Own Regiment gehörte ganz der Krone und der Verfassung, nicht dem Premierministeramt oder der jeweiligen Regierung des Sternenkönigreichs. Die Regimentsangehörigen hatten die Aufgabe, das Leben des Monarchen und der königlichen Familie um jeden Preis zu schützen, und man erwartete von ihnen, die Umstände ihrer Einsätze mit absoluter Gründlichkeit und vollkommener Offenheit zu besprechen. Man durfte auch dann die Dinge beim Namen nennen, wenn die Dummheit der Regierung oder der Tagespolitik das Erreichen des Hauptziels zu verkomplizieren drohte. Dennoch …
»Glauben Sie denn ernsthaft, die Erewhoner behindern unsere Interessen?«, fragte sie in nüchternerem Ton, und Griggs zuckte mit den Achseln.
»Eigentlich nicht«, antwortete er. »Ich erwarte aber etwas anderes: dass sie sich nicht gerade überschlagen, um zusätzliche Zusammenarbeit zu leisten, wie damals, als Prinzessin Ruths Vater Erewhon während des Krieges besuchte.« Er hob wieder die Schultern. »Kann man ihnen auch schwer verübeln. Selbst wenn man außer Acht lässt, wie oft wir ihnen in den letzten drei oder vier T-Jahren auf die Füße getreten sind, ist die Prinzessin ein viel unwahrscheinlicheres Ziel als der Herzog es war, und die Bedrohungsumstände dürften erheblich weniger extrem sein als damals.«
Hofschulte und er blickten einander grimmig an und erinnerten sich an die vielen Freunde und Kameraden, die an Bord der königlichen Jacht umgekommen waren, als während des königlichen Staatsbesuchs auf Grayson der Mordanschlag auf die Queen verübt wurde.
»Nun, das ist wohl wahr genug, Sir«, stimmte Hofschulte dem Lieutenant nach einem Augenblick zu. »Andererseits, der Herzog war nicht die Prinzessin, wenn ich das so sagen darf. Er war verdammt noch mal viel leichter zu beschützen als wahrscheinlich sie.«
»Das weiß ich«, stimmte Griggs ihr missgelaunt zu. Eigentlich war Ruth bei den Leibwachedetachements der königlichen Familie recht beliebt. Jeder mochte sie gern, sie war stets fröhlich, und sie behandelte – wie die meisten Wintons, sei es von Geburt oder durch Adoption – die Uniformierten, die dafür verantwortlich waren, ihr Leben zu schützen, niemals von oben herab. Unglücklicherweise wusste die Abteilung auch alles über den Ehrgeiz der Prinzessin, eine Geheimdienstkarriere einzuschlagen. Anton Zilwickis Gegenwart unterstrich diese Absicht, und in einer Situation, die politisch so heikel war wie das Stein-Begräbnis, mit Aktivisten der Anti-Sklaverei-Liga auf Du und Du zu verkehren, konnte Auswirkungen haben, über die kein geistig gesunder Leibwachenkommandant gern nachdachte. Vor allem aber …
»Wie alt ist Ms Zilwicki, sagten Sie, Sir?«, fragte Hofschulte, und Griggs lachte säuerlich auf über diesen Beweis, dass sie in genau den gleichen Bahnen dachte wie er.
»Siebzehn«, sagte er und sah, wie der weibliche Sergeant zusammenzuckte.
»Wundervoll … Sir«, brummte sie. »Ich hatte irgendwie gehofft, sie könnte vielleicht … nun ja, einen zügelnden Einfluss auf die Prinzessin ausüben«, fügte sie recht hilflos hinzu.
»Ja, es wäre schön, wenn das jemand könnte«, seufzte Griggs. Ruth Winton war eine wunderbar nette junge Frau mit einem großartigen angeborenen Gefühl für Anstand. Außerdem hatte sie aufgrund der Art und Weise, wie die königliche Familie zu ihrem Schutz die Reihen geschlossen hatte, und ihrer eigenen intensiven Konzentration auf Themen, die für sie von besonderem Interesse waren, ein sehr behütetes Leben geführt. Sie war in vielerlei Hinsicht ein Mensch, den man in früheren Zeiten als Fachidioten bezeichnet hatte: ein brillanter, talentierter, gebildeter, unglaublich tüchtiger und gut angepasster Fachidiot, aber ein Fachidiot und – auch das in vielerlei Hinsicht – ungewöhnlich jung für ihr Alter.
Und niemand, der sie kannte, zweifelte auch nur einen Augenblick, dass sie bereits jetzt Pläne schmiedete, wie sie das Beste aus ihrer Flucht vom Mount Royal Palace an einen Ort schlug, der so … interessant war wie Erewhon.
Der einzige wirkliche Unterschied zwischen ihr und der kleinen Zilwicki besteht darin, dass Königliche Hoheit in den sechs T-Jahren, die sie ihr voraushat, nur noch verschlagener und raffinierter geworden ist, sobald es um das Umgehen von Vorschriften geht, dachte er finster. Auf jeden Fall hat die Familie nichts unternommen, um ihre Abenteuerlust ein bisschen zu dämpfen, verdammt noch eins.
»Na, wenigstens haben wir Captain Zilwicki dabei, der die beiden schon im Zaum halten wird«, stellte er im Tonfall entschlossenen Optimismus fest.
»Ach ja, da fühle ich mich gleich viel besser, Sir«, erwiderte Hofschulte schnaubend. »Verbessern Sie mich, falls ich mich irre, aber ist das nicht der Kerl, der hinging und den Audubon Ballroom mobilisierte, als er außer der Reihe ein paar Schläger brauchte?«
»Nun … ja«, gab Griggs zu.
»Wundervoll«, wiederholte Hofschulte und schüttelte den Kopf. Doch dann, plötzlich, grinste sie.
»Wenigstens wird uns nicht langweilig, Sir.«
»Langeweile ist ganz gewiss das Eine, um das wir uns keine Sorgen machen müssen«, stimmte Griggs ihr mit einem weiteren Auflachen zu. »Ich denke vielmehr, für diesen Einsatz verdienen wir alle das Fauchende Kätzchen, Sergeant. Wir hüten die Prinzessin, dann eine Siebzehnjährige, die so tut, als wäre sie die Prinzessin, einen Intellektuellen aus der Anti-Sklaverei-Liga und den berüchtigsten ehemaligen Geheimdienstler des Sternenkönigreichs, alle genau in dem Fadenkreuz, das die Stein-Beerdigung auf einem Planeten wie Erewhon sein wird?« Er schüttelte den Kopf. »Zeit fürs Fauchende Kätzchen, das steht fest.«
»Ich will’s nicht hoffen, Sir!«, erwiderte Hofschulte lachend.
Das ›Fauchende Kätzchen‹, so nannte man im Queen’s Own Regiment das Adriennekreuz. Der Orden war von Roger II. gestiftet worden, um Angehörige der Queen’s Own zu ehren, die ihr Leben riskierten – oder verloren –, um einem anderen Mitglied der königlichen Familie als dem Monarchen das Leben zu retten. Das Kreuz zeigte eine fauchende Baumkatze (dem Gerücht zufolge hatte der ’Kater der damaligen Kronprinzession Adrienne, Dianchect, Modell gesessen), und in den zweihundertfünfzig T-Jahren, seit es ins Leben gerufen worden war, hatten elf Personen es erworben. Neun davon waren posthum ausgezeichnet worden. Natürlich, überlegte der Lieutenant, würden sie bei dieser Reise nicht alle ums Leben kommen. Es käme ihnen nur so vor.