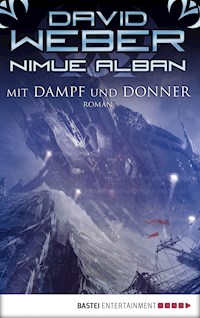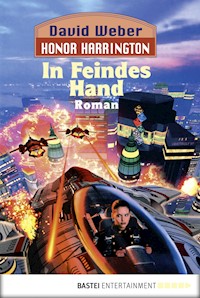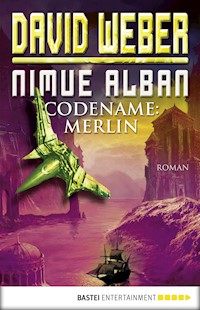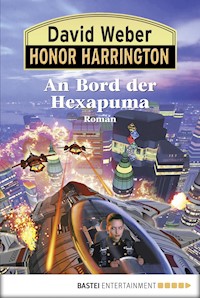9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Honor Harrington
- Sprache: Deutsch
Queen Berry, die Königin vom jüngst befreiten Sklavenplaneten Torch, ist in Gefahr. Anscheinend haben es Attentäter auf sie abgesehen. Jeremy X stellt ihr einen Sicherheitsoffizier an die Seite, der sie beschützen soll. Keine leichte Aufgabe - vor allem nicht bei einer jungen Monarchin, die so gar nichts davon hält, bewacht zu werden...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 664
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
David Weber
DIE FACKELDER FREIHEIT
Aus dem Amerikanischen vonUlf Ritgen
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
© 2009 by David Weber
Titel der Originalausgabe: »Torch of Freedom« (Teil 2)
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2011/2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
This work was negotiated through
Literary Agency Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen,
on behalf of St. Martin's Press, L. L. C.
Textredaktion: Uwe Voehl
Lektorat: Ruggero Leò
Titelillustration: © Arndt Drechsler, Regensburg i. NB
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München
E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN: 978-3-8387-0494-4
Sie finden uns im Internet unterwww.luebbe.de
Bitte beachten Sie auch: www.lesejury.de
Für Lucille und Sharon – dafür,dass sie es mit uns aushalten …immer noch.
Kapitel 1
»Es wird schwieriger, Jack.« Im Besuchersessel in Jack McBrydes Küche lehnte sich Herlander Simões zurück und schüttelte den Kopf. »Man sollte doch glauben, es würde entweder irgendwann nicht mehr schmerzen, oder dass ich mich daran gewöhne. Oder ich endlich den nächsten Schritt mache und einfach aufhöre daran zu denken.« Er entblößte die Zähne zur bitteren Parodie eines Lächelns. »Ich habe immer gedacht, ich sei ein ganz helles Bürschchen, aber offensichtlich habe ich mich getäuscht. Wenn ich wirklich so verdammt helle im Kopf wäre, dann wäre es mir wohl mittlerweile gelungen, wenigstens eines davon zustande zu bringen.«
»Ich wünschte, ich könnte dir irgendeinen Zauberspruch verraten, Herlander.« McBryde öffnete eine weitere Bierflasche und schob sie seinem Gast hin. »Und ich will ganz ehrlich zu dir sein: Manchmal möchte ich dir einfach nur kräftig in den Hintern treten.« In seinem eigenen Lächeln lag wenigstens eine Spur echter Belustigung, und auch er schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, ob ich eher darüber sauer bin, wie du dich immer weiter damit quälst, oder darüber, wie das dein ganzes Leben ruiniert, nicht bloß deine Arbeit.«
»Ich weiß.«
Simões griff nach dem Bier und nahm einen tiefen Zug aus der Flasche. Dann stellte er sie wieder auf den Tisch und umschloss sie mit beiden Händen, sodass seine Daumen und Zeigefinger sich berührten. Einen Moment lang starrte er seine Hände an. Seine Miene wirkte dabei sehr nachdenklich.
»Ich weiß«, wiederholte er und blickte wieder McBryde an. »Ich habe bereits versucht, meinen Zorn zu überwinden, genau wie du gesagt hast. Manchmal glaubte ich sogar, ich würde es schaffen. Aber dann taucht immer irgendetwas Neues auf.
»Schaust du dir immer noch nachts diese Holos an?« McBrydes Stimme klang jetzt sehr sanft, und Simões’ Schultern schienen herabzusinken, obwohl er sich keinen Millimeter bewegt hatte. Wieder starrte er auf die Bierflasche; seine haselnussbraunen Augen hatten sich erneut in Jalousien verwandelt. Kurz nickte er.
»Herlander«, sagte McBryde leise. Simões blickte ihn an, und Jack schüttelte erneut den Kopf. »Damit bringst du dich doch bloß um. Und das weißt du genauso gut wie ich.«
»Ja, vielleicht.« Simões holte tief Luft. »Nein, nicht ›vielleicht‹ – ja, es ist so. Sogar meine offizielle Therapeutin weiß das. Aber ich … ich kann einfach nicht anders, Jack! Es ist, als wäre sie, solange ich nur immer wieder diese Holos anschaue, nicht wirklich fort.«
»Aber sie ist es, Herlander.« McBrydes Stimme war ebenso gnadenlos wie sanft. »Und Harriet auch. Und bald auch dein ganzes verdammtes Leben, wenn du dich davon immer weiter runterziehen lässt.«
»Manchmal frage ich mich, ob das wirklich eine so schlechte Idee ist«, gestand Simões leise ein.
»Herlander!« Dieses Mal klang McBrydes Stimme sehr scharf, und wieder hob Simões den Kopf.
Schon komisch, dachte McBryde, als sie einander in die Augen blickten. Unter gewöhnlichen Umständen wäre es ein Verstoß gegen jegliche Regeln des Alignment-Sicherheitsdienstes gewesen, einen der Wissenschaftler, für deren Sicherheit er verantwortlich war, als Gast in seinem eigenen privaten Appartement willkommen zu heißen. Und besagter Wissenschaftler war ihm sogar erstaunlich schnell zu einem echten Freund geworden. Ja, das war wirklich ein Verstoß gegen sämtliche Regeln … nur dass immer noch die Anweisung galt, die Isabel Bardasano persönlich Jack erteilt hatte.
Zunächst hatte Jack gewisse Vorbehalte gehegt, als er diese Anweisungen erhalten hatte – und in mancherlei Hinsicht war dem immer noch so, vielleicht sogar noch mehr als zu Anfang. Zum einen war seine Beziehung zu Simões wirklich zu so etwas Ähnlichem wie echter Freundschaft geworden, und Jack wusste, dass das aus ach so vielerlei Gründen überhaupt nicht gut war. Jemanden, der eigentlich nur eine einzige Verkörperung unbändiger Qual war, zu seinem Freund zu machen war so ziemlich die beste Methode, den eigenen Seelenfrieden gründlich zu ruinieren. Selbst mitempfinden zu müssen, was man Herlander Simões und seiner Tochter angetan hatte, war sogar noch schlimmer, vor allem, wenn man bedachte, wie das zu seinem Zorn beitrug … und die abwegigen Denkpfade, auf die ihn das führte. Und selbst wenn man all das einfach außer Acht ließe, war Jack sich doch nur zu deutlich bewusst, dass seine Objektivität – seine professionelle Objektivität, die niemals zu verlieren, auch nicht im Hinblick auf Simões, er sich und anderen geschworen hatte – gänzlich zerstört war. Was zunächst lediglich Gehorsam einer Weisung gegenüber gewesen war – nur die pflichtschuldige Bemühung, einen wissenschaftlichen Aktivposten funktionsfähig zu halten –, hatte sich nach und nach in etwas gänzlich anderes verwandelt.
Auch Simões war sich dessen bewusst. Es war sonderbar, aber in mancherlei Hinsicht hatte die Tatsache, dass McBryde zunächst auf gänzlich pragmatischem Wege versucht hatte, Simões’ Nützlichkeit für das Gamma Center zu bewahren, es dem Hyperphysiker sogar leichter gemacht, sich ihm gegenüber zu öffnen. McBryde war der Einzige, der nicht mit der Erklärung angefangen hatte, alles was er tue, geschehe doch nur zu Simões’ ›eigenem Besten‹, und das hatte Simões dazu gebracht, diesem Mann gegenüber seine Deckung aufzugeben. Es gab Momente, in denen sich McBryde fragte, ob in Simões’ Einstellung ihm gegenüber nicht zumindest ein Funken Selbstzerstörungswut liege – er würde irgendetwas sagen oder tun oder preisgeben, was McBryde dazu zwingen würde, ihn aus dem Center herauszuwerfen.
Doch wie auch immer seine verworrenen Emotionen, seine Einstellungen, seine Motive und seine Hoffnungen auch geartet sein mochten: Jack McBryde war der Einzige in der ganzen Galaxis, zu dem Herlander Simões gänzlich offen zu sein bereit war. Zugleich war er auch der Einzige, der es wagen konnte, Simões für irgendetwas zurechtzuweisen – beispielsweise für seine selbstzerstörerische Neigung, sich jeden Abend aufs Neue Aufzeichnungen von Francesca anzusehen –, ohne sich damit sofort augenblicklich Simões’ selbstverteidigenden Zorn zuzuziehen.
»Seien wir doch ehrlich, Jack«, sagte der Wissenschaftler jetzt und verzog die Lippen zu einem schiefen Grinsen. »Früher oder später wirst du zu dem Schluss kommen, es sei an der Zeit, mich von der Arbeit abzuziehen. Du weißt genauso gut wie ich, dass meine Effizienz immer weiter sinkt. Und ich bin auch nicht gerade eine Stimmungskanone, wenn es um die Moral des restlichen Teams geht, oder? Was meine Emotionen angeht, so sind sie nicht einmal mehr aktiv zerstörerisch. Wirklich, eigentlich sind sie das nicht mehr. Da ist bloß noch dieses langsame, schleifende, allmähliche Aufzehren. Ich bin so gottverdammt müde, Jack. Ein ziemlich großer Teil von mir will einfach nur noch, dass es aufhört. Aber da ist auch dieser andere Teil, der einfach nicht aufhören kann, denn wenn ich das tue, dann wird Frankie einfach für immer fort sein, und diese Mistkerle werden weitermachen, als wäre nichts gewesen, und sie ganz und gar vergessen. Die werden das Ganze einfach unter den Teppich kehren.«
Bei den letzten beiden Sätzen klang seine Stimme unendlich verbittert, und seine Finger verkrampften sich um die Bierflasche, als wolle er sie zerquetschen. Als wolle er sie erwürgen, schoss es McBryde durch den Kopf und fragte sich, ob er versuchen solle, Simões von seinem Zorn abzulenken.
Er wusste, dass er sich unbedingt mit der Therapeutin zusammensetzen sollte, die man dem Wissenschaftler zugewiesen hatte. Jack sollte ihr mitteilen, was er bislang in Erfahrung gebracht hatte und sie um Rat fragen, wie er auf Simões reagieren sollte, damit es möglichst konstruktiv wäre. Bedauerlicherweise konnte Jack das nicht tun. Zu seiner eigenen Überraschung lag es zum Teil daran, weil es für ihn ein Vertrauensbruch gegenüber Simões gewesen wäre. Was auch immer er zu diesem Mann bei ihrem allerersten Gespräch hinsichtlich seiner Privatsphäre gesagt hatte, bislang hatte er sie gewahrt und niemals verletzt – und er vermutete, dies sei Simões durchaus bewusst.
Der andere Grund war noch deutlich erschreckender, wenn Jack sich selbst gestattete, sich damit zu befassen (was er so selten wie nur irgend möglich tat): Er hatte Angst. Er hatte Angst, er könne, wenn er über Simões’ Denkart und Zorn sprach, nur allzu viel seiner eigenen Gedanken verraten … insbesondere im Gespräch mit einer ausgebildeten Therapeutin im Dienste des Alignments, die bereits darüber nachdachte, welches potenzielle Risiko ihr Patient wohl darstellen mochte.
Soll ich versuchen, ihn von diesem Zorn abzubringen, oder soll ich ihm einfach gestatten, ein bisschen Dampf abzulassen? Zumindest einen Teil dieses gewaltigen Druckes muss er loswerden, aber so richtig helfen tut das ja auch nicht, oder? Innerlich schüttelte McBryde den Kopf. Natürlich nicht. Es ist, als würde jedes Mal, wenn er etwas Druck ablässt, auf diese Weise nur noch mehr neuer Sauerstoff hereingelassen. Und dieser Sauerstoff sorgt dafür, dass das Feuer letztendlich nur noch umso heftiger lodert.
»Du lässt Fabre und dem Rest immer noch keine Ruhe, oder?«, fragte er schließlich.
»Du bist doch der Sicherheitsexperte«, gab Simões sofort zurück, doch in seiner Stimme schwang nur ein Hauch Zorn mit. »Du liest doch jetzt schon sämtliche meiner E-Mails und Memos und dergleichen, oder etwa nicht?«
»Na ja … ja«, gab McBryde zurück.
»Dann weißt du die Antwort auf die Frage doch schon, nicht wahr?«, forderte Simões ihn heraus.
»Eine Frage wie diese nennt man in Gesprächen eine ›einleitende Bemerkung‹«, erwiderte McBryde mit ein wenig Nachdruck. »Eine Methode, einen wichtigen Gesprächspunkt aufs Tapet zu bringen, dabei aber immer noch ein Mindestmaß an Takt beizubehalten.«
»Oh.« Kurz wandte Simões den Blick ab, dann zuckte er mit den Schultern. »Naja, dann … jou. Ich lasse sie immer noch … wissen, wie ich darüber denke.«
»Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie allmählich zumindest eine grobe Vorstellung davon haben dürften«, erwiderte McBryde trocken, und Simões überraschte sie beide damit, dass er kurz auflachte. Es war ein raues Lachen, aber immerhin war es echt.
Trotzdem war das Thema eigentlich gar nicht dazu angetan, zum Lachen zu reizen. Simões hatte noch nicht ganz den Punkt erreicht, an dem er in seinen E-Mails, die er Martina Fabre zweimal wöchentlich sandte, Drohungen ausstieß, doch das Ausmaß seines Zorns – seines Hasses, um ein ehrlicheres und treffenderes Wort dafür zu verwenden – war zwischen den Zeilen lesbar. Tatsächlich hatte McBryde Fabre heimlich geraten, zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Wäre der Mann, der diese Nachrichten verschickte, auch nur einen Deut weniger wichtig für die militärische Forschung des Alignments gewesen, dann hätte man ihn womöglich schon längst festgenommen. Zumindest ihn unter zusätzliche Überwachung gestellt, aus reiner Vorsicht … nur dass er natürlich bereits längst unter zusätzlicher Überwachung stand.
Das Ganze hat eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Erdrutsch, den man sich in Zeitlupe ansieht, dachte McBryde. Und in mancherlei Hinsicht machten Simões’ schiere Brillanz, seine geistige Beweglichkeit, sein Konzentrationsvermögen und seine Sturheit, die ihn zu einem der wichtigsten Forscher des Alignments machten, alles nur noch schlimmer. Ob er nun wollte oder nicht, der Hyperphysiker führte seine Kampagne, Fabre und den Mitgliedern des Ausschusses für Langfristige Planung deutlich seinen Hass und seinen Ärger wissen zu lassen, mit dem gleichen konzentrierten Unwillen, der ihn auch ansonsten auszeichnete. In gewisser Hinsicht war diese Kampagne alles, was ihn noch zusammenhielt, das Einzige, was ihm noch Antrieb verlieh – und den Willen –, sich weiterhin der Wüstenlandschaft zu stellen, in die sich der Rest seines Lebens verwandelt hatte.
Doch nicht einmal das reichte aus, um den schleichenden Zusammenbruch aufzuhalten. Es geschah nicht über Nacht. Das Schicksal war dazu nicht gnädig genug. Doch trotz aller Bemühungen, Herlander Simões zu retten, verfiel der Wissenschaftler innerlich immer weiter, langsam aber unaufhörlich. Es war ihnen lediglich gelungen, diesen Verfall zu verlangsamen, und Simões’ Therapeutin gestand McBryde auch zu, dass er den Löwenanteil dabei geleistet hatte.
Ich glaube nicht, dass irgendetwas ihn aufhalten kann, dachte McBryde düster. Ich denke, er wird von seiner eigenen Unfähigkeit angetrieben, irgendetwas zu erreichen. Ich habe diese E-Mails gelesen, deswegen weiß ich ganz genau, was er Fabre geschrieben hat. Und wäre ich an ihrer Stelle, hätte ich schon längst verlangt, Simões in Vorbeugehaft zu nehmen. Und als Mitglied des ALP bekommt sie immer, was sie verlangt. Ich frage mich, warum sie es noch nicht getan hat! Natürlich ist es durchaus möglich, dass er ihr einfach leidtut. Dass sie sich tatsächlich dafür verantwortlich fühlt, die Umstände geschaffen zu haben, die jetzt sein ganzes Leben zerstören. Aber er hat so viel Zorn in sich, irgendjemanden für das zu strafen, das seiner Tochter widerfahren ist – jemand anderen als sich selbst, oder vielleicht noch zusätzlich zu sich selbst. Eines Tages wird er versuchen, sie umzubringen, oder jemand anderen aus dem Ausschuss. Und das wird dann das Ende sein.
Wenn dieser Tag irgendwann käme, das wusste McBryde, wäre es seine Aufgabe, Simões aufzuhalten – und dieses Wissen nagte an ihm. Es nagte an seinem Mitgefühl und an seinen eigenen Zweifeln.
Denn in Wahrheit hat Bardasano tatsächlich Recht damit, wie rasch Prometheus näher rückt, dachte er. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass es noch zu meinen Lebzeiten so weit kommen würde – was ziemlich dumm von mir war, wenn man bedenkt, wie jung ich noch bin und wie viel ich darüber weiß, was unter den verschiedenen Schalen der ›Zwiebel‹ tatsächlich abgelaufen ist. Aber wir arbeiten schon so lange auf diesen Moment hin, dass ich rein emotional niemals begriffen habe, ich könne derjenige sein, der es wirklich miterleben wird. Und jetzt weiß ich, dass es so sein wird … und Herlander hat jeden einzelnen Zweifel aufgeführt, von dessen Existenz ich bislang nicht einmal selbst richtig gewusst habe, nicht wahr?
Wie viele weitere ›Herlanders‹ wird der Ausschuss noch erzeugen? Wie viele Menschen – und bloß weil sie ›Normale‹ sind, heißt das noch lange nicht, sie wären keine Menschen, verdammt noch mal! – werden sich selbst früher oder später in genau der Situation vorfinden, in der jetzt Herlander steckt? Verflucht, wie viele Millionen oder Milliarden Menschen werden wir letztendlich töten müssen, einfach nur, damit der Ausschuss für Langfristige Planung die ganze Menschheit in das Hochland genetischer Überlegenheit führen kann? Und inwieweit sind wir wirklich bereit, uns der Herausforderung zu stellen, die Leonard Detweiler uns entgegengeschleudert hat: jedes einzelne Mitglied der menschlichen Spezies zum Gipfel seiner Leistungsfähigkeit zu treiben? Werden wir das wirklich tun? Es wird natürlich immer noch ein paar Gamma-Linien geben. Es ist doch ganz offensichtlich, dass wir ohne die nicht auskommen werden, oder? Dafür werden wir reichliche Gründe finden, und einige dieser Gründe werden sogar stichhaltig sein! Aber was ist mit den Sklaven von Manpower? Werden wir die wirklich wie unseresgleichen behandeln … abgesehen von der unerfreulichen Notwendigkeit natürlich, dass wir bestimmen müssen, welche Kinder zu haben man ihnen zugestehen wird? Angenommen, natürlich, ihre Chromosomen sind hinreichend vielversprechend, dass man ihnen überhaupt gestatten wird, Kinder zu haben. Und wenn wir sie nicht wie unseresgleichen behandeln – und du weißt verdammt genau, dass das nicht geschehen wird! –, werden die Kinder, die wir ihnen zugestehen, niemals über die Stufe Gamma hinauskommen? Und wer zur Hölle sind wir, dass wir uns anmaßen, einer ganzen Galaxis zu sagen, alles müsse so laufen, wie wir das sagen? Ist das nicht genau das, was uns so lange an Beowulf gestört hat? Weil diese scheinheiligen Mistkerle darauf beharrt haben, wir könnten unsere Sachen nicht so machen, wie wir das wollten? Weil sie uns gesagt haben, was wir tun sollten? Denn genau darauf läuft es letzten Endes hinaus, wie hehr die Motive auch sein mögen, die wir uns selbst zuschreiben.
Mehrere Sekunden lang starrte er nur die Bierflasche an, die vor ihm auf dem Tisch stand, dann hob er den Kopf wieder und blickte Simões in die Augen.
»Weißt du, Herlander«, sagte er im beiläufigen Gesprächston, »es werden genau diese Schreiben an Fabre sein, die dir letztendlich den Boden unter den Füßen wegziehen. Das ist dir doch auch klar, oder?«
»Jou.« Simões zuckte mit den Schultern. »Aber ich werde ihr das nicht einfach so durchgehen lassen, Jack. Vielleicht kann ich ja wirklich nichts tun, was sie davon abhalten würde, genau das Gleiche mit einer weiteren Frankie zu machen, und vielleicht kann ich auch nichts tun, um … um es dem System heimzuzahlen. Ach verdammt, ich nehme sogar hin, dass ich das nicht kann! Aber ich kann wenigstens dafür sorgen, dass sie weiß, wie wütend ich bin, und auch, warum das so ist. Und ihr genau das zu sagen ist der einzige Trost, den ich wohl überhaupt noch habe, oder nicht?«
»Ich weiß zufälligerweise, dass es in dieser Küche hier keine Überwachungsgeräte gibt.« McBryde lehnte sich in seinem Sessel zurück, und sein Tonfall klang beinahe schon humorig. »Aber gleichzeitig solltest du zumindest darüber nachdenken, ob es wirklich ratsam ist, jemandem vom Sicherheitsdienst gegenüber zu erzählen, dass du ›es dem System heimzahlen‹ willst. Bei uns in der Branche nennt man das eine ›unverhohlene Drohung‹.«
»Und du hast nicht schon vorher gewusst, dass ich so denke?« Simões lächelte ihn allen Ernstes an! »Außerdem bist du der Einzige, dem ich so etwas sagen und mich dann darauf verlassen kann, dass es nicht dem Sicherheitsdienst gemeldet wird. Abgesehen davon sollst du doch dafür sorgen, dass ich so lange wie irgend möglich noch schön in der Spur bleibe. Also denke ich mir, du wirst mich nicht als Sicherheitsrisiko melden – mit so einem Schritt würdest du deine Vorgesetzte wohl gewaltig überraschen, könnte ich mir denken –, solange du aus mir auch nur ein bisschen anständige Arbeit für das Center herausholen kannst.«
»Du weißt, dass da nicht mehr alles so nach dem alten Fahrplan läuft, oder, Herlander?«, fragte McBryde mit leiser Stimme nach, und einen Moment lang hob der Hyperphysiker den Blick und schaute ihm in die Augen.
»Jou«, bestätigte Simões nach kurzem Schweigen, und auch er sprach sehr leise. »Jou, das weiß ich, Jack. Und« – wieder lächelte er, doch dieses Lächeln hätte selbst einer Statue das Herz brechen können – »ist das nicht wirklich eine tolle Galaxis, wenn der einzige echte Freund, den ich überhaupt habe, mich über kurz oder lang als unannehmbares Sicherheitsrisiko festnehmen muss?«
Kapitel 2
»Ich denke, wir sollten mit Admiral Harrington reden«, sagte Victor Cachat. »Und das so schnell wie möglich – also werden wir sie da aufsuchen, wo sie sich derzeit aufhält, und keine Zeit darauf verschwenden, für ein Treffen auf neutralem Grund und Boden zu sorgen.«
Anton Zilwicki starrte ihn an. Thandi Palane tat es ihm gleich.
Und ebenso die anderen: Queen Berry, Jeremy X, Web Du Havel und Prinzessin Ruth.
»Und da heißt es, ich sei völlig verrückt!«, rief Ruth aus. »Victor, das ist unmöglich!«
»Es heißt, Harrington befinde sich bei Trevors Stern«, erklärte Zilwicki. »Um genau zu sein, hat sie das Kommando über die Achte Flotte inne. Was glaubst du denn, wie die Chancen stehen, dass sie zustimmt, einen havenitischen Agenten an Bord ihres Flaggschiffes zu lassen?«
»Eigentlich sogar ziemlich gut, wenn alles, was ich bislang über sie erfahren habe, wirklich den Tatsachen entspricht«, gab Victor zurück. »Ich mache mir eher Gedanken darum, wie ich Haven davor schützen kann, aus mir irgendwelche Informationen herauspressen zu lassen – für den Fall, dass sie die harte Tour fahren will.«
Er warf Zilwicki einen Blick zu, den man mit dem Wort ›verletzt‹ beschrieben hätte – wenn es um eine andere Person als Victor gegangen wäre. »Ich möchte darauf hinweisen, dass ich der Einzige bin, der hier irgendwelche echten Risiken einginge – nicht du und ganz gewiss nicht Admiral Harrington. Aber damit lässt sich leicht genug umgehen.«
»Wie?«, fragte Berry. Sie warf Ruth einen um Entschuldigung bittenden Blick zu. »Nicht, dass ich glaube, die Manticoraner würden ihr Wort brechen, wenn sie Ihnen freies Geleit zusichern – vorausgesetzt natürlich, dass sie das zuvor auch tun. Aber Sie können unmöglich sicher sein, dass es wirklich so kommt, und wenn die Sie erst einmal in den Fingern haben …«
Zilwicki seufzte. Palane zog eine Miene, als könne sie sich nicht entscheiden, ob sie einfach nur sehr unglücklich angesichts von Victors Entscheidung sein solle oder schlichtweg stinkwütend auf ihn.
»Machst du Witze? Wir reden hier von Cachat, dem ›tollwütigen Hund‹, Berry!«, sagte Thandi. Ihr Tonfall klang wahrlich nicht danach, als spreche sie hier von der Liebe ihres Lebens. Vielmehr erinnerte er an das Schaben einer Feile, die gerade sehr feine Späne abhobelt. »Er wird damit in der gleichen Art und Weise ›umgehen‹, wie dieser mutmaßliche Manpower-Agent Ronald Allen damit umgegangen ist. Selbstmord.«
Cachat schwieg. Doch sein Gesichtsausdruck verriet unverkennbar, dass Thandi mit ihrer Vermutung ins Schwarze getroffen hatte.
»Victor!«, protestierte Berry.
Doch Anton wusste, wie schwierig es war, Victor Cachat etwas auszureden, wenn dieser erst einmal eine Entscheidung getroffen hatte. Und um der Wahrheit die Ehre zu geben: Anton war auch nicht gewillt, es überhaupt zu versuchen. Es war noch nicht einmal einen ganzen Tag her, dass sie nach Torch zurückgekehrt waren und von diesem Attentat auf Berry erfahren hatten, das sich vor drei Tagen ereignet hatte. Anton Zilwicki war so wütend wie vielleicht noch nie zuvor in seinem Leben – und Cachats Vorschlag hatte den zumindest emotional gesehen immensen Vorteil, dass sie irgendetwas Konkretes würden unternehmen können … und das jetzt gleich.
Und selbst wenn man jegliche emotionalen Aspekte außer Acht ließ, hatte Victors Vorschlag immer noch einige äußerst reizvolle Aspekte. Wenn sie Honor Harrington tatsächlich dazu bringen könnten, sich mit ihnen zu treffen – und dieses ›wenn‹ war natürlich ein äußerst ungewisses ›falls‹! –, dann hätten sie endlich Kontakt zu einer der wichtigsten Führungspersönlichkeiten von Manticore geknüpft. Einem Anführer, der, zumindest was Haven betraf – soweit Anton das beurteilen konnte – die allgemeine im Sternenkönigreich herrschende Einstellung und Meinung mit einer gewissen Skepsis betrachtete.
Aber selbst wenn Anton Recht hatte, war es natürlich immer noch verwegen davon auszugehen, sie werde jemanden in ihre Nähe lassen, von dem bekannt war, dass er als Agent im Dienste von Haven stand – als Agent, der zwar kein richtiger ›Attentäter‹ war, diesem aber doch schon erschreckend nahekam, gerade angesichts der Tatsache, dass vor noch nicht einmal sechs T-Monaten ein Anschlag auf Herzogin Harrington selbst verübt worden war.
Andererseits …
Mittlerweile hatten Anton und Victor den Punkt erreicht, an dem sie, zumindest wenn es um berufliche Dinge ging, praktisch die Gedanken des jeweils anderen lesen konnten. Deswegen war Zilwicki nicht im Mindesten überrascht, als Victor sagte: »Anton, es wird gerade die Offenheit sein, mit der wir uns ihr nähern, die Harrington am ehesten dazu bewegen wird, zuzustimmen. Was auch immer ich im Schilde führen mag, sie wird wissen, dass ich nicht herumschleiche – und ganz anders als bei diesem Attentat, das auf sie verübt wurde, werde ich geradewegs und offen an sie herantreten. Und angesichts des Schutzes, unter dem sie steht – ganz zu schweigen von ihrem Ruf als versierte Nahkämpferin – wird das wohl kaum eine echte Gefahr darstellen.«
Er spreizte die Hände und blickte an sich herab; dabei lächelte er so engelsgleich, wie Victor Cachat es eben nur zustande brachte. Was zugegebenermaßen jeden Heiligen dann doch immens bestürzt hätte. »Ich meine, sieh mich doch mal an: Ist das etwa der Körperbau eines tödlichen Attentäters? Und auch noch eines unbewaffneten Attentäters, schließlich wird sie in der Lage sein, jegliche Waffen, die ich bei mir trage, sofort zu erkennen und darauf bestehen, dass ich sie ablege.«
Zilwicki verzog das Gesicht. »Kennt hier irgendjemand einen guten Zahntechniker? Und er muss sofort zur Verfügung stehen - und sich mit archaischen Techniken wie dem Ziehen von Zähnen auskennen.«
Berry legte die Stirn in Falten. »Warum brauchst du einen Zahntechniker?«
»Er schlägt nur gerade vor, was ich tun sollte, Berry. Mir einen Zahn mit Giftfüllung einsetzen lassen. Und das ist einfach albern.« Abschätzig schnalzte Victor mit der Zunge. »Ich muss dir sagen, Anton, dass auf diesem Gebiet der Technik Haven Manticore weit voraus ist. Und Manpower anscheinend auch.«
Thandi Palane blickte ihn mit zusammengekniffenen Augen an. »Victor, willst du mir etwa erzählen, dass du standardmäßig Selbstmordgerätschaften bei dir hast?« Ihr Tonfall hatte zwar noch nicht ganz den absoluten Nullpunkt erreicht, aber Eiswürfel hätte sie damit augenblicklich erzeugen können. »Wenn das wirklich so ist, wäre ich darüber nicht sonderlich erbaut. Und ich wäre es nicht einmal dann, wenn wir nicht jede Nacht das Bett teilen würden.«
Kurz warf Cachat ihr ein beruhigendes Lächeln zu. »Nein, nein, natürlich nicht! Ich werde noch etwas bei unserer Station auf Erewhon abholen müssen. Aber auf dem Weg zu Trevors Stern müssen wir ohnehin bei Erewhon vorbei.«
Während sie den Palast verließen, um sich an die Vorbereitungen zu machen, murmelte Anton: »Nett abgelenkt, Victor.«
Vielleicht blickte Cachat wirklich ein wenig peinlich berührt drein. Aber wenn dem so war, dann nur eine Winzigkeit – eine klitzekleine Winzigkeit.
»Hör mal, ich bin doch nicht verrückt! Natürlich habe ich das Ding nicht dabei, wenn ich ins Bett gehe. Ich bewahre es nicht einmal im Schlafzimmer auf. Aber … was hätte es denn für einen Sinn, so ein Selbstmordgerät in einem anderen Sonnensystem aufzubewahren? Selbstverständlich habe ich das Ding sonst immer bei mir. Schon seit Jahren!«
Zilwicki schüttelte zwar nicht den Kopf, aber er war doch ernstlich versucht, genau das zu tun. Es gab Momente, in denen Victor ihm wie ein Alien aus einer gänzlich fremden Galaxie vorkam, mit einer emotionalen Struktur, die der von Menschen nicht einmal ansatzweise ähnelte. Es war ganz offensichtlich, dass Cachat der Ansicht war, es sei völlig vernünftig – und ein gänzlich gewöhnliches Verhalten für einen jeden kompetenten Geheimagenten – immer und überall ein Selbstmordwerkzeug bei sich zu haben. Er käme genauso wenig auf den Gedanken, ohne dieses Spielzeug aus dem Haus zu gehen, wie ein anderer Mann einfach vergessen könnte, sich Schuhe anzuziehen.
Tatsächlich jedoch hing einzig und alleine der Geheimdienst von Haven dieser Vorgehensweise an – und auch wenn Anton es natürlich nicht genau wissen konnte, so war er sich doch recht sicher, dass dies nicht einmal bei den Haveniten der Alltagsroutine entsprach. Nicht einmal zu der Zeit, da Saint-Just noch den Laden am Laufen gehalten hatte. Selbstmordgerätschaften wurden Agenten nur in Ausnahmefällen zur Verfügung gestellt, bei Aufträgen, die ganz besonders heikel waren. Natürlich wurden sie nicht verteilt wie Lutschbonbons!
Andererseits stellte, als hätte Anton diesbezüglich einer Erinnerung bedurft, Victor damit eben noch einmal deutlich heraus, dass er eben Victor Cachat war.
»Einzigartig«, murmelte er.
»Wie bitte?«
»Ach, egal, Victor.«
Hugh fuhr sich durch die Haare. Das war eine Geste, die er normalerweise nur dann vollführte, wenn er zornig war. Und das …
Traf hier zu, und gleichzeitig wieder auch nicht. Das alles war ziemlich verwirrend – und Hugh Arai verabscheute es, verwirrt zu sein.
»Ich begreife immer noch nicht, warum du so darauf beharrst …«
»Jetzt hör schon auf, Hugh!«, fauchte Jeremy X. »Du weißt ganz genau, warum ich dich hier gerade nach Kräften unter Druck setze. Erstens weil du nun einmal der Beste bist.«
»Ach, das ist doch Unfug! Es gibt in der Galaxis reichlich Leute im Sicherheitsdienst, die besser sind als ich.«
Den stechenden Blick, den Jeremy ihm zuwarf, musste man gesehen haben, sonst hätte man ihn für unmöglich gehalten.
»Na ja … also gut, meinetwegen. Allzu viele sind es wahrscheinlich dann doch nicht, und auch wenn ich es für schlichtweg lächerlich halte, wenn ich behaupte, ›ich bin der Beste‹, trifft es vermutlich zu …«
Er ließ die Stimme verebben. Web Du Havel beendete den Satz: »Dass niemand besser ist als du.«
Hugh warf dem Premierminister von Torch einen recht unfreundlichen Blick zu. »Das ist nicht beleidigend gemeint, Web, aber wann genau sind Sie eigentlich zu einem Experten auf dem Gebiet der Sicherheit geworden?«
Du Havel grinste nur. »Das bin ich nicht, und ich habe auch niemals Gegenteiliges behauptet. Aber das brauche ich auch nicht zu sein, schließlich …« – mit dem Daumen wies er auf Jeremy – »… habe ich meinen Kriegsminister, der Jahr um Jahr bewiesen hat, dass er praktisch jedes nur erdenkliche Sicherheitssystem zu überwinden vermag. Also kann ich auf sein Wort bauen, wenn es um derartige Dinge geht.«
Dem konnte man schwerlich etwas entgegensetzen.
Jeremy wartete gerade lange genug ab, um sich sicher sein zu können, dass Hugh sich genau das zumindest innerlich auch selbst eingestanden hatte. Vielleicht war es ja ein ›Eingeständnis durch störrisches Schweigen‹ – aber es war ein Eingeständnis, und das wussten sie beide.
»Der zweite Grund ist genau so wichtig«, fuhr er dann fort. »Normalerweise würden wir uns für etwas Derartiges an den Ballroom wenden. Aber angesichts dessen, was wir jetzt wissen, vor allem durch diesen Ronald-Allen-Zwischenfall, können wir das nicht tun. Ich bezweifle, dass Manpower ernstlich viele Agenten in den Ballroom oder die Regierungskreise von Torch hat einschleusen können. Aber es scheint fast sicher, dass für sämtliche Agenten, die es dort geben mag, ein Attentat auf die Königin ganz oben auf der Liste stehen dürfte.«
Er hielt inne und wartete darauf, dass Hugh ihm entweder zustimmte oder widersprach. Nein, mit seinem Schweigen zwang er Hugh praktisch dazu, das eine oder andere zu tun.
Da die Antwort eindeutig war, nickte Hugh. »In dieser Hinsicht will ich mich ja gar nicht mit dir anlegen. Und deine Schlussfolgerung ist jetzt …?«
»Ganz offensichtlich müssen wir ein Sicherheitsteam auf die Beine stellen, das nicht das Geringste mit dem Ballroom zu tun hat und auch nicht auf die Mitarbeit ehemaliger Gensklaven angewiesen ist.«
Hugh sah einen leichten Hoffnungsschimmer aufblitzen.
»Na ja, wenn das so ist, sollte ich vielleicht noch einmal darauf hinweisen, dass ich ebenfalls ein ehemaliger Gensklave bin, deswegen scheint mir …«
»Jetzt hör schon auf!« Diese Worte kamen einem Brüllen näher, als es Hugh jemals zuvor bei Jeremy erlebt hatte. Das normale Verhalten dieses Mannes – und auch der Verhaltensstil, den er selbst stets vorzog – war eher ›humorig‹ als ›wild‹.
Jeremy blickte ihn finster an. »Du zählst nicht, und der Grund dafür ist ebenfalls offensichtlich – und du kennst ihn genauso gut wie ich. Für dich kann ich bürgen, seit du fünf Jahre alt geworden bist, und wenn man mir nicht vertrauen kann, dann sind wir hier alle sowieso am Arsch, schließlich bin ich verdammt noch eins hier der Kriegsminister! Jetzt lasst uns bloß nicht durchdrehen. Aber selbst wenn du die Leitung übernimmst, möchte ich doch, dass der gesamte Rest des Teams von Beowulf stammt.«
Noch während er seine Einwände vorbrachte, hatte er schon über das Problem nachgedacht. Auf einem Nebenkanal, sozusagen. Jeremy hätte ihm wirklich nicht zu erklären brauchen, welche Vorzüge es hätte, ein Sicherheitsteam einzusetzen, das bislang noch keinerlei Verbindungen nach Torch oder zum Ballroom geknüpft hatte. Das war von Anfang an offensichtlich gewesen. Und die Lösung für dieses Problem war ebenso offensichtlich – wenn es sich denn bewerkstelligen ließe.
»Am besten wäre es wohl, einfach dafür zu sorgen, dass das Biological Survey Corps mich und mein Team auf Dauer nach Torch abstellt.«
Jeremy nickte. »Endlich. Jetzt denkt der Bursche wieder klar!«
Web Du Havel blickte sie nacheinander an. »Ich hatte nicht den Eindruck, das BSC habe sich auf Sicherheitsfragen spezialisiert.«
Hugh und Jeremy lächelten völlig gleichzeitig. »Naja, das haben sie auch nicht. An sich nicht«, sagte Jeremy. »Hier spricht eher meine eigene Erfahrung auf diesem Gebiet.« Web verdrehte die Augen. »Mit anderen Worten: Du hast keine Ahnung von Sicherheitsmaßnahmen, außer wie man sie umgeht.«
»Das trifft es ziemlich gut«, sagte Hugh. »Wenn man mich einmal außen vor lässt, dann könnte man wohl annehmen, die Fertigkeiten meines Teams entsprechen ungefähr denen der Gegenseite. Aber das ist mehr als genug, Web. Und da sie überhaupt nicht mehr auf dem neuesten Stand gehalten werden, was Torch oder den Ballroom betrifft, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, man könnte sie unterwandert haben.«
»Damit bleibt immer noch das Problem, dass es mit der Vorgehensweise bei den letzten Attentaten – ob nun erfolgreich oder nicht – möglich sein könnte, alles einfach zu umgehen.«
Hugh schüttelte den Kopf. »Ich glaube nicht an Zauberkräfte, Jeremy, und du auch nicht. Ich selbst denke ja, dass Manpower hinter all dem steckt – auch wenn ich zugebe, dass das nur an meiner eigenen Voreingenommenheit liegen könnte. Trotzdem: Wie auch immer die Methode nun eigentlich funktioniert, das riecht einfach nach etwas auf biologischer Basis. Abgesehen von Beowulf hat Manpower auf diesem Gebiet die größte Erfahrung in der ganzen Galaxis – und teilweise kann nicht einmal Beowulf ihnen das Wasser reichen. Aber wer auch immer letztendlich dahintersteckt, man kann es abwehren, wenn wir erst einmal herausgefunden haben, wer dahintersteckt. Und in der Zwischenzeit …«
Nun klang er sehr grimmig. »Mir fällt zumindest eine Methode ein, mit der wir für Berrys Sicherheit sorgen können, solange wir noch im Dunkeln tappen. Aber gefallen wird ihr das sicher nicht.«
Web wirkte ein wenig beunruhigt. »Wenn es darauf hinausläuft, sie irgendwo einzuschließen, Hugh, dann können Sie das gleich wieder vergessen. Selbst jetzt, wo sie sich relativ umgänglich zeigt, eben weil Lara und die anderen gestorben sind, halte ich es für absolut ausgeschlossen, dass Berry sich dazu bereiterklären wird.«
»Daran habe ich auch nicht gedacht – aber ob es ihr nun passt oder nicht, sie wird einen Großteil der Zeit von allen anderen abgeschirmt sein. Das bedeutet nicht, dass sie sich überhaupt nicht frei bewegen darf, aber … nennen wir es ›Sicherheit durch extreme Unbarmherzigkeit‹. Aber ich kenne Berry gut genug, um schon jetzt zu wissen, dass es ihr wirklich schwerfallen wird, sich diesen Vorsichtsmaßnahmen zu unterwerfen.«
»Natürlich ist diese ganze Diskussion hier höchstwahrscheinlich völlig nutzlos, weil mir kein einziger Grund einfällt, weswegen das BSC irgendwelchen der Dinge, die hier besprochen wurden, zustimmen sollte. Eine ganze Kampfgruppe abkommandieren, die dann einer fremden Sternnation dienen soll – und das für einen nicht näher bestimmbaren, vermutlich aber längeren Zeitraum? Du träumst doch wohl, Jeremy!«, sagte Hugh.
Nun war es an Jeremy und Du Havel, gleichzeitig zu lächeln. »Warum überlassen Sie diese Sorge nicht einfach uns?«, entgegnete Web. »Vielleicht können wir ja etwas arrangieren.«
»Klar«, sagte Prinzessin Ruth. »Soll ich die Aufzeichnung auch für meine Eltern machen, nicht nur für meine Tante? Ich würde ja empfehlen, auch Mom und Dad einzubeziehen. Tante Elizabeth wäre ziemlich sauer, wenn das irgendjemand laut aussprechen würde, aber in Wahrheit kann mein Vater ihr praktisch alles abschmeicheln. Und da jegliche Sicherheitsmaßnahmen, die Berry schützen sollen, sich auch auf mich auswirken werden, wird er sich wahrscheinlich ganz besonders anstrengen.«
Web und Jeremy blickten einander an. »Wie Sie meinen, Ruth. Sie sind die Expertin hier.«
»Na, dann okay.« Ruth schürzte die Lippen. »Jetzt muss ich mir noch überlegen, was am besten funktioniert. Mit ›Tränen in den Augen‹, oder doch lieber ›so beharrlich, dass es fast schon an kindliche Respektlosigkeit grenzt‹?«
»Warum bist du dir so sicher, dass Manticore genug Einfluss auf Beowulf hat?«, fragte Jeremy später.
»Dafür fallen mir mindestens vier Gründe ein«, erwiderte Web. »Der einfachste davon ist, dass du, auch wenn du reichlich Zeit mit Beowulfianern verbracht haben magst, anscheinend noch nicht ganz erkannt hast, wie tief und unnachgiebig der Hass ist, den die Elite von Beowulf auf Manpower verspürt. Für die ist dieser Krieg, mehr noch als für manche Exsklaven wie uns, etwas zutiefst Persönliches. Da treffen zwei Gruppen aufeinander, die einen tiefen Groll hegen.«
»Das alles ist doch schon Jahrhunderte her, Web. Mehr als ein halbes Jahrtausend! Wer kann denn derart lange einen Groll hegen? Ich glaube nicht, dass ich zu so etwas in der Lage wäre, und von mir ist ja nun allgemein bekannt, dass ich ein echter Fanatiker bin.«
Leise lachte Web in sich hinein. »Ich weiß von mindestens acht Projekten auf Beowulf, in denen es darum geht, evolutionäre Effekte zu studieren, und jedes einzelne davon wurde innerhalb der ersten fünf Jahre nach der Besiedelung des Planeten gestartet – vor fast eintausendachthundert Jahren. Wenn Biologen erst einmal ein gewisses Maß an Hingabe und Aufopferungsbereitschaft entwickelt haben, sind sie eigentlich kaum noch zurechnungsfähig.«
Er schüttelte den Kopf. »Aber lassen wir das. Ein weiterer Grund ist, dass Manticore beachtlichen Druck auf Beowulf ausüben kann. Vielleicht sollte man es lieber ›Einfluss nehmen‹ nennen. Und umgekehrt gilt natürlich das Gleiche. Die Beziehungen zwischen diesen beiden Sternnationen sind deutlich enger, als den meisten bewusst ist.«
Jeremy wirkte immer noch ein wenig skeptisch. Doch er ging der Sache nicht weiter nach. Schließlich war das hier Web Du Havels Fachgebiet.
Kapitel 3
Das Kriegsschiff, das aus dem Trevors-Stern-Terminus des Manticoranischen Wurmlochknotens drang, sendete keinen manticoranischen Transpondercode und auch keinen graysonitischen oder andermanischen. Dennoch wurde ihm der Transit gestattet, denn sein Code wies es als dem Königreich Torch zugehörig aus.
Die Einheit als ›Kriegsschiff‹ zu bezeichnen war vielleicht allzu großzügig, denn es handelte sich um eine Fregatte ein Schiff einer solch kleinen Klasse, dass keine größere Raummacht sie seit über fünfzig T-Jahren mehr baute. Allerdings war es ein sehr modernes Schiff, keine drei T-Jahre alt, und von manticoranischer Fertigung, vom Hauptmann-Kartell für die Anti-Sklaverei-Liga gebaut.
Was, wie jedermann wusste, tatsächlich bedeutete, dass das Schiff für den Audubon Ballroom gefertigt worden war, und zwar vor dessen Sprung in die Ehrbarkeit. Diese besondere Fregatte TNS Pottawatomie Creek war recht berühmt, um nicht zu sagen berüchtigt, weil es das persönliche Transportmittel eines gewissen Anton Zilwicki war, ehemals Captain Ihrer Manticoranischen Majestät Navy.
Der Mordanschlag auf Zilwickis Tochter war im ganzen Sternenkönigreich bekannt, und in der augenblicklichen blutgierigen manticoranischen Stimmung machte niemand irgendwelche Probleme, als die Pottawatomie Creek die Erlaubnis erbat, sich HMS Imperator zu nähern und zwei Besucher überzusetzen.
»Hoheit, Captain Zilwicki und … ein Gast«, verkündete Commander George Reynolds.
Honor brach das Sinnieren über die am nächsten treibenden Einheiten unter ihrem Kommando ab und zog eine Augenbraue hoch, als sie die eigenartige Färbung von Reynolds Empfindungen wahrnahm. Sie hatte sich entschieden, sich so rasch wie möglich mit Zilwicki zu besprechen, und hatte ihn darum von Reynolds empfangen und in die relativ kleine Beobachtungskuppel gleich achtern vom vorderen Hammerkopf der Imperator führen lassen. Dort bot sich eine spektakuläre Panoramasicht, aber die Kuppel lag deutlich außerhalb ihrer Kajüte oder der offiziellen Umgebung der Flaggbrücke.
Nun allerdings veranlasste das eigenartige Kräuseln in Reynolds Geistesleuchten sie zu der Frage, ob Zilwicki nicht vielleicht genauso froh wie sie sei, die ›inoffizielle‹ Natur des Besuches zu wahren. Reynolds, der Sohn eines befreiten Gensklaven, war ein begeisterter Befürworter des großen Experiments im Congo-System und, man brauchte es kaum zu erwähnen, ein Bewunderer von Anton Zilwicki und Catherine Montaigne. Unmittelbar vor Honors Einsatz im Marsh-System hatte der Commander mit Zilwicki sehr eng zusammengearbeitet, und er hatte sich sehr gefreut, als sie ihn bat, Zilwickis Kutter zu empfangen. Jetzt allerdings wirkte er fast ein wenig … besorgt. Nein, das war nicht ganz das richtige Wort, aber es kam der Sache nahe, und Honor bemerkte, wie Nimitz Interesse erwachte, als der Kater sich auf der Sessellehne, zu voller Größe aufrichtete.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!