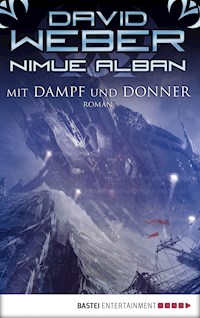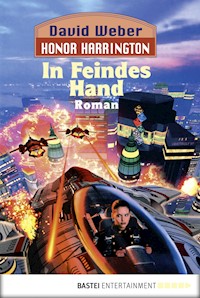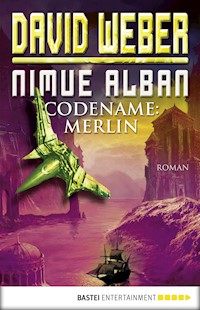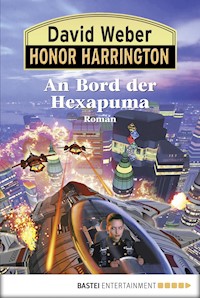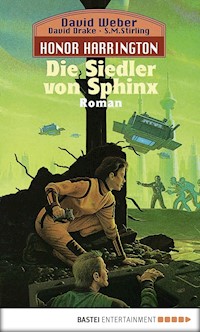
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Honor Harrington
- Sprache: Deutsch
Innerhalb einiger weniger kurzer Jahre hat sich David Weber mit seiner Serie um Honor Harrington, der zähesten und tüchtigsten Kommandantin eines Sternenschiffs in der Galaxis, an die Spitze der amerikanischen Science Fiction geschrieben.
In diesem Buch berichtet er von einer Vorfahrin seiner Heldin, die als erster Mensch die Brücke schlägt zu einer der geheimnisvollsten Spezies der Milchstraße - den Baumkatzen von Sphinx.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 468
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Die Siedlervon Sphinx
Roman
Ins Deutsche übertragenvon Dietmar Schmidt
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstveröffentlichung
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»More Than Honor«
© 1998 by David M. Weber
Published by arrengements with Baen Publishing Enterprise
All rights reserved
© für die deutschsprachige Ausgabe: 2001/2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
This book was negotiated through
Literary Agency Thomas Schlück, 30827 Garbsen
Lektorat: Ruggero Leò / Stefan Bauer
Umschlaggestaltung: QuatroGrafik Bensberg
Titelillustration: Romas B. Kukalis/ Agentur Schlück
E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-2256-6
Sie finden uns im Internet unter
www.luebbe.de
Bitte beachten Sie auch: www.lesejury.de
Inhaltsverzeichnis
Eine wunderbare Freundschaftvon David Weber
Eine Bildungsreisevon David Drake
Eine Feuertaufevon S. M. Stirling
Das Universum Honor Harringtonsvon David Weber
Eine wunderbare Freundschaft
von David Weber
1
Klettert-flink huschte den Baumstamm hinauf und verharrte gleich auf der ersten Astgabelung, um sich mit peinlicher Sorgfalt die beschmierten Echthände und Handpfoten zu säubern. Nun, da die kalten Tage in die schlammigen übergingen, verabscheute er es schlichtweg, den Boden zwischen den Bäumen zu überqueren. Schnee mochte er zwar genauso wenig, überlegte er und bliekte belustigt, aber Schnee schmolz wenigstens und verschwand – irgendwann – von selbst aus dem Fell, anstatt zähe Klumpen zu bilden, die hart wie Stein wurden, sobald sie trockneten. Dennoch, die neue Spanne brachte auch Vorteile mit sich: Wärme zum Beispiel, oder Grün. Klettert-flink atmete zufrieden die frische Luft ein, die durch die pelzigen Knospen an den nahezu kahlen Ästen strich. An anderen Tagen wäre er hoch in den Wipfel hinaufgeklettert, um zu genießen, wie der Wind an seinem Fell zupfte, doch heute gab es Wichtigeres zu tun.
Als er mit dem Putzen fertig war, erhob er sich in der Beuge zwischen Ast und Stamm auf die Hinterbeine und musterte mit grasgrünen Augen seine Umgebung. Keines der Zwei-Beine war in der Nähe, aber das hatte wenig zu sagen: Zwei-Beine steckten voller Überraschungen. Der Clan vom Hellen Wasser, dem Klettert-flink angehörte, hatte bis vor kurzem nur sehr wenig mit den Zwei-Beinen zu tun gehabt. Andere Clans aber beobachteten diese seltsamen Wesen bereits seit ganzen zwölf Spannen. Ganz offensichtlich beherrschten sie Kunstfertigkeiten, auf die sich die Leute nicht verstanden; zum Beispiel vermochten sie über große Entfernungen hinweg Wache zu halten – aus so großer Feme, dass die Leute sie weder hören noch riechen, geschweige denn sehen konnten. Dennoch, Klettert-flink bemerkte kein Anzeichen dafür, dass am Ende er selbst beobachtet würde. Geschmeidig schnellte er zum benachbarten Baum und drang über die dichten Äste weiter zur Lichtung vor.
Allzu besorgt war der Clan vom Hellen Wasser nicht gewesen, als die ersten Flugdinger eintrafen und die Zwei-Beine ihnen entstiegen und die Lichtung schufen, denn die Clans, in deren Revier die Zwei-Beine vorher eingedrungen waren, hatten angekündigt, dass dergleichen zu erwarten stehe. Die Zwei-Beine konnten gefährlich sein und veränderten unablässig ihre Umwelt. Trotzdem glichen sie weder Todesrachen noch Schneejägern, die nur allzu oft willkürlich oder zu ihrem Vergnügen töteten. Kundschafter und Jäger wie Klettert-flink hatten hoch in den Bäumen gesessen und aus der Deckung der frostbedeckten Blätter diese erste Hand voll Zwei-Beine beobachtet. Die Neuankömmlinge waren ausgeschwärmt und hatten seltsame Gegenstände umhergetragen und immer wieder hineingeblickt. Einige der Dinger glänzten, andere waren mit unsteten bunten Lichtem besetzt; wieder andere standen auf langen, dünnen Beinen. Dann trieben die Zwei-Beine in regelmäßigen Abständen Pflöcke aus ebenfalls merkwürdigem Nicht-Holz in den Boden. Die Sagen-Künderinnen hatten daraufhin die Lieder anderer Clans wiedergesungen und dadurch offenbart: Bei den Gegenständen, wie die Kundschafter sie beschrieben, müsse es sich um unbekannte Werkzeuge handeln. Klettert-flink wusste keinen Einwand gegen diese Schlussfolgerung zu erheben, auch wenn sich die fremden Werkzeuge in der Form ebenso sehr von den Äxten und Messern der Leute unterschieden, wie sich das unbekannte Material, aus dem die seltsamen Werkzeuge bestanden, von Feuerstein, Holz und Knochen unterschied.
Wegen alledem mussten die Zwei-Beine sehr sorgfältig beobachtet werden – ohne dass sie etwas davon bemerkten. So wenig Leute es gab, so flink und schlau waren sie, und durch ihre Äxte, Messer und das Feuer verrichteten sie vieles, wozu größere, aber weniger kluge Wesen nicht imstande waren. Doch sogar das kleinste Zwei-Bein ragte höher auf als zwei Leute zusammen. Selbst wenn ihre Werkzeuge also nicht besser gewesen wären als die der Leute (dabei wusste Klettert-flink genau, dass sie sehr viel besser waren), verliehen diese größeren Körper den Zwei-Beinen gewiss mehr Kraft. Zwar gab es noch keinen Beweis, dass die Zwei-Beine den Leuten übel gewillt wären, doch andererseits sprach auch nichts gegen diese Vermutung. Deshalb war es ohne Zweifel von Vorteil, dass sie sich so leicht ausspähen ließen.
Klettert-flink erreichte den letzten Querast und verharrte. Lange Augenblicke blieb er regungslos sitzen. Sein cremefarbenes und graues Fell verschmolz völlig mit den Baumstämmen und Ästen, die von geschlossenen grünen Knospen wie besprenkelt wirkten. Er machte keine Bewegung, außer dass er sich mit der einen Echthand unwillkürlich die Schnurrhaare strich. Mit Gehör und Gedanken gleichzeitig lauschte er, und als er das schwache Geistesleuchten erspürte, das ihm die Anwesenheit der Zwei-Beine verriet, richteten sich seine Ohren auf. Das Leuchten verblasste jedoch vor der klaren, deutlichen Verständigung, die er von den Leuten gewohnt war, mit denen er auf diese Weise mühelos kommunizieren konnte. Offenbar waren die Zwei-Beine geistesblind. Dennoch hatte ihr Leuchten etwas … Angenehmes an sich. Klettert-flink wunderte sich darüber, denn abgesehen von der offenen Frage, was sie eigentlich darstellten, unterschieden sich die Zwei-Beine doch sehr von den Leuten. Die Sagen-Künderinnen jedes Clans hatten ihre Lieder weithin ausgesandt, kaum dass die Zwei-Beine vor zwölf Spannen zum ersten Mal aufgetaucht waren. Gleichzeitig hatten sie die Lieder der anderen Clans daraufhin untersucht, ob sie ihnen etwas, irgendetwas, über die fremdartigen Geschöpfe verrieten: woher sie gekommen waren – oder wenigstens, aus welchem Grund sie kamen.
Niemand wusste auf diese Fragen eine Antwort, doch die Sagen-Künderinnen des Clans der Tänzer vom Blauen Berg und des Clans vom Schnelllaufenden Feuer hatten sich an ein sehr altes Lied erinnert, das fast zweihundert Spannen alt sein musste. Zwar bot dieses Lied keinen Hinweis auf die Ursprünge und Beweggründe der Zwei-Beine, aber es berichtete von der allerersten Gelegenheit, bei der Zwei-Beine von den Leuten erblickt worden waren. Ein lange verstorbener Kundschafter hatte seinen Sagen-Künderinnen berichtet, wie das eiähnliche, silberne Ding der Zwei-Beine sich unter Licht und Feuer aus dem hohen Himmel herabsenkte und dabei ein Getöse machte, das schrecklicher war als der schlimmste Donner.
Die Leute jener Zeit waren daraufhin geflohen und hatten sich versteckt. Andere schlossen sich dem ersten Kundschafter an, der das silberne Ei entdeckt und dessen Herren daraus hervorkommen gesehen hatte, und gemeinsam beobachteten sie aus dem Schutz der Schatten und der Blätter das Geschehen – genau wie jetzt Klettert-flink. Ab wartend hatten sie Abstand gehalten und nie versucht, sich mit den Eindringlingen zu verständigen. Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn nicht ein Todesrachen versucht hätte, eins der Zwei-Beine zu fressen.
Die Leute mochten die Todesrachen nicht. Die riesigen Raubtiere sahen aus wie zu groß geratene Leute, doch im Gegensatz zu den Leuten waren Todesrachen alles andere als schlau. Jemand, der so groß war wie sie, brauchte andererseits auch nicht besonders schlau zu sein. Todesrachen waren die größten, stärksten und tödlichsten Jäger auf der ganzen Welt. Im Gegensatz zu den Leuten töteten sie oft aus Vergnügen, und sie fürchteten nichts, was lebte – außer den Leuten. Zwar ließen Todesrachen keine Gelegenheit aus, einen einzelnen dummen Kundschafter oder Jäger zu fressen, wenn sie ihn am Boden überraschten, doch vom Herzland eines Clans hielten sich auch Todesrachen fern. Größe allein zählte nur wenig, wenn ein ganzer Clan von den Bäumen herabschwärmte und angriff.
Der Todesrachen, der das Zwei-Bein angriff, entdeckte jedoch, dass es außer den Leuten noch mehr zu fürchten gab. Keiner der Zuschauer hatte jemals so etwas gehört wie das ohrenbetäubende Krachen aus dem Röhrending in den Händen des Zwei-Beins. Der heranstürmende Todesrachen überschlug sich einmal in der Luft, krachte zu Boden und rührte sich nicht mehr. Ein blutiges Loch klaffte in seinem reglosen, durchbohrten Körper.
Nachdem die Beobachter ihr anfängliches Entsetzen überwunden hatten, freuten sie sich zwar grimmig über das Schicksal des Todesrachens, gleichzeitig aber wussten sie, dass jemand, der einen Todesrachen mit einem einzigen Bellen erlegte, in der Lage sein musste, Leute ebenso leicht zu töten. Deshalb entschieden sie, die Zwei-Beine zu meiden, bis man mehr über sie herausgefunden hatte. Die Kundschafter beobachteten die Fremden Tag um Tag, bis diese schließlich nach etwa einer Viertelspanne ihre merkwürdigen, viereckigen Wohnnester abbauten, in ihr Ei zurückkehrten und wieder im Himmel verschwanden.
All das war lange, lange her, und Klettert-flink bedauerte, dass niemand mehr über die Zwei-Beine erfahren hatte. Natürlich musste er einräumen, dass die alten Kundschafter recht daran getan hatten, vorsichtig zu sein, und doch wünschte er, die Tänzer vom Blauen Berg wären eine Spur weniger auf der Hut gewesen. Vielleicht hätte man schon damals herausfinden können, was die Zwei-Beine hier wollten. Dann hätten die Leute zwischen dem ersten Verschwinden der Fremden und ihrer Wiederkehr beschließen können, wie man sich ihnen gegenüber verhalten sollte.
Klettert-flink war der Meinung, dass es sich bei diesen ersten Zwei-Beinen um Kundschafter wie ihn gehandelt haben musste. Gewiss waren auch die Zwei-Beine so klug, anfangs Späher auszusenden; jeder Clan verfuhr so, wenn er sein Revier erweitern wollte. Warum aber hatte der Rest ihres Clans dann so lange abgewartet? Und weshalb verteilten sich die Zwei-Beine so weit? Wie wenig sie waren! Um das Wohnnest auf der Lichtung zu erbauen, die Klettert-flink beobachtete, hatten sich mehr als ein Dutzend Zwei-Beine sehr anstrengen müssen, obwohl sie über diese vielen schlauen Werkzeuge verfügten, und es war groß genug, um einem ganzen Clan Unterkunft zu bieten. Trotzdem waren die Erbauer nach vollendeter Arbeit einfach weitergezogen. Mehr als zehn Tage lang hatte es leer gestanden, und nun wohnten darin nur drei Zwei-Beine, eins von ihnen – wenn sich Klettert-flink nicht sehr irrte – noch ein Junges. Manchmal fragte er sich, was wohl den Wurfgeschwistern dieses Jungen zugestoßen sein mochte, doch wirklich verwunderlich erschien ihm, dass die Zwei-Beine sich durch ihre weite Verteilung offenbar freiwillig jeder Verständigung mit ihren Artgenossen beraubten.
Aus diesem Grund glaubten viele Kundschafter, die Zwei-Beine unterschieden sich nicht nur in Bezug auf Größe, Gestalt und Werkzeuge von den Leuten, sondern in jeglicher Hinsicht. Gerade die Fähigkeit, sich mit anderen zu verständigen, machte es ja aus, zu den Leuten zu gehören: Nur nicht-denkende Wesen wie die Todesrachen, die Schneejäger oder jene, die den Leuten zum Opfer fielen, lebten abgeschlossen für sich, und deshalb konnten die Zwei-Beine keine Leute sein, denn schließlich waren sie nicht nur geistesblind, sondern mieden auch ihre eigenen Artgenossen. Klettert-flink indes zweifelte an dieser Schlussfolgerung. Nicht einmal sich selbst vermochte er eindeutig zu erklären, wie er zu seiner Meinung kam, aber er war felsenfest davon überzeugt, dass auch die Zwei-Beine Leute waren – zumindest in gewisser Hinsicht. Klettert-flink war von ihnen fasziniert, und immer wieder lauschte er dem Lied von den ersten Zwei-Beinen und ihrem Ei. Zum einen bemühte er sich, durch das Lied zu begreifen, was sie damals gewollt hatten. Darüber hinaus beförderte dieses Lied selbst jetzt noch Untertöne, von denen er glaubte, sie an den Zwei-Beinen zu erspüren, die er beobachtete.
Leider hatten zu viele Sagen-Künderinnen das Lied im Laufe der Zeit sehr geglättet, bevor Singt-wahrhaftig es dem Clan vom Hellen Wasser vorgetragen hatte. So etwas widerfuhr sehr oft alten Liedern oder solchen, die über lange Strecken weitergegeben worden waren. Dieses Lied aber war beides: uralt und aus der Ferne. Obwohl seine Bilder nach wie vor klar und scharf waren, hatte jede der vielen Sagen-Künderinnen, die vor Singt-wahrhaftig gekommen waren, die Bilder doch ein wenig gefärbt und verzerrt. Klettert-flink wusste daher zwar, was die Zwei-Beine getan hatten, aber nicht weshalb. Weil so viele Künderinnen auf das Lied eingewirkt hatten, war jede Spur eines etwaigen Geistesleuchtens, von dem die lange verstorbenen Beobachter gekostet haben mochten, lange verloren.
Klettert-flink hatte bisher nur Singt-wahrhaftig anvertraut, was er von ›seinen‹ Zwei-Beinen auf gefangen zu haben glaubte. Natürlich war es seine Pflicht, den Sagen-Künderinnen Bericht zu erstatten, und diese Pflicht hatte er erfüllt. Doch hatte er Singt-wahrhaftig dabei beschworen, seinen Verdacht für sich zu bewahren, denn manch anderer Kundschafter hätte ihn schallend ausgelacht. Singt-wahrhaftig hatte nicht gelacht, doch andererseits hatte sie ihm auch nicht zugestimmt. Am liebsten wäre sie persönlich zum Clan der Tänzer vom Blauen Berg oder vom Schnelllaufenden Feuer gereist, um von deren ältesten Sagen-Künderinnen das Lied über die Zwei-Beine unverfälscht zu hören. Doch das stand außer Frage: Sagen-Künderinnen waren das Herz jedes Clans, das Speicherhaus für Erinnerungen, der Verbreiter von Weisheit. Sagen-Künderinnen waren immer Weibchen, und ihr Verlust durfte nicht riskiert werden. Es war ganz gleich, was Singt-wahrhaftig gern wollte: Solange ein Clan keinen Überschuss an Sängerinnen besaß, musste er die möglichen Nachfolgerinnen schützen, indem er ihnen gefährliche Aufgaben verweigerte. Klettert-flink begriff die Gründe dafür sehr gut, doch konnte er die Konsequenzen nicht so leicht akzeptieren wie die anderen Kundschafter und Jäger seines Clans. Es hatte durchaus seine Nachteile, der Bruder einer Sagen-Künderin zu sein, die wegen der Freiheiten schmollte, die ihre Rolle ihr verweigerte – ihrem Bruder aber gestattet waren. Klettert-flink lachte leise keckernd (ohne dass es finstere Folgen für ihn haben konnte; Singt-wahrhaftig war zu weit entfernt, um seine Gedanken noch schmecken zu können), dann schob er sich verstohlen auf den vordersten Baum vor. Leichtfüßig stieg er in die höchste Astgabel und ließ sich dort auf seinem bequemen Polster aus Zweigen und Laub nieder. Die Heimsuchungen der kalten Spanne machten einige Reparaturen an seinem Sitzplatz nötig, aber damit eilte es nicht. Noch war das Polster benutzbar, und außerdem dauerte es noch etliche Tage, bis die knospenden jungen Blätter das Material liefern konnten, das Klettert-flink benötigte.
In gewisser Weise fand er es schade, dass die Blätter sich bald öffneten. Solange sie fehlten, fiel helles Sonnenlicht durch die dünnen Zweige der Baumkrone und warf sanfte Wärme auf den spähenden Klettert-flink. Mit einem wohligen Seufzen streckte er sich auf dem Bauch aus, legte das Kinn auf die gefalteten Echthände und richtete sich auf langes Warten ein. Kundschafter lernen schon früh Geduld. Wenn sie bei dieser Lektion Ermunterung benötigten, so gab es zahlreiche Lehrer, die gern aushalfen – von Stürzen bis hin zu Todesrachen. Solche Nachhilfe hatte Klettert-flink allerdings nie gebraucht, und mehr deshalb denn wegen seiner Beziehung zu Singt-wahrhaftig rangierte er unter den Spähern des Clans nur hinter Kurzer Schweif, dem obersten Kundschafter im Clan vom Hellen Wasser – daher hatte man ihn auserwählt, die Zwei-Beine im Auge zu behalten.
So wartete er nun regungslos im warmen Sonnenschein und beobachtete den merkwürdigen, von einer Kante gekrönten Wohnbau aus Stein, den die Zwei-Beine mitten auf der Lichtung errichtet hatten.
2
»Es ist mir ernst damit, Stephanie!«, sagte Richard Harrington mit Nachdruck. »Du wirst nicht noch einmal in den Wald gehen, ohne dass ich oder deine Mutter dabei sind. Haben wir uns verstanden, junge Dame?«
»Ach, Daaaaddy …«, hub Stephanie an, doch als ihr Vater die Arme verschränkte, schloss sie augenblicklich den Mund. Dann begann er, mit der rechten Schuhsohle auf den Teppich zu klopfen, und ihr sank das Herz. Nein, es sah nicht gut aus. Das Gebaren ihres Vaters warf kein gutes Licht auf ihr – sagen wir – Verhandlungsgeschick, und das passte ihr fast ebenso wenig wie das Verbot, das sie stets hatte verhindern wollen und das nun ausgesprochen war. Elf T-Jahre war sie alt, ein helles Köpfchen, Einzelkind und so zauberhaft, dass es für drei gereicht hätte. Ihre Ausstrahlung brachte ihr gewisse Vorteile ein; gleich als Erstes nach dem Sprechen hatte sie gelernt, ihren Vater um den kleinen Finger zu wickeln. Zwar hegte sie schon lange den Verdacht, dass ihr Erfolg in nicht zu unterschätzendem Ausmaß von Daddys Bereitschaft abhing, sich um den kleinen Finger wickeln zu lassen, doch das war ihr recht, wenn es nur funktionierte. Mom hingegen war schon immer ein härterer Brocken gewesen – und auch der Vater zögerte nicht, alle Nachsichtigkeit völlig skrupellos über Bord zu werfen, wenn die Situation seiner Meinung nach Unnachgiebigkeit erforderte.
Wie jetzt zum Beispiel.
»Wir brauchen gar nicht weiter darüber zu reden«, sagte er mit unheilverkündender Ruhe. »Nur weil du noch keine Hexapumas oder Gipfelbären gesehen hast, heißt das längst nicht, dass es da draußen keine gibt.«
»Aber ich habe den ganzen Winter lang in der Stube gesessen, ohne etwas unternehmen zu können«, wandte sie in so vernünftigem Ton ein wie möglich. Sie unterdrückte geflissentlich den Anflug von Schuldgefühlen, den die Erinnerung an Schneeballschlachten, Langlaufski, Schlittenfahrten und diverse andere Ablenkungen, bei ihr hervorriefen. »Ich will nach draußen und mich umsehen!«
»Das weiß ich ja, meine Süße«, sagte der Vater sanfter als zuvor und verwuschelte ihr das braune Lockenhaar. »Aber da draußen ist es gefährlich. Du weißt genau, dass wir nicht mehr auf Meyerdahl sind.« Stephanie verdrehte die Augen und bedachte ihn mit einem gequälten Blick. Nun war es an Richard Harrington, ein leichtes Schuldgefühl zu empfinden; diesen letzten Satz hätte er sich besser verkniffen. »Wenn du etwas unternehmen willst, warum magst du dann nicht heute Nachmittag mit Mom nach Twin Forks fahren?«
»Weil Twin Forks absolut hohl ist, Daddy.« Verzweifelter Ärger färbte Stephanies Antwort, obwohl sie genau wusste, wie taktisch unklug das war. Selbst überdurchschnittlich erträgliche Eltern wie die ihren wurden halsstarrig, wenn man ihnen allzu nachdrücklich widersprach – aber mal ehrlich: Twin Forks war zwar der ›Ort‹, der dem Harringtonschen Gehöft am nächsten lag, aber dieses Kaff konnte sich gerade einmal fünfzig Familien rühmen, die dort wohnten, und die meisten von Stephanies Gleichaltrigen in Twin Forks waren echte Zorkköpfe. Keiner davon interessierte sich auch nur im Geringsten für Xenobotanik oder Biosystematik. In ihrer gesamten Freizeit versuchten sie nichts anderes, als irgendein Tier zu fangen, das klein genug war, um es zähmen zu können; ob und wie sehr sie damit ihrem ›Kuscheltier‹ in spe schadeten, war ihnen wohl egal. Stephanie zweifelte keinen Augenblick, dass jedweder Versuch, irgendeinen von diesen Zorks für ihre Erkundungszüge zu rekrutieren, eher früher als später zu einem Wortgefecht oder sogar zu dem einen oder anderen blauen Auge führen müsste. Nicht etwa, dass sie an der Situation Schuld gewesen wäre, in der sie sich nun hier auf Sphinx befand. Sie könnte bereits als Praktikantin auf ihrer ersten Exkursion unterwegs sein, wären nicht ihre Eltern gewesen, die sie ausgerechnet dann von Meyerdahl verschleppten, als man sie endlich beim Jugendprogramm der Forstbehörde angenommen hatte. Stephanie trug jedenfalls nicht die Schuld daran, dass es anders gekommen war, und da konnten sie ihr doch wenigstens erlauben, den eigenen Besitz zu erkunden!
»Twin Forks ist nicht ›absolut hohl‹«, widersprach ihr Vater energisch.
»Und ob«, erwiderte sie mit vorgeschobener Unterlippe, und Richard Harrington holte tief Luft.
Er zwang sich, im Geiste einen Schritt zurückzutreten und mehr Geduld zu sammeln, jenes lebenswichtigste aller elterlichen Talente. Das Bedauern, das er bei Stephanies Gesichtsausdruck empfand, machte es ihm ein wenig leichter, sein Temperament zu zügeln. Freiwillig hatte sie nicht jeden ihrer Freunde und Bekannten auf Meyerdahl zurückgelassen, und er wusste genau, wie sehr sie sich auf das Praktikum bei der Forstbehörde gefreut hatte. Doch Meyerdahl war seit tausend Jahren besiedelt – Sphinx nicht. Zum einen lebten die gefährlichen Raubtiere Meyerdahls nur noch in den Naturschutzgebieten, die man ihnen überlassen hatte, und zum anderen behandelten die Ranger des Forstdienstes ihre Praktikantinnen und Praktikanten wie rohe Eier. Die Naturparks, in denen die Exkursionen der Jugendprogramme stattfanden, waren von vom bis hinten mit Satcomrelais, Überwachungselektronik und schnell verfügbaren Erste-Hilfe-Stationen ›vernetzt‹. Sphinx’ endlose Wälder hingegen waren weder erschlossen, noch wurden sie in irgendeiner Weise überwacht. Dort lebten Raubtiere wie der schreckliche Hexapuma, der fünf Meter lang werden konnte, und der kaum weniger gefährliche Gipfelbär. Zwei Drittel der Flora bestand zudem aus immergrünen Pflanzen, selbst hier in den so genannten Subtropen. Darum konnte auch der beste Vermessungssatellit unter dem grünen Blätterdach nur wenig erkennen. Generationen würden vergehen, bis man auch nur ein ungefähres Bild davon hatte, wie viele Millionen unbekannte Tierarten im Schatten der gewaltigen Bäume lebten.
Folglich stand jede Wiederholung des Erkundungsausflugs, den Stephanie am Vortag unternommen hatte, völlig außer Frage. Sie schwor, sich nicht weit vom Haus entfernt zu haben, und Harrington glaubte ihr. Stephanie hatte ihren eigenen Kopf und konnte gelegentlich durchtrieben sein, aber sie log nicht. Außerdem hatte sie ihr Armbandcom mitgenommen, sodass sie immer erreichbar gewesen war; wäre sie in Schwierigkeiten geraten, hätte er sie anpeilen können. Doch darum ging es überhaupt nicht. Stephanie war seine Tochter, und er liebte sie; wenn sie einem Hexapuma Aug in Auge gegenüberstand, brächten alle Armbandcoms der Welt ihn nicht mehr rechtzeitig in den Flugwagen.
»Hör mir zu, Stephanie«, sagte er schließlich, »ich weiß ja, dass Twin Forks im Vergleich zu Hollister nichts Besonderes ist, aber mehr habe ich dir nicht zu bieten. Du weißt doch, dass der Ort wächst. Man spricht sogar davon, im nächsten Frühling einen eigenen Shuttlelandeplatz zu bauen!«
Stephanie gelang es – irgendwie -, die Augen nicht noch einmal zu verdrehen. Twin Forks im Vergleich zu Hollister als ›nichts Besonderes‹ zu bezeichnen war ungefähr so untertrieben wie die Behauptung, es schneie auf Sphinx ein wenig. Angesichts des langen, sich ewig dahinziehenden, endlosen Jahres auf Sphinx wäre sie im nächsten Frühling schon siebzehn T-Jahre alt! Bei ihrer Ankunft war sie keine zehn Jahre alt gewesen – gerade rechtzeitig zu Winterbeginn war sie mit ihren Eltern eingetroffen. Und dann hatte es fünfzehn T-Monate lang nicht mehr zu schneien aufgehört!
»Es tut mir leid«, sagte der Vater, der ihre Gedanken erriet. »Es tut mir leid, dass Twin Forks nicht besonders aufregend ist, und es tut mir leid, dass du Meyerdahl nicht verlassen wolltest, und es tut mir leid, dass ich dir nicht erlauben kann, auf eigene Faust durch den Wald zu streifen. Aber so ist es nun einmal, meine Süße. Und nun …« – er blickte ihr ernst in die braunen Augen und versuchte, die Tränen nicht zu bemerken, die sich darin sammelten – »versprich mir, dass du tust, worum deine Mom und ich dich bitten.«
Mürrisch schleppte sich Stephanie durch den Schlamm zu dem Pavillon mit dem steilen Dach. Einfach alles auf Sphinx hatte ein steiles Dach; sie gestattete sich ein tiefes Stöhnen, das von Herzen kam, während sie sich auf die kleine Treppe niederließ und darüber nachsann, aus welchem Grund man die Dächer wohl so steil baute.
Es lag natürlich am Schnee. Selbst hier, so dicht an Sphinx’ Äquator, maß man den jährlichen Schneefall in Metern – vielen Metern. Häuser benötigten steile Dächer, um nicht unter dem Gewicht des gefrorenen Wassers einzustürzen, zumal die Schwerkraft des Planeten um ein Drittel höher war als auf Alterde. Nicht, dass Stephanie jemals Alterde besucht hätte – oder irgendeine andere Welt, auf der die Schwerkraft deutlich niedriger war als auf Sphinx.
Sie seufzte, empfand tiefe Melancholie und wünschte sich, ihre Urururur-undsoweiter-Großeltern hätten sich nicht freiwillig zur Ersten Meyerdahl-Welle gemeldet. Kurz nach ihrem achten Geburtstag hatten ihre Eltern sie ernst beiseite genommen und ihr genau erklärt, was die Kolonisation von Meyerdahl eigentlich bedeutet hatte. Das Wort ›Dschinn‹ kannte sie damals schon, obwohl sie nicht wusste, dass es zumindest technisch auch auf sie zutraf. Doch sie ging erst seit vier T-Jahren zur Schule, und in Geschichte waren sie noch nicht beim Letzten Krieg von Alterde angelangt. Deshalb wusste Stephanie nicht, weshalb manche Menschen schon auf die bloße Erwähnung von Änderungen am menschlichen Erbgut so heftig reagierten – und warum diese Leute ›Dschinn‹ als schlimmstes Schimpfwort der standardenglischen Sprache ansahen.
Nun wusste sie es und hielt noch immer jeden, der so dachte, für albern. Natürlich waren die Biowaffen und ›Supersoldaten‹ im Letzten Krieg schlechte Ideen gewesen, und sie hatten furchtbaren Schaden auf Alterde angerichtet. Aber das lag doch nun schon fünfhundert T-Jahre zurück, und mit den Leuten aus den Ersten Wellen von Meyerdahl oder Quelhollow hatte der Letzte Krieg nicht das Geringste zu tun. Stephanie war mittlerweile ganz froh, dass die ersten manticoranischen Siedler Sol schon vor dem Letzten Krieg verlassen hatten. Ihre altmodischen Kälteschläfer waren über sechs T-Jahrhunderte lang unterwegs gewesen und hatten so die Ereignisse verpasst – aber auch nicht die Vorurteile abbekommen, die damit zusammenhingen.
Zum Glück gab es fast nichts, was irgendjemandes Aufmerksamkeit auf die Veränderungen lenkte, die von den Genetikern an den Meyerdahl-Kolonisten vorgenommen worden waren. Auf die Masse bezogen waren Stephanies Muskeln um ungefähr fünfundzwanzig Prozent leistungsfähiger als die Muskeln ›reinblütiger‹ Menschen, und um diese Muskeln mit Energie zu versorgen, lief ihr Stoffwechsel um gut ein Fünftel schneller. Am Atmungssystem und Kreislauf der Meyerdahler waren geringfügige Verbesserungen vorgenommen worden, und ihre Knochen hatte man verstärkt. Alle Veränderungen waren dominant, sodass alle Nachkommen sie aufwiesen. Stephanies Abart von Dschinn war mit reinblütigen Menschen voll fortpflanzungsfähig, und Stephanie fand, dass die Unterschiede zusammengenommen nicht sehr viel ausmachten. Sie bewirkten nur, dass ihre Eltern und sie weniger Muskelgewebe brauchten, um eine bestimmte Körperkraft zu besitzen, und hervorragend an Hochschwerkraftweiten angepasst waren, ohne klein und stämmig zu sein, ohne hässliche, wulstige Muskeln. Doch nachdem sie vom Letzten Krieg und über einige der Anti-Dschinn-Bewegungen gelesen hatte, gab sie ihren Eltern Recht: Es war besser, nicht jedem Fremden gleich auf die Nase zu binden, dass ihre Gene verändert worden waren. Ansonsten dachte sie selten darüber nach – nur manchmal überlegte sie bitter, wie sich ihre Eltern wohl entschieden hätten, wenn sie keine Dschinni gewesen wären. Hätte die hohe Schwerkraft auf den Planeten des Doppelsterns Manticore ihre Eltern vielleicht davon abgehalten, Stephanie einfach hierher in diese Ödnis zu zerren, wo man das Licht mit dem Hammer ausmachte?
Stephanie nagte an ihrer Unterlippe und lehnte sich zurück. Ihr Blick schweifte über die isolierte Lichtung, in der sie auf Beschluss ihrer Eltern festsaß. Das grüne hohe Dach des Haupthauses war ein heiterer, farbenfroher Klecks vor den noch kahlen Pfostenbäumen und Kroneneichen, die es umringten. Stephanie indes war nicht der Laune, sich von dem Anblick aufheitern zu lassen, und deshalb gelangte sie rasch zu dem Urteil, dass Grün jedenfalls eine dumme Farbe sei für ein Dach. Etwas Dunkles, Stumpfes – braun vielleicht, oder sogar schwarz – hätte ihr besser gefallen. Und wo sie schon bei unpassendem Baumaterial war, wieso hatte man nicht etwas Bunteres benutzt als grauen Naturstein? Gewiss, Naturstein war am billigsten, das wusste sie selbst, aber um die nötige Wärmeisolation für einen sphinxianischen Winter herzustellen, brauchte man Wände, die über einen Meter dick waren. Als würde man in einem Verlies leben, dachte sie … Dann hielt sie inne und freute sich an dem Vergleich. Ganz hervorragend passte er zu ihrer Stimmung, und sie merkte ihn sich für spätere Verwendung.
Nachdem sie noch einen Augenblick nachgedacht hatte, schüttelte sie sich und blickte mit einem Verlangen auf die Bäume hinter dem Wohngebäude und den sich daran anschließenden Gewächshäusern, dass sie einen fast körperlich spürbaren Schmerz empfand. Manche Kinder wollten Raumfahrer oder Wissenschaftler werden, kaum dass sie das Wort aussprechen konnten, doch Stephanie zog es nicht zu den Sternen, sondern – ins Grüne. Sie wollte dahin gehen, wo noch nie jemand zuvor gewesen war – aber nicht durch den Hyperraum, sondern auf einen warmen, belebten Planeten, auf dem man atmen konnte. Sie wünschte sich Wasserfälle und Berge, Bäume und Tiere, die noch nie zuvor einem Zoo gehört hatten. Und sie wollte diejenige sein, die all dies entdeckte und als Erste studierte, verstand und beschützte …
Vielleicht lag es an ihren Eltern, überlegte sie; der Groll über des Vaters Verbot war vergessen – bis auf weiteres. Richard Harrington hatte in terranischer und Xeno-Veterinärmedizin abgeschlossen; akademische Grade, die ihn für eine Grenzwelt wie Sphinx weitaus wertvoller machten als für seinen Heimatplaneten, dennoch war er auf Meyerdahl immer wieder von der Forstbehörde herangezogen worden. Dadurch war Stephanie mit dem Tierreich ihrer Geburtswelt schon früh in viel engere Berührung gekommen als die meisten Menschen im ganzen Leben. Der Beruf ihrer Mutter – sie war promovierte Pflanzengenetikerin und darum eine Spezialistin, wie man sie auf neuen Welten händeringend suchte – hatte Stephanie dazu verholfen, schon in sehr zartem Alter auch die Schönheit von Meyerdahls Flora zu begreifen.
Und dann hatten sie ihre Tochter dort weggerissen und ausgerechnet hier auf Sphinx ausgesetzt.
Als ihr Abscheu wieder erwachte, schnitt Stephanie eine Grimasse. Zum Teil hatte sie sich anfangs der Vorstellung widersetzt, Meyerdahl zu verlassen, zum Teil war sie begeistert gewesen. Sosehr sie auch in den Forstdienst treten wollte, Sternenschiffe und Reisen zwischen den Sternen waren doch etwas Großartiges. Also hatte sie sich auf den Gedanken konzentriert, dass sie im Rahmen einer Rettungsmission auf den neuen Planeten einwandern würde, dessen Bevölkerung fast vollständig von einer Seuche dahingerafft worden war. (Sie musste allerdings zugeben, dass dieser Aspekt weniger entzückend gewesen wäre, hätten die Ärzte nicht bereits ein Heilmittel für die betreffende Krankheit gefunden.) Das Tollste daran war, dass das Sternenkönigreich ihren Eltern angeboten hatte, die Reise zu bezahlen, weil beide aufgrund ihrer Berufe besondere Qualifikationen mitbrachten. Daher hatten sie sich mit ihren Ersparnissen ein gewaltiges Stück Land kaufen können, das ihnen allein gehörte. Die Harringtonsche Parzelle bestand aus einem ungefähren Rechteck über dem Steilhang der Copper Walls Mountains und besaß einen prächtigen Blick auf den Tannerman-Ozean. Die Kantenlänge der Parzelle betrug etwa zwanzig Kilometer. Nicht zwanzig Meter im Geviert wie das Grundstück in Hollister, sondern zwanzig Kilometer – damit war es so groß wie eine ganze Großstadt auf Meyerdahl! Und es grenzte noch dazu direkt an eine ausgedehnte Region, die bereits zum Naturschutzgebiet erklärt worden war.
Doch in ihrer Begeisterung hatte Stephanie manches nicht bedacht, wie zum Beispiel den Umstand, dass ihre Parzelle fast tausend Kilometer von jedem Flecken entfernt war, den man als Stadt bezeichnen konnte. Sosehr sie die Wildnis mochte, sie war es nicht gewohnt, abgeschieden von der Zivilisation zu leben. Die Entfernungen zwischen den Ansiedlungen hatten zur Folge, dass ihr Vater auf dem Weg von einem Patienten zum anderen sehr viel Zeit in der Luft verbrachte. Durch das planetare Datennetz versäumte sie die Schule nicht und hatte die eine oder andere kleine Freude – tatsächlich war sie trotz des Umzugs (wieder) Klassenbeste und stand auf Platz 16 der planetaren Schachspielerliste. Die Ausflüge in die Stadt genoss sie (es sei denn, sie benutzte die Mickrigkeit Twin Forks’ als Argument gegen ihre Eltern). Doch von den wenigen Kindern in ihrem Alter, die es in Twin Forks gab, nahm kein einziges am beschleunigten Lehrprogramm teil, also war keins von ihnen in Stephanies Klasse. Außerdem ließ die Ansiedlung sämtliche Annehmlichkeiten vermissen, die Stephanie als selbstverständlich erachtete – denn sie war in einer Stadt mit einer Bevölkerung von fast einer halben Million aufgewachsen. Selbst damit hätte sie sich arrangieren können, hätte es auf Sphinx nicht zwei weitere Übelstände gegeben: Schnee und Hexapumas.
Finstren Gesichts bohrte sie die Stiefelspitze in den matschigen Boden vor der untersten Stufe des Pavillons. Daddy hatte ihr vorher gesagt, dass sie bei Wintereinbruch auf dem Planeten eintreffen würden, und sie hatte geglaubt zu verstehen, was das hieß. Auf Sphinx aber besaß das Wort ›Winter‹ eine ganz andere Bedeutung als auf dem milden, warmen Meyerdahl, wo Schnee aufregend war und Seltenheitswert hatte. Der sphinxianische Winter hingegen dauerte fast sechzehn T-Monate! Das war mehr als ein Zehntel ihres bisherigen Lebens, und mittlerweile konnte sie den Anblick von Schnee einfach nicht mehr ertragen. Da konnte Daddy noch so oft sagen, dass die anderen Jahreszeiten ebenso lange dauern würden. Selbstverständlich glaubte Stephanie ihm das. Intellektuell begriff sie durchaus, dass nun fast vier T-Jahre vergehen würden, bevor der Schnee zurückkehrte. Doch erlebt hatte sie das noch nicht, und nun gab es nichts außer Schlamm. Sehr viel Schlamm, die ersten Knospen auf den Laubbäumen, und jede Menge Langeweile.
Stirnrunzelnd rief sie sich in Erinnerung, dass sie Daddy hatte versprechen müssen, nichts gegen diese Langeweile zu unternehmen. Vermutlich sollte sie froh sein, dass Mom und er sich solche Gedanken um sie machten, aber es war so … so hinterhältig von ihm, ihr dieses Versprechen abzuzwingen. Das war doch, als machte er sie zu ihrer eigenen Gefangenenwärterin, und das wusste er genau!
Erneut seufzte sie, erhob sich, schob die Fäuste in die Jackentaschen und machte sich auf den Weg zum Büro ihrer Mutter. Wahrscheinlich würde es ihr nicht gelingen, Mom auf ihre Seite zu ziehen und Daddy zu bewegen, es sich noch einmal zu überlegen, aber sie konnte es wenigstens versuchen. Und von ihr hatte Stephanie wenigstens ein bisschen Mitgefühl zu erwarten.
Dr. Marjorie Harrington stand am Fenster und lächelte, als sie Stephanie aufs Haus zutrotten sah. Sie wusste, wohin ihre Tochter wollte – und was sie dann immer plante. Im Prinzip schätzte sie es nicht besonders, wenn Stephanie versuchte, das eine Elternteil auf ihre Seite zu ziehen, wenn das andere ein Gebot ausgesprochen hatte. Andererseits hatte sie zu viel Verständnis für ihr einziges Kind, um deswegen nun böse zu sein. Und eins musste man Stephanie lassen: Sosehr ein Verbot ihr auch missfiel, sosehr sie sich auch wand, um es wieder loszuwerden – wenn sie einmal versprochen hatte, es einzuhalten, dann war auf sie Verlass.
Dr. Harrington wandte sich vom Fenster ab und kehrte an ihren Terminalschreibtisch zurück. In den siebzehn T-Monaten, die Richard und sie nun auf Sphinx lebten und arbeiteten, waren ihre Dienste immer gefragter geworden. Im Gegensatz zu ihrem Mann brauchte sie ihre Kunden nur selten zu besuchen. Bei den wenigen Gelegenheiten, zu denen man mit elektronischer Datenübertragung nicht auskam und fassbare Proben benötigte, konnten die Kunden die Daten an ihr kleines, aber gut ausgestattetes Laboratorium mit eigenen angeschlossenen Treibhäusern liefern, das sie hier auf dem Gehöft eingerichtet hatte. Marjorie genoss das Gefühl von Freiheit, das sie dadurch erlangte. Alle drei bewohnbaren Planeten des Doppelsterns Manticore wiesen bemerkenswert menschenverträgliche Biosysteme auf. Bislang war Dr. Harrington jedenfalls noch auf kein Problem gestoßen, für das sie nicht schnell eine Lösung gefunden hätte – wenn man von dem Geheimnis des verschwindenden Selleries absah, doch das fiel nicht in ihr Spezialgebiet. Darüber hinaus genoss sie das Gefühl, hier beim Aufbau von etwas Neuem, Außergewöhnlichem mitzuhelfen. Auf dem schon lange besiedelten Meyerdahl hatte ihr das gefehlt. Nun aber schaltete sie ihr Terminal auf Bereitschaft und lehnte sich zurück, um über das bedrohlich näher rückende Gespräch mit Stephanie nachzudenken.
Manchmal glaubte die geplagte Mutter, es wäre vielleicht auch schön, ein etwas weniger begabtes Kind zu haben. Stephanie wusste bereits, dass sie die Gleichaltrigen in der Schule lange überflügelt hatte und einen überdurchschnittlich hohen Intelligenzquotienten besaß. Was sie nicht wusste und was ihre Eltern ihr auch noch nicht zu sagen beabsichtigten, war die Tatsache, dass ihre Leistungen sie mitten in die geistigen oberen zehn Prozent der Spezies Mensch setzten. Tests wurden nach wie vor umso unzuverlässiger, je höher die Intelligenz der Testperson war. Deshalb fiel es schwer, Stephanie Harrington genau einzuordnen, doch Marjorie wusste aus eigener Erfahrung, wie schwierig es sein konnte, aus einer Diskussion mit ihrer Tochter als Sieger hervorzugehen. Tatsächlich sahen sich die Eltern letztendlich häufiger als ihnen recht war gezwungen, zu einem entschiedenen »Weil wir es so sagen und basta!« Zuflucht zu nehmen, wenn Stephanie sie mit einer schier endlosen und einfallsreichen Kette absolut folgerichtiger Einwände konfrontierte (folgerichtig zumindest aus Stephanies Perspektive). Marjorie verabscheute es, eine Diskussion auf diese Weise beenden zu müssen, doch musste sie eingestehen, dass Stephanie damit viel besser zurande kam als Marjorie, als sie im gleichen Alter wie ihre Tochter gewesen war.
Denn begabt oder nicht, Stephanie war erst elf. Sie hatte noch nicht recht begriffen, was Sphinx’ lange Jahreszeiten bedeuteten. In den nächsten Wochen würde Stephanie durch lange, traurige Seufzer, lustlosen, schleppenden Gang (wenn jemand hinsah zumindest) und weitere traditionsreiche Zeichen ihre hartherzigen Eltern darauf aufmerksam machen, wie grausam sie ihre Nachkommenschaft unterdrückten. Doch angenommen, man überlebte so lange, um den Frühling einziehen sehen zu können, würde Stephanie feststellen, dass Sphinx ohne Schnee weitaus interessanter war, als sie nun glaubte. Marjorie nahm sich fest vor, einige Zeit mit ihrer Tochter abseits des Terminalbildschirms zu verbringen.
Zwar würde sie mit ihrer Tochter nicht, so viele Stunden im Wald verbringen können, wie Stephanie es sich gewünscht hätte, aber doch genug Zeit finden, dass sich Stephanie zumindest an gewisse Regeln gewöhnte.
Sie hielt gedanklich inne und lächelte, als ihr eine weitere Idee in den Sinn kam. Auf sich allein gestellt konnten sie Stephanie nicht durch den Wald streifen lassen, vielleicht aber gab es eine Möglichkeit, sie ein wenig abzulenken. Stephanie gehörte zu den Menschen, die das Kreuzworträtsel in der Yawata Crossing Times mit unlöschbarer Tinte ausfüllen. Einer Herausforderung konnte sie nicht widerstehen, und deshalb mochte es möglich sein, sie in die richtige Richtung …
Marjorie stellte die Rückenlehne wieder auf und zog einen Stapel Ausdrucke heran, als sie Schritte hörte, die sich durch den Flur ihrem Büro näherten. Rasch zog sie die Schutzkappe von einem Stift und beugte sich mit konzentriertem Gesicht über den Papierstoß. Im nächsten Moment klopfte Stephanie an den Rahmen der offen stehenden Tür.
»Mom?«
Dr. Harrington gestattete sich ein mitfühlendes Lächeln, als sie die aufgesetzte Verletztheit in Stephanies Tonfall hörte, dann verscheuchte sie den Gesichtsausdruck und blickte auf.
»Komm herein, Stephanie«, sagte sie einladend und lehnte sich wieder zurück.
»Könnte ich dich kurz sprechen?«, bat Stephanie, und Marjorie nickte.
»Aber natürlich. Was hast du auf dem Herzen?«
3
Klettert-flink hockte wieder auf seinem Beobachtungsplatz, doch der sonnenleuchtende Himmel von vor drei Tagen hatte sich nun in dunkle, schwarzgraue Holzkohle verwandelt, und von den Bergen im Westen wehte kalter Wind heran. Er brachte den Geruch nach Stein und Schnee mit sich, in den sich die helle Schärfe von Donner mischte. Der Wind blies auch über die Lichtung der Zwei-Beine. Klettert-flink klappte die Ohren zurück und blinzelte in den Wind, der ihm das Fell zerzauste. Er roch nicht nur Donner, sondern auch Regen in dem starken Luftzug. Die Aussicht, durchnässt zu werden, freute ihn wenig, und wenn es blitzte, war sein Beobachtungsposten sogar gefährlich. Trotzdem plante er noch nicht, nach einer Deckung zu suchen, denn weitere Gerüche verrieten ihm, dass seine Zwei-Beine in einem ihrer durchsichtigen Pflanzennester etwas Interessantes vorhatten.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!