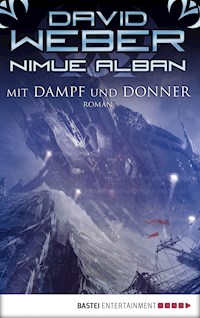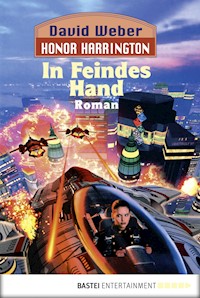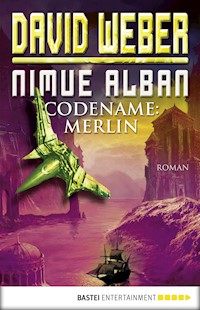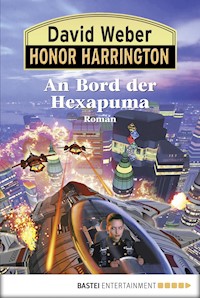9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Honor Harrington
- Sprache: Deutsch
Seit Jahrzehnten sät das Mesanische Alignment - eine Geheimorganisation, die Menschen nach ihrem genetischen Wert bemisst - Zwist zwischen der Republik Haven und dem Sternenkönigreich von Manticore. Ihr Ziel: Selbst zur einflussreichsten Sternennation aufzusteigen. Doch die Geheimdienstler Anton Zilwicki und Victor Cachat - der eine Manticoraner, der andere ein Havenit - wollen dem ein Ende bereiten. Um mehr über die geheimen Pläne des Alignments herauszufinden, begeben sie sich in die Unterwelt Mesas, wo sie schon bald gnadenlos gejagt werden und feststellen müssen, dass ihr Feind noch weit bösartiger und skrupelloser ist als geahnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 640
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Mai 1922 P.D.
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Juni 1922 P. D.
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Juli 1922 P. D.
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
August 1922 P.D.
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Personenverzeichnis
David WeberEric Flint
RÜCKKEHRNACH MESA
Roman
Aus dem amerikanischen Englischvon Dr. Ulf Ritgen
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2014 by Words of Weber, Inc. & Eric Flint
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Cauldron of Ghosts«
Originalverlag: Baen Books
Published by Arrangement with Baen Books, Wake Forest, NC, USA
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur
Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titelillustration: Arndt Drechsler, Regensburg
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München
E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-1512-7
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Jim Baen, der Autoren Chancen gegeben hat.
Mai 1922 P.D.
»Na und? Victor kann praktisch alles in einen Scherbenhaufen verwandeln.«
Yana Tretiakovna,Geheimagentin im Dienste Torchs
Kapitel 1
»Und was jetzt?«, fragte Yana Tretiakovna.
Sie verschränkte die Arme vor der Brust und lehnte sich in ihren bequemen Sessel zurück. Dabei bedachte sie Anton Zilwicki und Victor Cachat, die beiden einzigen anderen Anwesenden im Raum, mit einem beeindruckend finsteren Blick. Zilwicki hockte auf der Vorderkante seines Sitzes und begutachtete konzentriert einen Computerbildschirm; Cachat hingegen hatte sich in einen Sessel gefläzt und blickte beinahe ebenso verstimmt drein wie Yana.
»Ich weiß es nicht«, antwortete er mit gedämpfter Stimme. »Ich habe oben …«, mit ausgestrecktem Finger deutete er in Richtung Zimmerdecke, »nicht näher zu benennende, aber zweifellos erlesen hochgestellte Persönlichkeiten schon um eine Antwort auf diese Frage ersucht.«
Wer Cachat nicht gut genug kannte, aber immerhin wusste, dass er bekennender Atheist war, hätte diese Geste missverstehen können und nun meinen, er hätte plötzlich doch zum Glauben gefunden. Denn jenseits besagter Zimmerdecke befand sich nichts weiter als der freie Himmel. Die enorm großzügig geschnittene Suite, die sich die drei Anwesenden teilten, lag im obersten Stockwerk eines ehemaligen Luxushotels in Havens Hauptstadt. Vor Jahrzehnten hatte die Geheimpolizei der Legislaturisten das Gebäude für eigene Zwecke requiriert. Nach der Revolution – der jüngsten Revolution, heißt das – hatte die neue Regierung sich vergeblich bemüht, die rechtmäßigen Eigentümer des Gebäudes ausfindig zu machen. Doch alle waren sie entweder nachweislich verstorben oder spurlos verschwunden. Da die Regierung nicht wusste, was sie sonst mit dem Bauwerk hätte anstellen sollen, war es zu einer Kombination aus konspirativem Unterschlupf und Luxusresidenz für Gäste der Regierung umfunktioniert worden.
Victor jedenfalls war sich, das war offenkundig, der Ironie, die seiner Geste innewohnte, keineswegs bewusst. Im selben missmutigen, ja, beinahe schon angewiderten Flüsterton setzte er hinzu: »Bislang hätte ich die Frage aber genauso gut auch einer Straßenlaterne stellen können – falsch: Die Straßenlaterne hätte wenigstens noch ein bisschen Licht in die Angelegenheit gebracht!«
Anton verzog die Mundwinkel zu einem schiefen Grinsen. »Ich glaube, die Frage sollte nicht ›Was jetzt?‹ heißen, sondern ›Wohin jetzt?‹.« Er deutete auf den Bildschirm. »Sehen Sie das da?«
Langeweile wich Neugier: Victor und Yana erhoben sich aus ihren Sesseln und blickten nach ein paar Schritten auf das, was Zilwicki ihnen auf dem Bildschirm zeigen wollte.
»Was zur Hölle ist das denn?«, fragte Yana entgeistert. »Das sieht ja aus wie ein Rührei auf Steroiden!«
»Das ist ein Astrogationsdisplay, das den gesamten eingehenden und ausgehenden Verkehr dieses Planeten zeigt«, erklärte Victor ihr. »Und damit bin ich auf diesem Gebiet auch schon am Ende mit meinem Latein. Interpretieren kann ich so etwas nicht.«
Yana starrte immer noch den Bildschirm an. Sie war eindeutig beunruhigt, was bei Schwätzern höchst selten war – allerdings gehörte sie schon lange nicht mehr zu einer der Einheiten dieser im Genlabor gezüchteten Elitesoldaten.
»Wollen Sie mir jetzt tatsächlich auftischen«, bohrte sie nach, »dass auf diese Weise die Flugleitstelle alles an einkommendem und abfliegendem Verkehr zu Umlaufbahnen oder Landezonen lotst? Wenn das sicher sein soll, müssen die dem Wort ›Sicherheit‹ eine ganz neue Definition verpasst haben, und ich steige ganz sicher nie wieder in etwas, das fliegt! Und Drachen steigen lasse ich in Zukunft auch nicht mehr.«
»Keine Panik, Yana!«, gab Anton zurück. »So ein Kompaktdisplay verwendet da niemand – ganz zu schweigen davon, dass sämtliche Orbitalrouten ohnehin von Computern ausgewählt und überwacht werden. Nein, ich habe mir das selbst zusammengestellt, einfach nur um zu schauen, ob ich mit meiner Vermutung richtig liege: Dass der Verkehr hier großräumig umgeleitet wird, um nicht in den offiziellen Flugplänen verzeichnete Starts zu ermöglichen.«
Er deutete mal hier, mal dorthin – nichts von dem, auf das sein Finger zeigte, verriet seinen beiden Begleitern viel. »Sie schaffen Schlupflöcher, wenn Sie so wollen.«
Victor und Yana blickten erst einander an, dann schauten sie auf Anton hinab.
»Und wer oder was schlüpft da hindurch?«, fragte Yana.
Zilwicki hob die massigen Schultern, ehe er sie wieder hinabsacken ließ. Bei einem normal gebauten Menschen, dessen Gestalt keine Ähnlichkeit mit einem Zwergenkönig aus dem Märchen gehabt hätte, wäre das wohl als Schulterzucken durchgegangen.
»Woher soll ich das wissen?«, versetzte er. »Das wird Victor herausfinden müssen – von seinen nicht näher zu benennenden, aber zweifellos erlesen hochgestellten Persönlichkeiten.«
In einer Slawisch klingenden Sprache gab Yana etwas zweifellos nicht Druckreifes von sich. Victor hingegen, der bei unflätiger Sprache stets ein wenig … schüchtern war, beschränkte sich auf ein: »Ach, jemine.« Ein oder zwei Augenblicke später steigerte er das Ganze zu: »Heiliger Bimbam.«
Es war Yanas und Victors Stimmung immens zuträglich, nur wenige Minuten später von jenem Gefühl der völligen Ungewissheit erlöst zu werden. Kevin Usher und Wilhelm Trajan sorgten dafür. Usher war der Leiter von Havens Staatspolizei, Trajan der Direktor des Foreign Intelligence Service, des wichtigsten Nachrichtendienstes der Republik.
Sie waren vor der Suite erschienen, hatten den Türsummer betätigt und waren daraufhin von Yana eingelassen worden. Kaum dass sie auf der Schwelle standen, sprang Victor auf.
»Kevin«, begrüßte er den ersten der beiden Besucher unverbindlich. Dann nickte er Trajan zu: »Boss.«
»Jetzt nicht mehr«, entgegnete Wilhelm und blickte sich nach einer Sitzgelegenheit um. Er entdeckte einen Sessel, ging darauf zu und ließ sich mit wohligem Seufzen hineinsinken. Sein Körper verschmolz sozusagen mit dem Möbel – ganz typisch für jemanden, der sich nach langer Zeit intensiver Anspannung endlich entspannen durfte.
»Sie wurden mit sofortiger Wirkung dem Foreign Office zugeteilt«, erläuterte er seine kryptischen ersten Worte. »Damit gehören Sie nicht mehr zum FIS.«
Die Vorstellung, nicht länger mit jenem Mann zusammenzuarbeiten, den Wohlinformierte – darunter auch Trajan selbst – für den brillantesten und fähigsten Agenten von ganz Haven hielten, schien Trajan nicht sonderlich zu bestürzen. Als Präsidentin Pritchart ihn über ihre Entscheidung informierte, Cachat zu versetzen, hatte er als Erstes gefragt, ob das nun hieße, dass er wieder einen Geheimdienst leiten dürfe, anstatt Löwenbändiger zu spielen.
Usher hatte sich einen Sitzplatz gewählt, der von Trajans beinahe schon auffällig weit entfernt war. »Das ist eine Wahnsinns-Beförderung, Victor. Im, äh … rechten Licht betrachtet, heißt das.«
Victor warf ihm einen finsteren Blick zu. »Bei absolut miesen Lichtverhältnissen, meinen Sie.«
Ushers Miene verriet Zorn. »Ach, um Himmels willen, Victor! Wenn wir im Bild bleiben wollen: Nein, mein Bester, dass soll nicht heißen, Sie brauchen jetzt ein Nachtsichtgerät! Im Gegenteil: Ich spreche hier vom Licht einer Flutlichtanlage, die was kann. Die Zeiten, in denen Sie sich im Schatten herumdrücken mussten, sind für Sie endgültig aus und vorbei. Vorbei – mit Pauken und Trompeten. V-O-R-B-E-I.«
Trajan schlug etwas mildere Töne an. »Seien Sie doch realistisch, Victor! Nach Ihren Heldentaten im Zusammenhang mit der, nennen wir es … Umbildung des Königreichs von Torch waren Sie doch praktisch sowieso schon aufgeflogen. Viel Deckung war da nicht mehr übrig. Und jetzt, nach dieser Mesa-Geschichte … Sie … und Anton und Yana …«, er nickte den beiden zu, »Sie drei haben gemeinsam den dicksten nachrichtendienstlichen Coup gelandet seit … ach, so etwas hat es doch in der ganzen Geschichte der Galaxis seit wer weiß wie vielen Jahrhunderten nicht mehr gegeben! Meinen Sie wirklich, danach könnten Sie einfach weiter Ihren alten Job machen? Da helfen Ihnen doch selbst Veränderungen der Gesichtszüge und des Körperbaus auf Nanotech-Basis nicht mehr weiter, denn das tarnt schließlich nicht Ihre DNA. Klar, für einen praktisch unbekannten, unbedeutenden Spion mag das ausreichen. Aber bei Ihnen? Jeder, der auch nur vermutet, Sie könnten ihm auf der Spur sein, wird von jedem DNA-Proben nehmen, bei dem es sich auch nur im Entferntesten um Sie handeln könnte!«
»Die SyS hat sämtliche DNA-Aufzeichnungen zu meiner Person vernichtet – abgesehen von den Messdaten am Tag meines Akademieabschlusses an der Akademie«, erklärte Victor. »Die aber sind bestens geschützt, und ich habe sorgfältig darauf geachtet, meine DNA nicht einfach in der Gegend zu verstreuen.« Sein Tonfall klang unverkennbar gereizt.
»Stimmt«, warf Anton ein. »Wer darauf wartet, dass Special Officer Cachat einen Becher, aus dem er getrunken hat, einfach nur abstellt oder fortwirft, wartet, zugegeben, bis er schwarz wird. Aber hören Sie, Victor, Sie kennen die jetzige Lage doch. Solange Sie sich immer bedeckt gehalten haben und niemand gezielt nach Ihrer DNA gesucht hat, mochten Vorsichtsmaßnahmen wie diese ja ausgereicht haben, aber jetzt?«
»Eben«, unterstrich Trajan. Mit dem Kinn deutete er in Richtung des Panoramafensters, das einen atemberaubenden Ausblick auf Nouveau Paris bot. »Das Ganze ist doch schon jetzt zu den Medien durchgesickert. Noch ein paar Tage – allerhöchstens noch eine Woche –, dann kennt jeder hier auf Haven mit ein bisschen Interesse an Nachrichten und einem Alter über fünf Ihren Namen und Ihr Gesicht. Und noch viel wichtiger: Das Gleiche gilt natürlich auch für jeden Nachrichtendienst in der gesamten Galaxis … und die werden allesamt nach DNA-Spuren von Ihnen suchen. Früher oder später muss eine solche Suche unweigerlich Erfolg haben. Also geben Sie diesen Job endlich auf! Und machen Sie sich gar nicht erst die Mühe, darüber mit Kevin oder mir zu diskutieren. Präsidentin Pritchart hat eine Entscheidung getroffen. Wenn Sie dagegen angehen wollen, werden Sie sich wohl Mittel und Wege überlegen müssen, die Präsidentin aus dem Amt zu jagen.«
Mit einer großen Hand fuhr sich Usher über das Gesicht. »Wilhelm, er kommt schon von allein auf genug dumme Ideen. Sie brauchen ihm jetzt nicht noch neue einzugeben!«
Verdutzt blickte Trajan ihn an. »Was? Ich habe doch nur …« Schlagartig wurde seine Miene sehr besorgt. »Officer Cachat …«
»Nein, keine Sorge, ich plane keinen Staatsstreich!«, versetzte Victor sarkastisch. »Ich bin immer noch Patriot, Sie verstehen, ja? Abgesehen davon kann ich der Präsidentin die Entscheidung nicht einmal verdenken.« Dann verfinsterte sich seine Miene. »Ganz offenkundig wurde sie von boshaften Ratgebern schlecht beeinflusst.«
Anton lachte leise. »Ganny hat Sie gewarnt, Victor! Jetzt sind Sie dran mit den reißerischen Videoberichten! Ich hätte ja Mitleid mit Ihnen, nein, wirklich … aber ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern, dass Sie Mitgefühl gezeigt hätten, als seinerzeit meine Deckung aufflog!«
Anton blickte zu Yana hinüber. »Was glauben Sie, Yana? Ganny hat ja seinerzeit vermutet, die Medien würden sich für ›Cachat, der Tod der Sklavenhändler‹ oder ›Victor der Schwarze‹ entscheiden.«
»›Victor der Schwarze‹«, antwortete sie augenblicklich. »Eines muss man Victor lassen: Zu Theatralik neigt er nun wirklich nicht. ›Der Tod der Sklavenhändler‹ ist einfach zu … zu … das ist einfach nicht Victor. Außerdem: Schauen Sie ihn sich doch an!«
Victor blickte gerade noch finsterer drein als zuvor.
»Dann wird’s also ›Victor der Schwarze‹«, verkündete Anton. »Victor, Sie müssen sich etwas Neues zum Anziehen kaufen. Leder, von Kopf bis Fuß. Schwarzes Leder, natürlich, aber das versteht sich ja von selbst.«
Einen kurzen Moment lang sah es aus, als würde Victor explodieren. Oder zumindest zu einem für seine Verhältnisse sehr deftigen Schimpfwort greifen. Doch … nichts geschah. Anton war nicht überrascht. Victors Heldentaten der jüngsten Zeit verdienten ein Wort wie, nun, wie … extravagant. Er selbst aber war es nicht, nichts an ihm. Er war ein absolut bescheidener Mensch – und jemand, der sich außergewöhnlich gut zu beherrschen wusste.
Und so war alles, was er sagte – und das auch noch völlig ruhig und tonlos: »Und wie sieht nun meine neue Verwendung aus? Ich warne Sie: Wenn es etwas mit gesellschaftlichen Ereignissen zu tun hat, bei denen man gepflegt Cocktails trinkt, bin ich dafür ungeeignet. Ich trinke nicht. Nie.«
»Stimmt«, bestätigte Yana. »Er ist wirklich sterbenslangweilig! Na ja, außer wenn er gerade Regierungen stürzt und so.« Sie kicherte – was Anton noch nie zuvor gehört hatte. »Victor bei Gesellschaftsereignissen, in nettem, belanglosem Small Talk: Ich kann’s mir lebhaft vorstellen!«
Nun versuchte Victor einen Blick, der seinen Langmut unterstrich. Usher hingegen wirkte schon wieder zornig.
»Wir sind doch keine Idioten!«, sagte er. »Victor … und Sie, und Sie auch«, er zeigte mit dem Finger auf jeden der drei und schwenkte dabei den ausgestreckten Arm wie einen Geschützturm herum, »Sie alle gehen nach Manticore, und zwar morgen. Also packen Sie Ihre Sachen zusammen.«
Anton hatte ohnehin nach Manticore reisen wollen, und das so rasch wie möglich. Seit über einem Jahr hatte er seine Lebensgefährtin Cathy Montaigne nicht mehr gesehen. Doch bislang war ihm noch kein Grund für diese Reise eingefallen, den man den diversen herrschenden Kreisen schmackhaft hätte machen können. Und so war es eine echte Überraschung für ihn, dass man ihm nun einen solchen Grund lieferte: Ihm fiele nun das Ganze in den Schoß – ohne dass er sich dafür hatte anstrengen müssen.
Victor suchte seinen Blick und lächelte. Echte Wärme und Zuneigung lagen in diesem Lächeln – und das bekam man bei ihm wahrlich nicht oft zu Gesicht. Nicht zum ersten Mal war Anton überrascht, dass sich zwischen ihm und dem havenitischen Agenten etwas entwickelt hatte, das absolut unwahrscheinlich gewesen war: Freundschaft. Und dass eine Freundschaft zwischen ihnen so unwahrscheinlich gewesen war, machte ihre Beziehung zueinander noch enger.
Natürlich gab es Menschen, die Anton lieber mochte als Victor. Aber es gab nur sehr wenige Menschen, denen er so sehr vertraute wie ihm.
»Und in welcher Eigenschaft reise ich dorthin?«, fragte er Usher nun. »Irgendwie fällt es mir trotz all der neu gewonnenen Herzlichkeit schwer zu glauben, dass ich seit Neuestem dem Foreign Service von Haven angehören soll.«
Usher grinste ihn an. »Nun, Sie werden sich sicher erinnern, dass ich während des von Ihnen provozierten Manpower-Zwischenfalls gerade auf Alterde war. Aber nach allem, was man so hört darüber, würde wohl kein System, das noch halbwegs bei Verstand ist, Sie in sein diplomatisches Korps aufnehmen.«
»Ich habe es nicht vergessen, nein. Beides nicht.«
Das war nun etwas, das Anton wohl kaum vergessen würde. Offiziell war der Zwischenfall nie kommentiert worden, und bis zum heutigen Tage weigerte sich Victor kategorisch, noch offene Fragen zu beantworten. Trotzdem war Anton überzeugt davon, dass Kevin Usher derjenige gewesen war, der im Hintergrund die Strippen gezogen hatte. Er hatte Cachat und dem Audubon Ballroom die Drecksarbeit überlassen, doch letztendlich war er, Usher, eindeutig verantwortlich für alles.
Anton verdankte damit neben Cachat Kevin Usher, dass Helen, seine Tochter, noch lebte … nein, nicht nur Helen, sondern dass alle seine Kinder, auch Berry und Lars, die er ja adoptiert hatte, noch lebten. Die Weisheit war alt und hätte eigentlich keiner nachdrücklichen Erinnerung dieser Art gebraucht: Nur weil man die Ideologie eines anderen nicht teilte, bedeutete das noch lange nicht, dass man besagte Ideologie nicht ernst nahm. Anton teilte Havens politische Ideale nicht – na ja, manche zugegebenermaßen schon –, aber es waren eben diese Ideale Havens gewesen, die seine Familie beschützt hatten.
In seinen Überlegungen so weit gediehen, hellte sich Antons Stimmung merklich auf; er bekam regelrecht gute Laune. Auf Manticore ahnte man es wahrscheinlich noch nicht, doch die Informationen, die Victor und er von Mesa mitgebracht hatten, würden große Wirkung entfalten. Wenn alles so liefe, wie sich das – zumindest nach Antons Meinung – Eloise Pritchart dachte, würden besagte Informationen nicht nur den längsten und erbittertsten Krieg in der Geschichte der Galaxis beenden, sondern zwei Erzfeinde zu Verbündeten machen. Diese Verbündeten mochten sich mit der neuen Lage vielleicht nur zögerlich und mit einigem Unbehagen abfinden, aber sie wären trotzdem Verbündete. Die Informationen, um die es ging, würden dann auch ein Schlaglicht auf eine Freundschaft werfen, sie sozusagen ins rechte Licht rücken: Endlich dürfte er dann die Vorsicht, die Vorbehalte, die er Victor Cachat gegenüber bislang immer noch gehegt hatte, ablegen. Auf einen Schlag.
Irgendetwas in Victors Miene verriet ihm, dass dem Haveniten genau die gleiche Erkenntnis gekommen war. Doch dieser sagte nur: »Stimmt wohl. Für Diplomaten jeglicher Couleur dürfte ich gewissermaßen ein Problemkind sein. Aber Anton auf diplomatischem Parkett – das dürfte ein wahrer Albtraum für sie sein.«
»Womit wir, Kevin, auf meine Frage an Sie zurückkommen, die Sie bisher zu beantworten verabsäumten«, warf Anton ein.
Usher zuckte mit den Schultern. »Woher zum Teufel soll ich das wissen? Mir hat Eloise bloß gesagt, ich solle Sie drei zusammentreiben – und gemeinsam mit Herlander Simões nach Manticore schaffen. Victor, streng genommen sind Sie natürlich nicht dem Foreign Service zugeteilt.« Er warf Trajan einen tadelnden Blick zu. »Da hat Wilhelm ein wenig zu dick aufgetragen. Nun, als Eloise beschloss, Sie, Victor, aus dem FIS abzuziehen, waren nun einmal auch Leslie Montreau und Tom Theisman zugegen. Tom ließ eine Bemerkung fallen, also so in der Art: Eloise zöge es sicher vor, in einer so sensiblen Abteilung wie dem FIS keinen Wahnsinnigen zu haben, der sich wie ein Elefant im Porzellanladen gebärde. Also, das waren seine Worte, nicht meine.«
»Was ist denn ein ›Porzellanladen‹?«, fragte Yana.
»Es handelt sich um eine uralte Redensart«, erläuterte Anton. »Porzellan war früher eine als ganz besonders edel angesehene Keramikart.«
»Na und? Was soll nun damit gemeint sein?«
»Porzellan war sehr zerbrechlich, viel zerbrechlicher als Betokeramik. Einen Laden, in dem so etwas Fragiles verkauft würde, könnte Victor in Nullkommanix in einen Scherbenhaufen verwandeln.«
»Ähm, gleich noch mal: Na und? Victor kann praktisch alles in einen Scherbenhaufen verwandeln.«
Ungeduldig wedelte Victor mit der Hand. »Also, wem oder was wurde ich denn jetzt nun wirklich zugeteilt?«
Usher kratzte sich am Kopf. »Na ja … eigentlich niemandem. Eloise findet nur, Ihre Anwesenheit auf Manticore wäre für das Zustandekommen der Allianz wohl unerlässlich.«
»Warum? Anton weiß doch über die ganze Sache genauso viel wie ich – und er ist obendrein auch noch Manticoraner.«
Schon wieder wirkte Usher verärgert. Rasch mischte sich Anton wieder in das Gespräch ein.
»Genau darum geht es wohl, Victor«, versuchte er zu vermitteln. »Ich gelte im Sternenkönigreich sozusagen als bekannte Größe. Ich hatte sogar schon eine Audienz bei der Kaiserin persönlich. Sie hingegen sind eine völlig unbekannte Größe. Na ja, fast, zumindest. Eigentlich glaube ich ja, Herzogin Harrington hat Sie ziemlich gut eingeschätzt. Aber zumindest in Manticore dürfte das wohl für niemanden sonst gelten.«
Viktor starrte ihn an; er schien ernstlich Schwierigkeiten zu haben, Antons Worten einen Sinn abzuringen. Es war schon sonderbar, dass sich ein derart scharfsinniger Mensch seiner eigenen Bedeutung so wenig bewusst war. Anton fand diesen Charakterzug seines Freundes einnehmend, aber gleichzeitig auch ziemlich beängstigend. Unter den richtigen (oder falschen) Umständen war jemand, der über ein derart geringes Ego verfügte – oder besser: der sich so wenig um sein Ego scherte –, ja, zu was wohl in der Lage?
Zu praktisch allem.
»Glauben Sie es mir einfach, ja? Man wird Sie sehen wollen, und man wird mit Ihnen sprechen wollen, ehe man sich Informationen von Ihnen aushändigen lässt.«
»Ganz genau.« Usher wuchtete sich aus dem Sessel. »Oh, morgen früh, null sieben null null, stehen Sie bitte mit vollständigem Gepäck abmarschbereit in der Lobby.«
Auch Trajan erhob sich. »Ich wünsche Ihnen eine gute Reise«, sagte er. Natürlich meinte er damit in Wahrheit: ›Ich wünsche Ihnen eine gute, schöne und sehr lange Reise.‹ Und irgendwie wirkte er geradezu beschwingt, als er in Richtung Tür ging – beinahe als wäre ihm eine gewaltige Last von den Schultern genommen.
Kapitel 2
»Na, wäre wirklich schön gewesen, wenn man uns wenigstens eine Woche Zeit zum Vorbereiten gelassen hätte! Aber allzu viel darf man von Sklavenhändlern wohl nicht erwarten.« Mit dem Daumennagel der Rechten klopfte sich Colonel Nancy Anderson gegen Zähne im Unterkiefer. Es war eine ihrer Eigenarten, eine unbewusste zudem. Ihre Untergebenen hielten diese ganz spezielle Eigenart für eine besonders perfide Methode, andere am eigenen Elend teilhaben zu lassen.
Andere: Damit waren nicht etwa ihre eigenen Untergebenen gemeint, weshalb diese sich auch nicht an der schlechten Angewohnheit ihrer Vorgesetzten störten. Im Vergleich zu den meisten anderen Offizieren des Biological Survey Corps von Beowulf war Anderson eine regelrechte Zuchtmeisterin – aber das hieß nicht viel. Ohne jeden Zweifel herrschte beim BSC strengste Disziplin … aber für jeden Außenstehenden, der bereits Erfahrung mit anderen Militärorganisationen gemacht hatte, war das alles andere als offensichtlich. Trotz ihrer harmlosen Bezeichnung handelte es sich beim BSC eben sehr wohl um eine Militäreinheit – sogar eine der besten Elitetruppen der Galaxis. Aber man scherte sich beim BSC herzlich wenig darum, wie aus dem Ei gepellt auszusehen, eine Förmlichkeit, die konventioneller gestrickte Freunde des Militärs unweigerlich erwarteten. Selbstverständlich konnte es das BSC im Bedarfsfall bei dieser Art des Militärtheaters jederzeit mit den Besten der Besten aufnehmen. Eigentlich jedoch neigte man hier bei diesem Korps zu der eher hemdsärmeligen Einstellung, in die Hände zu spucken und den Job, egal welchen, einfach anzugehen.
»Wie hättest du’s denn gern, Nancy?«, fragte ihr Stellvertreter und Erster Offizier, Commander Loren Damewood. Entspannt saß er an einer der Signalstationen und betrachtete die Daten auf dem Bildschirm – deutlich aufmerksamer, als seine bequeme Sitzposition und seine beiläufigen Worte vermuten ließen. »Deren Transponder übermittelt einen Code des Jessyk Combine – einen, der wir schon kennen: verwendet für eine geschäftliche Transaktion hier – wenn auch nicht unbedingt von genau diesem Schiff.«
Colonel Anderson wusste, was ihr Damewood damit sagen wollte. Sklavenschiffe tauchten nicht einfach aufs Geratewohl in der Nähe von Raumstationen auf, in deren Leitstellen sie keine Ansprechpartner hatten. Um ganz sicherzugehen, dass sich seit dem letzten Besuch eines Firmenschiffs auch wirklich nichts verändert hatte, verwendeten sie gern völlig unscheinbare Transpondercodes – das war sozusagen das Gegenstück zu einem vereinbarten Klopfzeichen an der Tür.
»Sie haben also Fracht an Bord.«
Damewood nickte. »Die Sensoren melden ein Zwo-Millionen-Tonnen-Schiff, eine Menge Fracht demnach.«
Damit schied natürlich die einfachste und direkteste Methode des BSC, seinen Job zu tun, aus: das Sklavenschiff mit einem der gut getarnten, aber höchst leistungsfähigen Graser von Parmley Station in seine Atome zu zerlegen, sobald es der Station nahe genug gekommen wäre. Bei Sklavenschiffen war ›Fracht‹ nun einmal ein Euphemismus. Hier ging es um Menschen, zwar keine, die quicklebendig gewesen wären – das war angesichts der misslichen Lage, in der sie sich befanden, nicht zu erwarten –, aber eben doch lebendig.
»Plan C?«, schlug der dritte Offizier in der Kommandostation vor: Ayibongwinkosi Kabweza war die Kommandeurin der Stoßtruppen von Parmley Station, bereitgestellt von der Armee des Königreichs von Torch.
Colonel Anderson nahm sich die Zeit, diese Frage zu durchdenken. Bislang hatte sie noch nicht mit Torchs Militär zusammengearbeitet. Deswegen wollte sie sich absolut sicher sein, die Sache hier auch richtig anzugehen.
Das Biological Survey Corps hatte die Regierung von Torch ersucht, ein Bataillon geeigneter Männer und Frauen für den Dienst auf Parmley Station abzukommandieren. Das war geschehen, sobald offenkundig geworden war, dass für die angedachte Verwendung der Station deutlich mehr Truppen benötigt würden, als das BSC selbst dafür abstellen konnte. Beowulf war wohlhabend und deshalb einflussreich. Es war jedoch nur eine Einzelsternnation und zugleich Mitglied in der Solaren Liga. Dafür waren Beowulfs Systemverteidigungskräfte zahlenmäßig außergewöhnlich groß und schlagkräftig. Dennoch hatte das System dank des Beowulf-Terminus, des Manticoranischen Wurmlochknotens, der es wohlhabend gemacht hatte, niemals eine große Armee benötigt – und entsprechend auch nie unterhalten. Stattdessen hatte man eine kleine Truppe von höchster Leistungsfähigkeit aufgestellt. Die geringe Mannstärke erlaubte es nun, Rekruten sehr sorgfältig auszuwählen und mit der bestmöglichen Ausrüstung auszustatten. Angesichts der immer weiter anwachsenden politischen Spannungen gerade der letzten Jahre hatte Beowulf seinen Militärhaushalt drastisch aufgestockt. Priorität war jedoch gewesen, zunächst die Flotte zu modernisieren. Zumindest vorerst hielt sich die Mannstärke von beowulfianischen Bodentruppen ebenso wie die von Marineinfanteristen deutlich in Grenzen.
Vor dem offiziellen Unterstützungsgesuch an Torch hatte Beowulf gezögert. Ausbildung, Methoden und Taktiken von Torchs Armee folgten nämlich Thandi Palanes Ideen und Vorgaben und damit denen der Solarischen Marineinfanterie. Dementsprechend unterschieden sie sich in vielerlei Hinsicht recht deutlich von denen, die beim Militär von Beowulf üblich waren – insbesondere beim BSC. Und nicht nur das: Die Royal Torch Army befand sich immer noch im Aufbau, was hieß: Sie musste sich erst vorsichtig an ihre eigene Identität herantasten und eigene Traditionen erst entwickeln.
Ohne belastbare Erfahrungen war es natürlich schwierig abzuschätzen, wie gut die beiden unterschiedlichen Einheiten zusammenarbeiten würden. Obendrein, und das machte das Ganze richtig knifflig, würden Torchs Stoßtruppen, wie viele andere neu aufgestellte Einheiten auch, Schwierigkeiten dabei haben, mit schon seit langer Zeit bestehenden Einheiten zusammenzuarbeiten: Vermutlich würden sie in jeder unbedachten oder auch nur missverständlichen Formulierung sofort einen persönlichen Angriff wähnen.
Sollte sich Colonel Anderson wirklich für Plan C entscheiden, läge es an Lieutenant Colonel Kabweza und ihren Leuten, diesen Plan auch in die Tat umzusetzen. Unter den BSC-Angehörigen hatte Plan C den schönen Spitznamen ›Plan GGV‹ – größter greifbarer Vorschlaghammer, was sich bei Einsatz von Kabwezas Torch-Bataillon in der Wirkung noch steigern würde: Denn den Traditionen und Einstellungen des Solarischen Marines Corps folgend – was zwangsläufig der Fall sein dürfte, schließlich entstammten sowohl Palane als auch Kabweza diesen Streitkräften –, würden sie als Entermannschaften zu heftigen Schocktaktiken greifen. Im Allgemeinen war man auf Beowulf und Manticore sehr skeptisch, was den Ruf der Solarian League Navy anging – vor allem, wenn es um die Schlachtflotte ging. Anders jedoch sah es bei des Solarischen Marines aus. Im Gegensatz zur Schlachtflotte, bei der Offiziere wie einfache Mannschaftsgrade eine vollständige Laufbahn absolvieren konnten, ohne jemals in ein einziges Gefecht verwickelt zu werden, gehörten die Marineinfanteristen echten Kampfeinheiten an.
Dennoch war der Gedanke, Plan C auszuführen, verführerisch. Die Besatzungen von Sklavenschiffen mochten noch so gerissen und noch so gut bewaffnet sein: Ließ man Torchs Truppen massiert angreifen, hätten die Sklavenhändler gegen einen Gegner, der nach den Standards der Solarischen Marines ausgebildet war, ebenso gute Überlebenschancen wie äußerst gerissene und reißzahnbewehrte Feldmäuse im Kampf gegen einen Luchs. Der Angriff würde derart rasch und unaufhaltsam erfolgen, dass noch nicht einmal für die Fracht des Schiffes ernstliche Gefahr bestehen sollte.
Ja, sollte. Aber es konnte immer noch anders kommen. Es bräuchte ja nur ein einziger Befehlshaber auf der Brücke des Sklavenschiffs zu beschließen, den Sklavenevakuierungsprozess einzuleiten. Mit Giftgas würde dann die ›Fracht‹ aus ihren armseligen Räumlichkeiten herausgetrieben … und dann einfach ins All hinausbefördert. Logik besäße dieses Vorgehen natürlich nicht; denn unter derartigen Umständen könnte keine Besatzung eines mutmaßlichen Sklavenschiffs behaupten, es hätten sich niemals Sklaven an Bord befunden. Einige der Leichen würden vermutlich sogar noch in Sichtweite der Station durch das All treiben. Doch die Sklavenhändler mochten durchaus der Ansicht sein, sie hätten ohnehin nichts mehr zu verlieren – und das wahrlich nicht zu unrecht! Massenmord wäre dann ihre perverse Art von Vergeltung, und der Sklavenhandel zog weiß Gott genug Sadisten und Soziopathen an. Ja, man könnte sogar behaupten, für eine Karriere in diesem Sektor wären das geradezu berufsqualifizierende Kriterien.
Doch selbst wenn den bedauernswerten Sklaven an Bord nicht das Geringste widerführe, bestünde keine Chance, dass Torchs Stoßtruppen auch nur ein einziges Besatzungsmitglied am Leben ließen. Ebenso wie bei den Solarischen Marines würde ihre Taktik ganz darauf bauen, die Bedrohung auszuschalten, nicht etwa Gefangene zu machen. Ganz zu schweigen davon, dass die Mehrheit von Torchs Soldaten selbst einst Sklaven gewesen waren: Ungefähr ein Drittel der Stoßtruppen waren ehemalige Mitglieder des Audubon Ballroom. Mit jeder Faser ihres Körpers hassten sie die Sklavenhändler. So diszipliniert sie auch sein mochten: Ihr erster Impuls wäre zweifellos, gnadenlos zu töten.
Anderson schüttelte den Kopf. »Nein, Ayi, Plan C halte ich für keine so gute Idee. Das wird unser erster Einsatz, seit wir Parmley Station zu einer Festung ausgebaut haben. Wenn irgend möglich, möchte ich dabei an neue Informationen gelangen.«
Die Skepsis auf dem Gesicht des Lieutenant Colonels war unverkennbar, doch sie schwieg. Empfindlichkeiten hin oder her: Da Thandi Palane sie ausgebildet hatte, würden Kabweza und ihre Einheiten, anders als das bei einigen Einheiten von Beowulf der Fall wäre, unliebsame Befehle zunächst nicht erst in aller Breite auszudiskutieren versuchen.
»Wir probieren es mit Plan F«, fuhr Anderson fort. »So finden wir dann gleich heraus, wie effektiv unsere neuen Sensorabwehrmaßnahmen sind.« Nach einem Blick auf Kabweza lächelte sie und setzte hinzu: »Na gut, Ayi! Wenn’s dich glücklich macht, setzen wir dieses Mal deine Leute zur Sicherung ein, nicht Lorens übliche Truppe.« Fragend blickte sie zu Damewood hinüber. »Wenn Sie einverstanden sind, heißt das, Eins-O.«
»Hmm.« Damewood kniff die Augenbrauen zusammen und blickte dann Kabweza an. »Ein paar deiner Leute, Ayi. Und niemand Schießwütigen.«
»Keiner meiner Leute ist schießwütig«, versetzte der Lieutenant Colonel. »Wir leiden nur nicht an der Lustlosigkeit, die beim BSC anscheinend üblich ist, wann immer es darum geht, Bösewichtern das Licht auszublasen.«
Dieser Satz führte zu allgemeinem Gelächter auf der Brücke. Mit einer als versöhnlich anzusehenden Geste setzte Kabweza nun hinzu: »Das Kommando über diese Leute übernehme ich persönlich – nur damit ihr nicht nervös werdet.«
Die Schiffskommandantin und der Erste Offizier bedachten sie mit exakt jener Sorte Blick, den sich Flottenoffiziere für besondere Gelegenheiten aufsparten – beispielsweise für einen Lieutenant Commander, der sich um Kleinigkeiten zu kümmern versprach, die eigentlich ins Aufgabengebiet eines Ensign fielen.
»Ein bisschen Bewegung kann mir nicht schaden«, meinte Kabweza erklärend.
Das führte zu erneutem Gelächter. Der Lieutenant Colonel hatte Bewegung so nötig wie eine durchtrainierte Löwin in der Savanne. Sie war zwar nicht annähernd so groß und stabil gebaut wie Thandi Palane, aber sie hatte bei den Solarischen Marines exakt das gleiche harte Training durchlaufen.
»Nein, wirklich wahr!«, beharrte sie.
Damewood erhob sich aus seinem Sessel. Besser wäre vielleicht die Beschreibung: Er faltete sich aus dem Sitz. Das Skelett des I. O. schien aus entschieden weniger Knochen zu bestehen, als einem Menschen von Natur aus zustanden. Es gab Gerüchte, er sei das Ergebnis eines finsteren Experiments, mit dem gegen absolut jeden einzelnen Absatz des auf Beowulf gültigen Biowissenschaften-Ethik-Kodex verstoßen worden sei.
So richtig Glauben schenkte niemand diesen Gerüchten. Aber trotzdem verschwanden sie nie ganz.
»Ich hole meine Ausrüstung.« Er warf einen Blick auf einen anderen Bildschirm. Dort war ein weiteres Schiff zu sehen, das allerdings bereits an die Station angedockt hatte. »Was ist mit der Hali Sowle? Die könnte uns nützliche Ablenkung bieten, falls Ganny bereit ist, ein ganz klein bisschen was zu riskieren. Wirklich nur ein winziges bisschen was.«
»Das habe ich gehört, du Klugscheißer.« In einem Sessel gleich neben dem Eingang zur Brücke fläzte sich Elfriede Margarete Butry – auch bekannt als Ganny. Ihrer Haltung nach hatte sie sogar noch weniger Knochen im Leib als Damewood, die sie aufrecht in einem Sitz zu halten vermochten. Zu ihrer Verteidigung sollte angeführt werden: Obwohl Butry wie Ende dreißig oder höchstens Anfang vierzig aussah, kam sie in Wahrheit auf mehr als doppelt so viele Lebensjahre wie der Erste Offizier der Station.
Die Matriarchin des Clans, der Parmley Station noch bis vor gar nicht so langer Zeit gehört hatte, kam nun ebenfalls auf die Beine und stemmte die Hände in die Hüften. »Was hattest du denn im Sinn, Loren?«, verlangte sie zu wissen. In dieser Haltung sah sie durchaus furchteinflößend aus – dass ihre Körpergröße von noch nicht einmal anderthalb Metern eigentlich wenig angetan war, Ehrfurcht zu gebieten, fiel dabei überhaupt nicht ins Gewicht. »Und ich möchte das ganz genau wissen, klar? Komm mir jetzt bloß nicht wieder mit dem alles beschwichtigenden Handwedeln, für das der BSC so berüchtigt ist!«
Damewood lächelte. »Nichts Besonderes, Ganny! Es wäre einfach nur nett, wenn ihr mit dem Schiff in genau dem Augenblick ablegen würdet, in dem das Sklavenhändlerschiff eintrifft – und dabei auf einem offenen Kanal vor euch hin fluchen, dass es eine wahre Freude ist! Ihr könntet die Neuankömmlinge sogar ganz offen warnen, dass sie gleich Bekanntschaft mit den gierigsten, skrupellosesten Dreckskerlen diesseits von Beteigeuze machen dürfen.«
Dann hob er überrascht die Augenbrauen, als sei ihm gerade erst ein Gedanke gekommen. »Du weißt doch, wie das mit dem Fluchen geht, oder?«
Ihre Antwort beseitigte jeglichen in diese Richtung gehenden Zweifel – für ihn selbst und auch für jeden anderen ›diesseits von Beteigeuze‹.
»Jetzt hör dir das an!« Ondøej Montoya, Signaloffizier der Ramathibodi, grinste über das ganze Gesicht. »Ein solches Talent sollte man wirklich nicht unter den Scheffel stellen!«
Er drückte einen Knopf, und das Signal, das auf seiner Konsole eintraf, wurde in Echtzeit an die Brücke weitergeleitet.
Der Captain des Schiffes runzelte die Stirn. Montoyas Neigung, völlig veraltete Redewendungen zu nutzen, war ihr schon immer ein wenig lästig gewesen. Was zur Hölle war denn ein ›Scheffel‹? Doch während sie der Übertragung lauschte, verschwand das Stirnrunzeln sehr rasch, und kurz darauf grinste sie ebenfalls.
»… une vraie salope! Und was dich angeht, du Schwanzlurch: Dich würde ich nicht mal einem dauergeilen Bumsaffen zumuten! Obwohl … wahrscheinlich kämest du bestens mit einem meiner Cousins zweiten Grades zurecht, mit Odom. Nur damit du’s weißt: das ist die Kurzform von ›Sodom‹. Seine Familie hat das S abgelegt, nachdem er zum dritten Mal wegen eines missglückten Vergewaltigungsversuchs verurteilt wurde, weil sie fanden, er sei eine Schande für sie. Du wirst aber noch ’n bisschen warten müssen, aus dem Knast kommt er erst in fünfzig oder sechzig Jahren. Aber wenn’s so weit ist, werde ich dich auf jeden Fall weiterempfehlen! Allerdings glaube ich nicht, dass du dann noch lebst, so wie ihr hier die Leute abzieht!«
Captain Tsang lachte leise in sich hinein. »Worüber regt die sich denn so auf?«
Montoya zuckte mit den Schultern. »Gar nicht so leicht zu sagen. Soweit ich das verstehe, ist sie der Ansicht, man habe ihr auf der Station für alles viel zu viel berechnet, für ihre eigenen Waren aber unverschämt geringe Preise gezahlt.«
Aufmerksam betrachtete Marième Tsang das Abbild des Schiffes, das sich langsam, aber stetig von der riesigen Parmley Station entfernte. »Unsere Sorte Fracht scheint sie nicht gerade zu transportieren – andererseits: man weiß ja nie. Wie heißt das Schiff?«
»Hali Sowle.« Wieder schüttelte der Signaloffizier den Kopf. »In unseren Datenbanken ist sie nirgends verzeichnet. Aber …« Erneutes Schulterzucken.
Genau – das hatte nicht viel zu bedeuten. Schiffe, die im Rahmen des Sklavenhandels genutzt wurden, selbst wenn sie nicht gerade dem Sklaventransport dienten, mühten sich redlich, in keiner Datenbank aufzutauchen. Dieses Schiff hier sah ganz nach einem Trampfrachter aus, der diese Station vermutlich eher zufällig, denn gezielt zum Andocken ausgesucht hatte. Doch wie Captain Tsang gerade so treffend bemerkt hatte: Sicher konnte man sich niemals sein.
Tsang war nicht sonderlich beunruhigt; einen Schwindel jedenfalls vermutete sie nicht. Parmley Station war ein durchaus bekannter, wenngleich inoffizieller Umschlagplatz für den Sklavenhandel – und die Ramathibodi war kein Trampfrachter. Sie gehörte – natürlich nicht offiziell – zum Jessyk Combine, einer der vielen Tochtergesellschaften von Manpower. Die Betreiber von Parmley Station würden ganz gewiss hart verhandeln, aber sie übertrieben es ganz gewiss nicht. Schließlich würden sie sonst langfristig einen Großteil ihres Kerngeschäfts einbüßen.
Was gleich die nächste Frage aufwarf …
»Wer betreibt Parmley eigentlich heutzutage, Ondøej? Wir waren nicht mehr hier seit … wie lange ist das jetzt her? Zwei T-Jahre?«
»Eher zweieinhalb.« Kurz befasste sich Montoya mit seiner Konsole, rief einen neuen Bildschirm auf und betrachtete ihn. »Hier heißt es, derzeit gehöre sie zu Orion Transit Enterprises. Scheint ein Tochterunternehmen einer Firma namens Andalaman Exports zu sein, die ihre Zentrale im Sheba-Knoten hat. Was immer uns das jetzt sagen soll.«
»Nicht viel«, brummte Tsang. Der Sheba-Knoten lag hunderte von Lichtjahren weit entfernt, beinahe genau auf der anderen Seite des von Menschen besiedelten Weltraums. Viel mehr als den Namen kannte Tsang von diesem System nicht – und den kannte sie auch nur, weil er so ungewöhnlich klang.
Mittlerweile hatte sich die Hali Sowle weit genug von Parmley Station entfernt, dass von ihr keine Gefährdung des Verkehrs mehr ausging.
»Legen Sie einen Kurs zum Andocken fest, Lieutenant Montoya!«, befahl Tsang und befleißigte sich so wenigstens vorübergehend der beim Militär üblichen Formalitäten.
»Jawohl, Ma’am«, erwiderte Montoya. Zu den Dingen, die er an seiner Kommandantin besonders schätzte – trotz mancher ihrer … lästigen Angewohnheiten – gehörte eindeutig, dass sie die an Bord von Sklavenschiffen übliche Lockerheit im Umgang zwischen Offizieren und Mannschaftsdienstgraden niemals missbrauchte.
Diese Lockerheit war schlichtweg unvermeidbar – schließlich gehörten gerade Zügel- und Maßlosigkeit zu den Privilegien, die mit einer Karriere an Bord eines solchen Schiffes einhergingen. Unter solchen Umständen wäre militärische Straffheit im Umgang miteinander völlig widersinnig gewesen. Ein Kommandant konnte bestenfalls anstreben, sich aber nicht darauf verlassen, dass jede Aufgabe an Bord auch wirklich kompetent ausgeführt wurde.
Kompetent war Montoya zweifellos. Gleiches galt für den Piloten der Ramathibodi. Das Andockmanöver würde mindestens eine halbe Stunde dauern; Tsang selbst würde dabei nicht benötigt. Deswegen machte sie es sich erneut in ihrem Sessel gemütlich und rief ihre Finanzdaten auf. Sie genauestens zu studieren – nein: in ihnen zu schwelgen! – war ihre Lieblings-Freizeitbeschäftigung.
Kapitel 3
Loren Damewood gab die letzte Sequenz in die Spezialsoftware ein. Unter seinen Fingerspitzen spürte er bereits die ersten Vibrationen: Die Schleusen öffneten sich. Natürlich waren diese Vibrationen eher zu erahnen, denn wirklich zu fühlen. Schließlich trug er einen Skinsuit und die zugehörigen Handschuhe. Hätte er sich an Bord des Schiffes befunden, nicht draußen im Vakuum, hätte er auch die entsprechende Geräuschkulisse wahrgenommen. Übermäßig laut wäre es nicht; an Bord der Ramathibodi würde es nur jemand in unmittelbarer Nähe zur Schleuse mitbekommen. Es wäre aber höchst unwahrscheinlich, dass sich dort jemand aufhielte. Damewood hatte ganz gezielt die Personenschleuse eines der Laderäume ausgewählt, und Laderäume waren meist groß, leer und langweilig. Von der Besatzung wurden sie eigentlich nur betreten, wenn es gerade darum ging, Frachtgüter umzuschlagen. Die Sorte ›Frachtgut‹, die an Orten wie Parmley Station umgeschlagen wurde, würde wiederum wohl kaum in einem Standardladeraum wie diesem hier befördert.
Ein wenig verstimmt war Damewood dennoch. Bei anständiger Wartung nämlich hätte man überhaupt nichts gehört.
Überrascht hingegen war der Commander nicht. Die Begriffe ›anständig gewartet‹ und ›Sklavenschiff‹ tauchten selten im gleichen Satz auf. Zwischen Besatzungen auf Piraten- und auf Sklavenschiffen gab es keinen sonderlich großen Unterschied. Einige wenige Piratenkapitäne forderten an Bord ihrer Schiffe ja vielleicht wirklich strikte Disziplin ein, aber die meisten versuchten das gar nicht erst. Für die Kommandanten von Sklavenschiffen galt das Gleiche.
Und außerdem hatte die zu erwarten gewesene Nachlässigkeit durchaus ihr Gutes: Wo jämmerlich gewartet wurde, gab es vermutlich auch nur jämmerliche Sicherheitsvorkehrungen. Außer vielleicht bei den wichtigsten Systemen.
Das Schott, vor dem seine Kameraden und er sich sammelten, glitt zur Seite. Dafür war Damewoods Programm nicht mehr unmittelbar verantwortlich. Wäre dem so gewesen, hätten auf der Brücke des Schiffes Warnleuchten aufblinken müssen, die zweifellos aufgefallen wären. Stattdessen hatte Damewoods Software das Betriebssystem des Schiffes infiziert. Deswegen war es auch die Ramathibodi selbst, die nun dieses Schott öffnete – und das dank einer kleinen Modifikation eben so, dass weder Warnleuchten noch Sirenen aktiviert wurden.
»Und rein geht’s«, murmelte Damewood. Aber er war der Einzige, der diese Worte hörte – sämtliche Coms waren stummgeschaltet.
Als sie an Bord gingen, übernahm nicht Damewood die Führung. Das wäre auch dämlich gewesen; schließlich waren ja Ayibongwinkosi Kabweza und ihre Leute vor Ort. Ihm als Technikexperten kam nur die Aufgabe zu, die Sicherheitssysteme des Schiffes zu umgehen; zum eigentlichen Angriffstrupp gehörte er nicht.
Der Lieutenant Colonel glitt in die Schleuse, sobald sich das Schott weit genug geöffnet hatte, um hindurchzuschlüpfen. Alle drei Angehörigen ihres Trupps waren ebenfalls an Bord, noch bevor sich die Luke völlig geöffnet hatte.
Damewood hingegen wartete, bis die Bewegung des Schotts aufhörte, dann betrat er ebenfalls die Luftschleuse. »Schießwütige Gorillas!«, murmelte er. Und natürlich hörte er es wieder als Einziger.
In der Luftschleuse mussten sie warten, bis Damewoods Programm vollständig durchgelaufen war. Beim Betreten hatte dort natürlich nacktes Vakuum geherrscht; wenn sie die Schleuse wieder verließen, würde dort die gleiche Atmosphäre herrschen wie im eigentlichen Schiffsinneren.
In Laderaum Nummer eins von Parmley Station trafen sich Nancy Anderson und zwei Angehörige ihres Teams mit dem Captain der Ramathibodi. Diese hatte zu den Verhandlungen fünf ihrer Mannschaftsmitglieder mitgebracht.
Obwohl eigentlich niemand Parmley je als Frachtumschlagplatz vorgesehen hatte, war der Laderaum bemerkenswert geräumig: Ursprünglich hatten hier die mitunter sperrigen Bauteile angeliefert werden sollen, die ein Weltraumvergnügungspark nun einmal benötigte, und so maß der Laderaum an der längsten Wand etwas mehr als dreißig Meter. Die Sklavenhändler, die von Bord ihres Schiffes gingen, hatten etwa einen Drittel dieser Strecke zurückgelegt, bevor man sich gegenüberstand.
»Was hätten Sie denn gern?«, erkundigte sich Anderson. »Vollständige oder partielle Umladung – oder brauchen Sie nur Versorgungsgüter und suchen ein bisschen Ruhe und Erholung?«
»Was soll ’n das sein?« Die Frage kam von einem Mannschaftsmitglied des Sklavenschiffs, der schräg hinter Captain Tsang stand. Nein, es sollte keine Frage sein: Es war reiner Sarkasmus.
»Das hier ist schließlich immer noch der größte Vergnügungspark im Umkreis von fünfzig Lichtjahren.« Nancy verzog die Lippen zu einem Lächeln. »Auch wenn die meisten Fahrgeschäfte nicht funktionieren.«
»Klappe, Grosvenor!«, zischte der Captain der Ramathibodi. An Anderson gewandt, fuhr sie fort: »Partielle Umladung. Wir haben mehr einfache Arbeiter, als wir am Ziel unserer aktuellen Fahrt loswerden können. Da können wir sie genauso gut auch hier absetzen.«
Dass die Ramathibodi nur einen Teil ihrer Fracht umschlagen wollte, legte die taktischen Parameter der Lage fest. Bei einer vollständigen Entladung der Frachträume hätte das BSC-Team mit ihrem Angriff einfach abwarten können, bis sämtliche Sklaven von Bord gegangen wären. So würde es ein wenig … komplizierter.
Anderson nickte. »Wollen Sie auch neue Ware aufnehmen?«
»Sexualobjekte, wenn Sie welche dahaben. Die lassen sich immer verkaufen. Und Schwerstarbeiter auch.«
»Schwerstarbeiter kann ich Ihnen anbieten. Was Sexualobjekte betrifft …« Sie legte eine Pause ein und lächelte dann gehässig. »Das hängt davon ab, wie viel sie zu zahlen bereit sind.«
»Vorher will ich sie mir aber ansehen.«
»Na klar.« Anderson wies auf einen schweren Behälter aus Panzerstahl, der mit einem Mechatronik-Schloss an einem Schott befestigt war. »Aber wir können uns ja erst einmal um die einfachen Arbeiter kümmern.«
Tsang zuckte mit den Schultern. »Was immer Ihnen lieber ist.«
Anderson wollte Loren Damewood und Ayibongwinkosi Kabweza so viel Zeit wie möglich verschaffen, sich in Stellung zu bringen und ihren Angriff vorzubereiten. Das Gefeilsche und Geschachere, die bei dieser ersten Transaktion zwangsläufig wären, sollte dafür voll und ganz ausreichen.
Der Captain der Ramathibodi und sie traten neben den Panzerstahlbehälter. Aus offensichtlichen Gründen verbot sich der im normalen Waren- und Dienstleistungshandel übliche elektronische Zahlungsverkehr natürlich beim Sklavenhandel – außer an besonders sicheren Orten … wie auf Mesa selbst. Ansonsten griff man eben auf deutlich ältere Zahlungsweisen zurück: eine modernere Variante der Barzahlung.
Derartige Zahlungen waren hin und wieder auch bei vollkommen legalen Geschäften notwendig; deswegen hatte man schon vor Jahrhunderten eine einfache und sehr sichere Methode dafür entwickelt: Dabei kamen Kreditchips von einer der allgemein anerkannten Banken zum Einsatz – häufig, allerdings nicht immer, einer Bank mit Hauptsitz auf Alterde.
Anderson gab die Kombination ein, die den Panzerstahlbehälter entriegelte; lautlos öffnete sich der Deckel. Im Inneren befanden sich zahlreiche Kreditchips, ausgegeben von der Banco de Madrid von Alterde: jeder einzelne ein hauchdünner Molycirc-Speicherchip, der in eine Matrix aus praktisch unzerstörbarem Plastik eingebettet war. Auf jedem Chip war eine Bankprüfnummer gespeichert, ein Zahlenwert und ein Sicherheitscode, der vermutlich noch weniger leicht zu knacken wäre als die Befehlscodes des Zentralrechners der Solarian League Navy. Jeglicher Versuch, den auf einem Kreditchip gespeicherten Wert zu manipulieren, würde den Sicherheitscode aktivieren und den Chip in einen nutzlosen, zusammengeschmolzenen Klumpen verwandeln. Derlei Kreditchips wurden überall in der erforschten Milchstraße als gesetzliches Zahlungsmittel akzeptiert. Es war unmöglich, sie nachzuverfolgen oder – und das war für die Sklavenhändler eindeutig das Beste daran – herauszufinden, wer sie seit dem Tag ihrer offiziellen Ausgabe durch die Banco de Madrid alles schon in Händen gehalten hatte.
Captain Tsang beugte sich gerade genug vor, um einen Blick auf die Chips zu werfen, rührte sie aber nicht an. Tatsächlich achtete sie sogar sorgsam darauf, mit ihren Fingern keineswegs auch nur in die Nähe des Panzerstahlbehälters zu kommen: Jeder Versuch, sich die Chips anzueignen, bevor die Transaktion abgeschlossen wäre, würde sie eine oder gleich beide Hände kosten.
Sie zog ein kleines Gerät hervor und richtete es auf die Chips. Immer noch achtete sie darauf, dem Behälter nicht näher zu kommen als für den aktuellen Zweck unbedingt nötig. Einige Sekunden lang betrachtete sie aufmerksam das Display des Geräts – nicht übermäßig lange, sondern nur gerade lange genug, um sich zu vergewissern, dass die Chips wirklich echt waren … und zahlreich genug, um die an diesem Tag vorgesehene Transaktion auch zu ermöglichen.
Nachdem das getan war, wandte sie sich einem ihrer Untergebenen zu: »Bring die Ersten raus!«
Sie warf einen Blick über die Schulter, suchte nach dem Ausgang.
Anderson deutete auf ein Schott unmittelbar zu ihrer Linken. »Wir führen Sie hier durch.«
Während dann Sklave um Sklave durch die Luke ging, würde Tsangs kleines Handgerät registrieren, welche Summe sich bislang angesammelt hätte, und dann melden, wenn sie groß genug wäre, um einen der Chips aus dem Behälter die Besitzerin wechseln zu lassen. Geschachere sollte nicht erforderlich sein – nicht für einfache Arbeiter.
Nur um ganz sicher sein zu können, merkte sie trotzdem an: »Wir verlangen den im Rand üblichen Preis.«
»Kein Problem«, bestätigte Anderson und nickte.
Tsang entfernte sich einige Schritte weit von dem Behälter mit den Kreditchips. Dieses verdammte Ding machte sie nervös – auch wenn sie noch nie von einer Fehlfunktion gehört hatte.
Kaum hatte sie etwas Distanz zu dem Behälter, konnte sie sich endlich ein wenig entspannen. Nun, wo die Vorverhandlungen beendet waren, versprach dies eine einfache, unkomplizierte Transaktion zu werden.
Schießwütige Gorillas hin oder her: Sobald sie sich im Inneren des Schiffes befanden, warteten die Stoßtrupps geduldig ab, dass Loren Damewood noch mehr Spezialausrüstung zum Einsatz brächte und das gesamte Terrain zunächst ausgiebig scannte.
»Hier entlang«, entschied er leise. Mit knappen Gesten wies er den Trupp an, dem Korridor zu folgen und dann nach rechts abzubiegen.
Was nun folgte, erschien ihm sonderbar: Die vier Stoßtrupps rückten im überschlagenden Einsatz vor. Das hieß, je einer sicherte, während die anderen zügig zur nächsten Deckung vorrückten. Hinter ihnen – teilweise sogar ganz schön weit hinter ihnen – folgte, deutlich langsamer, auch Loren. Als ›trödeln‹ hätte er das gewiss nicht bezeichnet – im Gegensatz zu einem Außenstehenden, der das Ganze unbarmherzig beobachtet hätte.
Doch das galt weder für Kabweza selbst noch für einen ihrer Untergebenen, nein, dass Damewood trödele, dieser Gedanke wäre ihnen niemals gekommen. Der I. O. stand im Ruf, mit seiner Sensorausrüstung wahre Wunder vollbringen zu können – und das mochte sich entscheidend auf den Ausgang dieses Einsatzes auswirken. Man hatte immer wieder Ähnlichkeiten zwischen Stoßtrupps von Torch und Wikinger-Berserkern festzustellen Anlass gehabt, aber ›ähnlich‹ und ›gleich‹ war eben doch etwas anderes. Schließlich waren mehr als dreitausend mehr oder minder zivilisierte Jahre ins Land gegangen, seit der legendäre Ragnar Lođbrók mit seinen Langschiffen die Nordsee durchquert hatte, um Frankreich und die britischen Inseln zu plündern.
»Zwei Schotts weiter, dann links«, erklärte Loren. »Die Sklavenquartiere erreichen wir dann durch einen Lagerraum. Der ist unbewacht.«
Der Lagerraum erwies sich als vollgestellt – ›vollgestopft‹ traf es besser. Es war fast unmöglich, sich hindurchzuzwängen, ohne zuvor einiges an gelagerten Vorräten auf den Korridor hinauszuwerfen … was natürlich viel zu lange gedauert hätte.
Es ging gerade so eben. Natürlich war es hilfreich, dass die Stoßtrupps mit ihren Panzeranzügen beinahe mühelos alles zerquetschen konnten, was ihnen im Weg war – Kartons, Container oder Dosenstapel, kein Problem für sie.
Wie sich herausstellte, enthielt einer der besagten Container einen grell pinkfarbenen Fruchtsaft. So war die Farbgebung der Panzerungen schlagartig recht auffällig … als hätten sich die Stoßtrupps im Vorfeld in einer hochgradig psychedelischen Landschaft auf den Kampfeinsatz vorbereitet.
Das Abteil, das sie dann betraten, war mit Menschen beinahe ebenso vollgepackt wie der Lagerraum vorher mit Lebensmitteln und Ausrüstungsgegenständen. Die Menschen drängten sich an die Wände und starrten die Fremden mit weit aufgerissenen Augen angstvoll an.
Damit hatte Kabweza schon gerechnet; deswegen hatte sie Sergeant Supakrit X vorangeschickt. Sobald er das Quartier betreten hatte, öffnete der Sergeant den Visor seiner Panzerung und streckte die Zunge heraus.
Supakrit war ein Sklave, dem die Flucht gelungen war. Auf seine Zunge war der Genmarker geprägt, mit dem Manpower sämtliche seiner ›Produkte‹ kennzeichnete. Diese Kennung war eindeutig und nur schwer zu fälschen – tatsächlich war es sogar unmöglich, ihn so nachzuahmen, dass er einer gründlicheren Untersuchung aus der Nähe standhielt.
Und genau einer solchen gründlichen Untersuchung wurde Supakrits Marker fast augenblicklich unterzogen. Eine recht kleine, junge Sklavin trat furchtlos an ihn heran und öffnete seinen Mund noch etwas weiter. Supakrit, der deutlich größer war als sie, beugte sich ihr ein wenig entgegen, um ihr die Aufgabe zu erleichtern. Konzentriert betrachtete die Sklavin den Marker auf seiner Zunge, dann trat sie wieder einen Schritt zurück.
»Der ist echt«, verkündete sie. »Aber vom Ballroom sind die nicht, da bin ich mir ziemlich sicher.«
Supakrit richtete sich wieder auf. »Das ist ja auch bloß ein Haufen Wahnsinniger. Nein, Mädchen, wir sind von der Royal Torch Army.« Mit dem Daumen wies er auf Commander Damewood. »Wir arbeiten mit dem Biological Survey Corps zusammen.«
Bei diesen Worten grinste einer der deutlich älteren Sklaven sogar noch breiter als der Sergeant. Bislang hatten nur wenige Sklaven vom Planeten Torch gehört, der seit Neuestem entkommenen Sklaven eine neue Heimat bot. Ein weit höherer Prozentsatz an Sklaven kannte aber die Wahrheit (oder einen Teil davon) über das BSC. Anscheinend gehörte dieser Bursche zu diesem erlesenen Personenkreis.
Doch die junge Frau verzog mürrisch das Gesicht. »Nenn mich bloß nicht ›Mädchen‹!«
Kabweza trat vor. »Dann sag uns doch, wie du heißt.«
»Takahashi Ayako. Du kannst mich Ayako nennen.«
Dass sie einen vollständigen Namen besaß und auch bereit war, ihn in der Öffentlichkeit zu verwenden, war durchaus von Bedeutung. Bei Manpower gab man seinen Sklaven keine Eigennamen. Während der sogenannten Aufzucht reichten die letzten drei oder vier Ziffern ihrer Kennung voll und ganz aus. Doch im Laufe der Zeit hatten die Sklaven eine eigenständige Gesellschaft entwickelt: Um die Jüngsten kümmerten sich meist Adoptiveltern. Manpower tolerierte dieses Vorgehen, weil es ihren eigenen Zwecken ja nur dienlich sein konnte: Es war doch viel einfacher und billiger, wenn die Sklaven selbst die jeweils nächste Generation aufzogen, sobald sie aus den Zuchttanks herausgekommen waren, statt dass sich Manpower darum kümmern musste.
Doch während die Firma den Brauch der Sklavenfamilien duldete – und sich sogar bemühte, derlei Familien möglichst nicht auseinanderzureißen –, gestatteten sie nicht, dass die Öffentlichkeit davon erfuhr. Einen Vornamen konnte man verwenden – durchaus auch einen, den sich der betreffende Sklave selbst gegeben hatte. Aber ein Sklave, der in der Öffentlichkeit auch den Nachnamen seiner Adoptiveltern nutzte, wurde als potenzieller Rebell und Unruhestifter angesehen … und meist entsprechend hart bestraft.
Anscheinend war Ayako genau jene Art potenzielle Rebellin und Unruhestifterin – oder sie war scharfsinnig genug zu begreifen, dass Manpower schon bald keine Macht mehr über sie haben würde.
Trotz des japanischen Namens und der zugehörigen Tradition, erst den Nach- und dann den Vornamen zu nennen, sah Takahashi keinen Deut asiatisch aus. Ihre Augen waren haselnussbraun, die Farbe ihrer Haare erinnerte an Backsteine, und ihre Haut war deutlich dunkler als die der meisten Ostasiaten.
Aber das war nichts Besonderes bei einem Menschen, der zweitausend Jahre nach Beginn der Diaspora geboren war – selbst wenn man außer Acht ließ, dass die Gengineure von Manpower die verschiedensten genetischen Stammbäume ganz nach Bedarf miteinander vermengten. Einer von Kabwezas Vorgesetzten im Ausbildungslager der Solarischen Marines hatte Bjørn Haraldsson geheißen – obwohl er allem äußeren Anschein nach ausschließlich auf afrikanische Vorfahren zurückblicken konnte.
»Seid ihr hier, um uns zu befreien?«, fragte der Mann, der angesichts der Erklärung von Sergeant Supakrit X so breit gegrinst hatte.
»Ja. Aber vorerst müsst ihr noch hierbleiben«, antwortete Kabweza. Nach einer sehr kurzen Pause fügte sie hinzu: »Einer von euch sollte allerdings mitkommen. Das würde es deutlich vereinfachen, uns den anderen vorzustellen.«
»Hier«, meldete sich Takahashi sofort. »Ich kenne alle an Bord. Das liegt daran, das ich zu allen immer nett und freundlich bin«, sie warf Supakrit einen scharfen Blick zu, »es sei denn, ich werde ›Mädchen‹ genannt. Na ja, und ein paar andere Sachen mag ich auch nicht.«
Die junge Frau war wirklich attraktiv. Vermutlich hatte sie die – gänzlich ungewünschte – Aufmerksamkeit mehr als eines Besatzungsmitglieds auf sich gezogen, wenn sich nicht genug Lustsklaven an Bord befunden haben sollten.
Die skeptischen Mienen einiger weiterer Sklaven in der Kabine verrieten deutlich, dass nicht alle der Ansicht waren, Takahashi sei tatsächlich ›immer nett und freundlich‹. Aber was auch immer sie sonst sein mochte: Schüchtern oder ängstlich war sie keinesfalls. Das musste reichen. Wenn schwer bewaffnete, gefährlich aussehende Männer und Frauen auftauchten, die gekommen waren, um Gefangene zu befreien, bestand eigentlich keine Notwendigkeit für Nettigkeiten, während man sich einander vorstellte.
»Dann komm mit!« Kabweza machte sich daran, die Kabine zu durchqueren, um das Schott am anderen Ende zu erreichen. »Und was den Rest von euch angeht: Entspannt euch! Das hier sollte ziemlich bald vorbei sein.«
Kabweza kam nur langsam voran. Nicht nur, dass das Quartier wirklich sehr eng und vollgestopft mit Menschen war: Gerade wegen der Panzerung, die es ihnen eben so sehr erleichtert hatte, sich durch störende Kisten, Container und Dosenstapel zu pflügen, musste sie sich nun mit äußerster Vorsicht bewegen. Es wäre nur allzu leicht, Fleisch zu zerquetschen oder auch Knochen zu brechen, ohne es überhaupt zu bemerken.
Nachdem der Lt. Colonel die Luke erreicht hatte, wartete sie, dass Damewood zu ihr aufschloss. Einige Sekunden lang hantierte er mit seinem Gerät herum. Was genau machte er da eigentlich? Kabweza wusste es nicht – und sie würde ihn auch nicht fragen.
Klick. Als sich die Verriegelung löste, war das recht deutlich zu hören.
»Faules Pack«, murmelte Damewood.
Die Wahrscheinlichkeit, dass das leise Geräusch jemanden auf der anderen Seite aufmerksam gemacht hatte, war recht gering. Dennoch rollte sich Kabweza im Sprung durch die geöffnete Luke. Dann ging sie in die Hocke, das Schrapnellgewehr im Anschlag, und sicherte.
Alles frei.
Gedankenschnell und lautlos schwenkte sie einen Sekundenbruchteil später herum, immer noch in der Hocke.
Auch in dieser Richtung war der Korridor frei.
Mit einer Handbewegung bedeutete sie dem Rest ihres Trupps, ihr zu folgen. Takahashi trat als Letzte auf den Gang hinaus.
»Wo sind die Kabinen der Besatzung?«, fragte Kabweza leise. »Weißt du das?«
Takahashi nickte und deutete in die Richtung, die Kabweza zuerst gesichert hatte. »Da lang.«
»Sicher?«
Kurz huschte ein gequälter Ausdruck über das Gesicht der jungen Frau. »Ja«, gab sie knapp zurück, »ganz sicher.«
Kabweza bohrte nicht weiter nach. Mit einer auffordernden Kopfbewegung bedeutete sie Supakrit X, die Vorhut zu übernehmen.
Kapitel 4
Die ersten einfachen Arbeiter trafen zehn Minuten später auf der Station ein. Die Sklaven schlurften auf den Korridor hinaus, den Kopf gesenkt, den Blick auf den Boden gerichtet. Zwei Besatzungsmitglieder des Sklavenschiffs trieben sie vorwärts, die Nervenpeitschen blieben dabei derzeit deaktiviert. Im Ganzen wirkten die Sklaventreiber ein wenig lustlos; offenkundig rechneten sie nicht mit Schwierigkeiten. Bei denen, die hier durch den Korridor gelotst wurden, handelte es sich um Gensklaven: Sie waren in Gefangenschaft geboren, in Gefangenschaft aufgewachsen und von der Gefangenschaft geprägt. Schon vor langer Zeit hatten sie gelernt, dass Widerstand ihrerseits lediglich zu Leid führte.
Ihr Mienenspiel verriet keine Verzweiflung, sondern eher … gar nichts. Verzweiflung war schließlich eine Emotion – und alle Manpower-Sklaven lernten schon als Kinder, dass Emotionen für Menschen wie sie gefährlich waren. Die ausdruckslosen Mienen dieser Männer und Frauen ließen in Anderson nackte Wut aufsteigen, doch sie ließ sich nichts anmerken.
Nachdem die erste Charge Sklaven auf den Korridor hinausgetreten war, blinkte an dem Chipbehälter ein grünes Lämpchen auf. Während sie auf das Eintreffen der Sklaven gewartet hatten, hatten Anderson und Tsang dem Tresor die Anzahl Sklaven einprogrammiert, die dem Gegenwert von einem Kreditchip entsprach.
»Bitte«, sagte Nancy Anderson nun. Vorsichtig griff der Captain der Ramathibodi in den Behälter hinein und zog einen Chip heraus.
Nur einen – und den packte sie behutsam mit Daumen und Zeigefinger. Sollte dieser Tresor bemerken, dass mehr Chips als vereinbart entnommen würden, würde sich der Deckel ruckartig schließen und dafür sorgen, dass die Chips schön im Inneren blieben … zusammen mit der Hand, die danach gegriffen hatte.
Als die Sklaven die offene Luke erreichten, die in den Rest der Station führte, übergaben die beiden Wachen von der Ramathibodi sie offiziell an drei Angehörige der Abordnung von Parmley Station. Zwei davon hielten ebenfalls Nervenpeitschen in den Händen, bei der dritten Person handelte es sich offenkundig um eine Meditechnikerin. Sie sollte jeden Sklaven einer Gesundheitsprüfung unterziehen, um sicherzustellen, dass man ihnen keine fehlerhafte Ware andrehte.
Sie erfüllte ihre Aufgabe rasch, beinahe schon beiläufig: Jeder Sklave wurde mit einem Untersuchungsgerät gescannt, dann durfte er in die Personenröhre weitergehen. Der Handscanner sollte zumindest alles Offensichtliche sofort erkennen: ansteckende Krankheiten ebenso wie Krebs im Endstadium.
Komplexere gesundheitliche Probleme würden unentdeckt bleiben, aber auch das war nicht sonderlich bemerkenswert. Medizinische Täuschungsmanöver, dank derer man fehlerhafte Ware als einwandfrei deklarieren und an den nächsten Kunden weiterreichen konnte, wurden allgemein im Sklavenhandel vermieden – sie waren schlecht fürs Geschäft. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung, das Konzept der Ganovenehre sei bloß eine romantische Vorstellung, beruhten illegale oder außergesetzliche Transaktionen fast ausschließlich auf Treu und Glauben – aus dem einfachen und sehr einleuchtenden Grund, dass im Falle eines Disputs etwaige Regressansprüche nun einmal nicht vor einem Gericht geltend gemacht werden konnten. Etwaige Dispute wurden daher meist mit Gewalt beigelegt – und das hielt praktisch jeden davon ab, seinen Geschäftspartner übers Ohr hauen zu wollen.
Es gab aber noch einen anderen Grund, weswegen die Meditechnikerin nicht übermäßig wachsam war – und dieser Grund war noch viel einfacher: Wegen der bei Manpower üblichen Produktionsmethoden war es einfach eine gegebene Tatsache, dass bei einem hohen Prozentsatz der Sklaven langfristig gesundheitliche Probleme zu erwarten wären. Die radikale Gentechnik, mit der die verschiedenen Sklavenserien produziert wurden, führte häufig zu unerwünschten Nebeneffekten. Bei Sklaven, die auf große Körperkraft angelegt waren, traten zum Beispiel häufig Probleme mit Bluthochdruck auf, oder es kam zu akutem Nierenversagen.
Im Allgemeinen war bekannt, dass die Lebenserwartung von Gensklaven niedriger lag als bei den meisten anderen Menschen, selbst wenn man außer Acht ließ, dass Sklaven nur äußerst selten in den Genuss einer Prolong-Behandlung kamen, um ihre Lebenszeit zu steigern. Unser Leben währet siebzig Jahre, und wenn’s hoch kommt, so sind’s achtzig Jahre, hieß es in der Bibel. Bei Manpower Incorporated hatte man sich überlegt – tja, möglicherweise, um sich nicht mit Gott auf eine Stufe zu stellen? –, bei ihren Produkten seien fünfzig oder sechzig Jahre mehr als genug.
Sobald die Meditechnikerin zustimmend genickt hatte, trat ein Sklave nach dem anderen durch die Luke in die Personenröhre, die sie zu ihren neuen Quartieren auf Parmley Station brächte. Von den beiden Wachen, die im Inneren der Röhre bereits auf sie warteten, wurden sie weitergelotst. Um genau zu sein: Die beiden Männer hatten sich bequem gegen die Innenwand gelehnt und winkten die Sklaven nur mit beiläufigen Handbewegungen weiter. Sie machten sich keinerlei Sorgen, es könnte zu einem Aufstand kommen. Die Sklaven wussten ja auch genau, dass eine solche Station über exakt die gleiche Evakuierungsausstattung verfügte wie ein Sklavenschiff. Falls Sklaven hier, in den Abteilungen und Korridoren der Station, tatsächlich erfolgreich rebellieren sollten, würde jemand in der für Unbefugte unzugänglichen Zentrale einen Knopf drücken, und schon würden sie alle ins Vakuum des Alls hinausgerissen.
Lieutenant Colonel Kabweza und ihr Team hatten insgesamt acht Schotts passiert, bevor sie endlich vor der Luke standen, hinter der sich laut Takahashi die Mannschaftsquartiere befanden. Auf dem Weg hatte sie erklärt, hinter mindestens sechs der erwähnten acht anderen Luken befänden sich weitere Sklaven.