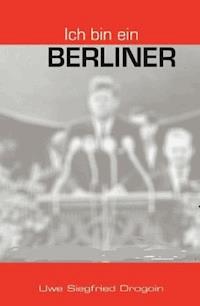
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Erzählt wird die Geschichte einer außergewöhnlichen Freundschaft zweier Männer, die im Berlin der Vorkriegsjahre beginnt. Harald Eisenstein und Alfred Nagel fahren nach dem Abitur zu Bekannten nach Schweden und bleiben bis zum Kriegsende. Wie erleben sie das 3.Reich und den Weltkrieg aus der Perspektive des Auslandes? Nach dem Krieg kommen beide als erwachsene Männer, inzwischen mit Familie zurück. Harald in den Westen, Alfred in den Osten Wie werden sie mit den Schicksalsschlägen, bedingt durch die deutsche Teilung und schließlich mit der Mauer zurecht kommen? Wird ihre Freundschaft bis zum Mauerfall Bestand haben?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Uwe Siegfried Drogoin
Ich bin ein Berliner
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Danksagung
Vorwort
Frühjahr 1964
Wie alles begann
Die Fahrt nach Schweden
Ferien auf dem Land
Der Studienbeginn
Vater Lindgreens Geburtstag
Zurück in Uppsala
Alfred wird den Eltern vorgestellt
Erstes Weihnachten bei Anderssons
Die Aussprache
Das neue Jahr
Deutschland beginnt den Krieg
Harald beginnt beim Geheimdienst
Eine Doppelhochzeit
Thorben meldet sich an
Die Taufe
Das große Heimweh
Ankunft im Zerstörten Deutschland
Ankunft in Berlin
Erste Begegnung mit der Familie
Ankunft in Potsdam
Haralds Rückkehr
Rückfahrt über die Ostsee
In den Fängen der sowjetische Kriegsmaschine
Sonderflug nach Stockholm
Diplomatische Schritte
Der Krieg ist beendet
Einmal Geheimdienst…immer Geheimdienst
Der 17.Juni 1953
Der Mauerbau 1961
Aus Liebe tut ein Mann verrückte Dinge
In den Fängen der Staatssicherheit
Der sozialistische Knast
Flucht über Ungarn
Landung in Österreich
Ankunft in Westberlin
Mitte November 1967
Die Trennung
Abtransport in die Fremdenlegion
Thorben kehrt als gereifter Mann nach Berlin zurück
Reise nach Scheden
Thorben als Beschützer
Februar 1975… Versöhnung
Der Fall der Mauer
Ein später Schulbesuch
Schweden, wir kommen wieder
Thorben wird von seiner Vergangenheit eingeholt
Ende gut - alles gut
Impressum neobooks
Danksagung
Meine besondere Anerkennung und Dankbarkeit sei insbesondere zweier Damen ausgesprochen.
Meiner Frau, Renate Drogoin, die mir mir Rat und Tat zur Seite stand und
Meiner ehemaligen Mitschülerin und Freundin Anne-Katrain Schneider, die mir als Lektorin und Beraterin wertvolle Unterstützung gab.
Vorwort
Erzählt wird die Geschichte einer außergewöhnlichen Freundschaft zweier Männer, die im Berlin der Vorkriegsjahre beginnt. Harald Eisenstein und Alfred Nagel fahren nach dem Abitur zu Bekannten nach Schweden und erhalten dort die Nachricht, dass der Vater von Harald als Jude von den Nazis abgeholt wurde. Beide Männer beschließen in Schweden zu bleiben und Studieren an der Eliteuniversität Uppsala Architektur. Harald wird nach dem Studium durch den Geheimdienst abgeworben und gelangt in die höchsten Kreise des Schwedischen Adels. Er trifft hier auf Topspione aus aller Welt und baut als Offizier der Schwedischen Krone ein einzigartiges Geheimarchiv auf. Nach Kriegsende interessieren sich die Amerikaner für den weltweit bekannten Spezialisten und nutzen seine außergewöhnlichen Erfahrungen und Fähigkeiten in Zeiten des kalten Krieges. Am 13.August 1961 werden durch den Bau der Berliner Mauer die Familien Haralds und Alfreds brutal auseinandergerissen und die Trennung scheint auf unabsehbare Zeit zementiert zu sein. Da kommt der damalige Amerikanische Präsident John F. Kennedy im Sommer 1963 zum Staatsbesuch nach Westberlin und hält eine von aller Welt beachtete, flammende Rede. Er endet mit dem historischen Satz „Ich bin ein Berliner“.
Monate später, während der Weihnachtsfeiertage, bekommen Westberliner daraufhin erstmals wieder die Möglichkeit für wenige Stunden Verwandte im Ostteil der Stadt zu besuchen. Der Sohn Alfreds, Thorben, und die Tochter Haralds, Alruhn, die sich schon während der Zeit in Schweden lieben gelernt hatten, schwören sich bei diesem Treffen unter allen Umständen zusammen zu kommen. Thorben wagt bei Nacht und Nebel die Flucht in den Westen, wird aber an der Grenze angeschossen und verhaftet. Nach zwei Jahren Zuchthaus und einer Zeit intensiver Vorbereitung gelingt eine abenteuerliche Flucht über Ungarn nach Österreich. Alruhn ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bereit sich dauerhaft zu binden und so kommt es zu Zerwürfnissen und schließlich zur Trennung. Thorben versucht seinen Schmerz in Alkohol zu ertränken. Hatte er sich dafür fast erschießen lassen? War es das wirklich wert? Er zweifelt am Sinn des Lebens und gerät ungewollt in die Hände von Menschenhändlern, die ihn in die Fremdenlegion nach Kongo verschleppen. Infolge fehlender Lebenszeichen hält ihn seine Familie für verschollen oder sogar für tot. Nach sieben Jahren kehrt er als gereifter und reicher Mann nach Westberlin zurück und stellt fest, dass er Vater eines Sohnes ist. Thorben und Alruhn versöhnen sich und im November 1989 wird durch die Macht der aufgewühlten Massen der DDR die Grenzöffnung zwischen beiden deutschen Staaten erzwungen. Von nun an ziehen sich die Siegermächte des 2. Weltkrieges aus Deutschland zurück, Europa wächst zusammen und auch die beiden Familien sind wieder vereint.
Frühjahr 1964
Schwermut lag bleiern über dem Land und der nahende Frühling verschleierte die Nacht mit dichtem Nebel. Die innerdeutsche Grenze lag drohend und still inmitten der breiten Schneise, die man im Herbst1961 willkürlich in den Wald geschlagen und der Natur und dem Land tiefe Wunden beigebracht hatte. Dabei hatte der Staatsratsvorsitzende Ulbricht noch wenige Wochen vor dem 13. August `61 lauthals verkündet:
„Es hat niemand die Absicht eine Mauer zu errichten“.
Nun war sie zwischen den beiden Teilen Berlins doch gebaut worden und die Grenze der DDR zur Bundesrepublik Deutschland hatte man durch eine breite Todeszone hermetisch abgeriegelt. Die Arbeiter- und Bauernmacht ergriff drastische Maßnahmen, damit der ständig zunehmende Strom an Flüchtlingen vom armen Osten in den reichen Westen nicht das Land an Menschen ausblutete.Überall auf dieser Schneise leuchteten noch hell die Stümpfe der gnadenlos gefällten Bäume aus dem Boden. Von eilig aus vorgefertigten Betonplatten errichteten Wachtürmen aus konnte man bei klarer Sicht das Grenzgelände nach beiden Seiten hin für gut einen Kilometer einsehen. Die Türme standen Unheil verkündend in angemessenen Abständen, wie Fremdköper in der Natur herum und sollten den Grenzsoldaten Schutz vor der Witterung und vor allem einen besserten Überblick über das Gelände ermöglichen.Gelegentlich verirrte sich ein Reh im Gestrüpp des ausgelegten Stacheldrahtes, der später für einen hohen, schwer überwindbaren Zaun, bereitgelegt worden war. Die Wetterprognosen versprachen zwar in der nächsten Zeit sonnige Tage, doch davon war augenblicklich noch nicht viel zu spüren und die Kälte durchdrang die wetterfeste Tarnkleidung. Zwei Grenzer liefen gemächlich ihren Wachbereich ab und unterhielten sich leise. Sie wussten, dass der Nebel die Stimmen weiter tragen konnte, als ihnen lieb war. Ralf Lewandowski, der Ältere von beiden, stammte aus dem Erzgebirge und Rico Lang, der jüngere, kam aus Freital bei Dresden. Hier im Berliner Raum nahm man gerne junge Rekruten aus Sachsen, weil man bei ihnen im Verwandtenoder Bekanntenkreis weniger Westeinflüsse zu befürchten hatte. Rico war mit dem achtzehnten Lebensjahr zum aktiven Wehrdienst eingezogen und gleich nach der Grundausbildung zur Grenzkompanie eingeteilt worden. In der Grundausbildung hatte man ihn vor dem Klassenfeind gewarnt und ihm eingeschärft, dass es eine Ehre sei sein Vaterland mit der Waffe in der Hand zu verteidigen. Die Grenztruppen bekamen auch einen besseren Sold, als die normalen „Sandlatscher“, so nannte man die Motschützen scherzhaft in der Armee. Beide Männer hatten die Aufgabe Doppelschleife zu laufen und zu zweit den zugewiesenen Grenzabschnitt lückenlos zu überwachen. Auf der anderen Seite der Grenze lag Westberlin, die Frontstadt des Westens, die mit Rundfunk und Fernsehen weit in die DDR einstrahlen konnte und rund um die Uhr Informationen in den Osten sendete. „Hast du gestern das Fußballspiel Eintracht Frankfurt gegen Herta BSC gehört“? wollte der Ältere wissen. „Nein, für die Bundesliga interessiere ich mich nicht so sehr. Ich bin mehr Dynamo Dresden Fan“ entgegnete der Junge, der nicht wusste, ob ihn sein Kamerad für den Staatssicherheitsdienst aushorchen wollte. Halt, da war doch etwas? Beide hielten abrupt inne und erschauerten, denn ein deutliches Knacken ließ sie aufhorchen. In etwa sechzig Metern tauchte verschwommen eine Person aus dem Nebel auf, die sich leicht gebeugt den Grenzanlagen näherte. Noch ehe Rico Lang etwas sagen konnte, schrie Ralf Lewandowski: „Halt, stehen bleiben“! und gleich darauf: „Stehen bleiben, oder ich schieße“. Im nächsten Augenblick peitschten Schüsse durch die Nacht. Dann war es gespenstisch still. Die Person hielt augenblicklich inne und fiel langsam nach der Seite um, so dass die beiden herbeieilenden Grenzer sein Gesicht sehen konnten. „Mein Gott“, murmelte Lewandowki, „der sieht mir nicht aus, wie ein Klassenfeind. Der ist ja noch ein halbes Kind“. Beide blickten in das schmerzverzerrte Gesicht eines jungen Mannes. „Sag jetzt nichts, was dir später leid tun könnte“, schnurrte Lewandowski aufgewühlt den Grenzverletzer an, der ihm wütend entgegen gezischt hatte:„Ihr Schweine habt mich erschossen“. Blut quoll aus seiner linken Schulter. Der rote Fleck auf der leichten Winterjacke wurde zusehends größer, dann verlor der Getroffene das Bewusstsein. Rico wurden die Knie weich. Er jammerte: „Du hast ihn erschossen, du hast ihn erschossen. Musstest du gleich scharf schießen“? Das war sein erster Fall einer Festnahme und er stellte sich vor, was wäre, wenn er der Flüchtling gewesen wäre? Nein, lieber nicht nachdenken, der Fremde wäre ohnehin im Stacheldraht hängen geblieben und dann wäre es richtig schlimm für ihn gekommen.Vielleicht wäre er auch auf eine Mine getreten, dann ist es so schon besser und wir konnten ihn von seinem Vorhaben abhalten. Solche Grenzverletzungen mussten unverzüglich telefonisch an die vorgesetzte Dienststelle gemeldet werden. Lewandowski eilte zum Telefon und meldete mit bewegter Stimme den Vorfall. Er bemühte sich um einen militärisch sachlichen Ton: „Eine erwachsene männliche Person wurde durch Schüsse am Verlassen der Republik gehindert und dabei schwer verletzt“. „Es besteht Lebensgefahr“, fügte er mit trockener Kehle hinzu. Die Stimme versagte ihm den Dienst.Eine halbe Stunde später hielt ein Militärjeep russischer Bauart vor dem Wachturm. Der Diensthabende Offizier und ein Militärarzt eilten geradewegs in das Zimmer, in welches die beiden Grenzer den Fremden getragen hatten. Er lag auf einer Pritsche und war noch immer ohne Besinnung. Der Militärarzt untersuchte den Verletzten. Der Puls war zwar schwach, doch der Mann lebte noch. „Er muss sofort operiert werden, sonst stirbt er“, entschied der Arzt. Der Offizier forderte über Telefon mit der höchsten Dringlichkeit einen Hubschrauber an. Als die Sonne hoch am Himmel stand, fiel ein metallischer Gegenstand dumpf klirrend in die Nierenschale auf dem Operationstisch.Die Chirurgen in der Charité` hatten unter Aufbietung aller ihrer Fähigkeiten die Kugel aus der Lunge des jungen Mannes entfernt und dabei festgestellt, dass einige Sehnen und Muskeln stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Chefarzt schnaufte wütend: „Das wäre beinahe schief gegangen. Da hat sich wieder mal einer einen fetten Orden verdient“. Als er den Mundschutz abgenommen hatte, wischte er sich den Schweiß von der Stirn und ärgerte sich über den sinnlosen Schließbefehl seiner Regierung.Trotzdem auch er der Einheitspartei angehörte, war er mit diesen Praktiken an der Grenze nicht einverstanden.Im Stab der Grenztruppen hatte man inzwischen die Personalien des Mannes aufgenommen, die bei ihm gefunden wurden. Vorsorglich wurden die Eltern informiert, dass ihr Sohn, als er im Begriff war die Republik zu verlassen, durch Schüsse lebensgefährlich verletzt wurde. Routinemäßig wurde eine Akte mit folgenden Personalien angelegt:
Name: Nagel Thorben
Geboren: am 9. Februar 1943 in Falun, Schweden
Adresse: Berlin Köpenick
Vater: Nagel Alfred
Mutter: Nagel Hilda, geborene Andersson,
Schwedin
Festnahme: am 14. März 1964
Straftatbestand: versuchte Republikflucht
Gesundheitszustand: schwere Schulterverletzung durch einen Schuss aus einer automatischen Waffe.
Von nun an wurde ein präzise arbeitender Staatsapparat in Gang gesetzt, der die Strafverfolgung des Grenzverletzers zur Folge haben sollte. Als Thorben aus der Narkose aufwachte, fragt er sich, wo bin ich? „wie komme ich hier her? wie sollte es nun weiter gehen? Würde er sein geliebtes Mädchen wohl jemals wiedersehen“? Er empfand tiefe Trauer und Niedergeschlagenheit, weil seine Lebensträume in einer Nacht wie ein Luftballon zerplatzt waren. Eins war ihm nun sonnenklar: es würde nun nichts mehr so sein, wie es war.
Wie alles begann
Anfang September des Jahres 1935 war im Berliner Stadtteil Tempelhof schon wieder das geschäftige Treiben der Großstadt im vollen Gange. Die Urlaubszeit hatte nur eine kurze Atempause gewährt. Die Schrebergärten wurden nur noch an den Wochenenden angefahren und wer sich eine Reise an Nord- oder Ostsee hatte leisten können, war wieder in der Stadt eingetroffen. Der Sommer neigte sich langsam dem Ende zu und in manchen Nächten lag schon leichter Nebel über den Wiesen der Stadt. Es war ein schöner Sommer gewesen und jeder empfand ein bisschen Melancholie bei dem Gedanken, dass nun bald die kältere Jahreszeit beginnen würde. Der erste Tag des neuen Schuljahres im Schiller - Gymnasium war gekommen. Die Lehranstalt hatte nur Jungenklassen. Das Mädchengymnasium befand sich streng getrennt in einer Nebenstraße, damit die Schüler nicht durch die Begegnung mit dem anderen Geschlecht vom Lernen abgehalten wurden. Das Schulgebäude, ein Bau aus den Gründerjahren Berlins, war mit seinen schönen roten Backsteinen, hohen hellen Klassenzimmern und großen, schön geschwungenen Fenstern wie ein großes „U“ angelegt. In der Mitte dieses Gebäudekomplexes befand sich der Schulhof mit einigen weit ausladenden Kastanienbäumen, deren Blätter schon teilweise gelbe bis braune Flecken hatten und die allgemeine Laubfärbung ankündigten. Nach den Sommerferien sollte die Klasse 12b die letzte Etappe bis zum Abitur zurücklegen. Bevor der Schulbetrieb wieder einsetzte, fanden sich alle Schüler auf dem Hof vor der Schule ein und warteten, bis das Vorklingeln ertönte. Zurückblickend wurde ausgetauscht, was jeder in den großen Ferien, die in jedem Falle zu kurz waren, erlebt hatte. Und eigentlich war man auch froh, dass die Tage wieder geordnet zugingen und der untätige Urlaubstrott ein Ende hatte. Der Schulhof war in einzelne Segmente unterteilt und jede Klasse hatte ihren angestammten Stellplatz. An normalen Unterrichtstagen gingen die Schüler zu Beginn der großen Pausen im Gänsemarsch auf den Schulhof hinaus und hielten sich an ihren zugeordneten Plätzen auf. Diese Ordnung hatte den Vorteil, dass die große Zahl von Schülern von der Schulleitung perfekt beobachtet und kontrolliert werden konnte. Harald, ein neuer Schüler, wartete etwas abseits vom Standort seiner zukünftigen Klasse 12b. Er sollte in diesem Jahr neu hinzukommen, hielt sich aber noch zurück, bis das Klingelzeichen die Schüler, wie in jedem Jahr, am ersten Schultag zur Eröffnungsfeier in die Aula rief. Die Aula befand sich in der ersten Etage direkt über der Turnhalle als schöner Festsaal mit einem flexiblen Stuhlbestand und einer kleinen Bühne. Auf der linken Seite der Bühne war ein Rednerpult aufgestellt, welches an der Vorderseite das Schulwappen trug. Rechts daneben saßen die Mitglieder der Schulleitung an einem langen Tisch. Vor dem Pult war ein Fahnenständer auf dem Fußboden befestigt, bei dem sowohl die Reichsals auch die Berliner Flagge eingesteckt waren. Nachdem sich alle Schüler laut klappernd und schwatzend auf ihren Plätzen niedergelassen hatten, trat der Direktor, Herr Dr. Scholz, an das Pult: „ Meine Herren, ich bitte sie um Disziplin und Aufmerksamkeit, denn bei allem Verständnis für ihre Wiedersehensfreude mit ihren Klassenkameraden und der Schule wollen wir das neue Schuljahr beginnen. Ich begrüße zuerst die neuen Klassen mit all ihren hoffnungsvollen Talenten und nicht zuletzt auch die Alteingesessenen“. Er erläuterte traditionell die straffe Schulordnung und versuchte die heranwachsenden jungen Männer dafür zu motivieren für sich und ihr Vaterland im Unterricht beste Ergebnisse zu erzielen. „Sie sind die Zukunft unseres Reiches und ich erwarte von ihnen, dass sie sich dieser Verantwortung bewusst stellen. Geben sie ihr Bestes, damit unser Volk und unser Führer stolz auf sie sein können“. In dieser Schule arbeiteten mehrere Lehrer, die den Schülern eine hohe Lernmotivation vermitteln konnten. Dadurch wurde im Maßstab der Reichshauptstadt ein überdurchschnittlich hohes Wissensniveau gehalten. Nach der großen Ansprache gingen die Schüler geordnet in ihre Klassenräume.Als Harald in das Klassenzimmer kam, nahm zunächst keiner Notiz von seiner Anwesenheit, bis der Klassenlehrer, Herr Neumann, in den Raum trat und den Neuen vorstellte: „Das ist ab heute euer neuer Mitschüler Harald Eisenstein“. Zu Harald gewandt wünschte er: „Viel Erfolg und gutes Gelingen in der letzten Klasse. Setzen sie sich erst einmal auf die hintere Reihe. Alfred sie, als Klassensprecher, werden Harald nachher einen Platz zuweisen“. Damit war das Organisatorische zur Einführung des Neuen abgeschlossen. Alfred, der Klassenprimus der Zwölften, galt als hoch begabt, hatte ausgezeichnete Noten und galt als der körperlich Stärkste unter den Jungen. Als Klassensprecher vertrat er die Klasse nach außen. Nach innen richteten sich alle nach seiner Meinung. Die Klasse war ein intelligentes Rudel und Alfred der Leitwolf.
Harald Eisenstein hatte eine lange Krankheit hinter sich. Die Ärzte hatten den Eltern geraten, die unterbrochene Klassenstufe noch einmal zu beginnen, damit der Anschluss an den anspruchsvollen Lehrstoff bis zum Abitur nicht zu schwer würde. Herr Neumann verkündete den Stundenplan und ermahnte alle noch einmal ihr Bestes zu geben, damit bei den Abiturprüfungen gute Ergebnisse erzielt werden konnten. „Dass alle das Ziel schaffen werden, steht für mich außer Frage“, betonte er, „doch sie sollen es auch mit guten Ergebnissen abschließen“. Er kannte seine Klasse gut und traute ihnen eine Menge zu. In der Horde Jungen, wo alle starke Persönlichkeiten sein wollten, musste jeder täglich den Rang seiner Popularität neu erkämpfen. So wurde Harald gleich am ersten Tag auf die Probe gestellt. „Hast du Kraft“? wollten die Mitschüler wissen. Auf alle Fälle war nun eine neue Rangverteilung fällig. Der Neuling, mit sympathisch weichen Gesichtszügen und einer schlanken Figur konnte doch, vom ersten Eindruck her, in der internen Hierarchie der Jungen nur auf den hinteren Plätzen landen. So forderte ihn der ständige Herausforderer und Rivale Alfreds, Georg auf: „Wenn du testen willst, welchen Platz du künftig in der Klasse einnehmen willst, sollten wir unsere Kräfte per Armhebel messen“. Nach anfänglichem Zögern willigte Harald ein, er wollte ja nicht als Schlappschwanz angesehen werden. Die anderen Jungen waren freudig gespannt auf den Kampf und richteten sofort in der grossen Pause eine Schulbank her. Da war gleich zu Schulbeginn richtig etwas los. „Wie wird sich der Neue einordnen lassen“? lautete die spannende Frage. „War er ein Kämpfer oder war er so sanft, wie seine Augen“? Harald hatte bisher noch nicht viel gesagt, aber nun stellte er die Bedingungen: „Wer den Handrücken des Anderen auf den Tisch drückt, hat gewonnen. Und wer gewonnen hat, tritt gegen den Stärksten an“. So kühn hatte noch keiner vor ihm gesprochen und die Allgemeinheit war widerwillig bereit, Haralds Forderungen zu akzeptieren. Die Devise hieß: „Erst mal abwarten, dann konnte man ja weiter sehen“. Georg war der ewige Zweite hinter Alfred. Mit breiten Schultern und einem geschmeidigen Gang demonstrierte er, weit hin sichtbar seine Kraft und sportliche Fitness. Sein eckiger Kopf und seine blonden Haare verliehen ihm ein nahezu seemännisches Aussehen. Beide Jungen streiften langsam die rechten Ärmel hoch, so dass man auch die Muskeln sehen konnte, wenn sie sich anspannten. Georg genoss sichtlich den Augenblick, so konnte er allen Anderen wieder einmal zeigen, wasfür ein toller Kerl er war. Er lächelte lässig und überlegen: „Diesem Milchgesicht werde ich von Anfang an Respekt beibringen“. Als beide bereit waren, setzen sie sich an der vorbereiteten Schulbank gegenüber und gaben sich die Hand. Georg begann sofort mit aller Macht zu drücken, doch Alfred rief dazwischen: „Halt, Schorsch, ich gebe das Kommando und erst dann wird gedrückt. Nun noch einmal zur Ausgangsstellung“. Beide Kampfhähne setzten sich wieder in die Ausgangsstellung zurecht, dann rief Alfred ein kurzes „los“! Dieses Mal hielt Harald dem Druck Georgs stand. So sehr sich auch Georg mühte, er brachte Harald nicht zum Nachgeben. Die Angelegenheit schien unentschieden auszugehen. Nun wurde es für Alfred interessant. Wenn er dem Bullen Georg so lange standhielt, musste der noch mehr drauf haben. Bring` die Sache zu Ende Schorsch“ schnurrte er Georg an, „dieses Milchgesicht wirst du doch wenigstens schaffen“. Georg drückte was er konnte, ihn packe die Wut und er lief hochrot an. Seine Kräfte drohten langsam zu erlahmen, da merkte er, wie sein Gegenüber den Druck noch erhöhen konnte. Er dachte nur noch an die Blamage der Niederlage, doch dann war sein Arm zu nichts mehr fähig. Wie ein entsicherter Hebel kippte er um. Der Oberarm wurde ihm fast aus der Kugel gerissen. Sein Arm tat verdammt weh, doch schlimmer war die Blamage verloren zu haben. Erschrocken über seine Niederlage, blickte er sich um, ob nicht einer der Umstehenden schadenfroh lachte. Er brachte nur anerkennend heraus: „Du bist ja ein richtig harter Brocken, ich hätte nicht gedacht, dass ich heute verliere. Vielleicht habe ich heute nur eine schlechte Tagesform erwischt. Ich fordere für später eine Revanche“. Harald hatte zwar gewonnen, doch richtig glücklich war er dabei nicht. Instinktiv fühlte er, dass er sich ab jetzt einen Feind geschaffen hatte. Die Umstehenden schwiegen betreten, denn keiner wollte sich mit dem Bullen Georg anlegen. Ein überschwänglicher Beifall für den Sieger musste also ausfallen. „Du bist überraschend gut“, erkannte Alfred an. „Ruh erst mal deinen Arm aus und dann trittst du nach der nächsten Stunde gegen mich an, doch das wird schwerer werden, das verspreche ich dir“. Der ins Zimmer hinzugekommene Fachlehrer für Kunstgeschichte, Herr Uhlig, hatte die letzte Phase des Kampfes noch miterlebt doch nicht eingegriffen, nur verständnisvoll gelächelt. Er kannte es, es war ein immer wiederkehrendes Ritual, die Neuverteilung der Rangfolge unter den halbwüchsigen Jungen, die stolz auf ihre Körperkräfte sind. „Nun wenden wir uns einem Fach zu, was für die Menschwerdung des Affen genauso wichtig war, wie körperliche Stärke, nämlich die Kunst“, begann er. „Harald, kommen sie doch gleich mal vor die Klasse und zeichnen sie aus dem Gedächtnis ein Pferd. Sie werden sehen, wie schwierig es ist, ohne Vorbereitung und ohne Modell eine solche Aufgabe zu lösen. Und dabei denken wir alle, wir haben einen hohen Stand der Zivilisation erreicht“. Harald nahm die weiße Kreide, begann an der Wandtafel zu malen und der Lehrer fuhr in seinen Ausführungen fort, ohne auf Haralds Arbeit zu achten. „Wir werden sehen, was aus der Aufgabenstellung herausgekommen ist und wie wir bei dieser, so einfach erscheinenden Arbeit versagen“, mit diesen Worten wandte er sich der Tafel zu und schaute verblüfft an die Wand. Mit wenigen Strichen hatte Harald ein Pferd auf die Tafel gezeichnet und die Bewegungsabläufe eines Galopps klar herausgehoben. „Harald“, begann Herr Uhlig verblüfft, „Sie werfen meine ganze schöne Theorie über den Haufen. Warum sind sie so gut“? Alfred gab einen Laut der Bewunderung ab. „Da haben wir uns ja ein richtiges Schätzchen eingefangen“, raunte er, "mal sehen, was der noch für Überraschungen im Ärmel hat“. Die Stunde ging zu Ende, doch ehe der mit Spannung erwartete neue Kampf ausgetragen werden konnte, musste die Schulbank wieder vorbereitet werden. Eilfertig räumten die zwei Schüler in der ersten Reihe ihren Platz und stellten die Stühle bereit. Schon während des Unterrichts wurde über den bevorstehenden Kampf getuschelt. Würde der Neue auch noch den Alfred schaffen oder er erhielt eine vernichtende Niederlage? Alfred hatte bisher Jeden geschafft und so war man sich allgemein sicher, wie der nächste Kampf enden würde. Schnell räumten die Umstehenden das Feld, so dass die Rivalen gegenüber zum Sitzen kamen. Beide angehenden Männer waren mit etwa eins achtzig gleich groß. Haralds Erscheinung war eher schlank und gereift, Alfred dagegen, wirkte eher mehr jugendlich stämmig und kantig. „Du kannst wählen, welchen Arm du nehmen willst, ich werde dich in jedem Falle schlagen, einer muss nur noch das Startzeichen geben“, verkündete Alfred. Die Gegner nahmen sich bei den Händen und sahen sich fest in die Augen. Aus der Menge ertönte es mehrstimmig: „auf die Plätze, fertig, los“. Harald wusste, wenn er Alfred schaffte, hatte er die gesamte Klasse gegen sich. So drückte er zum Anfang so stark er konnte, um die Kraft des Anderen auszuloten. Als Alfred gegenhielt, nahm er allmählich den Druck zurück. Alfred bemerkte diese Taktik und war zunächst irritiert, dann ließ auch er in seinem Druck nach. Nach außen hin taten beide so, als ob ihnen vor Anstrengung die Adern aus dem Hals kamen. In dieser Stellung verharrten beide, bis das Klingelzeichen zur nächsten Stunde ertönte. So mussten der Kampf ohne Entscheidung abgebrochen werden. Ein Raunen ging durch die Reihen: „Dieses Milchgesicht hätte doch tatsächlich fast den Klassenprimus auch noch geschafft“. Das war eine echte Überraschung. Georg ärgerte sich nun nicht mehr so sehr über seine Niederlage, denn keiner hatte vermutet, welche Muskeln dieser Junge mit dem sanften Blick gegenhalten konnte. Alfred traf sich mit Harald auf dem Heimweg. Dieser Junge war ihm vom ersten Augenblick her sympathisch gewesen. Er konnte es nicht erklären, aber hier spürte er eine gewisse Seelenverwandtschaft, fühlte sich zu Harald hingezogen. „Du gefällst mir“, begann Alfred das Gespräch, „wollen wir uns nachher mal treffen“? „Ich bin dazu bereit, aber ich habe erst einmal meine häuslichen Pflichten zu erledigen. Da meine Eltern ein kleines Geschäft für Künstlerbedarf am Tempelhofer Damm betreiben, muss ich meine Mittagsmahlzeit selbst zubereiten und gelegentlich im Laden aushelfen“. Die beiden trafen sich dann am späten Nachmittag und hatten sich viel zu erzählen. „Warum haben wir uns nicht früher schon mal gesehen“? wollte Alfred wissen, „wir waren doch bisher in der gleichen Schule doch nur in unterschiedlichen Klassenstufen“? Die Antwort darauf wussten beide nicht. So entspann sich zwischen den halbwüchsigen Jungen eine beginnende Freundschaft. Alfred änderte am nächsten Tag die Sitzordnung, so dass Harald auf der Schulbank neben ihm zum Sitzen kam. In der Folgezeit erwies sich Harald als ein überaus begabter Schüler, dem Klassenbesten, Alfred, nahezu ebenbürtig. Alfred, der Sohn vermögender Eltern, die in besten Wohnlagen Berlins eine Reihe von Mietshäusern besaßen, genoss das Leben in vollen Zügen. Er war klug, sah mit seinem glatten braunen Haaren recht gut aus und hatte, trotz beträchtlicher monatlicher Zuwendungen durch die Eltern, ständig Geldsorgen. Harald war ein zielstrebiger Bursche, der zwar auch intelligent war, aber mehr Talent für die schöngeistigen Fächer aufbrachte. Harald malte gern und viel. Schon früher konnte er sich bei den Schulkameraden mit seinen Portraits ein paar Mark dazu verdienen. Gelegentlich half er bei einer befreundeten Familie aus, die am Tempelhofer Damm, nahe dem S-Bahnhof einen Kolonialwarenladen hatten. Er begleitete den Verkäufer zur Großmarkthalle und half beim Auf- und Abladen der Obst- und Gemüsekisten. So verdiente er sich etwas Geld, um die Familienkasse zu entlasten. Die Wintermonate boten sich bei den zwölften Klassen traditionell an, Tanzunterricht in Gesellschaftstänzen zu nehmen. Es gehörte einfach zum guten Ton, dass Eltern, die etwas auf sich hielten, ihre halbwüchsigen Kinder zur Tanzstunde schickten. In Berlin gab es zu dieser Zeit mehrere berühmte Tanzschulen, die auch Nachwuchs für den nationalen und internationalenTurniertanz ausbildeten. „Ich habe eine gute Tanzschule empfohlen bekommen“, begann Alfred eines Tages. Mein Vater hat über seine ausgezeichneten Beziehungen im benachbarten Neukölln ein angesehenes Haus ausgemacht“. Hier sollten die beiden jungen Männer der Weiblichkeit auf eine angenehme Art näher kommen. Der Gesamtkurs umfasste zehn Wochentage, jeweils Donnerstag von achtzehn bis zweiundzwanzig Uhr zuzüglich Mittel- und Abschlussball, jeweils an den entsprechenden Wochenenden. Wegen des späten Endes in den Nachtstunden mussten die Eltern die schriftliche Einwilligung zur Teilnahme einreichen. Die Tanzlehrer und die Polizei duldeten in diesem Punkt keine Ausnahmen. Das Tanzlehrer Ehepaar: „Wir bringen den jungen Herren nun bei, wie sich ein Gentleman gegenüber einer Dame verhält, wie man stilvoll am Tisch sitzt und wie man sich bei gesellschaftlich wichtigen Empfängen verhält“. Einige Grundbegriffe hatten beide Jugendlichen schon aus dem Elternhaus mitbekommen, doch hier wurde die Vollendung gemäß Knigge gelehrt. Alfred fand das am Anfang etwas übertrieben, doch Harald hielt ihm entgegen: „Mit erfolgreichem Abschluss eines Studiums könnten wir zur geistigen Elite der Nation zählen und da muss man etwas auf sich halten und Etikette wahren“. Irgendwo hatte er diesen Grundsatz einmal gelesen. „Gutes Benehmen ist immer von Vorteil“.Harald wurde durch die Tanzpartnerinnen mehrfach wegen seines Namens gefragt, ob er Jude sei, doch ohne zu zögern antwortete er: „Ich gehöre keiner besonderen Konfession an, ansonsten aber glaube ich an Gott“. Damit waren die Fragen im Allgemeinen beantwortet. Ganz wohl war ihm nicht bei dem Gedanken: „Warum musste er sich immer seiner Herkunft wegen rechtfertigen“?
Das Jahr nahm mit Aufgaben und Prüfungen seinenLauf und beide Freunde konnten sich bei der Erarbeitung des Lehrstoffes auf wunderbare Weise ergänzen. Schließlich war die Schule zu Ende und die Mühen schienen sich gelohnt zu haben. Alle Schüler der Zwölften hatten die Prüfungen mit Erfolg abgeschlossen und so kam der Tag der Zeugnisausgabe und der Urkundenverleihung heran. Beide Jungen hatten sich verabredet, gemeinsam zu dem erwarteten Zeremoniell zu erscheinen und ihre besten Anzüge aus dem Schrank geholt. Schließlich bekam man nicht alle Tage das begehrte Abiturzeugnis überreicht. Herr Neumann, ihr Klassenlehrer, empfing die festlich gekleideten Herren in ihrem Klassenzimmer und beglückwünschte jeden Einzelnen für seinen gelungenen Abschluss. Die große Feierstunde wurde unter Einbeziehung aller Lehrer und Schüler in der Aula abgehalten und begann mit einer Darbietung des Schulchores, der Beethovens „Freude schöner Götterfunken“ aus seiner Neunter Symphonie sang. Anschließend hielt der Direktor Dr. Scholz eine flammende Rede von Vaterland und Stolz und von Anstrengungen des deutschen Volkes, welches sich verteidigen müsse. Schließlich wurden alle fertigen Abiturienten zum Zeugnisempfang auf die Bühne gerufen, nur Harald nicht. Alfred wandte sich fragend an den Freund: „ Du hast doch auch bestanden, oder nicht“? Harald war genauso erstaunt, wie die Anderen, aber er blieb auf seinem Platz sitzen und wartete geduldig, dass etwas passierte. Es konnte sich nur um einen Irrtum handeln, er war doch einer der Besten gewesen und hatte in fast allen Fächern glänzend abgeschnitten.Die Feier nahm ihren Lauf, doch warum bekam ausgerechnet er sein ehrlich verdientes Zeugnis nicht? Er traute sich auch nicht zu fragen, weil plötzlich eine furchtbare Unsicherheit in seinen Gliedern saß. „Frag` du doch mal, warum ich nicht aufgerufen wurde“, bat er seinen Freund. Alfred wollte es nun genauer wissen und meldete sich wegen des offensichtlichen Versehens zu Wort. Doch ehe er den ersten Satz beendet hatte, zog ihn ein Lehrer zur Seite und macht ihm klar, „Harald ist eines deutschen Abiturzeugnisses nicht würdig, weil sein Vater Jude ist“. „Hast du das gewusst“, wollte Alfred von Harald wissen. Harald saß da, wie ein Häuflein Unglück: „Mir ist plötzlich bitter kalt, ich will nur noch weg von hier“. Er verließ die Veranstaltung, ohne sich zu verabschieden, in ihm kochte es gewaltig und er fühlte nur noch Wut und Verzweiflung. Irgendetwas war in dieser Welt nicht in Ordnung und ausgerechnet er musste darunter leiden, dass sein Vater nicht arischer Abstammung war. Zu Hause gab es heftige Diskussionen. Die Eltern glaubten nicht, dass die Schule das Zeugnis zurückhielt, nur weil Harald einen jüdischen Vater hatte. Es musste noch einen anderen Grund geben. Hatte er nicht zielstrebig genug gelernt oder sich daneben benommen? Warum hatten seine Eltern so plötzlich kein Vertrauen mehr zu ihm? Harald verstand die Welt nicht mehr. Aber sollte er darum gleich seinen Vater verdammen, nur weil die große Politik und der Führer es so wollten? Alfred kam gleich nach Ende der Veranstaltung zu Haralds Eltern und klärte den Zweifel auf. Ihm tat es in der Seele weh, dass sein Freund für all die Arbeit und Mühen leer ausgehen sollte. Doch offen zu opponieren hatte er nicht gewagt, weil er dann leicht mit in den zu erwartenden Sog hinein gezogen würde. In solchen unsicheren Zeiten hielt man manchmal lieber die Klappe, ehe man sich die Zunge verbrannte. Man hatte ja schon einiges gehört, dass jüdischen Menschen das Leben schwer gemacht wurde und in der Öffentlichkeit verstärkt eine systematische Herabsetzung betrieben wurde. Im Stadtteil Mitte hatten braune Horden mehrere Läden jüdischer Händler demoliert und mit Hakenkreuzen beschmiert. In Berlin Neukölln hatten sie ein ganzes Kaufhaus angebrannt. Besonders krasse Nachrichten kamen aus Bayern, wo jüdische Mitbürger aus ihren Häusern getrieben wurden. Doch in der letzten Zeit waren die Nachrichten spärlicher geworden und einige munkelten schon, dass die Gerechtigkeit gegen diese Elemente siegen werde. Alfred schlug kurzerhand vor: „Nun machen wir erst mal Ferien. Wir haben da eine befreundete Familie in Schweden. Die würden sich freuen, wenn wir einige Wochen bei ihnen verbringen. Über die Finanzen brauchst du dir keine Sorgen zu machen, erstens sind diese Leute nicht arm und zweitens werden uns meine Eltern unterstützen“. Harald willigte schweren Herzens ein, er wollte erst einmal alles um sich herum vergessen. Alfred übernahm die schriftliche Anfrage per Post und binnen einer reichlichen Woche war die positive Bestätigung da.
Falun, der 11. Juni 1935
Lieber Alfred,
Du weißt, dass Deine Familie bei uns immer herzlich willkommen ist.Auch für Deinen Schulfreund wollen wir gute Gastgeber sein.Bereite ihn auf das Landleben vor, denn hier ist das Leben einfacher, als im schönen Berlin und die Uhren gehen hier anders, als bei Euch. Momentan ist sehr viel Arbeit auf dem Hof und auf den Feldern, aber wir werden noch genügend Zeit miteinander verbringen können.
Liebe Grüße auch an Deine Eltern
Lars und Annegret Lindgreen
In der Abschlusskonferenz der Schulleitung des Gymnasiums kam der Fall Haralds nochmals zur Sprache. Einige Lehrer fanden die Entscheidung des Direktors nicht richtig, zumal der Junge die Sympathien aller auf seiner Seite hatte. Doch der Direktor Dr. Scholz blieb in seiner Entscheidung hart. Der Klassenleiter der ehemaligen 12b, Herr Neumann, hörte sich die fadenscheinigen Gründe an, warum man Harald das Abschlusszeugnis verweigert hatte, doch er wollte sich damit nicht abfinden. Sein Protest fand im Stillen statt. Schließlich ging es um die Zukunft eines begabten jungen Mannes, der weiter keine Verbrechen begangen hat, als dass sein Vater Jude war. Er fand einen Grund nach Dienstschluss länger zu bleiben, um das Zeugnis nachträglich noch ausliefern zu können. Geschrieben hatte er es zusammen mit den anderen, doch der Direktor hatte es vor der allgemeinen Übergabe unter Verschluss genommen. Nun kam es darauf an, in den Besitz des Dokumentes zu gelangen, ohne dass es jemand merkte. Herr Neumann wusste, dass es kriminell war, was er nun tat. Trotz heftiger Bedenken, wollte er begangenes Unrecht wieder gut machen und brach in das Büro des Direktors ein. Wenn jemand dahinter kam, konnte er seinen Beruf an den Nagel hängen.Das Büro des Direktors, gleich neben dem großen Lehrerzimmer im ersten Stock, war bei dessen Abwesenheit immer verschlossen. Der Klassenlehrer besorgte sich einen stabilen Dietrich und öffnete vorsichtig die kleine Verbindungstür. Er betrat mit klopfendem Herzen den ehrenwerten Raum, mit dem übergroßen Bild des letzten Kaisers und den schön geschwungenen Möbeln, die allesamt nach dem Pfeifentabak des Inhabers rochen. Im hinteren Teil des Raumes befanden sich die Unterlagen für Lehrer und Schüler in einer Registratur sauber nach Anfangsbuchstaben der Nachnamen abgeheftet. Die Schubfächer dieses Archivs waren abgeschlossen, doch er wusste, wo die Schlüssel aufbewahrt wurden. Oft genug hatte er zugeschaut, wie und wo die Sekretärin des Direktors die Schlüssel verwahrte. Halt! da war doch ein Geräusch? Wie elektrisiert hielt er in seinen Bemühungen inne und wagte nicht zu atmen. Richtig, der Hausmeister kam mit schweren Schritten den Gang entlang und rief: „Ist da noch jemand“? Im leeren Haus hallten Schritte und Rufe deutlich wider. Er wollte offensichtlich das Haus abschließen. Als niemand antwortete, ging er schließlich wieder nach unten.Dann war alles wieder still und der Lehrer nahm erneut seine Suche auf. Der vierte Schieber war der richtige. Hier waren alle Schüler mit dem Anfangsbuchstaben –E – abgelegt und nach Klassenstufen geordnet.Er nahm das Zeugnis von Harald Eisenstein heraus und schloss alles wieder sorgfältig ab. Doch wie verhielt er sich, wenn der Verlust bemerkt wurde? Dieser Gedanke schoss ihm durch den Kopf. Jetzt, wo er sicher sein konnte nicht gestört zu werden, konnte er diese Aufgabe doch auch besser und auch unauffälliger beenden. In aller Ruhe schloss er die Registratur wieder auf, suchte nach einem unausgefüllten Zeugnisformular und schrieb das Dokument mit größter Sorgfalt ab. Nun musste auch noch ein Stempel auf das Papier, sonst war es nicht rechtswirksam. Auch die Stempel waren im Schreibtisch sicher verwahrt, doch zum Glück war er an dieser Stelle offen. Nach reichlichen zwanzig Minuten besah Herr Neumann sein Werk und war mit sich zufrieden. Doch halt, die Unterschrift des Direktors fehlte noch. Der Chef unterzeichnete immer mit einem undefinierbaren Gekrakel, was nicht im Entferntesten an seinen Namen erinnern konnte. Der Lehrer musste also diesen Schwung in der Schrift erst üben. Nach mehreren Anläufen und einigen vollgeschmierten Blättern kam sein Namenserkennungszeichen der Unterschrift des Direktors sehr nahe. Nicht ohne ein ungutes Gefühl in der Magengegend beendete er seine Urkundenfälschung und besah sich seine Arbeit. Dieses Exemplar war vom echten in keiner Weise zu unterscheiden. Nun zum Abschluss noch das Schulsiegel darauf. Dieses Detail hätte er fast vergessen. Ein Blick auf dem Schulhof... der Hausmeister war nicht zu sehen. Herr Neumann schloss alles wieder sorgfältig ab, packte die vollgeschmierten Übungsblätter ein und verließ über den Hinterausgang die Schule. Festen Schrittes und in der Überzeugung größeres Unrecht verhindert zu haben, ging der Lehrer nach Hause, steckte das Zeugnis in einen neutralen Umschlag und schickte den Brief ohne Absender an Herrn Harald Eisenstein. Wie groß war die Überraschung, als Harald einen Tag später sein Zeugnis in der Hand hielt. Haralds Mutter hatte die Post aus dem Briefkasten genommen und den Umschlag von allen Seiten betrachtet. Nichts deutete auf den Inhalt und seinen Absender hin. „Harald, du hast Post“, rief sie ins Haus. Als der Junge den Brief öffnete, lüftete sich das Geheimnis. „Irgendjemand muss mich mögen“, strahlte Harald. Er hielt nun, wenn auch verspätet, seinen verdienten Lohn für die Jahre angestrengter Arbeit in den Händen. Als Alfred von dem Brief hörte, war seine spontane Reaktion: „Das war bestimmt der Neumann. Wenn das der Scholz wüsste, würde er fristlos entlassen werden“.
Die Fahrt nach Schweden
In den nächsten Tagen packten Alfred und Harald alles Nötige für die Reise zusammen, verschnürten es auf die Fahrräder und radelten eines Morgens in Richtung Norden nach Stettin. Mutter Nagel rief den Beiden nach: “Grüßt Tante Gertrud und Onkel Ernst von uns“. In Stettin hatte die Nagels Verwandtschaft, Tante Gertrud, die Schwester von Mutter Nagel und Onkel Ernst, Angestellter bei der Stettiner Hafenbehörde. Stettin sollte also das erste Etappenziel sein. Unterwegs auf der Landstraße trafen sie mitunter Pferdewagen und Traktoren, die ihre Abgase als lustige Kringel über einen verdicktes Auspuffruhr senkrecht in die Luft stießen. „Wollen wir mal mit solch einem Trecker um die Wette fahren“? versuchte Harald seinen Freund anzufeuern. „Nein, ich bin eher dafür mich hinten festzuhalten, damit wir Kräfte sparen“, wandte Alfred ein. So ließen sie sich einige Kilometer von Maschinenkraft ziehen. Hin und wieder begegnete Ihnen ein Auto. Das Wetter erlaubte ihnen das erste Stück bis Eberswalde- Finow zu fahren. Kurz vor der Stadt, überraschte sie ein heftiges Sommergewitter mit Regen und Windböen. Bei dem unfreiwilligen Stopp konnten sie sich gleich die dortige technische Meisterleistung ansehen, das große Schiffshebewerk. Noch ehe der Regen verebbt war, kam schon wieder die Sonne hervor und leckte sanft die nassen Straßen trocken. Man konnte zusehen, wie die kleinen Pfützen verdampften und es roch angenehm nach frischem Sauerstoff. Nach weiteren fünf Stunden Fahrt sahen sie die Zinnen der schönen Hansestadt Stettin. Schon vom Weiten leuchtete ihnen der Turm der Nikolaikirche und der dicke Bauch des Wasserturms entgegen. Tante Gertrud in Stettin hatte sie schon erwartet. Sie spülten sich den Schweiß des Tages vom Körper und zogen sich in aller Eile um. „ Beeilt euch“ drängelte sie, „wir haben heute Hafenfest und da wird immer viel geboten“. Onkel Ernst hatte einen Prospekt des Veranstaltungsprogramms zur Hand und so wussten sie, wo sie hin streben konnten. Onkel Ernst und Tante Gertrud hatten die Fünfzig überschritten und ihre Kinder hatten auch schon wieder eine reiche Nachkommenschaft. Doch im Herzen waren sie jung geblieben und so mischten sie sich mit den beiden jungen Gästen unters Volk und hatten ihren Spaß dabei. Der Höhepunkt des Abends war eine Flottenparade auf der Oder unter Flutlicht und die Ansprache des Bürgermeisters, einer Nazi - Größe. Harald umschlich bei den Worten der Rede ein deutliches Unbehagen. Der Kommunalpolitiker sprach offen von der Ausrottung des Judentums und der Reinigung des Deutschen Volkes von schädlichen Elementen. Da war es wieder das Gefühl, welches er während der Zeugnisausgabe schon einmal hatte. Er fühlte, wie sein Selbstvertrauen auf null sank. Alfred hatte Haralds Stimmungsabfall mitbekommen und versuchte ihn zu aufzumuntern: „Wir sind morgen schon in Schweden und da werden andere Themen eine Rolle spielen. Lass dir von solch einem Möchtegern nicht die Laune verderben. Der erzählt nur das, was in Hitlers Bibel steht. Die meisten kleinen Lichter der NSDAP sind oft zu übereifrig. Wer weiß ob diese Leute auch meinen, was sie sagen.“ Die Luft war abends noch mild, auch wenn von der Ostsee zuweilen eine frische Brise herüber wehte. „Der Tanzboden ist ja rappelvoll, so dass wir erst einmal zuschauen müssen“, meinte Onkel Ernst, der sich schon auf ein Tänzchen mit seiner Gertrud gefreut hatte. „Sieh` mal an“, wandte sich Gertrud an Alfred, „die anwesenden Mädchen drehen sich schüchtern nach euch gut gewachsenen Bengels um“. Sie kicherten untereinander verschämt und schüchtern, als sie angesprochen wurden. Es fiel den Beiden nicht schwer hier und jetzt Bekanntschaften zu schließen und nach ausgiebigem Tanz wurden pro forma Adressen ausgetauscht. Hier war der Kontakt mit dem anderen Geschlecht viel spannender als zu Hause, wo sie sich für Mädchen nicht sonderlich interessiert hatten. Um Mitternacht wurde durch die Behörden das Licht gelöscht, es war Polizeistunde. Alles protestierte kurz, doch es half nichts, die Veranstaltung war damit beendet. Alfred und Harald packten am nächsten Tag Proviant für die Weiterreise in die Taschen und begaben sich wieder auf die Landstraße. „Wir müssen die letzte Fähre von Saßnitz nach Trelleborg noch erreichen“, hatte Alfred bestimmt.Von Stettin fuhren sie über Pasewalk, Anklam, Greifswald nach Stralsund. Dort ging es über den künstlich aufgeschütteten Damm neben der Eisenbahnstrecke her auf die größte Insel Deutschlands, nach Rügen. Gegen achtzehn Uhr waren sie in Saßnitz und müssten sich beeilen, die Tickets zu lösen, durch den Zoll zu kommen und im Galopp auf das Schiff zu rennen. Da legte die Fähre auch schon ab und bei ruhiger See und auflandigem Wind konnten sie sich auf einige Stunden Ruhe einrichten. Da sie vom Radfahren recht müde waren, suchten sie sich ein ruhiges Plätzchen auf dem Schiff und schliefen neben Rädern und Gepäck ein. Erst als der Steuermann kurz vor der hell erleuchteten Einfahrt von Trelleborg mehrmals das Signal zog, wurden sie wach und bereiteten sich auf den Landgang vor. Alfred streckte seine steifen Beine in die Länge und zeigte nach Osten: „Hier sehen wir schon den kräftigen Schimmer des kommenden Tages über den Horizont leuchten. Durch die zunehmende Nähe am Polarkreis geht hier die Sonne nicht mehr vollständig unter“. In Trelleborg war es schon weit nach Mitternacht und die Leute schliefen für gewöhnlich um diese Zeit. Die beiden Deutschen wollten sich eine Herberge suchen, doch weit und breit war keine Menschenseele zu sehen, die man fragen konnte. Ein Polizist von der Hafenbehörde hörte sich schließlich ihr Anliegen an und half ihnen, indem er Auskunft gab, wo zu dieser Zeit noch Schlafplätze frei seien: „Es ist zurzeit hier Feriensaison, und die Hafenbehörde ist auf solche späten Besucher eingerichtet. Fahren Sie zur Jugendherberge, die ist nicht weit entfernt“. Nur wenige Minuten hatten sie bis zu ihrer Unterkunft zu strampeln, dann sahen sie da hell erleuchtete Schild. Die Beine waren inzwischen schwer wie Blei geworden und die Kühle der Nacht ließ sie durch die dünne Kleidung frösteln. Als sie in der Unterkunft ankamen, war die Rezeption nicht mehr besetzt. Auf dem schwach erleuchteten Tresen fanden sie einen Zettel vor mit der Nummer des Zimmers, in dem sie übernachten konnten. Harald staunte nicht schlecht: „Die Leute haben grenzenloses Vertrauen zu uns“. Alfred konnte diese offene Gastfreundschaft nur bestätigen, er hatte mit seinen Eltern viele schöne Stunden auf diese Weise erlebt.Ausgepackt wurde nur das Nötigste, denn am nächsten Morgen sollte es in das Landesinnere weiter gehen. Alfred hatte die Planung für Schweden übernommen, weil er sich schon aus mehreren Reisen auskannte. So schlug er vor:„Die Tagesetappen sollten jeweils etwa einhundert Kilometer betragen, damit wir zwischendurch sehenswerte Stätten ansehen oder bei Bedarf in einem See baden können“. „Einverstanden“, kam es von Harald, dem es auch so vernünftig erschien. Bis Stadt und Schloss Kalmar sollte die erste Etappe gehen. Riesige Felder mit blühendem Raps färbten die ganze Landschaft in ein leuchtendes Gelb. Im farblichen Kontrast dazu standen die Wiesen mit dem üppigen Grün und Millionen von leuchtend roten Blüten wilden Klatschmohns. „Das Farbenspiel der Natur in dieser bunten Vollendung habe ich noch nie gesehen“, bemerkte Harald, „ich bin wie verzaubert. So stelle ich mir den Garten Eden vor. Das Land beeilt sich, wie es scheint, in seinem kurzen Sommer alle verfügbaren Schönheiten der Natur auf wenige Wochen zu konzentrieren. Der Zyklus des Werdens, Blühens, Reifens und der Ernte wird zwangsläufig enger zusammengedrängt und bringt eine unbeschreibliche Farbenpracht hervor“. In Kalmar, der ersten Etappe, erklärte ihnen ein Reiseführer in gebrochenem Deutsch: „Im Jahre 1397 wurde durch die dänische Königin Margareta die Kalmarer Union gegründet. Ein starker Bund zwischen Dänemark, Schweden und Norwegen sollte als Gegengewicht zur mächtigen Norddeutschen Hanse wirken“. Sie besichtigten das von Gustav Vasa aus der ursprünglichen Festung umgebaute Schloss mit seinen kostbaren Holzarbeiten und dem einzigartigen Intarsienschmuck an den Wänden. Am zweiten Tage erreichten sie Schwedens Glasregion. Hier wurden vor hunderten von Jahren Fachleute von der italienischen Insel Morano angesiedelt, die auch hier die Kunst der Glasbearbeitung ausüben sollten. In Kosta, Nybro, Orrefors, Bergdala und anderen Orten zauberten geschickte Glasmacher nach alter Tradition in Hand- und Mundarbeit wahre Meisterwerke aus weißem und buntem Glas. Alfred und Harald konnten sich an den schönen Dingen kaum satt sehen, doch Alfred drängte: „Du hast Stockholm noch nicht gesehen, da haben wir sicher auch noch eine Menge Sehenswertes anzuschauen was noch eine viel Zeit kosten wird“. Am Morgen des nächsten Tages waren sie ein paar Meter gefahren, als Alfred seinen Vordermann verzweifelt zurief: „Halt mal bitte an, ich glaube ich habe eine Reifenpanne“. Mit wenigen Handgriffen entlastete er sein Fahrrad, Harald half dabei. Beide hatten Flickzeug und für den Notfall einen neuen Schlauch mitgenommen. Diese Umsicht zahlte sich nun aus. Mit einer Verzögerung von fast einer Stunde konnten sie schließlich weiter fahren. Harald besänftigte seinen Freund: „Wenn weiter nichts passiert, als solch eine kleine Panne, dann können wir noch ganz zufrieden sein“. Die nächste Übernachtung war in Västervik vorgesehen, eines der ältesten Städte Schwedens mit den liebevoll erhaltenen alten Häusern, die sich in Vorbereitung des langen Winters aneinander zu schmiegen schienen und kaum etwas Raum für den modernen Durchgangsverkehr boten. Am vierten Tag nach der Überfahrt erreichten sie Stockholm. Harald hatte einiges über Stockholm gehört und gelesen und Alfred hatte eigene Erlebnisse vergangener Jahre geschildert. „Nun wollen wir das Flair dieser schönen, weltoffenen Stadt auf uns einwirken lassen“, schwärmte Alfred. „In seiner wechselvollen Geschichte hat sich diese Stadt zur Metropole einer europäischen Großmacht entwickelt. Die verbliebenen alten militärischen Einrichtungen haben etwas vom Hauch einstiger Größe Schwedens über die Zeiten gerettet“. Die Stadt schien auf unzähligen Inseln erbaut zu sein, überall sah man Boote und gut gelaunte Menschen. Bis zu ihrem Zielort Falun waren es nur noch etwas mehr als zweihundert Kilometer, doch die Hauptstadt Schwedens mit den Fjorden und Schären, mit seiner Geschichte und seiner Bewohner hatte so viel Neues und Wissenswertes zu bieten, dass ihnen die Zeit davonlief. Schließlich wollten sie noch weiter in das Landesinnere und waren verabredet mit der Familie Lindgreen. Alfred ging zur nächsten Post und telegraphierte den Bekannten in Falun:
26.06.1935
Liebe Familie Lindgreen,
auf unserer Anreise nach Falun haben wir heute Stockholm erreicht. Wir werden uns Eure Hauptstadt ansehen und am Morgen des dritten Tages weiter fahren. Wenn alles so planmäßig läuft, wie bisher, werden wir in vier Tagen gegen Abend bei Euch sein.Viele Grüße auch von meinem Freund Harald
Euer Alfred





























