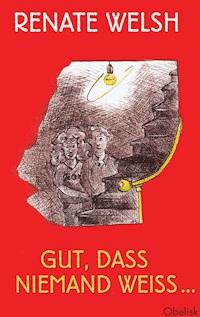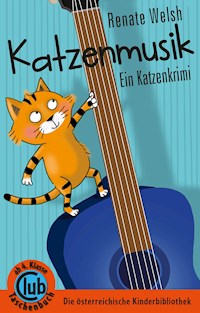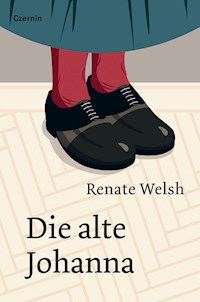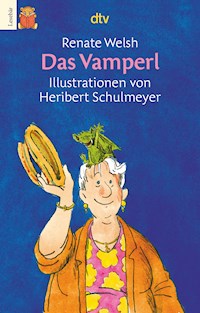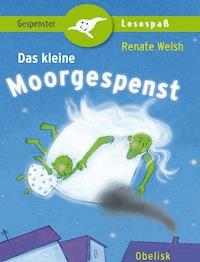19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Czernin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf den Spuren ihrer Herkunft erzählt Renate Welsh von einer unglücklichen Kindheit mitten im Zweiten Weltkrieg. Der Blick zurück und die Perspektive der Heranwachsenden verbinden sich mit nachdenklichen Reflexionen der Gegenwart über die Sehnsucht nach Zugehörigkeit, die Mühen der Erinnerung und die befreiende Kraft der Literatur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Renate Welsh
ICH FALL MIR SELBST INS WORT
Renate Welsh
ICH FALL MIR SELBST INS WORT
Czernin Verlag, Wien
Gedruckt mit Unterstützung der Stadt Wien, Kultur und des Landes Niederöstereich
Welsh, Renate: Ich fall mir selbst ins Wort / Renate Welsh
Wien: Czernin Verlag 2025
ISBN: 978-3-7076-0877-9
© 2025 Czernin Verlags GmbH, Wien
Autorinnenfoto: Christopher Mavrič
Lektorat: Benedikt Föger
Umschlaggestaltung und Satz: Mirjam Riepl
Druck: Finidr, Český Těšín
ISBN Print: 978-3-7076-0877-9
ISBN E-Book: 978-3-7076-0878-6
Alle Rechte vorbehalten, auch das der auszugsweisen Wiedergabe in Print- oder elektronischen Medien. Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne des Urheberrechtsgesetzes behalten wir uns ausdrücklich vor.
Inhalt
Bad Aussee, 2005
Bad Aussee, 1945
Wien, 2023
Bad Aussee, 1945
Wien, 2020
Bad Aussee, 1945
Hilzmannsdorf, 2025
Altaussee, 1945
Wien, 2024
Bad Aussee, 1945
Bad Aussee, 2023
Bad Aussee, 1945
Wien, 2025
Bad Aussee, 1945
Wien, 2025
Bad Aussee nach Wien, 1945
Wien, 2025
Wien, 1945
80 Jahre später
Wien, 1945
Bad Aussee, 2005
Es war etwas Besonderes für mich, im Kammerhof in Bad Aussee zu einer Lesung aus »Dieda oder Das fremde Kind« eingeladen zu sein.
Im roten Album der Großeltern gab es Fotos von meiner Mama mit mir im Schinakel auf dem Altausseer See, von Mama, Papa, Opapa und mir auf der Seewiese, von einer Jausengesellschaft in unserem Garten an der Traun, wo alle fröhlich waren und lachten und die Sonne schien, und alles war gut.
Bis zu dem Tag, an dem das Telefon läutete. Bis die anderen kamen und sich hier breitmachten, bis ich hier fremd war. Aber alles, was ich sah, was ich hörte, was ich roch, löste Erinnerungen aus, hatte eine Botschaft, ich verstand sie nur nicht.
Nach der Lesung legte mir eine Frau ein Körbchen in die Hand, darin waren drei Buchteln und eine Karte, auf der stand:
»Die größte Freude für das arme Mäderl war, wenn ihr die Nachbarin eine Buchtel geschenkt hat. Die habe ich heute für Sie gebacken.«
Ich wusste nicht, wohin mit der Rührung, die mir den Hals zuschnürte, und packte ihren Ellbogen. Die Frau war genauso verlegen wie ich.
Die Bibliothekarin trat zu uns. »Dabei wollte die Resi das Buch gar nicht mitnehmen, weil sie grad keine Zeit zum Lesen gehabt hat. Ich hab ihr eine Seite aufgeblättert …«
»Und da ist mein Papa vor mir gestanden, so wie er war, nicht, wie gewisse Leute über ihn geredet und kein gutes Haar an ihm gelassen haben. Anfassen hätte ich ihn können.«
Eine Weile standen wir schweigend.
Wie immer hatte ich allen Charakteren im Buch neue Namen gegeben, weil mir natürlich bewusst war, dass sie durch meine Augen gesehen, durch meine Sprache verändert worden waren. Nur Herrn Tasch passte keiner von den Namen, die ich ihm anprobierte, sie waren zu eng, zu weit, zwickten hier, schlotterten dort, schließlich gab ich auf. Herr Tasch musste Herr Tasch bleiben. Außerdem würde gewiss keiner, der ihn kannte, mein Buch lesen.
Darin täuschte ich mich. Ich schulde nicht nur dem real existierenden Herrn Tasch Dank, der für mich in der Vergangenheit Partei ergriff, sondern auch meinem Bild von ihm, weil ich diesem Bild die Begegnung mit seiner Pflegetochter verdanke. Es war eine seltsame Erfahrung, dass gerade dieses Buch von der Familie wahrgenommen wurde, wenn auch nicht so sehr als Literatur, eher als Ratespiel. »Who is who?«
Freunde, Bekannte und Verwandte jeglichen Grades meinen sich ja häufig in Texten zu erkennen, oft mit dem mehr oder weniger empörten Zusatz, sie seien keineswegs so, wie sie geschildert würden, wobei sie die Frage, woran sie sich denn erkannt hätten, als zusätzliche Bosheit übelnehmen.
Schreiben ist immer ein Risiko, wir können uns noch so sehr bemühen, darauf hinzuweisen, dass unsere Wahrheit nur eine von wahrscheinlich unendlich vielen Wahrheiten ist, die Tatsache, dass wir diese eine Wahrheit dargestellt haben, wirkt doch, als erhöbe sie den Anspruch, allein gültig zu sein. Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben.
»Sie müssen in Aussee gelebt haben, sonst hätten Sie das nicht so schreiben können.«
»Ja, natürlich. In der Mitte zwischen Bad Aussee und Altaussee haben wir gewohnt. Puchen 82, gleich nach der Traunbrücke, wo der Weg nach Obertressen abzweigt.«
Sie starrte mich an, schluckte mehrmals. »Das gibt es nicht.« Ihre Stimme klang gepresst. »Das gibt es nicht.«
»Wieso?«
Sie blickte sich um, faltete beide Hände vor der Brust. »Weil … weil es das Haus ist, das mir mein Papa zur Hochzeit geschenkt hat.«
»Zufälle gibt's!«, murmelte eine der umstehenden Frauen, und eine zweite sekundierte: »Das stimmt. Zufälle gibt's, die gibt's gar nicht.«
»Sie müssen mich besuchen. Am besten bald, ich bin schon über siebzig. Theresia Zach heiße ich. Die Adresse kennen Sie ja.«
An dem Abend konnte ich lange nicht einschlafen, gleich nach den Vormittagslesungen in der Hauptschule machte ich mich auf den Promenadenweg entlang der Traun. Ich war aufgeregt. Würde der Besuch die wenigen kostbaren Erinnerungen an meine Mutter mit neuem Leben erfüllen, oder wäre das Haus noch immer gefüllt mit der dröhnenden Allgegenwart des Alten, das für mich auch in der Erinnerung bedrohlich war?
Ich öffnete das Gartentor, Theresia Zach kam mir entgegen und begrüßte mich mit einer Herzlichkeit, die alle Gespenster verjagte. Am Schuppen hingen Fuchsien in grünen Kästen, der Brunnen stand da, nur die verglaste Veranda im Oberstock fehlte. Auf der Terrasse war der Kaffeetisch gedeckt, im Beet dahinter blühten Eisenhut, Phlox, Sonnenhut und Mädchenaugen, es gab sogar einen Herzerlstock wie damals. Der junge Spalierbaum an der Hauswand war neu, er hatte winzige Äpfel angesetzt.
Theresia Zach führte mich ins Haus. Alles war so perfekt, so ordentlich, dass ich beinahe erleichtert war, als ein Windstoß ein paar Birkenblätter hereinwehte. Wenn Ordnung einen Geruch hat, dann roch es hier nach Ordnung.
»Beim Saubermachen frag ich mich immer, wo das arme Mäderl geschlafen hat«, sagte sie.
Ich war froh, dass sie keine Antwort erwartete. Mir schien unmöglich, dass sieben Erwachsene und neun Kinder hier Platz gefunden hatten. Vielleicht erklärte die Enge das Gefühl, nicht richtig durchatmen zu können, wenn ich an die Zeit zurückdachte.
»Ist es schlimm für Sie, dass wir so viel verändert haben, mit dem Zubau und auch sonst?«
»Gar nicht! Ganz im Gegenteil. Sie haben die Gespenster vertrieben.«
Sie legte eine Hand auf meine Schulter, zog sie sofort zurück. »Der Kaffee ist fertig.«
Wir gingen hinunter in den Garten, schauten eine Weile schweigend den Hummeln und Taubenschwänzchen zu, die den Lavendelstrauch umschwärmten. Frau Zach legte mir das dritte Stück Zwetschgenfleck auf den Teller, einen Zwetschgenfleck mit Streusel, der eine winzige Spur knusprig war, so wie ihn meine Oma gemacht hatte.
»Auf der anderen Seite der Traun haben wir gewohnt«, sagte Frau Zach. »Gleich neben der Brücke. Das Haus gibt es nicht mehr.«
Unvermittelt begann sie zu erzählen, mit langen Pausen zwischen den Wörtern, dann immer schneller und leiser, so dass ich mich vorbeugen musste, um sie zu hören. Sie verstummte, hatte plötzlich einen so fernen Blick, dass ich das Gefühl hatte, jede Frage, jede abrupte Bewegung könnte sie in Gefahr bringen, ebenso plötzlich nickte sie, legte beide Hände mit gespreizten Fingern vor sich auf den Tisch, dann schüttelte sie heftig den Kopf und sprach weiter, sehr ruhig, als berichte sie etwas, das sie im Grunde nichts anginge und auch niemanden sonst, die Geschichte einer Fremden in einer anderen Zeit.
Ihre Mutter bekam in einem Jahr zwei Kinder von zwei verschiedenen Männern. Als sie mit dem zweiten schwanger war, schrieb sie ihrer Mutter und fragte, ob sie mit ihren Kindern nach Hause zurückkommen dürfe.
Mit einem Bankert kannst kommen, mit zweien nicht, lautete die Antwort. Da gab die Mutter das Neugeborene einer Schweinehändlerin, die steckte es zu den Ferkeln in den Kinderwagen, mit dem sie durch das Salzkammergut zog und ihre Geschäfte machte.
Bei einem Totenmahl im Gasthof Loser in Altaussee meinte eine junge Frau, Wimmern zu hören, dem ging sie nach und fand vor dem Gasthof einen Säugling in einem Kinderwagen zwischen Ferkeln und Kot. Sie nahm das Kind heraus, lief zu ihrer Freundin, die gegenüber wohnte, badete das Baby, wickelte es in eine Decke und marschierte mit ihm ins Gasthaus. Die Schweinehändlerin wollte das Kind an sich reißen, als der Bürgermeister mit der Polizei drohte, zog sie empört ab. Frau Tasch, die auch zur Trauergemeinde gehörte, sagte zum Bürgermeister, sie könne ohnehin keine Kinder bekommen, und das Pflegegeld könne sie wohl gut brauchen. In dem Augenblick öffnete Herr Tasch die Tür der Gaststube, um den Doktor zu einem Hausbesuch abzuholen. Der Doktor sagte noch im Weggehen, sie solle sich das gut überlegen, das Kind sei gewiss krank und werde wohl bald sterben.
Sie schaute mich an, ein kleines triumphierendes Lächeln hockte in ihren Mundwinkeln.
Ich drückte ihre Hand.
Als sie weitersprach, klang ihre Stimme fester.
»Immer wieder hat er mir's erzählt. Er kommt heim, hat er gesagt, da bin ich auf dem Ehebett gelegen und hab die Arme nach ihm ausgestreckt und von dem Augenblick an war er mein Papa und ich war sein Kind. So einfach war das.«
In das Schweigen hinein fragte ich nach der Pflegemutter.
Die habe alles richtig gemacht, habe sie gut versorgt, habe sie in die Schule und zur Kirche geschickt und ihr alles beigebracht, die Mutter habe für sie gekocht und genäht und dafür gesorgt, dass sie ihre Hausaufgaben ordentlich machte, sie sei ihr auch von Herzen dankbar, aber die Mutter habe halt kein Talent zum Freuen gehabt. Sie sei selbst keine Einheimische gewesen, habe nie richtig dazugehört, ihr Haus sei ja auch etwas abseits gelegen, das einzige am anderen Ufer der Traun.
Auf den Papa habe sie jeden Abend gewartet. Lange bevor sein Pferd einen Huf auf die Brücke setzte, hörte sie es und lief ihm entgegen. Sie half ihm, die Stute abzuhalftern, bürstete sie, führte sie in den Stall, holte frisches Wasser und füllte Hafer in den Trog. Dann stand sie neben ihrem Papa vor dem Haus, er legte seine schwere Hand auf ihre Schulter und sie hörten der Traun beim Rauschen zu, bis die Mutter zum Essen rief.
Theresia verschränkte die Finger ineinander, dann zeigte sie mit einer umfassenden Geste auf den Garten und auf das Haus.
»Es hilft alles nicht. Du kannst dir noch so viel Mühe geben, du kannst noch so viel Ordnung machen, am Ende zählt nicht, wer du bist, sondern nur, woher du kommst.«
Ich wollte ihr widersprechen, wusste nicht, wo ich ansetzen konnte, fühlte mich wieder einmal hilflos. Sie hatte ganz und gar unrecht, und gleichzeitig hatte sie recht, und es war furchtbar, dass sie recht hatte, immer noch recht, auch wenn ich es nicht wahrhaben wollte.
Die Traun gluckerte, murmelte, rauschte, immer in einem anderen Rhythmus. Eine Forelle schnellte in die Höhe, platschte zurück.
Theresia Zach lächelte, ihr schönes, strenges Gesicht veränderte sich völlig. Ich hätte gern gefragt, was sie dachte, aber in dem Moment hupte ein Auto. Ich wurde abgeholt. Es war höchste Zeit, ich durfte den Zug nicht versäumen.
»Aber Sie kommen wieder?«
»Ganz sicher. Ich freu mich drauf.«
Ich schrieb ihr zu Weihnachten, bekam eine herzliche Antwort. Bei meinem nächsten Besuch würde ihre Tochter ein Foto von uns beiden machen.
Wie war es möglich, dass diese Frau von einem Buch so berührt worden war? Woran lag das? Es gab hundert Fragen, die ich ihr stellen wollte, schlicht neugierige ebenso wie solche, die ohnehin nicht zu beantworten sind und gerade deshalb immer wieder gestellt werden müssen. Darunter eine Menge, die mehr mit mir und meinem Schreiben, also meiner Rechtfertigung für mein Leben, zu tun hatten als mit ihr.
Sobald ich sprechen konnte, fing ich an zu fragen. Das Kind macht einen fertig mit seinen ewigen Fragen, hieß es. Großvater aber schüttelte den Kopf. »Ihre Fragen sind ein Geschenk.« Irgendwann war ich stolz auf meine Fragen geworden, betrachtete sie als Schutz vor Engstirnigkeit und satter Selbstzufriedenheit.
Beim Nachdenken über Frau Zach begannen meine Fragen ihre scharfen Umrisse zu verlieren. Vielleicht wäre es sinnvoll, so viele Jahre später, nachdem ich die Sprache verloren, sie mit Mühe zurückgewonnen und dadurch neu schätzen gelernt hatte, meinen eigenen Text wie einen fremden zu lesen. Vielleicht könnte ich meine eigene Vergangenheit betrachten, ohne alte Rechnungen neu aufzulegen. Vielleicht könnte ich mir selbst begegnen, jedenfalls dem Kind, das ich einmal war, bereit, überrascht zu werden. Ich begann an meinem Gedächtnis zu zweifeln, es gab immer weniger feste Punkte, auf die ich mich verlassen konnte.
Eine Szene am Salzburger Hauptbahnhof fiel mir ein. Die jüngere Schwester meiner Stiefmutter wollte mich abholen, ich glaubte schon, wir hätten einander verfehlt, als ich sie in der Menge entdeckte. Ich hatte mit nach oben gerecktem Kopf nach ihr Ausschau gehalten, weil sie doch zu den Walküren ihrer Sippe gehörte, jetzt sah ich, dass sie in Wirklichkeit kleiner war als ich, und das lag nicht nur an ihrem hohen Alter. Als Kind hatte ich sie, ihre vier Schwestern und ihre Eltern als einen Clan erlebt, der eine undurchdringliche Wagenburg um seine Kinder bildete und mich ausschloss. Ich habe keine Ahnung, wo ich das Wort »Wagenburg« aufgeschnappt hatte, es bedeutete für mich im Kreis aufgestellte Leiterwagen mit Lanzen und mit Speeren, alle gegen mich gerichtet. Während sie Kaffee nachschenkte, erzählte sie mir, dass sie »Dieda« gelesen hatte und erschüttert war. »Wir waren alle mit uns selbst beschäftigt und haben einfach nicht gemerkt, wie es dir gegangen ist.«
Ein paar Tage davor hatte mich ihr Sohn angerufen und darüber geklagt, dass ich ausgerechnet Herrn Tasch so freundlich geschildert hatte, der sei ein wirklich unangenehmer Zeitgenosse gewesen, ein Dieb und ein Gauner, er habe auch sein Fahrrad gestohlen. Seine Wirklichkeit musste sich von meiner grundlegend unterscheiden, schließlich war der Alte für ihn nicht der Feind, sondern sein geliebter Großvater, der im Mittelpunkt der Familie seinen unangefochtenen Platz hatte, und er als jüngster Enkel direkt neben ihm.
Theresia Zach tauchte oft unerwartet in meinem Kopf auf. Es war merkwürdig, wenn ich über sie nachdachte, gerieten auch Bilder ins Wackeln, die gar nichts mit ihr zu tun hatten. Vielleicht ist es immer wieder notwendig, sich darüber klar zu werden, dass Verstehen unmöglich wird, wenn man einen Menschen wirklich zu kennen glaubt. Wenn wir wissen, dass wir den anderen, die andere, nicht kennen und nicht verstehen, könnten wir auf dem richtigen Weg sein. Das gilt aber nur, wenn wir nicht insgeheim überzeugt sind, dass die Erkenntnis unserer Grenzen der beste Beweis dafür ist, dass wir jedenfalls mehr verstehen als andere.
Immer wieder fiel mir der Satz ein, den Theresia Zach wie nebenbei und mehr zu sich selbst als zu mir gesagt und mit einer ganz kleinen Geste beinahe wieder weggenommen hätte. »Du kannst dir noch so viel Mühe geben, am Ende zählt nicht, was du tust, es zählt nur, woher du kommst.« Die Worte waren wie die kleinen Verletzungen im Mund, die die Zunge nicht in Ruhe lassen kann.
Das sagte eine Frau, die sich überhaupt kein Selbstmitleid erlaubte und so viel Mitgefühl für ein kleines Mädchen aus einer anderen Zeit, einer anderen Welt aufbrachte? Es gab hundert und mehr Fragen, die ich ihr stellen wollte. Vor allem, wie sie es geschafft hatte, ohne Groll von der Frau, die sie geboren hatte, und – noch schwieriger – von ihrer Großmutter zu sprechen, wie von Fremden, die nichts mit ihr zu tun hätten.
Hatte sie die beiden »ausgestrichen aus dem Buch der Lebendigen«?
Wenn ich aus welchem Grund auch immer intensiv längere Zeit nachdenke über einen Menschen, von dem ich wenig weiß, führt das auch zu neuem Nachdenken über Menschen, von denen ich viel zu wissen glaube. Ich werfe die Puzzleteile meiner Erinnerung durcheinander, schiebe sie hin und her, staune, welche neuen Zusammenhänge sich ergeben.
Wenn ich Nachrichten höre, Debatten verfolge, Zeitungen lese, scheint mir immer öfter, das darin vertretene rückwärtsgewandte Menschenbild entspricht zwar dem, was sich für Zeitgeist und Wirklichkeitssinn hält, hat aber mit Geist und Sinn wenig zu tun. Es ist vielmehr Resultat einer Weigerung, sich den Herausforderungen der Wirklichkeit zu stellen. Mauern und Stacheldrahtzäune schützen Gärten nicht halb so effektiv wie Nachbarn, die ihre eigenen Gärten liebevoll bestellen.
Ich begann mein eigenes Buch zu lesen und mir selbst ins Wort zu fallen.
Bad Aussee, 1945
»Dieda!«
Zwischen dem Haselstrauch und dem Hollerbusch konnte der Alte sie nicht sehen. Sie hielt den Atem an.
»Dieda!«
Jetzt schwollen die Adern an seinen Schläfen, wurden dunkelrot und dunkelblau, begannen sich zu bewegen wie Würmer. Eines Tages würden die Adern platzen und das Blut würde spritzen und er würde umfallen. Die Frauen drinnen im Haus würden weinen und klagen, Dieda aber würde ganz allein auf den Berg steigen und oben die Arme ausbreiten und lachen. Und ihr Lachen würde von allen Felsen zurückschallen.
Der Alte stapfte ins Haus. Der Kies knirschte unter seinen großen Schuhen.
Ihr linkes Bein schlief ein. Sie hob es mit beiden Händen, trommelte darauf. Es begann zu kribbeln. Das Wichtigste war, dass niemand sie beobachtete, wenn sie aus dem Versteck kroch, sonst konnte sie es nicht mehr verwenden. Es gab nicht so viele wirklich gute Verstecke.
Alle Fenster im Haus waren geschlossen, aber es war möglich, dass die Frau in der Küche stand, Erdäpfel schälte und zufällig aufblickte. Dieda robbte zur Hecke, rannte im Schatten der Fichten zum Gartentor. Eine wilde Rosenranke kratzte ihre Wade auf. Sie spuckte auf Zeigefinger und Mittelfinger, rieb Spucke auf den brennenden Kratzer. Löwenzahnblätter hätte sie suchen sollen. Sie klaubte Erde und trockene Nadeln von ihrem Hemd und begann Blätter zu pflücken, so viel sie fassen konnte. Damit schlenderte sie ins Haus.
»Wo warst du? Großvater hat dich gesucht!«
Großvater? Das war nicht ihr Großvater. Ihr Großvater war weit weg. Nie würde sie den Alten Großvater nennen. Großvater war ein gutes Wort. Wenn sie es langsam sagte, wurde das O groß und rund und warm. Eine weiche Decke.
Die Frau schickte Dieda Wasser holen. Dieda sollte »Mutti« zu ihr sagen.
Sie vermied es, sie direkt anzusprechen.
Der Schwengel des Brunnens war hoch, Dieda musste springen, um ihn zu erreichen, das machte Spaß, aber sie wurde beim Pumpen über und über nass. Sie schüttelte sich. Die Tropfen glitzerten.
»Kannst du nicht aufpassen?«, schimpfte die Frau.
Harald und Tommy platzten in die Küche, schleppten einen Einkaufskorb zwischen sich, hinter ihnen kamen die Schwestern der Frau. Ihre Stimmen ließen die Gläser im Schrank klirren. Sie füllten jeden Raum. Selbst wenn sie in einer leeren Bahnhofshalle stünden, wäre neben ihnen kein Platz. Dieda machte sich so klein wie möglich und schlich aus der Küche.
Draußen rannte sie los.
»Warte!«, rief Harald. Hinter ihm stolperte Tommy, ein kleiner dicker Schatten.
Sie lief zum Steg, ließ sich auf die warmen Planken fallen. Harald und Tommy kamen nach.
»Du bist gemein!«, keuchte Tommy.
»Stimmt. Ich bin auch eine böse Hexe und werde dich verzaubern.«
Tommy steckte den Daumen in den Mund. »Wirklich?«, nuschelte er mit flehendem Blick auf seinen großen Cousin.
»Klar«, sagte Harald. Er hielt Dieda sein Schmalzbrot hin und ließ sie abbeißen. »Spielen wir Verstecken?«
»Nein.« Verstecken würde sie nicht spielen. Verstecken brauchte sie zum Überleben, verstecken war kein Spiel.
»Oder Theater?«
Dieda ließ sich hintenüberfallen, ihr Kopf hing überm Wasser.
»Dreimal muss sie rummarschieren, das vierte Mal den Kopf verlieren«, sang Tommy.
Dieda sprang auf. »Gehen wir zum Steinbruch!«
Die steilen Wände strahlten Hitze aus. Eine grün und blau schimmernde Eidechse verschwand in einem Felsspalt. Zirpen und Flirren füllte die Luft. Am tiefsten Punkt des Talbodens stand wilde Minze in der Lehmkuhle, duftete stark und süß, daneben wucherte riesiger Huflattich. Dieda pflückte zwei Blätter, schaufelte mit den Händen Lehm darauf. Harald machte es sofort nach. Tommy flüsterte: »Es schaut uns einer zu!«
Dieda nickte ernst.
Eine Handvoll Steinchen rollten hell klappernd über den Felsen. Tommy schrie auf.
»Jetzt sind sie weg«, sagte Dieda. »Die kommen nicht mehr, du hast sie vertrieben mit deinem Gekreisch.«
»Wen?«
Dieda schüttelte nur den Kopf. Tommy trottete hinter ihr her, stolperte, schlug sich das Knie blutig, aber er heulte nicht, schluckte nur.
»Wehe, du sagst, wo wir waren, dann nehmen wir dich nie wieder mit!«
Tommy nickte. Eine riesige Rotzblase stand vor seinem linken Nasenloch. Dieda pflückte ein neues Huflattichblatt und reichte es ihm. Tommy würde den Mund halten. Er wusste, dass der Steinbruch verbotenes Gebiet war.
Sie konnten den Lehm unbemerkt in den Schuppen tragen und den ärgsten Schmutz abwaschen.
Der Alte und die Frauen saßen auf der Terrasse hinterm Haus und tranken Hetscherltee. Im Nussbaum hüpfte ein Eichhörnchen von Ast zu Ast. Sein buschiger roter Schwanz wehte hinter ihm her wie eine Fahne.
Lautes Klirren ließ die Frauen aufspringen, eine Teetasse lag in Scherben, es tropfte rötlich vom Tisch, das Hemd des Alten hatte Spritzer abbekommen. Eine grüne Nuss kollerte hinunter auf die Steine.
»Tor!«, flüsterte Harald. Dieda grinste. Das Eichhörnchen hatte gut gezielt, oder wenigstens gut getroffen.
In diesem Augenblick schaute der Alte zu ihr her. Mit drei Schritten war er bei ihr, packte sie mit seinen harten riesigen Händen, schüttelte sie. »Dir wird das Feixen noch vergehen!«
An diesem Tag begann der Krieg. Der Alte schwor, die Eichhörnchen zu erschießen, die Nüsse stahlen und Teetassen zerbrachen. Dieda lauerte ihm auf. Sie erkannte schon an seinem Schritt, ob er ins Haus ging, um das Luftgewehr zu holen. Dann rannte sie hinauf auf den Balkon, klatschte und kreischte und verscheuchte die Eichhörnchen. Der Alte würde nachkommen und dreimal mit dem Gewehrschaft zuschlagen. Dann würde er sie an der Schulter packen und sein Gesicht würde immer näher kommen. »Entschuldige dich!«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich denke nicht daran! In meines Vaters Garten wird niemand umgebracht.« Der Satz gefiel ihr.
Sie sah, wie die Adern an den Schläfen des Alten sich immer wütender knoteten. Bald, dachte sie. Es machte ihr fast nichts aus, dass der Alte ihr einen Löffel Rizinusöl einflößte, um ihr den Teufel auszutreiben. Sie hockte auf dem Klo und freute sich, wenn wild an der Tür gerüttelt wurde.
Geschah ihnen recht, dass es so fürchterlich stank. Ersticken sollten sie an dem Gestank, alle miteinander, der Alte und seine Töchter. Harald und Tommy nicht, was konnten die für ihre Mütter und ihren Großvater. Wenn sie zur Strafe kein Abendessen bekam, steckte ihr Harald heimlich ein Stück Brot oder einen Apfel zu.
»In meinem ganzen Leben habe ich kein derart halsstarriges, dickköpfiges, eigenwilliges, trotziges Kind gesehen«, sagte der Alte eines Abends zu der Frau. »Wenn es uns nicht gelingt, ihr klarzumachen, dass es so nicht geht, wächst sie uns über den Kopf. Das Mädchen ist gefährlich, denk an meine Worte.«
Dieda packte mit der linken Hand ihren rechten Oberarm und mit der rechten den linken Oberarm und wiegte sich vor und zurück. »Das Mädchen ist gefährlich«, wiederholte sie leise. »Ich bin gefährlich! Ihr wisst ja gar nicht, wie gefährlich ich bin!«
Wien, 2023
Bei einem meiner vergeblichen Versuche, die schriftliche Hinterlassenschaft meines Vaters zu sortieren, fiel mir ein Zettel in die Hand, mit Bleistift in der runden Volksschulschrift einer Achtjährigen geschrieben, korrekt adressiert und mit Datumsstempel versehen.
Liebe Mama!
Lass mich ein Monat zur Omama, da werde ich bestimmt anders, ich werd halt net besser von Deinem ewigen Strafen und Schimpfen.
Ich halts nimmer aus, wirklich net. Sag mir bitte, was Du dazu meinst.
Renate
»Ewig« ist so heftig durchgestrichen, dass ein Loch im Papier entstanden ist. Es wundert mich, dass der Zettel nicht vernichtet wurde, ich weiß nicht, wieso er sich in Vaters Sachen fand. Ich weiß auch nicht, wann ich anfing, »Mama« zu sagen, vielleicht nach der Geburt meiner kleinen Schwester. Vor allem habe ich keine Erinnerung an eine Reaktion. Gab es keine?
Die Angst, die Wut, die Verlassenheit, die Eifersucht der Achtjährigen verstehe ich, ihre Widerstandskraft ist mir unterwegs abhandengekommen. Vieles sehe ich heute anders. Erinnerungen sind nicht durchwegs verblasst, zum Teil sogar schärfer, detaillierter geworden, ich glaube aber längst nicht mehr, dass der Film in meinem Kopf ein getreues Abbild der Wirklichkeit darstellt, er reißt immer wieder ab, die Zeitenfolge gerät heillos durcheinander, vorher und nachher sind keine verlässlichen Richtwerte. Möglich, dass sich gerade darin echte Erinnerungen von konstruierten unterscheiden.
Manche Bilder drängen sich immer wieder in den Vordergrund, sie gehören zu Diedas Geschichte, auch wenn ich sie 2002 aus chronologischen oder anderen Gründen auslassen zu müssen glaubte:
Ich sitze neben meinem Vater in seinem Steyr-Puch, plötzlich fährt er an den Straßenrand, ich muss auf den Rücksitz kriechen, er öffnet den Wagenschlag, eine fremde blonde Frau steigt ein, geht einfach mit in unsere Wohnung. Ich krabble auf Vaters Schoß, da erklärt sie, ich wäre doch mit beinahe fünf Jahren schon viel zu groß, um noch auf Vaters Schoß zu sitzen. Tags darauf laufe ich laut singend durchs ganze Haus: »Ich krieg eine böse Stiefmutter! Ich krieg eine böse Stiefmutter!« In meinem Kopf kam wohl gleich nach der bösen Stiefmutter der schwarzgelockte Märchenprinz auf seinem edlen Ross dahergeritten, sonst hätte ich kaum gejubelt.
Mein Vater verlässt Türen knallend die Wohnung, gibt mir kein Gute-Nacht-Busserl, ist lang böse auf mich.