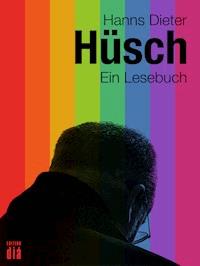Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition diá Bln
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Hanns Dieter Hüsch: Das literarische Werk
- Sprache: Deutsch
"Hüsch ist der einzige Lyriker unter den deutschen Kabarettisten. Andere Kabarettisten machen Verse fürs Kabarett - Hüsch macht Kabarett für seine Verse. Wäre er schärfer und modernistischer, er wäre Enzensberger - wäre er altmodischer und idyllischer, wäre er Ringelnatz. Vor der Schärfe bewahrt ihn die Melancholie, vor dem Idyll der Intellekt: So ist er eine besondere Art von Lyriker, ein Anti-Kabarettist." [Quelle: Karl Günter Simon, Theater heute]
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch
»Hüsch ist der einzige Lyriker unter den deutschen Kabarettisten. Andere Kabarettisten machen Verse fürs Kabarett – Hüsch macht Kabarett für seine Verse. Wäre er schärfer und modernistischer, er wäre Enzensberger – wäre er altmodischer und idyllischer, wäre er Ringelnatz. Vor der Schärfe bewahrt ihn die Melancholie, vor dem Idyll der Intellekt: So ist er eine besondere Art von Lyriker, ein Anti-Kabarettist.« (Karl Günter Simon in Theater heute)
Der Autor
Hanns Dieter Hüsch (1925–2005) war Schriftsteller, Kabarettist, Liedermacher, Schauspieler, Synchronsprecher und Rundfunkmoderator. Mit über 53 Jahren auf deutschsprachigen Kabarettbühnen und 70 eigenen Programmen gilt er als einer der produktivsten und erfolgreichsten Vertreter des literarischen Kabaretts im Deutschland des 20. Jahrhunderts.
Hanns Dieter Hüsch: Das literarische Werk
Herausgegeben anlässlich seines 90. Geburtstags am 6. Mai 2015 von Helmut Lotz
Ich sing für die VerrücktenDie poetischen Texte
Denn in jeder Leiche ist ein Kind verstecktDie kabarettistischen Texte
… so dass sich die Landpfleger sehr verwundernDie politischen Texte
Ich habe nichts mehr nachzutragenDie christlichen Texte
Das Gemüt is ausschlaggebend. Alles andere is dumme QuatschDie Niederrhein-Texte
… dass die Erziehung seiner Kinder eine völlig verfahrene warDie Hagenbuch-Texte
Gemacht aus Bauern- und BeamtenschwächeDie autobiografischen Texte
… am allerliebsten ist mir eine gewisse HerzensbildungDie Interviews
Hanns Dieter Hüsch
Ich sing für die Verrückten
Die poetischen TexteDas literarische Werk, Band 1
Mit Vignetten von Fredy Siggund einem Vorwort von Henryk M. Broder
Edition diá
Inhalt
Vorwort
Die Frieda-Geschichten
Einzeltexte 1950–2002
Förster Pribam
Wölkchen
Einzeltexte undatiert
Editorische Notiz
Textverzeichnis
Impressum
Süchtig nach Hüsch
Es war Mitte der sechziger Jahre, ich besuchte ein mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium in Köln, wo ich mich täglich von morgens bis mittags langweilte, weswegen ich meistens erst zur dritten Unterrichtsstunde erschien. Ich las viel und alles Mögliche – Mark Twain und Agatha Christie, Edgar Allan Poe und Jules Verne, Sinclair Lewis und Edgar Wallace, Hans Fallada und Arthur Conan Doyle.
Das Fernsehen steckte noch in den Kinderschuhen, es gab kein Internet, keine Mobiltelefone, keine Hashtags, kein Bashing und kein Mobbing. Und auch keinen Mario Barth, keinen Atze Schröder und keine Hella von Sinnen. Keine Comedy, nirgends.
Ich will damit nicht sagen, dass die Welt damals noch in Ordnung war, aber sie war extrem überschaubar. Es war viel einfacher, sich zurechtzufinden. Die Hälfte meiner Klassenkameraden war süchtig nach den Beatles, die andere Hälfte betete die Stones an. Ich gehörte weder der einen noch der anderen Fraktion an. Meine musikalischen Hochämter waren die Konzerte der Dutch Swing College Band. Wer unangenehm auffallen wollte, musste nur bei Nennung der DDR die Anführungszeichen oder das Adjektiv »sogenannte« weglassen. Ein kluges Wort, und schon war man ein »Kommunist«, so wie man heute zum »Rechtspopulisten« gestempelt wird, wenn man der Ansicht ist, Islam und Islamismus seien keine Gegensätze, sondern zwei Seiten einer Münze.
Ich weiß nicht mehr, wann ich Hanns Dieter Hüsch zum ersten Mal gesehen und gehört habe – ich meine mich zu erinnern, dass es im Hörsaal 1 der Kölner Universität war, wo er ein »Konzert« gab. So hieß damals praktisch alles, was irgendwie mit Musik zu tun hatte. Hüsch schlug auf seine Philicorda-Orgel ein und erzählte dabei Geschichten vom Niederrhein, einer mir völlig unbekannten Gegend, obwohl ich schon eine Weile in Köln lebte. Was die Leute so reden, wenn sie Bus fahren, und worüber sie sich bei einer Leichenfeier unterhalten. Er war »das schwarze Schaf vom Niederrhein«.
Erst viel später wurde mir klar: Dieser Abend hat mein Leben verändert. Ich wurde süchtig nach Hüsch. Er brachte mir das Hören, das Sehen und auch das Sprechen beziehungsweise Schreiben bei. Bei ihm lernte ich, dass es nicht auf das große Ganze ankommt, sondern gerade auf die Details, die überhört und übersehen werden, oder – wie Hüsch sagen würde – dass man darauf achten muss, »wie die Welt zusammenhängt und wie sie auseinanderfällt«. Ich begriff, dass es nicht darauf ankommt, die Welt zu verändern, sondern sie so zu beschreiben, wie sie ist – nicht wie man sie gerne hätte. Hüsch holte mich auf den Boden der Wirklichkeit zurück und machte mir dabei vor, wie man über den Schatten der eigenen Arroganz springt.
Wenn ich heute eine Party besuche, was extrem selten vorkommt, höre ich die Leute um mich herum lauter Hüsch-Sätze sagen, ich komme mir vor, als wäre ich in einem Stück, das von Hüsch geschrieben wurde. Als Parodie auf die Wirklichkeit. Aber es ist die Wirklichkeit, wie sie brutaler nicht sein könnte.
Wenn ich Volker Kauder oder Thomas Oppermann über »die Menschen draußen im Lande« reden höre, dass man sie »dort abholen müsse«, wo sie sind, wenn ich in der Tagesschau Frank-Walter Steinmeier sehe, der zwischen zwei Reisen erklärt, worum es in der Ukraine geht, dann denke ich: Das hast du doch alles schon mal gehört. Nur irgendwie witziger und nicht so präpotent wie bei diesen Politikerdarstellern. Und wenn ich in einer der Talkshows hängenbleibe, bei Illner, Jauch, Will oder Maischberger, dann frage ich mich: Wie schaffen die es, Interesse daran zu heucheln, worüber sie gerade reden? Das geht ihnen doch alles am Arsch vorbei. Heute diskutieren sie über den Mindestlohn, morgen machen sie Ferien auf den Malediven. Und immer bemüht, ihren CO2-Fußabdruck zu minimieren, um die Klimakatastrophe zu verhindern.
Hüsch hat mich versaut. Ich kann nur noch den Wetterbericht ernst nehmen. Der »Bericht aus Berlin« in der ARD und »Berlin direkt« im ZDF sind Possen, wie sie früher auf höfischen Bühnen aufgeführt wurden. Bettina Schausten interviewt Angela Merkel? Nein, es ist umgekehrt! Ulrich Deppendorf unterhält sich mit Sigmar Gabriel? Nein, Sigmar Gabriel spielt Katz und Maus mit Deppendorf. Marietta Slomka erzählt eine Gutenachtgeschichte? Nein, sie moderiert einen Beitrag über ein gekentertes Flüchtlingsboot im Mittelmeer an. Was würde Hüsch aus solchen Vorlagen machen? Perlen der Kleinkunst.
Hüsch war ein Literat, ein Poet, ein Philosoph. »Ein Einzelidiot«, wie er sich selbst beschrieb, angewiesen auf die Solidarität anderer Einzelidioten. Manchmal wurde ihm diese Rolle zu anstrengend, und es überkam ihn die Sehnsucht nach der Nestwärme des Kollektivs.
Dann wollte er dazugehören und »das System verändern«, aber solche Schübe dauerten nicht lange. Er kam wieder zu sich und schrieb wunderbare Gedichte, wie sie nur einer schreiben kann, der das Leben liebt und gleichzeitig daran verzweifelt.
Ich sing für die Verrückten
Die seitlich Umgeknickten
Die eines Tags nach vorne fallen
Und unbemerkt von allen
An ihrem Tisch in Küchen sitzen
Und keiner Weltanschauung nützen
Die tagelang durch Städte streifen
Und die Geschichte nicht begreifen
Er konnte aber auch kalauern und hochkomplexe Zusammenhänge mit wenigen Worten dekonstruieren.
Die einen spielen Tennis, die anderen Aufklärung, die meisten aber sitzen an der Bettkante und wissen nicht weiter.
Hüsch war ein politischer Mensch, verteidigte aber sein Recht, ein unpolitischer Künstler zu sein. Er weigerte sich, mit dem Publikum über seine Texte zu diskutieren, wie es in den sechziger und siebziger Jahren üblich war. Als alle nach Kuba reisten, um dort die Revolution anzuheizen, da machte er sich über seine Kollegen, die »kritischen Entertainer«, lustig.
Hüsch, am 6. Mai 1925 in Moers am Niederrhein geboren, brauchte relativ lange, um sich einen Namen zu machen. Als er im Dezember 2005 starb, hinterließ er Tausende von Texten und mehr als 70 Programme.
Falls es im Himmel eine Ecke gibt, die für große Kleinkünstler reserviert ist, dann sitzt dort das »schwarze Schaf vom Niederrhein« zu Füßen von Karl Valentin und schreibt an einem neuen Programm. Arbeitstitel: »Gott ist mein Zeuge«.
Henryk M. Broder, April 2015
Die Frieda-Geschichten
Anstelle eines Vorworts
Die Frieda behauptet von mir:
Er ist 1,73 groß.
Er hat keinen Sinn für die Natur.
Er ist immer abwesend.
Er will nur Pullover anziehen.
Er betrinkt sich gern.
Er will jedem Bettler etwas geben.
Er geht ohne mich nicht ins Kino.
Er lässt sich leicht übers Ohr hauen.
Er schwärmt für Deborah Kerr.
Er bleibt ein großes Kind.
Und ich behaupte von Frieda:
Sie ist 1,76 groß.
Sie ist jeder Landschaft hold.
Sie hängt immer an meinem Rockzipfel.
Sie will mich im dunklen Anzug sehn.
Sie betrinkt sich nie.
Sie will jedem Bettler was geben.
Sie kann ohne mich nicht schlafen.
Sie ist eine gute Köchin.
Sie schwärmt für Henry Fonda.
Sie hat immer noch Grübchen.
1959
Wie ich die Frieda kennenlernte
Als ich die Frieda kennenlernte, war ich total betrunken. Nein, ehrlich, ich war total betrunken, und ich saß auf einem Stuhl und dachte, wenn du jetzt aufstehst, liegst du am Boden.
Und als ich das dachte, kam die Frieda diagonal auf mich zu und sagte: »Darf ich bitten? Es ist Damenwahl!«
Sie sah mich von oben bis unten an, und der Trompeter spielte gerade so eine hohe Sache, und da sagte ich: »Ich bin furchtbar betrunken, und eine halbe Sache fange ich nicht gern an, und außerdem, ich kann gar nicht tanzen.«
Da lachte die Frieda mich aus. Sie lachte mich zum ersten Mal aus, zog mich an der Hand in das Gewühl und sagte: »Sehn Sie, das ist ein schneller Foxtrott, da müssen Sie wie beim Marsch, nur immer Wechselschritt, und dann können Sie tanzen.«
»Es geht nicht«, sagte ich, »es geht nicht, ich habe Sie gewarnt, es geht wirklich nicht, es tut mir leid.«
»Dann setzen wir uns wieder an Ihren Tisch«, sagte die Frieda.
Und wir setzten uns, und ich dachte, verdammt, sie ist keine dumme Gans, sie ist noch sehr jung, aber sie ist keine dumme Gans, und der schnelle Foxtrott geht ihr jetzt auch durch die Lappen, und jetzt musst du irgendetwas sagen, dachte ich, sonst läuft sie dir weg, und ich sagte: »Tja, öh … tja«, sagte ich, »öh, ach so, ja öh … in der Unterprima hatten wir mal einen komischen Lehrer, das ist aber schon lange her, und überhaupt, ich habe die Geschichte ganz vergessen, zu dumm, was?«
»Dann erzählen Sie doch etwas anderes«, sagte die Frieda.
»Ja, gern«, sagte ich, »sofort, einen Moment, bitte, öh … sind Sie auch so begeistert von dem Jazztrompeter heute Abend hier?«
»Ja«, sagte die Frieda.
»Menschenskind«, sagte ich, »dann sind wir ja bei… dann sind wir ja, öh, beide von dem Jazztrompeter begeistert, das finde ich toll!« Und ich schlug mit der Faust auf den Tisch und sagte: »Wissen Sie, nur wenn er so hohe Sachen spielt, dann ist er nicht so gut, aber jetzt spielt er ja nur tiefe Sachen.«
»Jetzt spielt er überhaupt nicht«, sagte die Frieda.
»Ach so, ja«, sagte ich, »richtig, jetzt, öh, jetzt, jetzt spielt er …« Jetzt ist es aus, dachte ich, du hast Blödsinn geredet, jetzt steht sie auf, jetzt läuft sie dir weg, Mensch, sag doch was, aber was, was denn bloß?
»Was halten Sie denn von der abstrakten Malerei?«, sagte ich dann so von oben herab.
Weiß der Teufel, mir fiel nichts anderes ein, mir fiel buchstäblich nichts anderes ein, und ich wusste, jetzt hängst du zwischen Himmel und Erde.
Du bist ein Idiot, dachte ich, so etwas kann in diesem Moment doch nur ein Idiot fragen, und die Frieda sagte: »Ich hab einen Bärenhunger, Sie nicht auch?«
»Ja doch«, sagte ich »öh … auch ich selbstverständlich … aber ich richte mich da ganz nach Ihnen. Wollen wir vielleicht etwas essen?«
»Ja«, sagte die Frieda, »aber meinen Teil bezahle ich!«
Tja, und dann aßen wir Sauerkraut mit Kartoffelpüree und Würstchen. Ich sagte, ich mag kein Sauerkraut, und die Frieda aß all das Sauerkraut und gab mir die Würstchen, und langsam wurde ich wieder nüchtern und merkte, dass man gar nicht immer etwas sagen muss, und wir sagten eine Zeitlang nichts, und dann sagte die Frieda: »Du … morgen muss ich mir flache Schuhe anziehen, sonst bin ich drei Zentimeter größer als du, und das geht nicht.«
Das geht wirklich nicht.
1959
Ein Liedchen pfeifen
Das war, als die Frieda noch Verkäuferin in dem kleinen Spielwarenladen war und ich um sieben Uhr an der Ecke auf und ab ging und das große Plakat studierte, auf dem immer stand: Dem Quick-Leser gehört die Welt!
Ich wollte das gar nicht glauben. Um Himmels willen, sagte ich, das kann doch gar nicht sein.
Und die Frieda hatte mir auch gesagt, dass das wohl nur so dahingeschrieben worden wäre, weil das den Menschen imponiere.
Und die Frieda ging ja mit allerhand Menschen um in dem kleinen Spielwarenladen, und da war sie ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen gewiefter als ich.
»Das ist eben so«, sagte sie, »wenn man hinter der Theke steht, muss man höllisch aufpassen, da sieht man tausend Hände und wie die Leute die Spielsachen anpacken und sie dann einpacken.«
Das wusste die Frieda.
Den Blick dafür hatte sie sich zugelegt, wie sich andere ein Auto zulegen.
Ich wusste ja auch allerhand. Ich wusste zum Beispiel, wie der Lieblingssohn Tamerlans hieß.
Das wusste ich in der Schule schon. Aber wenn die Sprache darauf kam, wurde ich immer noch ganz rot; denn ich wusste, dass die anderen das nicht wussten, und deshalb meldete ich mich nicht.
Und dann wurde ich verlegen, und dagegen kann man nichts machen.
Wenn ich das der Frieda erzählte, sagte sie immer: »Du bist zu rücksichtsvoll, du müsstest mal sehen, wie die Leute ihr Geld auf die Theke werfen, das ist ein Klang, den du nie verstehst.«
»Das ist doch kein Klang«, sagte ich.
»Doch, das ist ein Klang«, sagte sie.
»Entschuldige mal«, sagte ich, »öh … Mozart, das ist Klang.«
»Mozart, den haben sie doch umgebracht«, sagte da die Frieda.
Und da wurde ich wieder rot.
Denn ich wusste, dass sie Mozart nicht umgebracht haben. Und dass er auch immer eine Menge Schulden gehabt hatte, das wusste ich.
Und ich wusste auch, dass Mozart niemals geglaubt hätte, dass dem Quick-Leser die Welt gehört.
Aber da hätte ich bei der Frieda zu weit ausholen müssen, und wenn sie so etwas sagte, zitterten ihre Nasenflügel, und das war so lustig, und dann sagte ich weiter nichts.
»Mozart haben sie umgebracht«, sagte sie, »das kommt vom vielen muss nicht tun. Du bist auch so einer, der weiß zwar, wie der letzte Inka heißt, aber du weißt nicht, wie man Geld auf die Theke wirft. Das ist alles.«
Das war, als die Frieda noch Verkäuferin in dem kleinen Spielwarenladen war.
Später haben wir dann geheiratet, weil die einen sagten, wir liefen doch jetzt schon so lange zusammen, und weil die anderen sagten, es wäre doch wohl noch nichts unterwegs.
Dem wollten wir ein Ende machen, obwohl wir so viel wie gar nichts hatten. Wir liefen immer auf der Straße herum, weil vier Wände noch keinen Frühling machen, und es regnet ja immer dann, wenn man kein Geld hat.
Trotzdem sagt die Frieda, wenn ich mit der Straßenbahn fahre: »Sei vorsichtig, ja!?«
Und wenn wir heute an dem Plakat vorbeikommen, sage ich: »Dem Quick-Leser gehört die Welt«, und die Frieda antwortet: »Du, den Mozart haben sie umgebracht.«
Dann werde ich wieder verlegen.
Denn ich weiß, dass sie im Notfall für mich durchs Feuer geht. Und wenn man so etwas weiß, dann … dann kann man schon mal ein Liedchen vor sich hin pfeifen.
1954
Frieda und der Frühling
Meine Frieda, mit ie, damit keine Verwechslungen vorkommen, liebt den Frühling, man kann wohl sagen, sehr und innig.
Ich dagegen stehe meist um diese Jahreszeit am Fenster und schaue hinaus auf Land und Flur.
Und wie ich da so träumlings stehe, wie ja Männer manchmal so träumlings dastehen, Hände in den Taschen, anwesend und doch abwesend, da kommt meine Frieda auf mich zugestürzt und fragt: »An was denkst du jetzt?«
»Das ist schwer zu sagen, meine Liebe, ich denke, ich, öh … ich mache dir einen Vorschlag, ich denke an den Frühling, was hältst du davon?«
»Das heißt also«, sagt die Frieda, »dass du mir nicht sagen willst, an was du wirklich denkst.«
»Ich sage dir ja«, antworte ich, »es ist ein Vorschlag, wir beide denken jetzt an den Frühling.«
»Hm«, sagt die Frieda, »ich will aber erst wissen, was du vorher gedacht hast.«
»Das weiß ich nicht mehr«, sage ich.
»Soso«, sagt die Frieda, »das ist ja sehr bedenklich, du guckst zum Fenster hinaus und denkst an nichts, das kannst du mir nicht weismachen.«
»Moment«, erwidere ich, »ich habe gesagt, dass ich es nicht mehr weiß, an was ich gedacht habe, das ist ein Unterschied.«
»Also gut«, sagt die Frieda, »Schwamm drüber, ich nehme deinen Vorschlag an, dass wir jetzt an den Frühling denken, fang du an!«
Ich sage: »Was kommt eigentlich im Frühling alles so zum Vorschein, was bringt der Frühling alles an den Tag?«
»Primeln«, sagt die Frieda.
»Das geht auf mich, oder?«
»Wie man’s nimmt«, sagt die Frieda.
»Hm«, sage ich, »Primeln sind, soviel ich weiß, Himmelsschlüssel.«
»Ihr Männer seid doch ein eingebildetes Volk«, sagt die Frieda.
»Ich bin eine eingebildete Schlüsselblume, stehe in Wald und Wiese und habe zahlreiche Zierformen, es ist schlimm, von der Pike auf eine Primel zu sein.«
»Das glaub ich dir gern«, sagt die Frieda, »und ich bin das berüchtigte Mauerblümchen, stehe in deinem Schatten und habe nichts zu sagen.«
»Das stimmt nicht«, sage ich, »du bist die Primeldonna, einverstanden?«
»Was bleibt mir denn anderes übrig«, sagt die Frieda.
»Vielleicht finden wir noch etwas Besseres«, sage ich, »Anemonen sind jetzt auch sehr im Kommen, stehen auch im Wald und sind giftig. Ich finde, das passt zu dir wie die Butterfly zum Kimono.«
»Bin ich so giftig?«, fragt die Frieda.
»Bin ich Puccini«, sage ich, »ja, wäre ich Puccini, so würde ich dich Anemone nennen, das klingt wie Honig mit Tremolo.«
»Lass die Musik aus dem Spiel«, sagt die Frieda.
»Na, schön«, sage ich, »Aber du musst doch zugeben …«
»Ich muss nichts zugeben«, sagt die Frieda.
»Aber du musst doch zugeben«, sage ich, »dass du ein ausgesprochenes Buschwindröschen bist.«
»Was ist denn das schon wieder«, fragt die Frieda.
»Buschwindröschen, das sind Anemonen«, sage ich. »In Botanik war ich immer obenauf. Diese Röschen blühen weiß bis rosa. Was hast du lieber, weiß oder rosa?«
»Ich werd mir’s überlegen«, sagt die Frieda.
»Der Frühling ist kurz«, sage ich, »das Leben geht weiter, die Liebe ist zuweilen kompliziert, da kann man nichts machen.«
»War es das etwa, woran du vorhin gedacht hast?«, fragt die Frieda.
»Gib mir einen Kro-kuss«, sage ich.
»Was krieg ich dafür?«, antwortet die Frieda.
»Ich werde dich mit Anemonen überschütten, du Hahnenfußgewächs.«
»Ist das alles?«, sagt die Frieda. »Dann werden wir nicht einig.«
»Apropos Frühling«, sage ich, »Krokusse, oder heißt es Kroküsse?«
»Ich höre nicht zu«, erwidert die Frieda.
»Also, Kroküsse«, sage ich, »haben oft violette Blüten; Violett macht mich melancholisch.«
»Deshalb guckst du wohl immer zum Fenster hinaus.«
»Ich bin eben ein Naturbursche«, sage ich, »und wenn Feld und Au zu grünen beginnen, überfällt mich das große Staunen. Ich habe schon Schneeglöckchen gesehen.«
»Ich habe schon welche gehört«, sagt die Frieda.
»Ich habe schon welche in der Hand gehabt«, sage ich.
»Haben sie geklungen?«
»Ich hab’s nicht probiert«, sage ich, »man soll’s nicht übertreiben, es sind Zwiebelgewächse, und wenn ich die läuten höre, schießen mir die Tränen aus dem Kopf, und das tut nicht gut.«
»Armer Botaniker«, sagt die Frieda.
»Du, zum Beispiel, bist auch so ein Schneeglöckchen.«
»Ach nee«, sagt die Frieda.
»Du bist ein Weidenkätzchen.«
»Auch das noch«, sagt die Frieda.
»Ein Augen-Weidenkätzchen.«
»Ich danke für Obst«, sagt die Frieda, »aber damit lockst du kein Küken hinter dem Ofen hervor.«
»Darum geht’s nicht.«
»Du spinnst«, sagt die Frieda.
»Dann bin ich auf dem richtigen Wege«, sage ich.
»Ich habe den Frühling, der Frühling hat mich, schlingt Forsythien um mein Haupt … gelb blühender Zierstrauch aus Ostasien, dem Flieder verwandt!«
»Seit wann dichtest du?«, fragt die Frieda.
»Seit ich dich kenne«, antworte ich, »bei Shakespeare, seit ich dich kenne.«
»Aber sonst geht’s dir gut?«
»Und wie«, sage ich. »Such doch nicht immer in den Primeln herum, sei ein Veilchen, ein blauviolettes Veilchen, sei ein blauer Anemontag; ich kauf dir auch Gänseblümchen, einen Korb voll, na?«
»Gut«, sagt die Frieda, »aber …«
»Was aber?«
»Erst musst du mir sagen, was du gedacht hast, als du so am Fenster standst, vorhin.«
»Also, da, öh … Muss das sein? Also, ich habe da gedacht, Frühling, komm mir nicht zu nahe.«
»Ich glaube dir kein Wort«, sagt die Frieda.
»Ich habe gedacht, dass es schön ist, an nichts zu denken, verstehst du, ich kaufe dir zwei Körbe voll Gänseblümchen, ich pflücke sie selbst.«
»Ich danke schön«, sagt die Frieda, »ich verzichte auf deinen Frühling.«
Und die Frieda geht aus dem Zimmer und … und ich denke, was ich vorhin gedacht habe, ich denke, wie viele Frühlinge, oder man sagt wohl, Lenze, wir noch gemeinsam erleben oder nicht erleben werden.
Das musste mal gedacht werden. Weiter nichts.
1959
Frieda und der Fußball
Es war an einem Sonntagnachmittag, der Nachmittag der Jünglinge und kleinen Mädchen, der grellen Schlipse und der überfüllten Tanzdielen.
Überall spielen die »Vier lustigen Spatzen«, oder es singen die »Fidelen G’sellen«, und die Geschmacklosigkeit nimmt kein Ende.
An so einem Sonntagnachmittag sagte meine Frieda: »Du, hör doch mal, hör doch mal, mach doch mal das Fenster auf, hör doch mal das Geschrei vom Fußballplatz.«
Ich hörte nichts.
»Da wieder! Hör doch mal das Geschrei, ich glaube, bei Concordia geht ein Licht auf. Hörst du denn gar nichts? Das macht der Wind, die schrein ja immer noch«, sagte die Frieda.
»Na, und?«, sagte ich. »Als ob das schon etwas wäre! Was soll denn das überhaupt heißen: Bei Concordia geht ein Licht auf?«
»Stand doch in der Zeitung«, sagte die Frieda und stöberte in der Brottrommel, in die wir manchmal unsere Zeitungen legen.
»Hier, Zeitung von gestern, Sport auf einen Blick, geht bei Concordia ein Licht auf, Frage des Abstiegs noch nicht geklärt, morgiges Spiel mehr als ein Spiel, Torverhältnis kann schon entscheidend sein!«
Jetzt hörte ich das Geschrei ebenfalls.
»Wie viel werden das sein?«, sagte ich.
»Zweitausend«, antwortete die Frieda, blätterte in der Zeitung und sagte: »Der Mittelstürmer kommt immer hier vorbei, so ein Großer mit Dauerwellen. Ob der die meisten Tore schießt?«
»Weiß ich doch nicht«, sagte ich, »interessiert mich auch gar nicht. Woher weißt du denn den ganzen Kram?«
»Ooch, ich … öh, ich hatte doch mal einen Freund«, sagte die Frieda, »der war aber nur rechter Läufer.«
»Der Mittelstürmer ist ein Idiot«, sagte ich, »Mittelstürmer und Dauerwellen!«
»Lass man«, sagte die Frieda, »wenn er die meisten Tore schießt, ist er fein heraus. Mein Freund, der war ja nur rechter Läufer, aber er hat einmal aus dreißig Meter Entfernung ein Tor geschossen.«
»So«, sagte ich, »und da war er fein heraus.«
»Nein«, sagte die Frieda, »das Spiel ging nach Verlängerung verloren, und da haben die Zuschauer den Schiedsrichter verprügelt, und mein Freund hat mich nicht mehr angeguckt, weil ich gesagt habe, das wäre doch nicht nötig gewesen.«
Jetzt hörte ich wieder das Geschrei.
»Dreitausend sind’s bestimmt«, sagte ich. »Jedes Spiel müsste unentschieden ausgehn!«
»Das geht nicht«, sagte die Frieda, »dann sind die Zuschauer nicht zufrieden.«
»Dann schmeckt ihnen das Bier nicht«, sagte ich.
»Ja«, sagte die Frieda, »das Bier schmeckt ihnen nicht, und sie sind die ganze Woche nichts wert. Einer schiebt dem andern die Schuld in die Schuhe, und sie singen auch nicht. Sonst singen sie immer: Der Rasensport, der Rasensport und so. Und manchmal hält der Bürgermeister sogar eine Rede und sagt, wie hat er doch immer gesagt? Jungens … will nicht viel Worte machen … wieder einmal mehr bewiesen, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid!«
Ich musste lächeln. Ich konnte es gar nicht glauben, dass die Frieda darüber so gut Bescheid wusste.
Ich legte die Zeitung wieder in die Brottrommel und dachte an den rechten Läufer.
Aus dreißig Meter ein Tor geschossen, und das an einem Sonntagnachmittag, an einem Nachmittag, wo man nicht mehr wagt, vor die Tür zu gehen.
1954
Friedas Geburtstag
Wenn die Frieda Geburtstag hat, feiern wir immer einen tollen Geburtstag.
Meistens haben wir dann kein Geld.
Und da die Frieda kurz vor Weihnachten Geburtstag hat, verschieben wir die ganze Schenkerei auf Silvester.
Und an Silvester sind wir nie zu Hause, und ich sage: »Ostern ist ja auch noch ein Fest.«
So was fällt natürlich auf die Dauer auf, und im vorigen Jahre habe ich deshalb der Frieda zum Geburtstag eine prima Tasche geschenkt.
Ganz modern. Marke Goldpfeil. Nie wieder.
Die Frieda hat drei Stunden an einem Stück geheult. Ungelogen.
An einem Stück: Wie konntest du nur so eine Tasche kaufen, wie konntest du nur so etwas tun, wenn man dich schon alleine losschickt, die hat doch mindestens 30 Mark gekostet, aber du … du, du kaufst einfach drauflos, du bist eben zu nichts zu gebrauchen, und die Tasche, was soll ich denn mit so einer Tasche, kannst du mir das mal sagen?
»Ich … ich wollte dich mal überraschen«, sagte ich, »ich … ich kann sie ja wieder zurückbringen, aber wie sieht denn das aus, und die Verkäuferin hat zu mir gesagt, wenn Sie schon eine nehmen, dann nehmen Sie die da, die ist besonders apart, und da hab ich sie genommen; die anderen Taschen kosteten ja alle nur so an die 25 bis 30, und ich wollte mich doch nicht lumpen lassen … guck sie dir doch erst mal an, innen drin alles mit Wildleder und hier ein Portemonnaie …«
»Ich kann mich darüber nicht freuen«, sagte die Frieda, »ich hab ja noch nicht einmal ein Kleid, das ich zu der Tasche anziehn kann, sag mir wenigstens, was sie gekostet hat.«
»Ich … öh, ich weiß es nicht mehr«, sage ich, »das ging alles so rasch, weißt du, und als ich die Tasche gekauft hatte, bin ich ganz schnell gelaufen.«
»Warum denn das«, sagte die Frieda.
»Ich weiß es nicht«, sagte ich, »ich bin jedenfalls ganz schnell gelaufen, es war, glaube ich, so ein schöner Tag.«
»Es war kein schöner Tag«, sagte die Frieda.
»Gut«, sagte ich, »dann war es eben kein schöner Tag.«
»Nein«, sagte die Frieda, »es war auch kein schöner Tag, was hat denn die Tasche gekostet?«
»Damit du es ganz genau weißt«, sagte ich, »die Tasche, die Tasche hat … öh, du gehst mir bald auf die Nerven!«
»Es geht ja auch gar nichts rein«, sagte die Frieda, »und wann gehen wir schon mal aus?«
»Gut«, sagte ich, »dann … dann wird sie eben verschenkt, dann wird sie eben verschenkt, aus, Schluss, fertig!«
»Eine Armbanduhr wäre viel praktischer gewesen«, sagte die Frieda, »alles andere, aber so eine Tasche, ich könnte dich umbringen.«
»Ich dich auch«, sagte ich.
»Und ich kriege auch noch heraus, was sie gekostet hat«, sagte die Frieda, »sag doch selbst, so eine Tasche steht mir doch gar nicht, oder …?« Ich sagte nichts mehr. Da nahm die Frieda die neue Tasche, ging mit ihr ein paarmal auf und ab, und was meinen Sie, dieser Gang und dazu das verweinte Gesicht waren schon 78 Mark wert.
1954