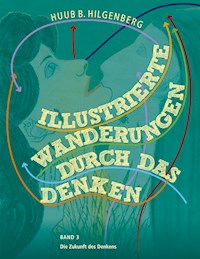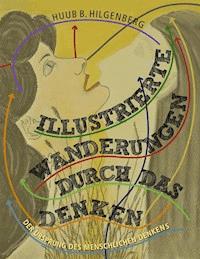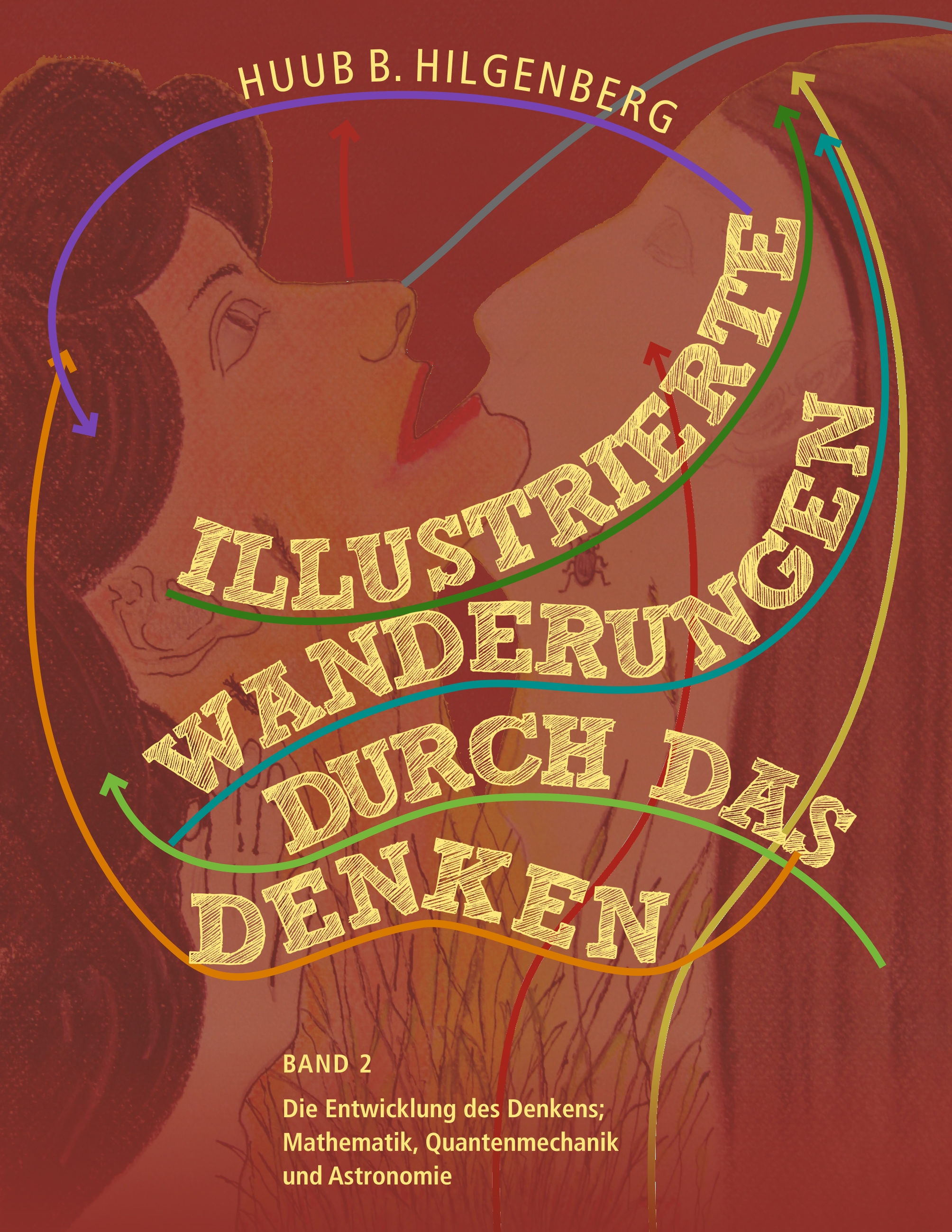
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In Band zwei der "Illustrierte Wanderungen durch das Denken" führt der Autor Sie durch die wunderbaren Landschaften der modernen Wissenschaften. In diesem Buch werden die benötigten Basisbegriffe zugänglich erklärt und die Geheimnisse der Relativitätstheorien gelüftet. Man versteht nicht nur besser wie diese Art von Mathematik funktioniert, es wird auch klar warum sie wichtig ist. Niemand braucht davor zurückzuschrecken seine Texte über Mathematik und Physik zu lesen: Sie sind auch ohne besondere Vorkenntnisse verständlich. Die Welten der Quantenmechanik und des Universums werden auf ähnliche Weise erklärt. Es kommt auf den Zusammenhang an um das ganz Kleine und das ganz Große zu verstehen. Diese Fortschritte im menschlichen Denken haben aber eine gefährliche Nebenwirkung: die Entfremdung. Wie konnte es dazu kommen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 563
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Der Anlass
Danksagung
Wissenschaftsphilosophie
Fakten, Meinungen und Vermutungen
Sprache
Was ist ein Naturgesetz?
Realismus oder Idealismus?
Mathematik
Was ist eigentlich Mathematik?
Zahlen und Räume
Der Zufall und die Unendlichkeit
Mathematik in der Welt der Automatisierung
Es gibt keinen Weizen ohne Spreu
Zukunftsprognosen
Die Spezielle Relativitätstheorie (SRT)
Zeitdilatation und Längenkontraktion
Raumzeitdiagramme und was sie uns sagen
Die allgemeine Relativitätstheorie (ART)
Zeitdilatation und Längenkontraktion unter der ART
E=mc
2
Quantenmechanik
Der Anfang
Die vier fundamentalen Naturkräfte
Die Quantenteilchen
Kernspaltung und Kernfusion
Erstaunliche Experimente
QM Interpretationen und Erklärungsversuche
Die Bell’sche Ungleichung
Die Quantengravitation
Die String- und Superstring-Theorien
Höhere Dimensionen
Grundlagen der quantenmechanischen Mathematik
Feynman-Diagramme:
Wahrscheinlichkeiten der QM-Prozesse
Die Zeit und die Raumzeit
Die Welt aus Sicht der Quantentheorie
Nochmal: was ist eigentlich Mathematik?
Astronomie
Eine kurze Entstehungsgeschichte des Universums
Die Entstehungsgeschichte der Erde
Schwarze, Weiße und Wurmlöcher
Multiversen
Das holographische Multiversum; das Spiel mit den Dimensionen
Dunkles Universum, was ist los mit der Schwerkraft?
Es gibt eigentlich nur Zahlen ….?
Sind wir allein im Universum?
Die entfremdete Wirklichkeit
Entfremdung und Fetischismus
Entfremdung als Folge der Kultur
Wissenschaft in der Krise
Die Entfremdung von unserem Wissen
Der Mensch, das Tier das weiterdenkt
Evolution und Gesellschaft
Wissenschaft und Technik
Immer weiter?
Empfehlungen zum Weiterlesen
Übersicht der Abbildungen:
Umschlag: Die Geschwister
Sudoku
Die Zeit
Das Doppelspalt-Experiment
Die Kulissenlandschaft
Richtungslos
Die unerträgliche Leichtigkeit des Daseins
Maske 1 und 2
Der Mittelpunkt
Der Anlass
In diesem zweiten Teil der »Illustrierte Wanderungen durch das Denken« handelt es sich um drei Bereiche die nah miteinander verwandt und ein Beispiel für die Leistungen des modernen menschlichen Denkens sind: Mathematik, Quantenmechanik und Astronomie. Diese drei Fachgebiete haben unseren Blick auf die Welt grundlegend verändert. Seit der homo sapiens in die Welt blickte, vertraute er auf seine Sinnesorgane. Der moderne Mensch hat jedoch seit den Entdeckungen von Max Planck und Albert Einstein und der darauf folgenden Entwicklung der Wissenschaften gelernt, nicht länger kritiklos dem was unser Körper wahrnimmt zu vertrauen, sondern besser über die verschollene Logik hinter den Wahrnehmungen nachzudenken.
Je weiter wir von den Fähigkeiten unserer Sinne entfernt sind, desto mehr brauchen wir unsere Vernunft um die Wahrnehmungen und die Messergebnisse richtig zu interpretieren. Logisches und widerspruchfreies Denken muss man mehr denn je einsetzen.
Oft wird die Mathematik nur als Hilfswissenschaft zur Unterstützung anderer Forschungsbereiche betrachtet obwohl sie sich seit dem achtzehnten Jahrhundert zunehmend eigene Ziele gesetzt hat. Wenn man über moderne Physik und Astronomie spricht, ist die unterstützende Rolle sicherlich der Fall. Auch bei der Wirtschaftslehre, Biologie und Chemie braucht man rechenkundiges Verständnis um verstehen zu können wie diese Kenntnisgebiete sich weiterentwickelt haben. Gerade bei der Quantenmechanik und der Astronomie hat sie jedoch eine noch viel wichtigere Rolle bekommen: Um die Phänomene überhaupt zu verstehen, ist eine abstrakte Abbildung der Wirklichkeit unverzichtbar. Ein Schwarzes Loch zum Beispiel ist furchterregend und kaum direkt wahrnehmbar. Nur mit zahlenmäßigen Modellen und Formeln kann man einigermaßen verständlich machen was da eigentlich vorgeht. Die Wirklichkeit, sowohl im ganz Großen als auch im ganz Kleinen, kann gar nicht mehr ohne Erklärungen aus der Mathematik erfasst werden: sie ist die einzige Sprache, die dazu geeignet ist die Entitäten und Ereignisse genau genug zu beschreiben. Diese Vorgehensweise bringt freilich auch Risiken mit sich. Die Rechenkunst ist eine rein logische Wissenschaft; man kann sie betreiben ohne jegliche Beziehung zu der Wirklichkeit. Ein Beispiel dafür liefert uns die spezielle Relativitätstheorie von Albert Einstein. Gemäß dieser Theorie brauchen zwei Ereignisse, die wir als gleichzeitig empfinden, überhaupt nicht gleichzeitig geschehen zu sein! Was wir wahrnehmen ist also nicht in Übereinstimmung mit der Theorie; also stellt sich die Frage wer Recht hat: Unsere Sinne oder eine von uns aufgestellte Theorie. Nur sehr genaue Messungen konnten uns hier die richtige Antwort liefern. In der Quantenmechanik messen wir Vorgänge die noch weiter von unserer Vorstellungskraft entfernt sind. Auch hier stellt sich eine ähnliche Frage: sollten wir unserer Logik glauben oder doch lieber den abstrakten Modellen, die zumindest teilweise eine schlüssige Antwort darstellen.
Ein zweites Merkmal der Mathematik ist ihre Neigung die Aussagen so allgemein wie möglich zu machen. Wir sind daran gewöhnt in einem dreidimensionalen Raum zu leben. Im Prinzip haben alle Gegenstände drei Abmessungen: eine Länge, eine Breite und eine Tiefe. Manchmal können wir eine der drei Abmessungen vernachlässigen; wenn wir uns z.B. ein Blatt Papier anschauen, sehen wir nur eine Länge und eine Breite, die Dicke des Papiers interessiert uns nicht. Mehr als drei räumliche Dimensionen sind uns jedoch total fremd. Mathematiker definieren Objekte in einem Raum mit Koordinaten; jede Abmessung bekommt eine Zahl. Statt einer dreidimensionalen Räumlichkeit, sprechen sie am liebsten über Räume mit n-Dimensionen, wobei n beliebig groß sein darf. Eine Beziehung mit der wahrnehmbaren Wirklichkeit geht dann sofort verloren; die rechnerischen Formeln sollten allerdings korrekt bleiben. Die Bedeutung dieser Formeln bleibt jedoch auf der Strecke, ein Problem, dem wir uns regelmäßig stellen müssen. Was bedeutet eine rein mathematisch fundierte Behauptung eigentlich?
Um das alles besser zu verstehen sollte man sich erst im Klaren sein, was die wahre Art der Rechenkunst eigentlich ist und was deren Nutzen und Grenzen sind. Schon bald wird man feststellen, dass sie im letzten Jahrhundert eine gewaltige Entwicklung durchgemacht hat, sowohl in der Grundlagenforschung als auch in ihren Anwendungen. Im Grundlagenwissen haben Rechenmeister wie David Hilbert und Gottlob Frege versucht die fundamentalen Schwächen zu beseitigen indem man eine neue Fundierung entworfen hat. Tausende Jahre lang hat man mit Zahlen gerechnet die der Natur entliehen waren: die natürlichen Zahlen. Der Vorteil dieser Zahlen ist das jeder sich sofort eine Vorstellung ihrer Bedeutung machen kann. Für eine Weiterentwicklung der Mathematik war es anfangs des zwanzigsten Jahrhundert wichtig alle Widersprüchlichkeiten zu beseitigen. Das beinhaltete unter anderem die Einführung ganz neue Zahlenarten. Neue Anwendungen, wie sie in den Relativitätstheorien oder der Quantenmechanik gebraucht werden, sind auf diesen neuen Zahlen gegründet um sicher zu stellen, dass die Grundlagen stabil und richtig sind. Vielleicht hat sich deshalb Albert Einstein einmal zu der Aussage hinreißen lassen: » Seit die Mathematiker über die Relativitätstheorie hergefallen sind, verstehe ich sie selbst nicht mehr«.
Gerade in der Quantenmechanik liefern die Rechenmeister die zentralen Voraussetzungen. Das ganze abstrakte Gebilde, womit das Verhalten der Elementarteilchen beschrieben wird, fordert einen neuen Formalismus. Mit unserer tagtäglichen Logik können wir diese Welt nicht verstehen, auch viele Wissenschaftler haben es schwer sich mit einer anderen Logik vertraut zu machen. Wenn man allerdings die richtigen Postulate benutzt ist man trotzdem in der Lage, Quantenzustände zu beschreiben, zu interpretieren und vorherzusagen. In wie weit die mathematische Beschreibung der Wirklichkeit entspricht bleibt dennoch eine offene Frage und ist der Grund, weshalb es so viele unterschiedliche Interpretationsversuche gibt. Auch philosophisch gesehen ist die Welt der Elementarteilchen interessant weil es erneut alte Fragen über Realität, räumliche Position, Masse und Modelle zu beantworten gibt. Gerade die Kombination unterschiedlicher Sichtweisen macht die Welt der kleinstmöglichen Teilchen so faszinierend, es ist als ob man einen anderen Planeten mit völlig anderen physikalischen Gesetzen betritt. Nicht verwunderlich dass mancher sich entfremdet fühlt.
In der Astronomie kommt vieles von dem was wir aus Mathematik und Physik wissen zusammen. Dieses Fachgebiet ist eine schöne Illustration dafür was man erreichen kann, wenn mehrere Fachgebiete zusammenarbeiten. Neue Perspektiven werden eröffnet: bisher unbekannte Planeten, unendlich ferne Sterne und Galaxien. Dort in der Ferne spielen sich Ereignisse ab die uns auf Erden nie begegnet sind; angsterregende aber auch wunderschöne. In den Himmel blicken heißt gleichwohl sich besser unserer Position und Bedeutungslosigkeit bewusst zu werden. Es regt zum Nachdenken über das was uns wirklich wichtig ist und uns zu bedeuten hat an. Hat es überhaupt einen Belang? Sind wir nur zufällig da, oder hat unser Dasein einen besonderen Sinn und wenn ja, für wen? Können wir diese Frage überhaupt beantworten? Nachdenken über das Wissen heißt auch, nachdenken über das nicht-Wissen oder das Nicht-Wissen-Können.
In der Planung steht noch Teil drei: »Die Zukunft des Denkens«. Ich werde untersuchen ob unsere Fähigkeiten ausreichen um die Zukunft zu bewältigen. Klar ist jedenfalls, dass ein Denken aus der Vergangenheit nicht genügt. Außer einer ständig wachsenden Beschleunigung spielt eine zunehmende Komplexität die Hauptrolle wenn es um Zukunfts-Szenarien geht. Daher bleiben uns eigentlich nur zwei Lösungsansätze: Entweder die Zukunft nach unseren Denkfähigkeiten gestalten und alle damit verbundenen Risiken im Kauf nehmen, oder unsere Denkleistungen verbessern.
Wir haben die Wahl.
Danksagung
Dieses Band zwei der Wanderung ist das Ergebnis großer Anstrengungen mehrerer Personen. Alle Mitglieder der philosophischen Runde habe ich zu danken für ihre Beiträge in unserer Runde. Die Vielseitigkeit der Meinungen ist eine unerschöpfliche Quelle meiner Inspiration gewesen.
Mein Besonderer Dank geht an meinen Studienfreund Gerrit Terink, der die Textvorschläge über Quantenmechanik überprüft hat, und an Eckhard Froese, der mir sehr geholfen hat meine Gedanken verständlich und einwandfrei zu formulieren.
Die virtuelle Wandergruppe durch das Denken ist in diesem Band zwei immer noch unterwegs. Ihre Erfahrungen habe ich kurz zusammengefasst und am Anfang jedes Kapitels festgehalten. Alle Namen, Aussagen und Ereignisse der Gruppe sind frei erfunden. Jegliche Übereinstimmung mit der Wirklichkeit ist Zufall.
Fußnoten und Verweisungen habe ich am Ende jedes Kapitels zusammengefasst. In dem betreffenden Text sind sie als (x) markiert. Das letzte Kapitel enthält eine Liste von Büchern, die ich zum Weiterlesen empfehlen kann.
Wissenschaftsphilosophie
»Unser Wissen ist ein kritisches Raten, ein Netz von Hypothesen, ein Gewebe von Vermutungen« (1).
Wissenschaftler sammeln Daten und sind immer auf der Suche nach der besten Erklärung ihrer Wahrnehmungen. Philosophen fragen sich ständig was eigentlich eine »beste Erklärung« heißen darf. Wer das Buch »Der Name der Rose« von Umberto Eco gelesen hat, hat Bekanntschaft mit dem scharfsinnigen Mönch William von Baskerville gemacht, von dem Autor nach seinem Vorbild der Franziskaner Mönch William von Ockham (1287-1347) beschrieben. Der letztere hat mit seinem Messer Furore gemacht: Ockhams Rasiermesser. William von Ockham spielte eine wichtige Rolle in dem mittelalterlichen Universalienstreit. Die Denker des Mittelalters waren sich uneinig ob Allgemeinbegriffe (abgeleitet von den Platonischen Ideen) wirklich existieren. Unser William bezog eine extrem nominalistische Position: Die Nominalisten sind davon überzeugt, dass Allgemeinbegriffe nur gedankliche Konstruktionen sind und nicht wirklich existieren. Ockhams Rasiermesser hat in der Wissenschaftsphilosophie die Bedeutung bekommen dass die einfachste Theorie (oder Erklärung) im Prinzip auch die beste Theorie ist. Wenn man alles Überflüssige wegschneidet, bleibt nur noch die Wahrheit übrig. Der britische Detektiv Sherlock Holmes hantierte bei seiner Suche nach dem Täter des Verbrechens in gleicher Weise.
Trotzdem zeigt Ockhams Messer uns nicht immer den Weg zu der besten Theorie, denn wie weiß man genau was überflüssig ist? Die Schwierigkeit im Umgang mit Theorien ist, dass sie die Folge von reinem Denken sind. Natürlich, am Anfang einer neuen Theorie stehen meistens eine Frage und eine Reihe von Versuchsdaten. Die Herausforderung ist, diese Daten zu erklären. In dieser Phase der Forschung braucht man seine Vorstellungskraft und logische Vernunft um Fakten mit einer Erklärung zu ergänzen. Wo das einbildende Denken ins Spiel gebracht wird, ist das Begehen von Fehlern eigentlich kaum zu vermeiden. Mit als Folge dass in der Physik bereits akzeptierte Theorien regelmäßig von anderen, die zu einer noch besseren Erklärung imstande sind, abgelöst werden. Unser Wissen, muss man daher sagen, ist nur ein vorläufiges Wissen.
In der Physik enthält eine Theorie meistens eine Anzahl von widerspruchsfreien und zusammenhängenden Formeln. Viele Theorien, wie die Gravitationstheorie, haben eine lange Geschichte. Die Denker im antiken Griechenland hatten ein geozentrisches Weltbild: Die Erde stand im Mittelpunkt. Deshalb war Aristoteles der Meinung dass die Gravitation eine Schwerkraft ist die alle Elemente zum Mittelpunkt der Erde treibt. Deshalb sprechen wir immer noch über die Schwerkraft wenn wir die Gravitation meinen. Solange wir auf Erden bleiben ist das kein Problem weil die Anziehungskraft der Erde die aller anderen Massen normalerweise mehrfach übertrifft. Erst Nikolaus Kopernikus erweiterte 1543 die Gravitationstheorie bis ins Weltall, er ging davon aus, dass alle Himmelskörper eine Anziehungskraft ausüben. Das Heliozentrische Weltbild revolutionierte die Naturwissenschaften; ein neues Zeitalter der Astronomie hatte angefangen. Auf Grund biblischer Zitate versuchte mancher die neue Theorie zu wiederlegen. Außerdem: Wenn sich die Erde mit großer Geschwindigkeit um die Sonne drehen würde, müsste man doch einen ständigen Fahrtwind spüren und müssten Steine doch schräg zur Erde fallen? Erst die Beobachtungen von Galileo Galilei und die Berechnungen von Johannes Kepler konnten die Kollegen überzeugen, aber da waren wir in der Geschichte schon viele Jahre weiter. Das Gravitationsgesetz von Isaac Newton gab den Beobachtungen eine mathematische Fundierung, das Newtonsche Gravitationsgesetz: Die Anziehungskraft F zweier Massen (m1 und m2) ist gleich:
wobei G die Gravitationskonstante und r der Abstand zwischen den beiden Massen ist. Newton war klar, dass diese Anziehungskraft überall im Universum gleichermaßen seinen Einfluss ausübte. Die Bahnen von Planeten und des Mondes konnten berechnet werden, genauso wie die Fallgeschwindigkeiten von Gegenständen auf der Erde. Ohne die Anziehungskraft zwischen der Erde und ihrem Himmels-Trabanten würde letzterer sich einfach geradlinig von uns entfernen. Newton konnte die Wirkung der Gravitation zwar wahrnehmen und berechnen, wie sie jedoch genau funktionierte konnte er nicht sagen; er war darüber nur verwundert. Seine Theorie hielt lange stand und auch heutzutage wird das Newtonsche Gravitationsgesetz noch häufig benutzt. Albert Einstein jedoch zeigte Anfang des zwanzigsten Jahrhundert, dass Newtons Theorie unter ganz extremen Bedingungen, wenn es zum Beispiel um die Beeinflussung des Lichts durch die Sonne geht, nicht ausreicht. Einstein wählte andere Ausgangspunkte und kam mit einer ganz anderen Theorie: Die Allgemeine Relativitätstheorie (ART). Wir werden diese noch ausführlicher besprechen.
Außer Formeln enthält ein physikalisches Gesetz einen Text oder auch mehrere Prinzipien um Ausgangspunkte und Wirkungsgebiet zu beschreiben. Wie schwierig das manchmal ist lässt sich beim Mach`schen Prinzip, genannt nach Ernst Mach, illustrieren. Er wehrte sich gegen Newtons` Idee eines absoluten Raums. Mach behauptete dass alle Bewegungen nur relativ zu anderen Körpern zu definieren sind; es gibt also kein bevorzugtes System um Bewegungen zu bestimmen. Eine Idee, die Einstein aufgriff als er seine ART entwickelte. Diese Idee ist schwer in Worte zu fassen, es gibt also mehrere Beschreibungen. Jeder Physiker weiß dennoch genau was damit gemeint ist. Die Sprache spielt folglich bei Theorien eine wichtige Rolle, sie ist aber zugleich ihre Achillesferse.
Man hat Vermutungen, Meinungen, Fakten (und seit kurzem auch die vielbesprochenen alternativen Fakten, die wir dennoch weiter außer Acht lassen). Wenn es um Forschungsdaten geht, reden wir gerne ausschließlich über objektive Fakten. Meinungen und Fakten sollten also immer klar voneinander zu unterscheiden sein. Danach sollten Fakten in einer eindeutigen Sprache bewertet und erklärt werden. Dieses Vorgehen beinhaltet zwei Aspekte: die Sache worüber man redet und die Sprache die man dafür benutzt. Wie kann man sicher sein die richtigen und eindeutigen Aussagen zu machen? Die Wissenschaftsphilosophie kann uns dabei helfen.
Fakten, Meinungen und Vermutungen
Der bekannte amerikanische Physiker Richard Feynman (1918-1988) sagte mal dass die Wissenschaftsphilosophie für die Wissenschaft genau so viel Bedeutung hat wie die Ornithologie für die Vögel. Feynman hatte oft recht, dennoch meine ich dass er hier reinen Unsinn verkündigt hat. Die Wissenschaft lebt von Fakten, denn nur auf Grund von Fakten kann man die Wirklichkeit objektiv beschreiben. Was man allgemein gesprochen unter Fakten versteht ist eine Beschreibung der Realität, und zwar möglichst objektiv. Wenn man demnächst seine Beobachtungen klar und eindeutig definieren kann, hat man diesen Teil der Wirklichkeit doch gut beschrieben, oder?
Dass die Wirklichkeit manchmal völlig anders sein kann, beweist folgendes Beispiel (2). Ein Kriminalbeamter möchte gerne untersuchen ob Ausländer häufiger Straftaten begehen als Inländer. Schon diese Fragestellung zeigt eine gewisse Kausalitätserwartung und die Ergebnisse seiner statistischen Untersuchung bewahrheiten scheinbar seine Voreingenommenheit. Er findet heraus, nachdem er die gesamten Kriminalitätsdaten analysiert hat, dass Ausländer fast zweimal öfters Straftaten begehen als Inländer. Was er jedoch übersieht ist die Tatsache dass in einer bestimmten Stadt, wo die Kriminalität besonders hoch ist, außerordentlich viel Ausländer wohnen. Pro Einwohner jedoch ist auch dort kein Unterschied zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen zu messen. Weil diese Daten rücksichtslos in die Gesamtzahlen aufgenommen wurden, konnte eine falsche Schlussfolgerung gezogen werden. Das aggregieren von Zahlen erzeugt nicht bestehende Zusammenhänge; kombiniert mit den Vorurteilen des Untersuchers ergibt sich eine scheinbar unwiderlegbare aber falsche Schlussfolgerung! Er hat übersehen dass offensichtlich auch andere Faktoren die verwendeten Daten beeinflussen. Fakten können zwar die Wirklichkeit möglichst objektiv beschreiben, jedoch nicht alle Fakten sind objektiv!
In der Naturforschung ist die Sache noch etwas komplizierter. Viele Wahrnehmungen können nur mit ausgeklügelten Messinstrumenten durchgeführt werden. Dann kommen schon schnell mehrere Frage auf, beispielsweise: ob die Instrumente richtig eingestellt wurden, ob die Messung ordnungsgemäß stattgefunden hat, ob die Ergebnisse richtig interpretiert wurden und ob der Bericht in Übereinstimmung mit der Messung ist. Und dann sprechen wir noch nicht über die Frage mit welchem Motiv und Ziel gemessen wurde, oder anders gesagt: Welches Paradigma schwebte bei der Vorbereitung den Forschern vor Augen? So muss man auch noch miteinbeziehen dass ein Experiment immer eine Vereinfachung der Wirklichkeit benötigt; man kann ja nicht die ganze Wirklichkeit mit einem Schlag messen! Darüber hinaus gibt es mathematische und physikalische Aussagen die überhaupt nicht mit Wahrnehmungen untermauert werden können; wie der rechnerische Unvollständigkeitsbeweis (die Frage ob es eine größtmögliche Primzahl gibt) oder die Unschärferelation in der Quantenmechanik. Grund genug, um zu zahlreichen Widersprüchen, Unklarheiten, Doppeldeutigkeiten oder Ungenauigkeiten zu kommen. Kein Wunder also, dass ein Großteil der Diskussionen unter Physikern gerade dieses Thema berührt!
In der Philosophie ist das Finden der Wahrheit ein erstes Anliegen. Philosophen wissen dennoch, dass es die Wahrheit in absolutem Sinne nicht gibt. Seit Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts werden nur Aussagen für wahr gehalten wenn diese überprüfbar sind. Dies schließt schon vieles bezüglich Theologie, Ethik oder Ästhetik aus. Die Mitglieder des Wiener und Berliner Kreises nannten diese Geisteshaltung »Logischer Positivismus«, was so viel bedeutet wie: Nur empirisch gesammelte, eindeutige Daten und eine logische Schlussfolgerung können zu einer überprüfbaren Wahrheit führen. Später, als die Sozialwissenschaften sich entwickelten, wurden diese Bedingungen ein wenig abgeschwächt, das Prinzip blieb jedoch aufrecht erhalten. Dennoch blieb die zentrale Frage wie die gewonnenen Einsichten eindeutig übertragbar sind. Der Brite Bertram Russell (1872-1970) meinte dass all unsere Kenntnisse noch etwas an Zweifel und Zweideutigkeit haben, sie sind eigentlich nur ein »best guess«, eine bestmögliche Einschätzung.
In der analytischen Philosophie wird der Frage nachgegangen in wie fern unsere tagtägliche Sprache überhaupt für eindeutige wissenschaftliche Aussagen geeignet ist. Gottlob Frege (1848-1925) meinte, man brauche eine bessere Sprache: Eine direkt von der Logik abgeleitete formale Sprache; die Prädikatenlogik. Diese Art von Logik wird immer noch in der Softwareentwicklung benutzt. Frege wurde ein Wegbereiter für Ludwig Wittgenstein, der in diesem Bereich später bahnbrechende Arbeit geleistet hat. Freges »Vorarbeit« für Wittgenstein bestand darin, dass er einen klaren Unterschied zwischen Begriffen machte und diese teilweise neu definierte. Ein Eigenname z.B. hat für ihn nur eine Bedeutung wenn es einen eindeutigen Bezug auf die Wirklichkeit gibt. Der Sinn eines Satzes, so Frege weiter, bezieht sich direkt auf den Gedanken, der dahinter steckt.
Wenn ich einen Satz ausspreche kommuniziere ich also inhaltlich mein Urteil. Dieses entspricht nicht immer der Vorstellung des Zuhörers. Angenommen ich sage: »Das ist ein schönes Bild«, dann habe ich meinen Gedanken über das Bild geäußert. Die Frage ist jedoch, ob mein Zuhörer dem Wort »schön« dieselbe Bedeutung zuteilt. Deshalb, sagt Frege, müssen wir die objektive Bedeutung, die immer gleich bleiben soll, von der subjektiven Vorstellung trennen. Wir werden später, in dem Kapitel über Mathematik, untersuchen, welche Konsequenzen es hat, wenn wir zum Beispiel den Satz »Der König von Frankreich ist kahl« erörtern.
Zusammengefasst bedeutet es für die Naturwissenschaften dass eine Messung keinen Sinn hat, wenn man nicht in der Lage ist die Ergebnisse eindeutig sprachlich zu kommunizieren: Was hat man gemessen, warum wurde gerade diese Messung durchgeführt, wie wurde gemessen und welche Schlussfolgerung darf man auf Grund der Ergebnisse ziehen.
Sprache
Die Kritik der Sprache bekam im deutschsprachigen Raum mit Ludwig Wittgenstein erneut viel Interesse. Seine erste und während seiner Lebenszeit einzig vollständige Veröffentlichung ist »Tractatus logico Philosophicus«; erschienen 1921 in deutscher Sprache.
Das Ziel Wittgensteins war ambitioniert: Eine Verbindung herzustellen zwischen der Sprache, die wir benutzen, und der Wirklichkeit, die wir mit unserer Sprache beschreiben möchten. Ein Unterfangen, das uns, um unsere Sprache besser zu verstehen, riesige Schritte vorwärts gebracht hat, aber ebenfalls auf heftige Kritik, inklusive von dem Schriftsteller selbst, gestoßen ist. In seinem posthum veröffentlichten »Philosophische Untersuchungen« wurde manche Behauptung aus Tractatus widerrufen. Allerdings haben beide Ausgaben viel Sinnvolles zu erzählen.
Der Anlass für Wittgenstein war ein Thema das auch schon zwischen Platon und Aristoteles aktuell war. Platon hatte eine Ideenlehre entwickelt. Er meinte dass wir die wahre Art der Dinge nicht erfassen können. Er machte einen Unterschied zwischen der Sinneswelt (das Wahrnehmbare) und der Ideenwelt (das Denkbare). Weil Ideen eine ganz andere Natur als die Dinge in der Sinneswelt haben bleibt es ein offenes Problem, wie die Ideen ihren Einfluss auf die Sinneswelt nehmen können. Deshalb hielt Aristoteles die Ideenlehre Platons für einen Kategorienfehler. Von dieser Art von Denkfehlern haben wir schon, wenn das menschliche Bewusstsein im Rahmen des Leib-Seele-Problems zur Sprache kam, einige Beispiele gesehen. Der Unterschied der Kategorien, den Aristoteles zwischen wahrnehmen und wissen machte, ist, dass eine Wahrnehmung nur eine einzige spezifische Situation betrifft und das Wissen sich auch mit der Frage nach dem Warum beschäftigt und die Tür zu einem allgemein gültigen Gesetz öffnen kann. Diese Streitfrage kommt in der Philosophie wieder wie eine Bombe zurück als, viele Jahrhunderte später, der Idealismus und der Empirismus einander gegenüber standen.
Wittgenstein war Logiker und wollte Klarheit über die Welt: ihre Beschaffenheit und wie wir sie zum Ausdruck bringen können. Schon Immanuel Kant meinte dass wir die (Dinge in der) Welt niemals komplett erfassen können; denn die Dinge »an sich« zeigen sich nicht und können wir uns nur in unserem menschlichen Verstand vorstellen. Die Grenzen dieser Vorstellung sind deshalb auch die Grenzen meiner Kenntnis der Welt. Wittgenstein meinte, dass eher die Sprache uns die Grenzen aufzeigt, denn unsere Gedanken brauchen eine Sprache um verstanden werden zu können.
Tractatus eröffnet mit dem Satz: »Die Welt ist alles was der Fall ist« und endet mit: »Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen«. Mit diesem letzten Satz fasste Wittgenstein zusammen was er als die endgültige Lösung der Philosophie sah: Wenn man seinen Gedanken nicht klar und eindeutig zum Ausdruck bringen kann: vergiss es! Seine Gedanken legte er in klar definierten logischen Schritten fest. Ich werde einige davon näher erklären.
»Das logische Bild der Tatsache ist der Gedanke«. Beispielsweise wenn man sagt: »Die Mutter ist größer als das Kind«, hat man zwei Gegenstände benannt und eine Relation zwischen den beiden gedacht und zum Ausdruck gebracht. Sinnvolle Sätze bezeichnen mit ihrer Logik die Welt auf eine eindeutige Weise. Komplexe Sätze können als eine Zusammenstellung dieser Art Elementarsätze gedacht werden. Die Elementarsätze können alle entweder wahr oder falsch sein, aber immer sinnvoll (d.h. möglich und überprüfbar). Die Gesamtheit der wahren Sätze ist die Gesamtheit der Naturwissenschaft, so wie der erste Satz im Tractatus das zum Ausdruck bringt. Das Denken sollte sich daran ein Beispiel nehmen und unsinnige (d.h. nicht zu überprüfende) Fragen und Sätze vermeiden. Wenn man sich zum Beispiel fragt was der Sinn des Lebens sei, dann sollte zuerst klar gemacht werden was man unter »Sinn« zu verstehen hat. Wenn man das nicht erklären kann, wird die Frage sinnlos.
Wir brauchen keine Erklärungen, sondern nur exakte Beschreibungen! Die von Wittgenstein vorgeschlagene Idealsprache ist für Philosophen und Wissenschaftler das Werkzeug um die Gedanken eindeutig und überprüfbar zum Ausdruck zu bringen. Jede Frage erhält dann nur eine Antwort: nämlich die richtige. Satz 6.5.4. in Tractatus lautet: »Man sieht die Welt richtig wenn man die sinnvollen von den unsinnigen [Sätze] getrennt hat und kann die Leiter, auf der er hinauf gestiegen ist, weggeworfen werden«. Denn wenn man alle zugrunde liegenden Elementarsätze überprüft hat und sie wahr sind, kann man seine Schlussfolgerung für wahr halten und die aufbauenden Sätze sind dann überflüssig geworden.
Jahre später widerrief Wittgenstein seine in Tractatus veröffentlichte Meinung. Er kam zu der Überzeugung dass die Sprache doch nicht so eindeutig zu gestalten ist wie er sich das vorgestellt hatte: »Die Bedeutung eines Ausdruckes nur daran einzusehen ist, wie er in unserer normalen Sprache gebraucht wird«. Wittgenstein introduziert also die Umwelt, der Gebrauch einer Sprache, um die Bezeichnung aufzuklären. Der Gebrauch bestimmt die Bedeutung, denn die Bedeutung ist etwas Soziales. Zusammengenommen nannte er es: Das Sprachspiel. Eine Zerlegung in Elementarelemente (lies: eindeutige Elementarsätze) ist deshalb unmöglich!
Können wir denken ohne Worte? Nein, denn nicht wir denken die Sprache, sondern die Sprache denkt uns. So wie wir die Welt sehen, so bringen wir sie zum Ausdruck. Ich werde dir später in diesem Band z.B. die Relativitätstheorie und die Quantenmechanik vorstellen, zwei naturwissenschaftliche Theorien, die beide experimentell bestätigt wurden, aber ein komplett anderes Bild der Welt darstellen. In Wittgensteins Welt sind das zwei unterschiedliche Sprachspiele. Jedes Sprachspiel hat seine eigenen Spielregeln. Wie das Schachspiel, das man nur spielen kann wenn man die Spielregeln kennt und die Figuren auf dem Schachbrett versteht. Wenn aber jeder sein eigenes Sprachspiel entwerfen kann, ist die Verwirrung doch komplett, oder? Das stimmt aber nur dann, wenn man nicht auf die Verwandtschaft aller Spiele schaut; denn es gibt immer eine Gemeinsamkeit. Wichtig ist es also die Verwandtschaften zu definieren.
Jürgen Habermas (deutscher Philosoph, geb. 1929) nimmt diese Herausforderung an und definiert unterschiedliche Rationalitäten die zweckorientiert festgestellt worden sind. Wenn die Bedingungen und Ausgangspunkte unterschiedlich sind, wie es in der Quantenwelt und den Relativitätstheorien der Fall ist, können die Aussagen nicht ohne weiteres einander gleichgesetzt werden und auch nicht zu unserer vertrauten Welt übersetzt werden. Sogar die Art und Weise wie ein Wort ausgesprochen wird, bestimmt dessen Bedeutung. Eine bestimmte Aussage kann sowohl eine Meinung, ein Wunsch, eine Anweisung, ein Befehl oder einfach eine bedeutungslose Bemerkung sein.
Wenn wir die Sprache der Naturwissenschaften verstehen wollen, sollten wir uns mit deren Umwelt vertraut machen. Das heißt meistens: Man soll die Bedingungen und Ziele kennen. Welche die genau sind, darüber kann uns die Philosophie aufklären. So betrachtet kann sie für die Wissenschaft doch eine große Bedeutung haben.
Was ist ein Naturgesetz?
Wenn wir darstellen möchten dass etwas unumgänglich ist sagen wir »Es ist wie ein Naturgesetz«, denn diese stehen für Zuverlässigkeit und eine immer geltende Wirksamkeit. Harald Lesch sagt gerne: »Ein Naturgesetz ist nicht verhandelbar«. Und wir alle wissen intuitiv was mit einem Naturgesetz gemeint wird. Trotzdem ist der Begriff nicht so selbstredend.
Überall um uns herum gelten die Naturgesetze. Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, dass wir fast vergessen haben was eigentlich ein Naturgesetz beinhaltet. Trotzdem ist jedem klar, dass diese Gesetze greifen: Ohne Gravitation würde unsere enge Beziehung mit der Erde plötzlich ein ganzes Stück lockerer und wir würden uns sogar ganz von unserer Sonne verabschieden müssen. Alle kennen Beispiele von Naturgesetzen oder deren Folgen: Die Erde umkreist die Sonne in einem Ellipse, Wasser kocht unter atmosphärischem Druck bei 100 Grad Celsius und die Lichtgeschwindigkeit in Vakuum beträgt fast 300.000 Km pro Sekunde, oder gut eine Milliarde Stundenkilometer. Das alles ist wie Fakten: wahr und unveränderlich.
Wo kommen die Naturgesetze her? Religiös denkende Menschen würden sagen dass Gott sie mit der Schöpfung bestimmt hat. Diese Sichtweise hat zwei Schwächen: erstens gibt es atheistische Wissenschaftler und wie sollte man sie überzeugen? Zweitens ist unklar ob, wie und warum Gott sie für uns erkennbar gemacht haben soll. Die meisten Kosmologen gehen davon aus dass unsere Naturgesetze direkt nach dem Urknall entstanden sind. Im Prinzip hätten sie auch völlig anders aussehen können und eine ganz andere Wirklichkeit wäre entstanden. Es gibt also eine sehr enge Beziehung zwischen unseren Naturgesetzen und der Natur, die uns umgibt. Man könnte sich fragen ob die Gesetze und die Naturkonstanten ewig und überall gelten. In dem Kapitel über Astronomie wird diese Frage weiter erörtert, vorläufig kann man davon ausgehen dass das der Fall ist.
Es liegt in der Logik, dass wir in der Lage sind die Naturgesetze auf Grund von Wahrnehmungen zu formulieren: Die Beobachtung, dass manche Ereignisse miteinander verbunden sind, führt zu der Schlussfolgerung dass es eine gewisse Gesetzmäßigkeit geben muss. Es kann doch kein Zufall sein dass die Erde wiederholt genau in einem Jahr die Sonne umkreist und gleichzeitig selbst immer wieder 365,2425 Umdrehungen um die eigene Achse gemacht hat? Der britische Philosoph David Hume hat diesen Standpunkt bestritten indem er meinte dass wir den Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung überhaupt nicht wahrnehmen können, sondern dass wir uns das nur einbilden. Wenn zwei Kugeln miteinander kollidieren liegt es nicht in der wahrnehmbaren Natur der Kugeln dass sie nachher beide eine andere Geschwindigkeit und Richtung bekommen haben. Was wir wahrnehmen sind nur die Folgen; die Ursache, wirksam im Moment der Kollision, bleibt für uns verborgen. Deshalb können wir niemals sicher sein dass jedes künftige Experiment dieselben Ergebnisse zeigen wird, obgleich die Wahrscheinlichkeit zunimmt je mehr Prüfungen durchgeführt wurden. Dennoch, so lange wir die Ursache nicht bis ins kleinste Detail erforscht haben, bleibt immer eine Chance bestehen dass ein nächstes Experiment ein total anderes Ergebnis bringt.
Darüber hinaus kann es so sein, dass eine Theorie, die auf Grund bestimmter Beobachtungen formuliert wurde, auch eine alternative Theorie haben könnte. Man braucht nur die gesammelten Daten, bewusst oder unbewusst, auf eine bestimmte Art und Weise zu manipulieren. Wenn beide Theorien, die einander wiedersprechen, bestätigt werden welche ist denn die richtige? Diese s.g. Unterdeterminiertheit war für den Philosoph Willard van Orham Quine (1908-2000) Anlass empirische Daten nur holistisch (d.h. in einem größeren Zusammenhang) bewerten zu wollen (3). Die Einheit des Wissens ist führend in der Frage welche Theorien für wahr gehalten werden können. Sind die Naturgesetze doch nicht so sicher wie wir immer gedacht haben? Empirie als einziges Standbein genügt offensichtlich nicht.
Es hängt ebenso von der Richtigkeit der Annahmen und Umstände ab, ob eine Theorie oder ein Gesetz der Wirklichkeit ausreichend nah kommt. Nur wenn Ausgangspunkte und Umstände stabil und wohldefiniert sind hat man eine Grundlage für zuverlässige Wahrnehmungen die zu Naturgesetzen führen könnten. Man kann sich fragen ob diese theoretische Bedingung praktisch überhaupt realisierbar ist, denn in der Natur ist alles mit allem verbunden. Welche Verbindungen man außer Betracht lassen kann und welche nicht, ist nicht immer klar.
Wenn man festgestellt hat, dass bei einer bestimmten Spezies 51% der Nachkommen männlich sind, hat man nur eine statistische Wahrscheinlichkeit formuliert. Von welchem Geschlecht die oder der nächste Nachkömmling sein wird bleibt unklar. Gibt es einen wesentlichen Unterschied zu dem Beispiel der zwei Kugeln von Hume? Ist alles Wissen nur vorläufig bis ein Experiment uns das Gegenteil zeigt?
Zusammengefasst können Naturgesetze nur dann als (vorläufig) zuverlässig gelten wenn sie die folgenden Bedingungen erfüllen: 1. Bestätigt von einer ausreichend großen Zahl von Wahrnehmungen die auch eindeutig annehmbar erklärt werden können. 2. In einen größeren Rahmen von Gesetzen passen. 3. Aussagen kommender Experimente vorhersagen können.
Selbst dann, wenn diese drei Bedingungen erfüllt sind, bekommen wir keine Sicherheit dass die von uns formulierten Naturgesetze richtig und vollständig sind. Wenn man sich die Geschichte von tausenden Jahren Wissenschaft anschaut, sieht man wie oft Gesetze ergänzt oder sogar ersetzt wurden weil man neue Einsichten erworben hat. Der Grund dafür ist dass jedes Gesetz bestimmte Annahmen und Voraussetzungen kennt. Die wichtigste ist wohl, dass die Wirklichkeit vereinfacht abzubilden ist, ohne wichtige Einflussfaktoren ignorieren zu müssen.
Der britische Mathematiker und Philosoph (welch eine herrliche Kombination!) Alfred North Whitehead (1861-1947) warnte uns schon mit seinem Schlagwort: »Der Trugschluss der unzutreffenden Konkretheit«. Je abstrakter und schwieriger die physikalischen Theorien sind, desto vorsichtiger muss man mit deren Deutung sein. In der Quantenmechanik zum Beispiel wissen wir nicht was sich da unten alles abspielt; wir können nur die Ergebnisse unserer Experimente als »Berichte aus der Unterwelt« mit unserer Logik interpretieren. Und das liefert uns merkwürdige Schlussfolgerungen, die unter Forschern Anlass zu heftigen Diskussionen geben. Sogar die Aussage »Wir wissen nur was wir gemessen haben, alles andere bleibt unklar« ist angreifbar, denn wir wissen oft gar nicht was wir gerade gemessen haben denn die Teilchen sind so klein, dass wir sie nicht beobachten können ohne sie zu beeinflussen!
Nachdem die Relativitätstheorien gefestigt waren wurde klar, dass der Raum niemals mehr derselbe bleiben würde. Vorher rechnete man mit der sinnesnahen euklidischen Systematik um Geometrien zu beschreiben. Alle natürlichen Ereignisse konnten eindeutig beschrieben werden und die Naturgesetze konnten mit ihren Formeln auch die Auskünfte der Experimente richtig und vollständig beschreiben. Wir nennen das jetzt die Newtonsche oder klassische Physik. Die allgemeine Relativitätstheorie benötigt eine ganz andere Systematik: Die Riemannsche Geometrie. Whitehead sprach von einer Krise: Welche Geometrie ist denn die richtige? Ihm zufolge sind wir gezwungen die alltäglichen Erfahrungen und Intuition zu verlassen, um eine vertrauenswürdige Vorstellung der Natur zu erlangen. Die Frage ist nur: Sind die neuen Einsichten zuverlässig? Eigentlich müsste man, um diese Frage beantworten zu können, einen schließenden Gesamtblick auf die ganze Welt haben. Etwas wozu wir, ihm zufolge, nicht imstande sind weil dieser Blick die Realität übersteigen wird und wir auf die Metaphysik angewiesen sind. Eine Domäne, worüber die Wissenschaften uns außer Spekulationen nichts sagen können.
Whiteheads Dilemma ist der Grund weshalb die Naturwissenschaften eine lange Geschichte von Paradigmenwechseln haben. Grundlegende Einsichten, worauf man sich geeinigt hatte, bewiesen sich auf Dauer trotzdem als unhaltbar. Jedes Mal nahm ein peinlicher Prozess seinen Anfang, denn nichts ist schwieriger als angesehene Kollegen von ihrem Irrtum zu überzeugen.
Realismus oder Idealismus?
Wie können wir denn wahres Wissen erlangen? Intuitiv würde man sagen, durch Wahrnehmungen, denn was ich wahrnehme ist der Fall. Vorsicht, sagen die Philosophen. Schon in der Wüste gewesen und eine »Fata Morgana« gesehen? Nun ja, könnte man sagen, das ist eine Ausnahme. Trotzdem, wann gilt eine Ausnahme und wann nehme ich die Wirklichkeit wahr? Eine Frage die so leicht nicht zu beantworten ist, denn außer der Unverlässlichkeit unserer Sinnesorgane spielt manchmal auch unser Verstand verrückt und wir nehmen (nur) wahr was wir wahrnehmen möchten. Darüber hinaus kennt man noch das Thema »selektive Wahrnehmung«. Wenn man sich eine neue Theorie ausgedacht hat und sie mit Wahrnehmungen untermauern möchte ist die Neigung groß, nur bestimmte, passende Resultate mit in Betracht zu ziehen. Wenn diese der Theorie widersprechen, möchte man sie lieber vergessen. Man kann ebenfalls unbewusst selektiv wahrnehmen; man könnte bestimmte einflussreiche Umstände übersehen und deshalb eine verzerrte Wirklichkeit als Normalzustand betrachten.
Oder man dichtet einem anerkannten Phänomen besondere Nebenwirkungen zu. Ein schönes Beispiel dafür ist der Einfluss des Mondes. Jeder weiß dass der Mond seine Anziehungskraft auf der Erde, spürbar als Ebbe und Flut, ausübt. Mancher meint jetzt zu wissen dass der Mond noch einen viel größeren Einfluss hat: wenn man schlecht schläft ist es Vollmond; wenn das Saatgut nicht richtig wächst oder der Teig nicht geht, hat man den Mondkalender nicht befolgt; Mondwasser hat besondere Eigenschaften und so geht es immer weiter. Eine sehr große Mehrheit der Deutschen glaubt an diese Wirkungen des Mondes und kann das mit vielen Beispielen »beweisen«. Was trotzdem danach folgt, ist eine Ansammlung selektiver Wahrnehmungen. Wissenschaftliche Beweiskraft: gleich null.
Zusammengefasst kann man sich die Frage stellen ob es überhaupt eine objektive und erfassbare Realität gibt. Hierzu gibt es mehrere philosophische Standpunkte, wovon ich dir die wichtigsten kurz vorstellen und kommentieren möchte: Der Rationalismus, der Empirismus, der Positivismus und der Idealismus.
Rationalismus und Empirismus
Der Rationalist Rene Descartes (1596-1650) sagte: »Wahr ist das, was ich ganz klar und deutlich einsehe«. Descartes hat anfangs alles in Zweifel gezogen. Die erste ganz sichere Wahrheit, die er danach feststellen konnte, ist, dass er tatsächlich existiere und kein Opfer eines Dämons sei (denn es muss ja jemand geben der zweifelt). Schritt für Schritt kann der Mensch auf Grund seiner angeborenen Ideen die Wahrheit weiterentwickeln. Das führende Prinzip in diesem Vorgang ist Deduktion: Das anwenden von allgemeinen Gesetzen auf konkrete Situationen. Diese Denkweise ist sehr geeignet in Bereichen, wie Mathematik und Logik, die in erster Instanz ohne direkte Wahrnehmungen auskommen; dort kommt es auf unsere Ratio und nicht auf Wahrnehmungen an. Der Empirist John Locke (1632-1704) meinte: »Nichts ist im Verstand das nicht vorher in den Sinnen war«. Er sagte, im Gegensatz zu Descartes, dass es keine angeborenen Ideen gäbe und alles zuerst wahrgenommen werden müsste. Wenn wir, so Locke, mehrere Wahrnehmungen mit derselben Auskunft gemacht haben, dürfen wir auf Grund der Induktion eine allgemeine Gesetzmäßigkeit annehmen.
Beide Standpunkte kann man kritisieren: Descartes geht von angeborenen Ideen, die er nicht bewiesen hat, aus; während Locke seine Kenntnistheorie auf Wahrnehmungen, die aber manchmal unzuverlässig sind, basiert. Die Methode der Induktion erweist sich ebenfalls als unsicher: Wir haben keine Garantie dass die nächste Wahrnehmung uns etwas Abweichendes vorzaubert. Skeptische Wissenschaftler erzählen gerne über das Induktionsgesetz der Hühner.
Stelle dir ein großer Hühnerstall vor, mit hunderten von Hühnern. Jeden Tag kommt der Bauer vorbei und wirft eine ganze Menge an Futter in den Stall; jedes Huhn kann sich satt fressen. Im Laufe der Zeit gewöhnen die Hühner sich an diese Fütterung und die klügsten Hühner gehen nach hundert vergangenen Tagen davon aus, dass auch künftig morgens um acht der Bauer vorbei kommen wird und stehen deshalb schon bereit. Das macht er tatsächlich am Tag einhunderteins. Nur kommt er nicht zum Füttern sondern zum Schlachten.
Was den Hühnern fehlte passiert uns manchmal auch: uns fehlt der Überblick. Trotzdem empfinden wir den Empirismus intuitiv als sehr nützlich; das was wir wahrnehmen repräsentiert doch die Wirklichkeit! So denkt auch David Hume, er verabscheut die metaphysischen Luftschlösser, wie er die Gedanken der Rationalisten nennt. Dennoch findet er heraus dass die Wahrnehmung doch nicht so vertrauenswürdig ist wie er hoffte. Wenn wir ein Ereignis wahrnehmen sehen wir ja die Ursache nicht und können deshalb keine abschließende Aussage machen. Was wir denken ist, wie bei den Hühnern, die Folge unserer Einbildungskraft.
Auch in der modernen Wissenschaft droht das Risiko der Einbildung. Wir hantieren bestimmte Theorien und Methoden von denen wir denken dass sie anwendbar sind. Dazu kommt noch dass wir gezwungen sind unsere Wahrnehmungen in einer mangelhaften Sprache zu kommunizieren, denn es gilt immer noch das Wort Wittgensteins: »Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen«.
Der Positivismus
Der Positivismus, eine Denkart aus der Antike aber neu definiert von dem französischen Philosoph August Comte (1798-1857), entwickelte eine ganz pragmatische Antwort auf diese Grundsatzfragen. Das Leitmotiv ist: Man muss die Fakten und Daten respektieren, aber auch die Bedingungen kennen. Wenn wir aus Experimenten einen verlässlichen Datensatz in einem dreidimensionalen Raum bekommen haben können wir die Daten analysieren und hieraus Schlüsse ziehen, aber nur solange wir die ursprünglichen Bedingungen und Theorien des dreidimensionalen Raums respektieren. Begriffe wie Masse und Energie und alle damit zusammenhängenden Gesetze sind damit Konstrukte in diesem Raum geworden. Wenn die Gesetze in anderen Räumen besser und ökonomischer abgebildet werden können sollten die geltenden Bedingungen angepasst werden. Deshalb brauchte Einstein eine ganz andere Raum-Zeit-Definition und gelten für die Quantenmechanik wieder andere Raumparameter.
Auf diesen positivistischen Grundlagen konnten die Naturwissenschaften sich seit dem neunzehnten Jahrhundert weiter entwickeln. Metaphysische Dogmen wurden abgeschüttelt und man konzentrierte sich auf das Sammeln von prüfbaren Daten. Dennoch ist zunehmend die Frage wichtig geworden was es bedeutet, dass eine Theorie eigentlich nur eine Abbildung und Vereinfachung der Wirklichkeit ist. Um die Daten prüfen und analysieren zu können braucht man also mehrere Theorien, genauer gesagt Abbildungsmethoden, um die Wirklichkeit so breit wie möglich zu erfassen. Die ganze Wirklichkeit wird man allerdings nie erfassen können (Whitehead). Man muss jedoch absichern dass alle wichtigen Aspekte und Einflussfaktoren in einem akzeptierten Modell benannt worden sind. Die Frage ist ob man überhaupt eine Methode, die diese Voraussetzungen erfüllt, entwickeln und anwenden kann.
Bei der Durchführung von Experimenten muss man sich zwei schwierig zu beantwortende Fragen stellen: sind die Testdaten repräsentativ für das Gesamte und hat das Testverfahren an sich vielleicht schon eine verzerrende Wirkung? Ein passendes Modell soll eine Erklärung für die Messungen geben. Weil es immer eine vereinfachte Abbildung der Wirklichkeit ist gelten besondere Bedingungen für dessen Brauchbarkeit. In der Physik betrifft das Begriffe wie »das ideale Gas« oder »der absolut schwarze Körper« um komplexes Sachverhalten begreiflich zu machen. In der experimentellen Psychologie ist es ganz schwierig zuverlässige Testdaten zu sammeln, weil Testpersonen, wissend dass man an einem Test teilnimmt, manchmal ganz anders reagieren.
Wenn man auf Grund seiner Modelle eine rechnerische Abbildung (Formeln) für die gesammelten Testdaten hat, ist das ein weiteres Indiz für die Richtigkeit. Mit einer Formel kann man ebenso für künftige Messungen genaue Vorhersagen machen; wenn sie richtig sind, könnten die Theorie und das Modell tatsächlich (vorläufig) korrekt sein.
Forscher, die fest davon überzeugt sind dass es möglich ist die Wirklichkeit mit Modellen korrekt zu beschreiben, benutzen gerne das s.g. »Miracle Argument«. Kurz gesagt ist es ihnen zu folge kein Wunder dass Wahrnehmungen eine Theorie bestätigen können, denn die Theorie versucht ja die Wirklichkeit zu beschreiben. Etwas anders formuliert: »Die überraschende Tatsache C wird beobachtet; aber wenn die Theorie A wahr wäre, würde C eine Selbstverständlichkeit sein; folglich besteht Grund zu vermuten, dass A wahr ist«. Der amerikanische Mathematiker und Philosoph Charles Sanders Pierce (1839-1914) hat die Grundlage dieser pragmatischen Denkmethode entwickelt; das abduktive Argument. Eine Methode, die jedoch schnell zu Fehlschlüssen führen kann. Beispielsweise wenn man folgender Logik folgen würde. Beobachtung: Diese Körper am Himmel strahlen im sichtbaren Lichtspektrum. Regel: Alle Sterne geben sichtbares Licht ab. Hypothetische Schlussfolgerung: Diese Himmelskörper sind Sterne. Die Hypothese könnte richtig sein, aber genauso gut auch falsch wenn man bedenkt, dass es auch Planeten, Flugzeuge, Satelliten und andere leuchtende Objekte am Himmel gibt.
Der Idealismus
Der Idealismus zieht sich als roter Faden durch die Erkenntnistheorie. Seine zentrale Frage ist: »Gibt es überhaupt eine objektive Realität?« Sowohl der Empirismus als auch der Rationalismus und Positivismus beantworten diese Frage bestätigend, alle drei jedoch auf eine andere Art und Weise. Der Idealismus hat jedoch ganz andere Antworten, variierend von »nein, es gibt keine objektive Realität« bis zu »vielleicht schon, aber die Frage ist ob wir Menschen sie kennen können«. Wenn die wahre Wirklichkeit gar nicht existiere, dann gäbe es nur Bewusstseinsprozesse. Diesen Standpunkt nennt man den subjektiven Idealismus im Gegensatz zu dem objektiven Idealismus, der davon ausgeht dass es eine bewusstseinsunabhängige und erkennbare Natur gibt.
Philosophisch betrachtet kann man sich fragen, ob die Wirklichkeit überhaupt auf Erkennbarkeit ausgelegt ist und wenn das nicht der Fall wäre, was dann der Sinn der Wirklichkeit sei. Wenn die Natur und ihre Gesetze völlig beliebig sind, ist es doch keine Selbstverständlichkeit dass wir sie kennen können. Was wir wissen ist also entweder dem Zufall zu verdanken oder es ist kein wahres Wissen, sondern nur eine Frucht unserer Vorstellung. Was wir wahrnehmen, meint Immanuel Kant, braucht nicht die eigentliche Wirklichkeit zu repräsentieren sondern es ist nur die Projektion unseres Denkschemas. Die Dinge »an sich« zeigen sich nicht, weil unsere Sinnesorgane dazu nicht reichen. Das Denkschema hat Kant detailliert beschrieben und es beruht auf a priori (»angeborene«) Kenntnisse über Zeit und Raum. Nur mit diesen a priori Kenntnissen, man könnte auch unserer Voreingenommenheit sagen, sind wir imstande die wahrgenommen Dingen dem Raum und der Zeit zuzuordnen. Der deutsche Idealismus hat begonnen, eine Strömung, die immer noch viele Protagonisten kennt.
Arthur Schopenhauer vertiefte die Fragestellung des Idealismus indem er feststellte, dass die Welt meine eigene Vorstellung ist: ich erschaffe meine Wirklichkeit. Eine Idee die später als Konstruktivismus weiter entwickelt wurde. Was bedeutet das? Der Schlüssel liegt in mir selbst: Ich definiere ein Ziel, das ist mein Wille. Der Mensch hat zwei Seiten: der Körper ist wie ich mich zeige, mein Wille ist eine Äußerung meines Innenlebens (siehe auch den Körper-Geist Diskurs in Teil eins). Der Wille ist die treibende Kraft hinter meiner Erscheinung. Das gilt auch für alle anderen Dinge in der Welt, dahinter steckt der triebhafte, blinde Wille zum präsent sein: Der Wille zum Leben und Überleben. Nicht unsere Vernunft sondern dieser irrationale Trieb steuert uns. Im Fortpflanzungstrieb zeigt sich der Wille als die universelle (Über)-Lebenskraft.
Bis jetzt hört sich das alles rein philosophisch an, ohne jegliche praktische wissenschaftliche Bedeutung. Aber pass auf, diese Bedeutung gibt es schon! Wenn wir uns mit dem Allerkleinsten befassen kommt unvermeidlich die Frage auf, was die wahre Natur des Universums ist; ist sie Masse, Energie, oder doch nur »Information«? Ähnliche Fragen kommen auf wenn wir den Urknall, wenn es ihn gegeben hat, versuchen zu verstehen. Und sollten wir der Theorie der Multiverse unseren Glauben schenken? Ist doch kompletter Wahnsinn, dass quer durch unsere Wirklichkeit zahllose andere »Wirklichkeiten« existieren würden?
In diesen Grenzbereichen des Wissens begegnen uns genau diese Fragen des Idealismus. Können wir diese Fragen überhaupt beantworten? Verbirgt sich, so wie Kant meinte, die wahre Natur der Dinge tatsächlich für uns? Gibt es eigentlich nur Bewusstseinsabläufe und ist das Universum gar nicht da weil es nur eine Abbildung eines Hologramms ist? Oder, wie in dem Film »Matrix«, eine Computer-Simulation«? Noch extremer gesagt: bin ich alleine auf der Welt und ist alles was ich erlebe nur meine eigene Vorstellung und Phantasie, ein Gedanke der als Solipsismus bekannt ist?
Du denkst, das alles sind nur Fragen eines Wahnsinnigen? Dann würde ich vorschlagen rasch die nächsten Kapitel zu lesen und dir diese Frage dann erneut zu stellen.
Verweisungen und Noten aus diesem Kapitel:
1. Zitat von Karl Popper in: »Logik der Forschung«, Vorwort; 3. Auflage.
2. Siehe auch: Tim Gramms; »Denkfallen vermeiden mit System« (Springer Verlag)
3. W.V. Quine: »Two Dogmas of Empiricism« in: Martin Curd & J.A. Cover »Philosophy of Science«, S. 280.
Mathematik
Die Wandergesellschaft nimmt ihre Reise wieder auf. Sie führt uns heute durch eine offene Landschaft mit weiten Ausblicken. Wenn man lange nach oben schaut, der blaue Himmel an dem die Wolken vorbeiziehen, fühlt man sich von der Erde losgelöst. Isolde, heute unsere Reiseleiterin, sagt mit Begeisterung: »Faszinierend was sich alles hinter dem einfachen eins-plus-eins versteckt. Um diese Welt der Zahlen entdecken zu können, muss man jedoch loslassen was uns konkret umgibt«. Alle Wanderer versuchen sozusagen mit ihrem Kopf die vorbei ziehenden Wolken zu erreichen und mit einer völlig losgelösten Gesinnung weiter zu laufen. Es geht jetzt um die höheren Aspekte des Lebens: Logik und das abstrakte Denken. »Passt aber auf nicht über eine herausragende Wurzel zu straucheln. Man darf träumen, sollte allerdings die harte Wirklichkeit niemals komplett aus den Augen verlieren!« Ein weiser Ratschlag, den Isolde uns für heute mitgibt; immer festen Boden unter den Füßen behalten. »Sodass uns nicht passiere wie Thales von Milet: Da er die Dinge im Himmel sehen wollte und in einen Brunnen fiel weil er übersehen hatte was vor seinen Füßen war«.
»Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile« (1)
Nicht jeder liebt Mathematik. Natürlich ist es möglich dieses Kapitel einfach sein zu lassen und mit anderen weiter zu lesen. Wenn man jedoch verstehen möchte was die Rechenkunst in unserer Welt bedeutet, kann ich es nur empfehlen. Unsere Gesellschaft wird geprägt von Computern, mobilen Funkgeräten (s.g. »Handys«) und vielen anderen Produkten der Informationstechnologie deren Grundlagen mathematischer Natur sind. Moderne Physik, wie Atomphysik oder Astronomie, kommt schon lange nicht mehr ohne Wahrscheinlichkeitslehre aus um die Unmengen von gesammelten Daten zu analysieren. Die Quantenmechanik kann überhaupt nicht verstanden werden ohne dass man die passenden Rechentechniken einigermaßen durchschaut. Jeder hat schon von den Relativitätstheorien von Albert Einstein gehört. Sich eine Vorstellung davon zu machen, wie sie Einfluss auf Zeit und Räumlichkeit nehmen, kann man (leider) nur wenn man sich mit den Prinzipien der zugrundeliegenden Rechenkunst vertraut macht. Unseren Sinnen und Intuition kann man, wenn man sich mit moderner Physik beschäftigt, nicht mehr vertrauen, man sollte sich daran gewöhnen »mathematisch« zu denken.
Neurowissenschaftler, wie Sian Leah Beilock, haben entdeckt wie eine Abkehr von Mathematik in unserem Gehirn funktioniert: Die Hirnfunktion für Mathematik sind bei Mathe-fernen Menschen eng mit denen für das Scherzempfinden verknüpft! Aber es gibt Hoffnung! Beilock hat auch Methoden gefunden wie diese Verbindung zu überwinden ist und es richtig Spaß machen kann. Einfach locker bleiben, nicht überkonzentrieren und Menschen in deiner Umgebung finden um gemeinsam etwas »Mathematisches« zu unternehmen.
Mathematisch denken, das heißt, im Allgemeinen versuchen so logisch wie möglich zu denken. Sich nicht von unwichtigen Details ablenken lassen, sondern das eigentliche Problem so einfach wie möglich zu definieren versuchen. Wie einfach die richtige Lösung sich dann anbietet wird klar, wenn man folgendes Beispiel liest.
Während des zweiten Weltkriegs mussten die Amerikaner schwere Verluste an ihrer Flotte von Bomberflugzeugen hinnehmen. Man entschied sich dafür zusätzliche Panzerplatten anzubauen. Dabei musste man sparsam vorgehen: zu viele Platten anbauen hatte den Nachteil, dass die Flugzeuge mehr Treibstoff verbrauchen und zudem weniger wendig würden. Zu wenig Platten würde den Schutz jedoch unzureichend verbessern. Deshalb untersuchte man genau die zurück gekehrten Flugzeuge auf Kugellöcher. Dort wo die meisten Löcher gefunden wurden, sollten also die Platten angebaut werden. Der Mathematiker Abraham Wald bestritt diese Sichtweise. Er fand es logischer die Platten gerade auf andere Stellen anzubauen, denn die Flugzeuge konnten die untersuchten Einschusslöcher ja ertragen, sonst wären sie ja nicht zurückgekehrt! Das nenne ich Logik.
Dass Männer in Mathe durchschnittlich besser sind als Frauen, hat hauptsächlich mit Kultur und Erziehung zu tun (2); unbewusst lassen sich Mädchen zu einer vorbestimmten Rolle verführen, wo für Mathe kaum Platz ist. Damit verpassen viele Frauen nicht nur interessante Einsichten wie unsere Welt funktioniert, sie verringern auch ihre Chance einen Nobelpreis zu gewinnen. Bis heute ist es eher eine Ausnahme dass eine Frau diesen begehrten Preis bekommt. Möglicherweise ist dieses Kapitel ein schöner Anfang Neues zu entdecken.
Wie mit Mathematik vollkommen neue Anwendungen ermöglicht werden, zeigt das Beispiel der Origami, die Kunst des Papierfaltens. Jeder hat schon mal ein Papierflugzeug aus einem quadratischem Blatt Papier gefaltet. In China und Japan wurden schon vor tausenden Jahren zwei- und dreidimensionale Figuren gefertigt, alles sehr traditionell. Seit 1960 findet eine Revolution statt: man baute neue Modelle, wonach neue Figuren entstehen konnten. Der Physiker Robert Lang hat Computerprogramme entwickelt womit sogar komplexe Tierfiguren möglich werden. Er meint dass » die Verbindung zwischen Kunst und Wissenschaft durch die Mathematik hergestellt wird«, denn das erste, das man bei den Origami-Figuren durchschauen muss, sind die Geometrie und die zugrunde liegenden rechnerischen Gesetze. Na ja könnte man sagen, Papierfalten könnte als Freizeitbeschäftigung schön sein, praktischen Nutzen wird es wohl nicht haben. Doch! Moderne Medikamente werden beispielsweise immer komplizierter, besonders wenn mehrere Moleküle unterschiedlicher Stoffe ineinander gefaltet werden müssen.
Ich meine, dass Mathematikkenntnisse auch im tagtäglichen Leben eine große Hilfe sind um die Tatsachen zu durchschauen und die Hintergründe besser zu verstehen. Und plötzlich öffnen sich manchmal ganz neue Perspektiven! Das hört sich vielleicht ein bisschen theoretisch an, es kann auch ganz einfach sein. Ein Beispiel dafür kommt aus Königsberg. Wie so viele Städte liegt auch diese an einem Fluss, am Pregel in diesem Fall. Mitten in dem Fluss liegen zwei Inseln. Man hat insgesamt sieben Brücken gebaut um die beiden Stadthälften und die zwei Inseln miteinander zu verbinden. In der nachfolgenden Skizze (3) ist die Lage schematisch dargestellt.
Jemand fragte sich mal: Gibt es einen Weg, alle sieben Brücken bloß einmal zu überqueren? Der Schweizer Mathematiker Leonhard Euler bewies dass das nicht möglich ist, weil es eine ungerade Zahl von Brücke gibt um die vier Ufergebiete miteinander zu verbinden. Später entwickelte sich aus dieser Problemstellung die Graphentheorie, die z.B. ihre Anwendung darin findet, mit operations research- Methoden eine optimale Route zu berechnen (bekannt als das Handelsreisender-Problem). Etwas, das als spielerische Aufgabe angefangen hat, führte hunderte Jahre später zu einem neuen Wissenschaftsbereich! Spiele und Rätsel wie diese kann man in großen Mengen in Zeitschriften und im Internet finden (4).
Sogar den Menschen selbst kann man als eine riesige Rechenmaschine bezeichnen. Stell dir vor du lebst in der Prähistorie, irgendwo in Afrika. Wie gewöhnlich bist du hungrig, auf der Suche nach etwas Essbarem. Plötzlich siehst du einen Baum, vollbeladen mit saftigen Früchten. Schade, ein Fluss trennt dich von diesem Baum. Was sollst du tun? Versuchen ans andere Ufer zu kommen, obwohl du nie richtig schwimmen gelernt hast oder den Baum sein lassen und deine Suche irgendwo anders fortsetzen? Dein Gehirn funktioniert jetzt wie eine riesige Rechenmaschine die mehrere Gefühle und Eindrücke zu kalkulieren versucht um eine Entscheidung zu treffen. Gewissheiten und Unsicherheiten werden bewertet und miteinander verglichen. Wie tief ist der Fluss? Wie schnell strömt das Wasser? Sind die Früchte tatsächlich essbar? Liegen da vielleicht Raubtiere auf der Lauer? Wie schnell muss ich etwas zum Essen bekommen um zu überleben? All diese Fragen werden bewertet und führen zu einer Entscheidung: ja ich wage es oder, nein ich ziehe weiter. Vielleicht führt es auch vorerst zu einem Zweifelsfall: ja vielleicht, oder vielleicht doch nicht? Natürlich spielen deine Erfahrungen und dein Charakter auch eine große Rolle; Waghalsige würden es schneller als Ängstliche versuchen die Früchte zu verputzen. Zu waghalsig Veranlagte werden sterben, zu ängstliche ebenso. Zusammengefügt ist deine Lage eine mathematische Gleichung mit mehreren Unbekannten, dein Gehirn meistert dennoch die Aufgabe und steuert dein Verhalten. Menschen mit einem Gehirn, das die richtige Rechenmethode hat, werden überleben, andere sterben aus. Die rechnerischen Fähigkeiten in unserem Gehirn waren also ausschlaggebend für die Frage wie wir geworden sind was wir jetzt sind. Und das alles ohne dass wir uns bewusst damit zu beschäftigen haben, denn die Berechnungen werden in unserem Unterbewusstsein durchgeführt.
Nicht allein während unserer Entwicklungsgeschichte, auch heutzutage spielt die Mathematik eine entscheidende Rolle; viele Wissenschaftler sind schon längst davon überzeugt, dass es ohne sie kaum noch neue Entdeckungen geben kann. Physik, Ingenieurswissen, Informationstechnologie, Wirtschaftslehre, Psychologie und Astronomie sind bloß einige Beispiele von Fachgebieten in denen sie eine wichtige, unentbehrliche Hilfswissenschaft ist. Eine Hilfe die sich immer mehr wegen komplexer werdenden Theorien in den Vordergrund drängt. Es wäre falsch anzunehmen dass die Mathematik nur eine Hilfe anderer Bereiche ist.
Seit dem zwanzigsten Jahrhundert haben die Entwicklungen in diesem Fachgebiet sich vornehmlich fokussiert auf das Zustandekommen einer eindeutigen und widerspruchfreien Sprache, ohne eine direkte Verbindung mit der Wirklichkeit. Die Frage welche Geometrie die wahre Beschreibung der Welt gibt ist nicht mehr relevant: Es können mehrere Geometrien gleichwertig nebeneinander bestehen unter der Bedingung dass jede für sich eindeutig und ohne Widersprüche ist. Die Mathematik ist eine formalistische Wissenschaft geworden, fundiert auf einem Satz unabhängiger Axiome. Für unsere Zwecke versuche ich jedoch immer wieder die, manchmal erstaunliche, Verbindung (oder muss ich Abhängigkeit sagen?) zwischen Natur und Mathematik ans Tageslicht zu bringen, dort befindet sich auch die Physik.
In diesem Kapitel werde ich versuchen mit möglichst wenigen Formeln auszukommen, denn das schreckt viele Leser ab und mir geht es eher um die logischen Gedanken hinter den Formeln. Außerdem ist ja allgemein bekannt, dass Algebraische Symbole vor allem dann benutzt werden, wenn man nicht mehr weiß worüber man redet. Im ernst, es geht mir um das Verständnis wie Wirklichkeit und Formeln miteinander zusammenhängen, nicht um mathematische Fähigkeiten und Subtilitäten.
Was ist eigentlich Mathematik?
Viele Leute finden sie eine abstrakte und schwierige Angelegenheit, wofür besondere Talente notwendig sind. So ungefähr wie sie ein super-Nerd angeblich hat. Topmathematiker wie Shinichi Mochizuki, Gregorij Perelman, oder die Legende Alexander Grothendieck bestätigen diese Meinung, weil sie sich durch ihr auffälliges soziales Verhalten unterscheiden. Mochizuki bringt Kollegen in der ganzen Welt durch seinen mehrere hundert seitigen Beweis der s.g. abc-Vermutung (5) in Aufregung. Seit 2012 bemühen sich Kollegen weltweit seine Arbeit zu durchblicken, was bisher noch nicht gelungen ist. Sogar wenn der Japaner seine Arbeit persönlich erläutert haben seine Zuhörer große Mühe, ihr eigenes Denkmuster abzuschalten um ihn überhaupt verstehen zu können. Gregorij Perelman, der die jahrhundertealte Poincaré Vermutung bewiesen hat, lebt, nachdem er die Fieldmedaille (6) abgelehnt hat, zurückgezogen in Sankt Petersburg. Der in Berlin geborene Grothendieck führte auch ein Leben in Extremen. Wahrscheinlich hatte er große psychische Probleme, wodurch er manchmal extrem radikal auf seine Umgebung reagierte und seine letzten Jahre einsam in einem französischen Dorf in der Nähe der Pyrenäen verbrachte.
Der legendäre englische Mathematiker Paul Dirac (1902-1984), über dessen Arbeit wir noch sprechen werden, war als menschenscheu bekannt und nahm kaum am gesellschaftlichen Leben teil. In einem Gespräch beschränkte er sich auf Nicken oder Kopfschütteln und ausnahmsweise auf ein paar karge Worte. Sowohl seine gehemmte Art zu kommunizieren als auch alles wortwörtlich zu nehmen wurden legendär. Erst am Ende seines Lebens, in einer Unterhaltung mit einem Freund, erzählte Dirac über seine schwierige Jugendzeit und es wurde manchem klar warum seine Persönlichkeit sich so entwickelt hat. »Ich erfuhr nie Liebe oder Zuneigung« erklärte er seinem Freund. Sein Vater Charles war ein wahrer Tyrann und zwang ihn, Französisch mit ihm zu sprechen. Jedes Mal wenn der kleine Paul einen Fehler beging, wurde sein nächster Wunsch nicht erfüllt (7). Während dem Abendessen, das er gemeinsam mit seinem Vater einnahm, durfte er, entgegen seinem Wunsch, den Tisch nicht verlassen obwohl er schreckliche Magenschmerzen, eine Folge seiner chronischen Krankheit (8), hatte. Dirac erklärte seinem Freund gelernt zu haben, dass es für ihn besser war zu schweigen als das Risiko einzugehen linguistische Fehler zu begehen.
Auch unter Kollegen hatte Dirac einen besonderen Ruf bezüglich seiner Persönlichkeit. Rutherford erzählte Niels Bohr mal folgende Geschichte.
Ein Kunde betrat einen Laden für Haustiere um einen Papagei zu kaufen. Er konnte wählen aus drei Exemplaren: ein rotes Tier das 10 unterschiedliche Wörter sprechen konnte, Kaufpreis 500 Euro, ein buntes Tier das 100 Wörter beherrschte das 5000 Euro kosten würde und dort in der Ecke ein blasses Tier das nur zwei Wörter sprechen konnte. Der Kunde fragte wieviel dieses Tier denn kostet (vielleicht ist es ja ein Schnäppchen) und bekam als Antwort: 10.000 Euro. Total überrascht wollte der Kunde wissen warum das denn, es sieht ja abscheulich aus und kann kaum sprechen. Der Tierhändler lächelte bloß und sagte: »Dieses Tier hier, das kann aber denken«!
Paul Dirac war ein klassisches Beispiel eines Denkers der »Top-down« arbeitete; von oben nach unten also. Er begann damit Konzepte zu überdenken und zu perfektionieren; erst wenn er neue Einsichten dazu gewann, versuchte er die dazu passenden praktischen Beispiele zu finden. Als er 1939 seine Vorgehensweise in einer Lesung »Über die Beziehung zwischen Mathematik und Physik« an der Universität Edinburghs verdeutlichte, ging Dirac noch einen Schritt weiter und forderte zudem noch eine mathematische Schönheit (9). Denn nur wenn eine neue Formel ästhetisch zu bewundern sei, könnte sie stimmen (10). Theoretische Physiker seien gut beraten, meinte er, wenn sie vor allem auf die ästhetischen Qualitäten ihrer Formeln achten würden, selbst dann wenn sie anscheinend den Beobachtungen widersprechen. Sogar seinem Freund, dem Atomphysiker Werner Heisenberg, war diese Aussage zu dreist und fand man könnte besser den experimentellen Befunden über die Natur folgen. Dirac jedoch bewies die Qualitäten seiner Vorgehensweise indem es ihm gelang, teilweise die Quantenmechanik mit der Relativitätstheorie zu verbinden und er seine berühmte Formel zur Beschreibung des Verhaltens des Elektrons präsentieren konnte. Ein klarer Sieg der Befürworter der Ästhetik.
Über den Mathematiker Henri Poincaré lässt sich noch eine besondere Geschichte erzählen. Sie verschafft uns einen Einblick, wie die Fachwelt sich aufregen kann. Es betrifft das Dreikörperproblem. Dieses beschäftigt sich mit dem Verhalten dreier Körper, die sich gegenseitig mit ihrer Gravitation beeinflussen. Oder etwas besser formuliert: wie eine Anzahl von n