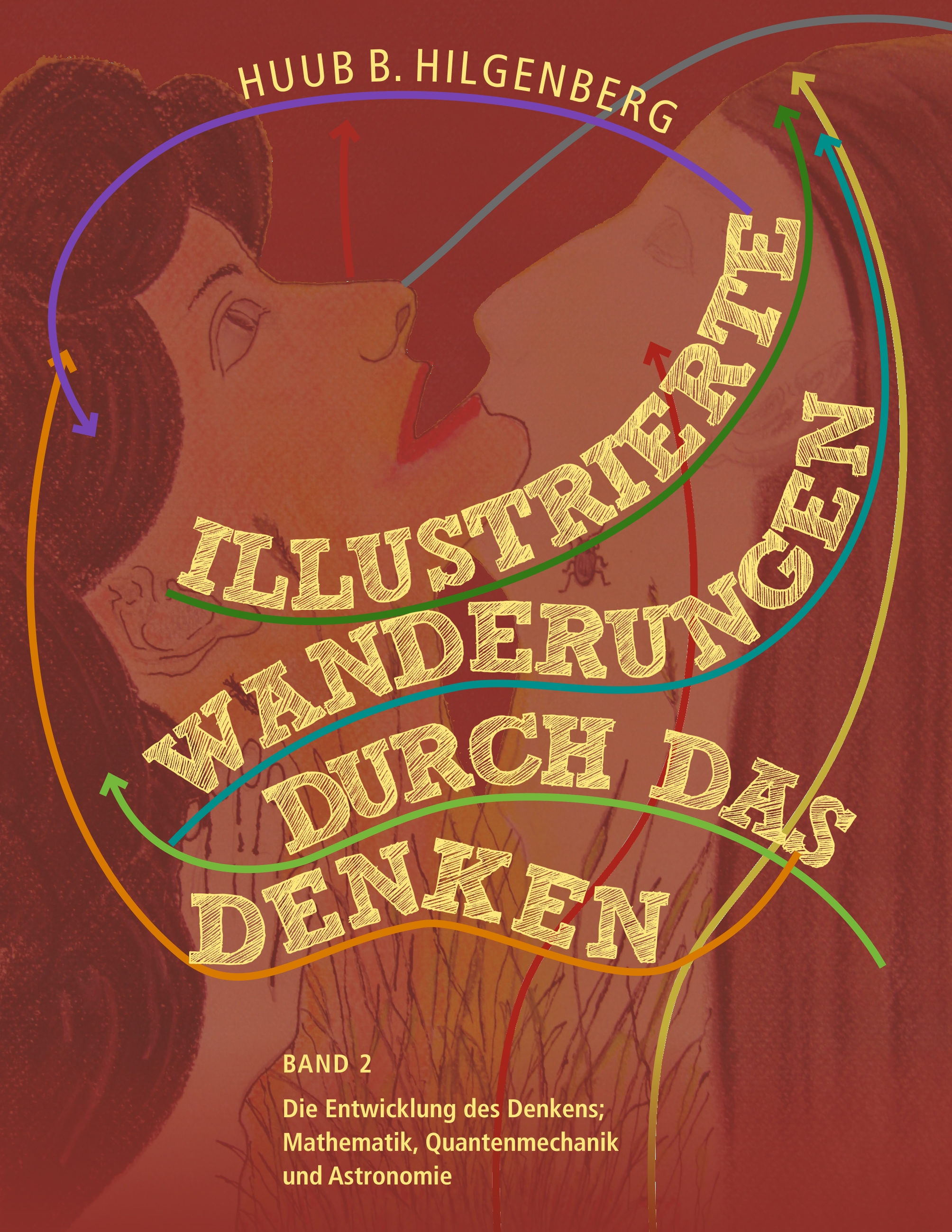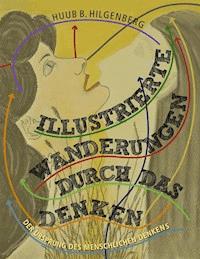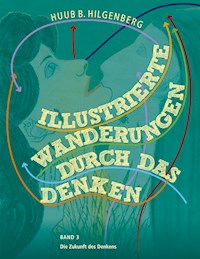
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Illustrierte Wanderungen durch das Denken
- Sprache: Deutsch
Band Drei: die Zukunft des Denkens. Eine Erkundung, wie das Denken sich weiter entwickeln könnte. Untersucht werden die Merkmale, Besonderheiten und Beschränkungen des menschlichen Denkens. Die Künstliche Intelligenz öffnet neue Perspektiven, umfasst jedoch auch gewisse Risiken. Bis heute hat unser Denken uns große Vorteile beschert, trotzdem ist die Lage bedrohlich. Umwelt und Gesellschaft brauchen dringend einen Kurswechsel, neue technische Erfindungen bringen nicht nur Vorteile, sondern erhöhen ebenfalls das Risiko. Die Herausforderungen wachsen und wir bekommen immer weniger Zeit, die richtige Antworten zu formulieren. Haben wir noch eine Zukunft?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 757
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Das Ziel
Was heißt Denken?
Die Kunst des Denkens
Der Mensch: Denken und Dasein
Wo das Denken uns den falschen Weg zeigt
Weshalb wir die Intuition mehr als je brauchen
Heideggers Blick auf das Denken
Ein neuer Blick auf das Bewusstsein
Das Bewusstsein, ein philosophisches Minenfeld
Unser Bewusstsein, das soziale Sinnesorgan?
Die Bildung unserer Werte
Können Gedanken unabhängig von einem Hirn bestehen?
Zwei häufige Denkmuster
Das Impfproblem
Das »Jean-Jacques Rousseau Gefühl«
Können wir wissen was wir nicht wissen können?
Künstliche Intelligenz
Unser Hirn im Vergleich mit Künstlicher Intelligenz
.
KI und wir: ein harmonisches Miteinander?
Wo die Daten herkommen und was sie mit uns machen
Unsere Zukunft mit KI
KI-Technologie und die wirtschaftlichen Folgen
Ist es ein Mensch oder ein KI System?
Daten als Machtinstrument
Unser Intellekt ist ein Parasit
Der Transhumanismus
Ethische Aspekte der KI
Ist KI eine Bedrohung?
Mensch gut, Roboter böse?
Datenmissbrauch
Die Qualität der KI Systeme
Einfluss der KI auf unser Denken
Die Sprache der Homo Digitalis
Das Denken im digitalen Zeitalter
Freiheit im digitalen Zeitalter
Die Errungenschaften und Risiken des Denkens
Krise, welche Krise?
Denken über Krisen
Die zweifelhafte Lage unseres Biotops
The Global Village
Die Umwelt- und Klimakatastrophen
Scheint da Licht am Ende des Tunnels?
Innovation als Ausweg
Werte und Kultur
Die Abwertung der Werte
Die Prinzipien der Werte
Soziale Werte
Wirtschaft und Staat
Die Autoritätskrise in der Wissenschaft
.
»Mann beißt Hund«
Das Gleichheitsprinzip
Die Vertrauensfrage
Unsere Demokratie ist in großer Gefahr
Ökonomisierung und die neoliberale Krise
Der Staat als Wirtschaftsmacht
»Big State« oder »new State«?
Denken und Wissen
Der Übermensch
Das neue Denken
Empfehlungen zum Weiterlesen
Personen- und Sachregister
Übersicht der Abbildungen:
Umschlag: Die Geschwister (die Wissenschaft und die Philosophie)
Seite →: Das Fragezeichen
Seite →: die Gedanken-Welt
Seite →: Die Bühne
Seite →: Besser langsam als schnell
Seite →: Zukunftsvisionen?
Seite →: Der Abschied
Seite →: Der »vergrünte« Mensch
Das Ziel
Quo vadis«? Wohin geht die Reise? Ist die Reise des menschlichen Denkens mit dem Floß von Médusa zu vergleichen: Ein Schiffbruch der am Ende fast allen vierhundert Schiffbrüchigen das Leben nahm?
Als letzte Hoffnung hat der Kapitän des unglücklichen Schiffs entschieden aus Wrackteilen seiner Fregatte ein Floß zusammenzubasteln, um die West-Afrikanische Küste zu erreichen. Nachdem man zehn Tage steuerungsunfähig herumgetrieben war, kam es sogar zum Kannibalismus. Nur zehn Prozent der Besatzungsmitglieder überlebten das Abenteuer (1). Wenn ich heutzutage einige düstere Vorhersagen bezüglich des Klimawandels lese und mir eine überhitzte Erde, Waldbrände, ein Mangel an Lebensmittel und Trinkwasser vorstelle, kommen mir das Floß und seine Besatzung wieder in Erinnerung. Eine ausgewogene und gut begründete Prognose ist gegenwärtig jedoch kaum zu finden, wenn die Medien mit Alarmismus um unsere Aufmerksamkeit kämpfen.
Sind wir am Ende hoffnungslos dem Laufe der Naturgesetze ausgeliefert? Dank unserer Technik konnten wir über Jahre hinweg das biologische Gesetz, besagend, dass jeder Spezies nur bis zu einer gewissen Grenze wachsen kann, außer Wirkung stellen. Doch dieses Aufschieben kann nicht endlos weitergehen, davon ist jeder mittlerweile überzeugt. Weniger überzeugend ist jedoch die Tatsache, dass wir schon an unsere Grenze gestoßen sind oder uns sogar weit darüber hinaus bewegen. Die Liste der Bedrohungen ist lang, ohne dass wir einen Konsens ihrer Lösung erzielen könnten. Überbevölkerung, Umwelt- und Klimakatastrophe, Massensterben der Arten, oder das Auseinanderdriften der Gesellschaft, keine von diesen potenziellen Katastrophen konnte bis jetzt eine allgemeine Verhaltensänderung bewirken. Der Unterschied zwischen einem Vogel-Strauß und einem Mensch ist doch nicht so groß wie es sich anatomisch gesprochen erahnen lässt.
Welches Szenarium sich in absehbarer Zeit bewahrheiten wird, kann keiner sagen, dass wir zum Überleben einlenken müssen ist jedoch sicher. Alle Gründe sich über unsere Aussichten, und die Art und Weise wie wir damitumgehen, Gedanken zu machen. Unser Intellekt hat uns weit gebracht, die Herausforderung jetzt auch längerfristig überleben zu können ist momentan größer denn je. Ein erster Schritt ist es, sich fit zu machen die Zukunft zu überdenken. Denn die Lage ist nicht hoffnungslos, wir haben die Intelligenz und die Mittel uns zu wehren. Eine Bedingung ist es jedoch sich den herausfordernden Bedrohungen zu stellen.
Der Publizist Michael Bukowski (@mbukowski auf Twitter) aus Berlin hat 2012 mal geschrieben: «75% der Leute leben heute gedanklich im 19. Jhd. 20% im 20. Jhd. und der Rest jetzt.”. Was sollen wir dann mit einem Buch über das Denken in der Zukunft anfangen? Weil ich meine dass uns gegenwärtig eine gewünschte Vision der Zukunft fehlt. Es ist nicht mehr selbstverständlich dass es, trotz Fortschritten in Wissenschaft und Technik, künftig immer nur besser gehen wird. Dafür müssen wir arbeiten und Fehler vermeiden.
Ohne Visionen hat unser Leben kein Ziel, ohne Ideale würde jegliche Anstrengung umsonst sein. Man muss träumen dürfen über eine einträchtige Weltgemeinschaft, eine erfolgreiche Bekämpfung von Krankheiten, eine Zeit ohne Krieg, eine Rettung der Umwelt, ausreichende Ernährung ohne Tierleiden, und so weiter und so fort.
Über alles träume ich von einer Zukunft der Freiheit. Eine wahrlich freie Gesellschaft wo jeder sich entfalten kann, man frei sprechen darf und wir alle unsere Talente zum Ausdruck bringen können.
Wenn man die politischen Parteien in Deutschland nach ihren Visionen fragt hört man entweder eine große Stille oder eine dürre Vorlesung aus ihren heutigen Programmen. Die s.g. Realpolitik ist dermaßen dominant, dass mancher Politiker sich dafür schämt eine Vision zu haben. Zugegeben, die gegenwärtigen Probleme sind groß und kompliziert. Wenn man sie vernachlässigen würde, kann es für eine Zukunftsbewältigung zu spät sein. Aber trotzdem an der Macht bleiben. Und wer kann schon mit bloß einer Vision einen Wahlkampf gewinnen?
Ohne Kompass kann man dennoch keine Politik betreiben, das politische Handeln sinkt zu einem Zickzack-Kurs herab. Auf Sicht fahren ist, langfristig betrachtet, keine zielgerechte Politik und schafft kein Vertrauen.
Wenn es um die Zukunft geht müssen wir fast immer bestimmte Hemmungen überwinden denn Zukunft steht für Unsicherheit und viele hassen das. Wenn wir mehr sein wollen als ein Floß das von der Strömung aufgenommen wurde, müssen wir unsere Lage und Wünsche genau überdenken.
Das ist sehr anstrengend und voller Risiken; die beiden wichtigsten Hemmungen die Zukunft gestalten zu wollen. Es ist ja so angenehm und bequem alles zu lassen so wie es jetzt ist. Man kann ja die gegenwärtigen Probleme auf zwei Arten beseitigen: Entweder man probiert eine neue Methode oder Denkweise aus (und versucht die Probleme mit viel Mühe zu lösen), oder man kehrt einfach wieder nach früher zurück, als ohnehin alles besser war. Es wird schon klar sein was die meisten sich wünschen.
Es ist nicht meine Absicht eine Auflistung neuester Lösungen und Techniken zu erstellen. Mir geht es um die Frage welchen Einfluss die Zukunft und deren Neuerungen auf unser Denken ausübt. Dieses Ziel hat zwei Aspekte: wie können wir uns unsere Aussichten denken und zweitens welches Denken brauchen wir zukünftig?
Das Denken von morgen hat natürlich seine Wurzeln in der Vergangenheit und Gegenwart. Der bekannte Unterschied zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist in erster Linie ein Unterschied des biologischen Menschen; der Tag von gestern und die von heute und morgen sind klar definierte Begriffe und mitbestimmend für unser Gespür für Zeit und Fortschritt. Wo genau das künftige Denken anfängt und das schon bekannte aufhört, kann nicht immer klar gemacht werden. Die jahrhundertealten Gedanken Platons spielen noch immer in der Gegenwärtigkeit eine große Rolle und das wird künftig auch so bleiben. Sie sind ein Beispiel für Grundsteine worauf man zuverlässig seine eigenen Visionen entwickeln kann. Ideen entziehen sich dem Zwang der fortschreitenden Zeit: Die von gestern können auch morgen noch modern sein. Die Geschichte des Denkens hat deshalb ganz andere Merkmale als die Geschichte der Evolution: Tierarten entstehen und sterben wieder aus, Ideen entstehen und bleiben im Prinzip für immer.
Manchmal vergleicht man das Entstehen von Ideen mit dem Öffnen der Büchse von Pandora, was einmal entwischt ist, kriegt man nie wieder rein. Aber nicht alle Ideen sind übel, das Problem ist nur, dass man sie nicht nur kurzfristig beurteilen darf. Als Karl Marx seinen Weg zum Arbeiterparadies beschrieb, konnte er nicht ahnen wie Diktatoren, um ihre Macht zu festigen, seine Vorstellungen missbrauchen werden. Die Bildsprache Hegels ist m.E. eine bessere Alternative um die Weltgeschichte des Denkens darzustellen: Die Entfaltung des Weltgeistes auf seinem Weg zum ewigen Frieden, durch die Entfesselung der Vernunft abgesichert.
Welche Metapher man für geeignet hält, hängt auch davon ab wie man selbst in die Zukunft blickt; mit Optimismus oder Pessimismus. Für beide Optionen ist etwas zu sagen: Wenn man die schon sichtbaren Entwicklungen einfach weiter denkt, zeichnet sich manche große Katastrophe ab. Wenn man aber in Fortschritt und menschlicher Vernunft Vertrauen hat, geht man davon aus dass gerade rechtzeitig eine neue Politik gemacht wird um die dystopischen Prophezeiungen abzuwehren. In den letzten Jahrhunderten haben wir große Fortschritte gemacht: Die weltweite Lebenserwartung ist drastisch angestiegen, hat sich z.B. seit 1900 weltweit von durchschnittlich 31 auf 71 Jahre erhöht, Analphabetismus und Unterernährung sind ausgesprochen stark reduziert (2). Das sind schon einige Gründe optimistisch für die Zukunft zu sein.
Fakt ist jedenfalls, dass dem Mensch immer kräftigere Mittel zur Verfügung stehen. Wissenschaft und Technologie setzen Kräfte frei, die sowohl eine Rettung als auch eine Verelendung bedeuten können. Diese Kräfte werden nicht nur stärker, sondern auch immer schwieriger zu durchblicken und beherrschen. Klar wird das in der Kriegsführung. Jahrhundertelang hat man sich auf Kriegsfeldern auseinander gesetzt. Derjenige mit der meisten Tapferkeit, mit dem besten Waffengerüst, den schlauesten Ideen und mit Frau Fortuna an seiner Seite konnte sich durchsetzen. Mit dem Einsatz von Massenvernichtungswaffen werden derartige persönliche Qualifikationen unwichtig und sind die Folgen deren Einsatz für die Akteure nicht direkt erkennbar. Wenn man sich die Bilder einer ferngesteuerten Kampfdrohne anschaut, wird ganz klar, dass die Grenze zwischen Spiel und Wirklichkeit immer mehr verschwimmt. Krieg, das organisierte Töten seiner Mitmenschen, wird in den letzten Jahren immer weniger als ein Verbrechen dargestellt sondern als eine Notwendigkeit, deren verursachtes Leiden verkraftbar gemacht werden soll. Ich meine, dass diese Virtualisierung eine große Bedrohung darstellt: Ursache und Wirkung werden voneinander getrennt, ein Naturgesetz wird außer Wirkung gesetzt.
Diese Trennung von Ursachen und Wirkungen ist auch im tagtäglichen Leben wahrzunehmen. Moderne Informationstechnologie, VR genannt (virtual reality), versetzt uns in die Lage fremde Welten und Orte zu »besuchen« ohne dorthin reisen zu müssen. Was wir erleben und denken wird nicht länger von unserer vertrauten Umgebung bestimmt. Die Denkanstöße können uns leicht überfallen und sich unserem Einfluss entziehen. Irgendein Informatiker kann unsere Umwelt manipulieren und dadurch unsere Prioritätenliste durcheinanderbringen. Wozu das führen könnte ist eines der Themen, die wir uns vornehmen werden.
Die Wandergruppe, schon seit zwei Bänden unterwegs, führt uns ständig weiter. Nachdem der Ursprung und die Weiterentwicklung des Denkens erkundigt wurden ist jetzt die Zukunft das Hauptthema. Ein schwierig zu fassender Begriff. Wir fangen mal an bei der Frage welches Denken, welches Wissen und welche jetzt schon bekannte Technologie großen Einfluss auf unser künftiges Leben haben werden.
Da gibt es viele Kandidaten, zu viele um alle zu besprechen: Nanotechnologie, neue medizinische Heilungsverfahren, Raumfahrt oder Energietechnik um nur die bekanntesten zu nennen. Ich habe mich für Computertechnologie und die daraus entstandene künstliche Intelligenz (abgekürzt als K.I. (kurz KI) oder auf Englisch A.I. artificial intelligence) entschieden, ich glaube dass derer Einfluss umfangreich und umwälzend sein wird und jetzt schon wahrnehmbar ist. Außerdem gibt es eine enge Verbindung mit meinem Hauptthema: das Denken.
Das künstliche Denken ist schon seit längerer Zeit aktuell. Wenn man die Welt der KI betritt, wird man überfallen von neuen Begriffen und futuristischen Anwendungen; es entsteht eine neue Welt die man nur schwer verstehen kann. Sich eine Phantasie über die weitere Zukunft ausdenken kann jeder, etwas ersinnen das einigermaßen realistisch sein könnte ist schon etwas anderes. Das bedeutet für mein Thema: Die Fakten über das Denken neu präsentieren und versuchen eine Verbindung mit anderen Wissenschaftsbereichen und der Philosophie zu bauen.
Dieses Buch umfasst zwei Teile: im ersten wird das heutige Denken analysiert, sowohl biologischer als auch künstlicher Art. Eine zentrale Frage ist welchen Einfluss KI auf unser Denken ausübt. Teil zwei beleuchtet die Folgen unseres Denkens. In welcher Welt leben wir? Wie haben wir unsere Gesellschaft und Wirtschaft organisiert? Sind wir unseren weltweiten Aufgaben gewachsen oder jetzt schon in einer Endphase unserer Zivilisierung angelangt? Zum Schluss wage ich es einen Vorausblick des Denkens zu formulieren um die Frage zu beantwortet welches Denken man braucht um sich den kommenden Herausforderungen zu stellen.
Hat das Schauen auf künftige Perspektiven einen Sinn? Ist es vorhersagen oder einfach spekulieren? Man kann die Zukunft nicht vorher kennen, aber sich darüber Gedanken zu machen könnte uns einige Ausgangspunkte liefern wie wir uns zielführend verhalten können. Einer davon ist m.E. dass wir sowohl unsere Grenze als auch unsere Verantwortlichkeiten richtig einschätzen sollten. Wir können z.B. den ganzen Planet Erde nicht ganz kontrollieren aber schon total vernichten. Das sollte schon eine Warnung sein.
Unsere Wandergemeinschaft nähert sich in diesem Band ihrem Ziel. Die abenteuerliche Reise war ab und zu eine wahre Probe für Leib und Seele. Aber wohin man auch verreist, die besuchten Orte sind bloß ein kleiner Ausschnitt des Ganzen.
Bemerkungen zum Haupttext
Dieses Buch ist Band drei der Trilogie »Illustrierte Wanderungen durch das Denken«. Nachdem in Band eins der Ursprung des Denken und in Band zwei das gegenwärtige Denken die leitenden Themen waren, ist in diesem Band die Zukunft des Denkens unser Leitfaden. Man kann alle Teile ohne besondere philosophische Vorkenntnisse oder Kenntnis der anderen Teile lesen, so wie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft drei voneinander getrennte Begriffe sind, obwohl Kenntnis der Zusammenhänge zu einem besseren Verständnis führen wird.
In allen drei Teilen habe ich der Einfältigkeit und Übersichtlichkeit halber meistens die maskuline Grundform von Wörtern wie Philosoph, Forscher oder Wissenschaftler benutzt. Ich benutze im Allgemeinen das generische Maskulin als eine geschlechtsneutrale Ausdrucksweise weil ich in meinen Texten keinen Unterschied, weder in Geschlecht noch in Religion oder Hautfarbe machen möchte. Ich benutze natürlich ebenfalls ein generisches Feminin, besonders wenn eine deutliche Mehrheit der angedeuteten Gruppe weiblichen Geschlechts ist. Einen emanzipatorischen Kampf über die Sprache möchte ich mitunter nicht führen.
Fußnoten sind durch (xx) gekennzeichnet und verweisen auf eine Übersicht am Ende jedes Kapitels. Die wichtigsten Stichwörter und ein Personenregister aller drei Bänder sind in diesem Band enthalten.
Dieses Buch wäre ohne die Mitwirkung vieler Personen nicht zustande gekommen. Besonderer Dank geht an Eckhard Froese und die weiteren Mitglieder der philosophischen Runde in Hirtscheid. Jeder Autor braucht kritische Mitdenker um ein akzeptables Ergebnis zu erzielen.
Huub B. Hilgenberg,
Hirtscheid (WW), 2022
Was heißt Denken?
Bevor man etwas über die Entwicklung des Denkens in der Moderne sagen kann, sollte man versuchen das Denken überhaupt zu deuten. Was macht das wahre und fruchtbare Denken aus und ist es eine einzigartige Kunst? Versuchen das Denken zu verstehen ist keine leichte Aufgabe weil wir selbst das denkende Wesen sind: Wir sind zu nah dran. Trotzdem ist es wichtig ein betreffendes Verständnis zu entwickeln; eine Sinngebung unserer Existenz kann nur gelingen wenn wir ein zuverlässiges Selbstbild haben.
Biologisch und evolutionär betrachtet sind wir einzigartig, seit der Entwicklung der Künstlichen Intelligenz hat der Mensch jedoch eine ernstzunehmende Konkurrenz bekommen. Mancher meint dass die Roboter uns bald überflügeln werden und wir als Sklave der von uns geschaffenen Maschinen verenden werden. Diese gefürchtete Singularität könnte laut vielen schon bald eintreten. Ich werde dagegen argumentieren dass der Mensch immer einzigartig bleiben wird und es deshalb eine dauerhafte Herrschaft der KI Systeme nicht geben kann. Wir sind aber gut beraten die technischen Entwicklungen in der Hand zu halten um unerwünschte Nebenwirkungen vorzubeugen.
Besser wäre es die Fortschritte der KI zu benutzen um unsere eigenen Unzulänglichkeiten des Körpers und des Geistes zu kompensieren. Vergiss nicht dass wir eine Last von Millionen Jahren Evolutionsgeschichte mit uns tragen. Diese Geschichte lehrt uns dass wir das Ergebnis von Zufall sind. Was immer unsere evolutionären Wege als Bedrohung kreuzte musste kurzfristig besiegt werden. Für eine weitsichtige Entwicklung gab es keine Möglichkeit weil die Evolution bekanntlich blind ist, mit der Folge dass Körper und Geist mit suboptimalen Merkmalen behaftet sind.
Uns selbst und das von uns Geschaffene verstehen zu wollen, bedeutet unsere Intelligenz zu erkunden. Ich werde zuerst versuchen die aktuellen Entdeckungen der Psychologie und Neurowissenschaften mit den betreffenden philosophischen Fragen des menschlichen Gehirns zu verbinden. Mit einem zweiten Schritt werden Systeme mit künstlicher Intelligenz auf Übereinstimmungen und Differenzen untersucht. Die gemachten Fortschritte der letzten Jahre sind beeindruckend und liefern völlig neue Perspektiven für die Zukunft. Ein Vergleich zwischen Mensch und Maschine macht es möglich sowohl uns selbst besser kennenzulernen als auch die technologischen Entwicklungen zu beherrschen. Wir suchen andauernd nach etwas womit wir uns selbst identifizieren können; KI Maschinen sind ein Spiegel zur Selbstkenntnis. Hier passen die Worte des Philosophen Stanley Cavell (1926-2018): »Nichts ist menschlicher als der Wunsch kein Mensch zu sein«.
Mein Anliegen ist es Phantasien von Fakten zu trennen, denn nur mit fundierten Meinungen kann man Wissenschaft und Technologie lenken. Eine überdachte Vision der Zukunft des Denkens ist dafür unverzichtbar.
Die Kunst des Denkens
Die Wandergemeinschaft hat schon eine lange Strecke durch Wissenschaft und Philosophie hinter sich. Man konnte sich mit viel neuem Wissen über Evolution, das Funktionieren des Gehirns, die Bedeutung einer Gesellschaft, über Mathematik, Quantenmechanik und Astronomie anvertrauen. Eine breite Palette an Themen, die irgendwie alle miteinander verknüpft sind. Die biologische Evolution des Menschen und seines Gehirns, die gesellschaftlichen Strukturen, die Denkleistungen in den Bereichen Mathematik, Quantenmechanik und Astronomie; das erregte sowohl Verwunderung als auch Aufregung: Gibt es eine gemeinsame Quelle die alle weiteren Entwicklungen beeinflusst? Wir müssen uns erstmal etwas Ruhe zum Nachdenken gönnen und untersuchen was das Denken eigentlich bildet, denn bei weitem sind nicht alle Fragen beantwortet worden.
Praktizieren wir überhaupt ein einheitliches Denken und wie kommen wir zu haltbaren Theorien? Wenn eine neue Theorie eine konkrete Problemlösung darstellt die von Fachleuten akzeptiert wird, dann hat die Forschung einen (vorläufigen) Schritt vorwärts gemacht. Daran geht eine Zeit rationaler Kritik vorab. Dieser Prozess von Konsensbildung kann nur in offenen Gemeinschaften, wo Kritik ausgeübt werden darf, stattfinden. Wissenschaft ist also kein Spiel mit Sicherheiten sondern man muss verschiedene Meinungen aushalten können. Wichtige aber vielseitige Themen wie Gesundheit, Ernährung oder Umweltschutz bleiben deshalb ohne endgültige Antworten, nur Teilfragen können manchmal beantwortet werden. Ein Umstand der nur wenige zufriedenstellen wird, womit wir jedoch alle leben müssen. Das bedeutet nicht dass wir nicht handeln müssen. Jeder kann schon Schritte machen gesunder zu leben und die Umwelt, wenn nicht zu verbessern, dann doch mindestens zu schonen.
Leben ist denken und denken ist lernen. Von Geburt an denken wir schon und wollen unser Wissens- und Fähigkeitsspektrum ständig erweitern. Denn nichts ist ärgerlicher als immer wieder dieselben Fehler wiederholen zu müssen (3). Mancher meint dass das Gehirn sogar schon vor der Geburt beschränkt funktionsfähig war. Seitdem hört es, bewusst oder unbewusst, bis zum unvermeidlichen Hirntot nicht mehr auf. Die kognitive Psychologie befasst sich mit der Frage wie wir Wahrnehmungen und abgespeicherte Erfahrungen interpretieren und verarbeiten; Kognition kann man als die Informationsverarbeitung des Menschen betrachten.
Unsere Tätigkeiten zwischen den Ohren umfassen zwei völlig unterschiedlichen Denkarten: das rationelle, diskursive Denken und das gefühlsmäßige oder die Intuition. Neurologisch gesagt: der Neocortex, wo Fakten rational erfasst und analysiert werden, und das viel ältere limbische System, das sich mit unseren Gefühlen beschäftigt. Zwei Denksysteme die unterschiedlicher kaum sein könnten. Die Ratio liefert, wenn einwandfrei zur Anwendung gekommen, verständliche Ergebnisse die allen rational denkenden Mitmenschen klar gemacht werden können. Die natürliche Witterung dagegen zeigt sich nur der Person selbst und lässt sich schwer kommunizieren. Andere überzeugen, nur auf Grund eigener Eingebungen, ist ein schwieriges Anliegen. Unsere Entscheidungen werden von beiden Denksystemen beeinflusst: Wenn etwas sich nicht gut »anfühlt« tun wir es oft nicht obwohl alle Fakten auf andere hinweisen.
Viele Entdeckungen haben mit einem Gespür angefangen. Forschung betreiben ist nicht die dürre, zähe, nur auf Fakten basierte Arbeit wofür viele sie halten, sondern es bedarf ebenfalls Kreativität und Intuition. Kunst und Wissenschaft liegen manchmal ganz nah neben einander! Ich will nicht behaupten dass unser Bauchgefühl uns immer neue Wege öffnet, dafür sind sie zu vielseitig und können uns zu leicht in die Irre führen. Das Bauchgefühl allein ist kein zuverlässiger Kompass wenn wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen.
Ich werde mich in diesem Kapitel der Aufgabe stellen das menschliche Denken weiter zu erörtern und werde untersuchen welche Komponenten und Einflussfaktoren es gibt und wie sie aufeinander einwirken. Denn es kommt am Ende darauf an welche Schlussfolgerungen wir für unser Handeln erreichen können.
Die kausale Kette »Wahrnehmen, interpretieren, denken, eine Meinung bilden, handeln und die Umgebung ändern« ist kein geradliniges Verfahren sondern kennt mehrere »loops« (Zurückmeldungen). Wie die Umgebung (die Welt) und das Denken einander beeinflussen, ist ein Thema wofür ich gerne den Gedanken des Philosophen Martin Heidegger als Vertreter des Phänomenalismus nachgehen möchte.
Klar ist, dass Offenheit und Freiheit für das produktive Denken wichtige Voraussetzungen sind. Das zeigt sich in Kulturen der ganzen Welt: Wenn Handel und die damit verbundenen Kontakte mit fremden Völkern gefördert werden, nimmt nicht nur der Wohlstand sondern auch das kreative Denken und das Wissen zu. Eine offene und respektvolle Streitkultur sorgt weiterhin für eine kritische Haltung; eine Voraussetzung für wahres, überprüfbares Wissen. Das ist der Grund weshalb in diesem Buch übers Denken auch die gesellschaftliche und kulturelle Umwelt besprochen werden muss.
Es ist ein Denkfehler zu meinen dass Wissensfortschritte hauptsächlich der Begabung einzelner Personen zu verdanken sind. Sie kann zwar eine wichtige Rolle spielen, die Kultur und die politische Gestaltung der Gesellschaften sind für einen Erfolg jedoch ausschlaggebend. Fortschritte entstehen wenn eine Kultur die neuen Ideen ausreichend fördert. Der Funken eines kreativen Freidenkers muss sich entfalten können um das geteilte Denken weiter zu bringen. Bevor es jedoch so weit ist findet ein offener Diskurs statt um die neue Sichtweisen zu prüfen indem man die Argumente pro und contra austauscht. Fortschritt entsteht also aus Uneinigkeit und respektvollem Misstrauen. Konsens kann nur erreicht werden wenn diese Phase erfolgreich abgeschlossen ist. Und auch dann noch ist alle Kenntnis nur vorläufig, nämlich bis eine bessere an die Oberfläche kommt.
Das Entstehen der Demokratie im antiken Griechenland förderte beispielsweise nicht nur die persönliche Freiheit, auch Wissenschaft und Philosophie erlebten eine Blütezeit. Ein starker Hinweis dafür dass die Evolution des Denkens während der letzten Tausenden Jahre auch kulturell und nicht bloß genetisch geprägt wurde (4). Gesellschaftliche Sensibilität für Freiheit, Verschiedenheit, Respekt und Offenheit ist die beste Garantie für fruchtbares Denken. Ich meine, wir sind auch im einundzwanzigsten Jahrhundert noch zu diesen Werten, die sich statt auf Konkurrenz und Egoismus auf Zusammenarbeit gründen, unterwegs.
Unser Hirn hat die einzigartige Möglichkeit andere Menschen zu verstehen und schreibt ihnen mentale Fähigkeiten zu. Wir begreifen auch dass unsere Artgenossen andere Ziele und Überzeugungen haben können. Wir sollten diese Fähigkeiten nutzen und unsere soziale Vernunft weiter entwickeln.
Die tiefere Kunst des Denkens betrifft nicht uns selbst sondern die Gesellschaft.
Der Mensch: Denken und Dasein
Der Mensch ist im Grunde nichts mehr als ein weiterentwickelter Affe; ein Ergebnis der biologischen Evolution. Eine offene Tür an der wir zu oft vorbeigehen. Denn es wäre gut sich immer wieder daran zu erinnern dass wir von unserem Körper geprägt sind. Über Millionen von Jahren haben wir uns entwickelt von Primaten bis zum »homo sapiens sapiens«; eine Art die denken kann und das auch von sich weiß. Wie die Fähigkeit denken zu können auch in dem Kampf ums Überleben eine wichtige Rolle gespielt hat, wird klar wenn man die Entstehungsgeschichte des Menschen in Band eins nachliest. Warum diese Fähigkeit entstanden ist, darüber wird gestritten. Eine der Fragen ist ob der Mensch zuerst seine Denkfähigkeiten entwickelte und danach neue Lebensräume betreten hat oder umgekehrt.
Meiner Meinung nach entsteht das Denken unumgänglich wenn das Gehirn in seiner Entwicklung eine bestimmte Komplexität erreicht hat (5). Wie ein Stein, der, einmal über den Gipfel gebracht, unaufhaltsam an Geschwindigkeit zunimmt. Auch Tiere haben eine gewisse Denkfähigkeit, manche Art sogar ein Selbstbewusstsein. Bei dem Mensch aber ist diese Entwicklung sogar so weit fortgeschritten dass sich einzigartige Fähigkeiten, wie eine komplexe Sprache und das Vermögen Naturwissenschaften oder Mathematik zu betreiben, entwickelt haben. Eine außerordentliche Entwicklung in der Evolution, vielleicht sogar einzigartig im Universum. Ich meine deshalb dass nicht nur der Körper, sondern auch das Mentale evolutionäre Gründe hat. Die Herausforderungen womit eine Spezies sich konfrontiert sieht, lenken nicht nur ihre körperlichen sondern auch ihre mentalen Fähigkeiten.
Unser Gehirn ist, meist unbewusst, ständig mit unserem Körper beschäftigt. Wen interessiert es jedoch anhaltend die momentane Lage im Kreislauf oder der Verdauung zu erfahren? Nur wenn sich Probleme zeigen möchten wir’s wissen und dann auch noch öfter widerwillig. Dadurch entgeht uns leider auch wie unser Körper Einfluss nimmt, oder schon genommen hat, auf die Art und Weise wie wir denken. Der Körper sendet kontinuierlich elektrische und chemische Signale aus und beeinflusst unser Gemüt (6). Der Mensch hat nicht nur einen Körper, er ist auch ein Körper. Wir haben sogar einen Tastsinn der sich ausschließlich mit dem Körper beschäftigt; die Tiefensensibilität oder das kinästhetische Sinnesorgan.
In dem Kapitel über künstliche Intelligenz wird die komplexe Wechselwirkung zwischen Leib und Seele noch mal angesprochen. Klar ist auf jedem Fall, dass wir die Rolle unseres Körpers niemals unterschätzen dürfen. Jeder weiß, dass wenn der Körper stirbt, der Geist nicht mehr mit dem Körper verbunden ist und jegliche biologische Gehirnaktivität endet. Ob der Geist überhaupt weiter existent sein kann ist eine Glaubensfrage. Wissenschaftlich kommt man da nicht viel weiter; der ganzheitliche Mensch ist, wenn er hirntot ist, unwiderruflich gestorben.
Das Denken unterscheidet unsere Spezies von allen anderen. Es hat uns bessere Überlebenschancen gebracht aber auch ein kaum zu lösender Konflikt mit unserem Körper. Schon Platon hat dies erkannt. In seiner Lehre von der Hierarchie der seienden Dinge wurde dem Körper (veränderlich und vergänglich) ein niedrigerer Platz eingeräumt als dem Geist, der eine Brücke mit der höheren, unveränderlichen Ideenwelt ist. Hieraus stammt der Gedanke dass der Körper eine Art Gefängnis des Geistes bildet.
Eine weitere Herausforderung im Denken ist die Gesellschaft. Ein Zusammenleben mit Artgenossen öffnet neue Möglichkeiten, engt aber auch unsere Freiheit ein. Der daraus entstandene Stress kann wieder abgebaut werden wenn wir akzeptieren dass unsere Mitmenschen selbständig denkende Personen mit manchmal abweichenden Ideen sind. Das vernünftige Zusammenleben und die Moral können sich nur in Gemeinsamkeit entfalten. Die Folge ist dass wir Verantwortung tragen und Rechenschaft ablegen müssen. Diese Zwiespältigkeit hat der Philosoph Jean Jacques Rousseau in seinem pädagogischen Roman »Emile« aus dem Jahr 1762 treffend dargestellt.
Um die Schnittpunkte des Denkens besser zu verstehen, möchte ich zuerst unsere Denkoptionen näher untersuchen. Wie bilden wir uns eine Meinung und was ist eine Meinung wert?
Wo das Denken uns den falschen Weg zeigt
Der Mensch hat mindestens zwei Denksysteme die sich zeigen als Ratio und Intuition. Außer diesen beiden könnte man sogar den Körper ebenfalls als Denksystem interpretieren. Unser Streben Schmerzen, Hunger und unangenehme Kälte oder Hitze zu vermeiden, sogar unsere Liebe für die Nachkommen, sie alle haben einen rein biologischen Ursprung. Besonders das Herz- Kreislaufsystem und die Verdauung sind mit zahlreichen Nervenzellen ausgestattet und pflegen eine enge Beziehung mit dem Gehirn. Das limbische System, der ältere Teil des Gehirns, ist ebenfalls eng mit dem Körper verbunden. Es reguliert unsere Gefühle und Emotionen, bewertet unsere Erinnerungen und hat damit eine zentrale Rolle für das Entstehen unserer Intuition.
Das rationelle oder diskursive Denken findet in zwei Hirnhälften statt; die linke und rechte Hemisphäre. Die linke ist mit der rechten Hälfte des Körpers verknüpft und die linke mit der anderen Hälfte. Auch die Denkaufgaben sind verschieden. Links werden Fakten verarbeitet und sind Sprache und Logik angesiedelt; in den rechten Arealen findet man Kreativität, Zeit- und Orientierungssinn und das konzeptuelle Denken. Unsere Fähigkeit Körpersprache zu verstehen haben wir ebenso der rechten Hemisphäre zu verdanken.
Wie wichtig unser Körper für unser Denken ist, zeigt sich an folgenden Beispielen. Wenn mehrere Menschen zusammenkommen hält jeder einen gewissen Sicherheitsabstand von ungefähr anderthalb Metern frei. Wenn jemand ungezwungen und ungebeten diesen »Freiraum« ignoriert, wird er als Eindringling betrachtet und wir fühlen uns unangenehm, wenn nicht bedroht.
In einem Publikum haben wir die Neigung uns selbst als Mittelpunkt zu betrachten und vergessen dass alle anderen das auch so machen. Wenn wir uns ungewollt nicht richtig benehmen oder uns etwas merkwürdig angezogen haben, denken wir dass alle Anwesenden das sofort bemerken und sich darüber lustig machen. Das ist natürlich nicht tatsächlich der Fall, aber versuche mal die betreffende Person davon zu überzeugen.
Alles was wir nicht direkt mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen können, betrachten wir als weniger wichtig. Das zeigt sich in mehreren Situationen. Bedrohungen die noch nicht direkt da sind, sondern sehr ernsthafte Formen annehmen können, werden gerne ignoriert. »Momentan läuft alles hervorragend, warum soll ich mir Sorgen machen? Ich bewege mich zwar zu wenig, rauche zu viel und schleppe einige Kilos zu viel mit mir herum, aber ich fühle mich 100% Okay«. Mit Vorhersagen über Klimawandel, Artensterben und derartigem geht es ähnlich: Sie kommen nicht an weil CO2 nicht sichtbar ist und die ausgestorbenen Arten ohnehin nicht mehr wahrnehmbar sind.
Die Tatsache dass wir einen Körper haben nimmt also einen großen Einfluss auf die Art und Weise wie wir denken. Zusammengefasst: Wir sind ein Körper wo zufälligerweise auch ein Geist inne wohnt.
Die Intuition, der menschliche Instinkt, basiert auf Erfahrungen, die häufig viele Generationen zurückliegen. Über 250.000 Jahre hat der Homo Sapiens Erfahrungen gemacht welches Verhalten am meisten erfolgreich ist. Uralte Abläufe, die sich ständig wiederholten, haben wir genetisch im Unbewussten abgespeichert um uns im Überlebenskampf zu helfen. Angst ist immer noch eine wichtige Intuition in unserem tagtäglichen Leben. Das war in prähistorischen Zeiten wichtig, denn man hatte bessere Überlebenschancen wenn man eher vorsichtig als risikofreudig war. Unsere Abscheu vor Schlangen, Insekten und verfaulten Waren ist auch darauf zurückzuführen weil sie alle eine potenzielle Gefahr darstellen. Sogar Fremde wurden immer mit Argwohn und Misstrauen begegnet weil in der Prähistorie Begegnungen übel ausgehen konnten. Erst der friedliche Austausch von Waren machte klar, dass sie auch Vorteile bringen können.
Glücklicherweise kommt es gegenwärtig auf völlig andere Qualitäten an. Wir kämpfen nicht mehr jeden Tag miteinander sondern versuchen gemeinsam kurz- und langfristige Bedrohungen zu meistern. Unser teils animalisches Erbe wirkt ab und zu mehr gegen als für uns, ist jedoch für bestimmte Aufgaben unverzichtbar. Ein schönes Beispiel wie unsere Intuition uns aus voller Überzeugung eine falsche Antwort liefert ist das s.g. Ziegenproblem.
Stell dir vor du nimmst an einem Fernsehshow teil und bekommst die letzte, allesentscheidende Frage. Es gibt drei Türen, wovon du nur eine öffnen darfst. Hinter nur einer Tür steckt der Hauptgewinn des Spiels: ein nagelneues Auto. Die anderen zwei Türen verbergen die Trostpreise: eine Ziege. Der Moderator weiß wo das Auto sich befindet, du selbstverständlich nicht. Du wählst dir eine Tür aus. Der Moderator öffnet eine andere Tür, wovon er weiß, dass sich dahinter eine Ziege befindet. Er fragt dich ob du deine Auswahl ändern möchtest oder lieber daran festhältst. Was ist klug; ist es von Vorteil deine Entscheidung zu widerrufen? Viele würden intuitiv meinen; ist egal es hat sich ja nichts geändert wo das Auto sich befindet. Weil noch zwei Türen geschlossen sind hättest du doch eine Chance von 50% das Auto zu erwerben. Das ist aberfalsch! In Wirklichkeit gewinnen 6 aus neun Kandidaten wenn sie wechseln (Gewinnchance 2/3) und nur 3 aus neun (Gewinnchance 1/3) wenn sie bei ihrer ursprünglichen Wahl bleiben. Dieses Beispiel ist dermaßen kontraintuitiv dass sogar erfahrene Mathematiker eine falsche Antwort geben (7).
Blind unserer Intuition folgen führt nicht zum Erfolg. Gut dass sich im Laufe der Evolution ein zweites Denksystem entwickelt hat; das diskursive Denken welches auf der Logik basiert und physiologisch einer Schwerpunkt in den präfrontalen Cortex hat. Wenn wir meinen mit der Logik wieder einen festen Boden unter den Füßen zu bekommen, irren wir uns, denn gerade in diesem Bereich machen wir leicht Fehler wie das nächste Beispiel zeigt.
Das Ehepaar Müller feiert seinen fünfundzwanzigsten Hochzeitstag. Frau Müller erzählt stolz in ihrem ganzen Leben nur dreimal gelogen zu haben. Alle bewundern ihre Ehrlichkeit bis Herr Müller auf trockener Weise sagt dass sie jetzt viermal gelogen hat. Jeder schmunzelt vor sich hin. Kann Herr Müller überhaupt Recht haben? Nein, das istunmöglich. Wenn seine Frau tatsächlich nur dreimal gelogen hat, spricht sie jetzt die Wahrheit. Wenn sie weniger oft oder öfter gelogen hat ist die Behauptung des Ehemannes ebenfalls falsch.
Beide Denksysteme können unabhängig voneinander ihre Arbeit erledigen und kommen deshalb öfter zu unterschiedlichen Empfehlungen. An uns die schwierige Aufgabe »das Richtige« zu tun. Deshalb ist es gut etwas mehr über die Stärken und Schwächen unserer Intuition zu wissen und welche Dilemmas sie produzieren (8). In den nachfolgenden Beispielen wird jeder etwas von seinem eigenen Verhalten wiedererkennen, denn unserem Gespür folgen wir gerne, weil es einfach ist und wenig Anstrengung fordert.
Die »Hedonistische Tretmühle«; immer wieder dasselbe genießen zu wollen. Der Altgrieche Epikur (341-270 v.Chr.) hat sich einen Namen aufgebaut als es um das Genießen ging. Die Lüste befriedigen ist eine überaus angenehme Erfahrung und das kann nicht lange genug dauern. Keine Philosophie wurde aber mehr missverstanden als der Epikureismus. Viele denken das genießen so etwas wie feiern bedeutet: das Gute des Daseins einfach genießen, leben in Saus und Braus und politische Streitigkeiten belächeln; der zügellose Hedonismus also. Das Streben nach Glück und Lust ist eben das einzig Gemeinsame aller Menschen: wer weist schon sein Glück ab? Der Unterschied verbirgt sich jedoch hinter der Frage wie man das Lebensglück finden kann. Die Lust kann nicht der Weg sein weil sie leicht zu Wollust führt und man immer mehr Impulse braucht um ein gewisses Ergebnis zu erzielen. Epikur predigte ein Leben in Verborgen- und Bescheidenheit. Unser Ziel soll es sein die Welt zu verstehen und sich von infundierter Furcht zu befreien. Der römische Dichter und Philosoph Lukrez (erstes Jhd. v.Chr.) hat die epikureische Philosophie in seinem »De rerum natura« (Über die Natur der Dinge) zusammengefasst. Ein Werk das vieles dazu beigetragen hat Epikur wiederzubeleben. Die wichtigste Lektion, die er uns übermittelte hat, ist dass das Glück nicht mit Lust und kurzfristigem körperlichen Genuss herbeigeführt werden kann, denn so wird man ein Sklave seiner Sinne. Wahres Glück liegt in der Entdeckungsreise nach der Wahrheit. Eine Erklärung der Natur ist ein effektives Mittel für die Seelenruhe und die Akzeptanz des Unvermeidbaren. In anderen Worten gefasst, zeichnet sich hier ein nie herablassender Kampf zwischen Körper (sinnliche Lüste; die hedonistische Tretmühle) und Geist (Verständnis und Gelassenheit) ab.
Der innere Schweinehund.
Energiesparen ist uns genetisch eingeprägt worden. Ein Streben das wir gerne befolgen, was ist angenehmer als in aller Ruhe gedankenlos auf dem Rücken in der Sonne zu liegen? Unser Gehirn macht es schon vor wie man Energie sparen kann: Das Denken ist anstrengend und soll auf das Notwendigste beschränkt werden. Eine naheliegende Lösung ist deshalb immer zu bevorzugen. Die intuitiven und auf Routinen basierten Denksysteme werden als erste eingeschaltet, erst wenn offensichtliche Fehler passieren ist man bereit weiter zu denken (9). Der Rest des Körpers macht da gerne mit. Muskelzellen zum Beispiel kosten relativ viel Energie, auch wenn sie ruhen. Wenn diese Zellen über längere Zeit nicht mehr beansprucht werden, werden sie abgebaut. Topathleten haben ausgeklügelte Trainingsprogramme um diesem Phänomen entgegenzuwirken und kontinuierlich in Form zu bleiben. Dieses Sparen kommt uns jedoch auch mal zum Nutzen: Wenn wir eine komplizierte Aufgabe zu lösen bekommen betrifft eine der ersten Gedanken die Frage ob es vielleicht auch einfacher ginge. Oder man aktiviert seine kreativen Fähigkeiten um etwas Neues auszuprobieren und manchmal bringt es die Kenntnisse und Fähigkeiten tatsächlich voran. Fortschritt ist teilweise aus Faulheit geboren! Schlaue Verkäufer nutzen unsere Faulheit aus indem sie offensichtlich ein besseres aber auch teureres Angebot präsentieren. Viele Zeitschriften kann man sowohl digital als auf Papier kaufen. Ein Jahresabonnement kann digital z.B. 89,= € kosten; eines mit Ausgaben auf Papier 135,= € und wenn man beides haben möchte 155,= €. Viele Interessenten wählen das letzte Angebot, weil es offensichtlich relativ günstig ist, obwohl ein günstigeres, rein digitales Abonnement schon reichen könnte.
Harte Arbeit lohnt sich.
Ständige Faulheit weisen wir ab: man soll sich anstrengen um etwas Gutes zu erreichen. Dieses Arbeitsethos hat sich fest in unser Wertesystem verankert. Viele denken deshalb dass Menschen die etwas im Leben erreicht haben hart dafür geschuftet haben, sogar die betreffenden Personen denken das. Untersuchungen weisen jedoch etwas ganz anderes aus. Viele vermögende Personen haben ihre Reichtümer einfach vererbt bekommen oder haben Glück gehabt indem sie zum richtigen Zeitpunkt mit den passenden Qualifikationen an der richtigen Stelle waren. Der Psychologe Ernest Dichter (ein Pionier der Marktpsychologie) wusste dies in den fünfziger Jahren schon auszunutzen. Sein Auftraggeber verkaufte eine Packung Mehl für die Zubereitung von Cake. Alles war schon drin: einfach mit Wasser vermischen und fertig. Dichter schlug vor die Rezeptur zu ändern indem man den Verbraucher selbst frische Eier hinzufügen lässt. Das Endergebnis blieb qualitativ gleich, trotzdem verkaufte es sich viel besser weil die Kunden glaubten, mit mehr Anstrengung ein besseres Produkt hergestellt zu haben. Ob diese Geschichte zu 100 % auf Fakten beruht ist nicht sicher, klar ist jedoch dass das Glauben an harte Arbeit ein starker Antrieb für Fortschritte ist. Ob diese Arbeit sich tatsächlich lohnt, steht auf einem anderen Blatt.
Loyalität gegenüber Freiheit.
Würdest du deinen Bruder anzeigen wenn dir klar wird dass er ein schweres Verbrechen begangen hat? Mancher würde diese Frage verneinen, die Loyalität innerhalb einer Familie geht über den Wunsch Gerechtigkeit zu bewirken. Eine familiäre Beziehung bildet eine sehr starke Loyalität: Das was die Familie denkt und tut hält man im Allgemeinen für richtig. Diese Neigung geht viele Generationen zurück bis in die Zeit wo man sich andauernd gemeinsam gegen Angriffe anderer schützen musste. Wem kann man besser vertrauen als den Mitgliedern der eigenen Familie? Gegenwärtig wird Loyalität immer noch als sozialer Wert geschätzt. Statt Familie kommen jetzt gleichermaßen Vereine, Arbeitsgemeinschaften, Religionsangehörigkeit, politische Parteien oder Nationalität in Betracht. Teilweise gibt man seine Freiheit auf um als vollständiges Mitglied gelten zu können; eine Neigung die bis ins Irrationale gehen kann. Die gefährliche Seite ist dass sich ein Gruppendenken entwickeln kann, womit man sich eigentlich nicht mehr vereinigen will. Dieses Verhalten als Mittläufer (in der Soziologie als »Bandwagon-effect« bekannt) findet seine Gründe in der Erwartung Sicherheit oder andere persönliche Vorteile zu erlangen. Manchmal geht dieses Verhalten so weit dass man sich nur in sozial erwünschten Meinungen äußert. Ähnliches, aber abgeschwächtes Verhalten zeigen viele Endverbraucher wenn ein neues Produkt plötzlich sehr beliebt wird (»Das muss ich haben«). Man will mit dem Ankauf die Zugehörigkeit zeigen.
Sozialpsychologen wie Dan M. Kahan versuchen zu verstehen welche treibenden Kräfte zu solchem Gruppenverhalten führen. Man vermutet dass entweder die Moral der Gruppe ähnlich denkende Menschen anzieht, sie werden sozusagen angesteckt, oder dass die Moral unter den Menschen schon vorhanden ist und gleichgesinnte Menschen sich einfach zusammenschließen. Die Krawalle in Hamburg anlässlich der G-20 Gipfel 2017 sind ein Beispiel eines Zusammenschließens von Menschen mit schon vorhandenen, gleichen Überzeugungen. Die spontane Bürgerbewegung in Frankreich Ende 2018, bekannt als »Les gilets jaunes« (die Gelbwesten), ist ein Beispiel dafür wie immer mehr Menschen überzeugt wurden und sich danach der Moral dieser Gruppe (Straßenblockaden) unterordneten. Die treibende Urkraft ist stets das Bedürfnis an Loyalität, das zeigt sich in unterschiedlichsten Formen und ist manchmal sehr irrational. Politiker mit populistischen Vorlieben wissen das rücksichtslos auszunutzen. Der Mensch liebt seine Freiheit, ist dennoch bereit sie freiwillig weitgehend für Bestätigung und Sicherheit zu opfern.
Langfristiges versus kurzfristiges Denken.
Jedes Jahr passiert dasselbe Ritual: die guten Vorsätze am Jahresanfang. Meistens betrifft es Ziele die nicht einfach zu realisieren sind, sonst wären sie ja längst erreicht. Nein, man muss sich richtig Mühe geben oder sich über längere Zeit etwas Beliebtem entsagen. Nicht selten werden lange Wunschlisten erstellt, leider nur bleibt es dabei. Denn nichts ist schwieriger als einen Vorsatz umzusetzen. Das kommt weil wir meistens eine große Menge kurzfristiger Ziele zu erfüllen haben und die sind alle für sich fast immer wichtiger. Wir finden es ganz schwierig die richtigen Prioritäten zu wählen. Das kommt weil zwei Eigenschaften durcheinander laufen: die Wichtigkeit einerseits und die Zeithorizont (eilig oder nicht) andererseits. Es gibt also vier Sorten: Unwichtige Wunsche die manchmal auch eilig sind, und wichtige die auch in eilig und nichteilig zu unterteilen sind. Jetzt kommt es darauf an die richtige Reihenfolge einzuhalten. Meistens bedeutet es dass wir die eiligen und zugleich alle wichtigen Aufgaben als erstes erledigen wollen. Das mündet in einen unübersichtlichen Haufen Arbeit, den man meistens nicht mehr in den Griff bekommt. Die Aufgabe dein Büro mal aufzuräumen kann eilig werden ist dennoch nicht so wichtig und bleibt dadurch ein frommer Wunsch. Zum Arzt gehen um die Ursache für das Schmerzen des Schultergelenks zu finden kann langfristig wichtig sein, hat aber keine Eile weil es ja schon so lange der Fall ist. Nur mit rationalem Denken (und Disziplin) können wir unsere unsortierte Intuition um alles (am liebsten gleichzeitig) anpacken zu wollen überwinden um damit ein sicheres Chaos zu vermeiden.
Mit Unsicherheit und Risiken umgehen.
Mit dem Zufall haben wir uns niemals so richtig anfreunden können. Man sagt schon: »Die Unsicherheit ist der Feind einer gesunden Wirtschaft«, sie könnte jedoch auch der größte Feind des Menschen sein. Wenn der Höhlenmensch in seine Unterkunft zurückkehrte hätte ihn gut ein Löwe erwarten können. Aber auch eben nicht. Glücklicherweise war meistens die letzte Möglichkeit der Fall, aber der Mensch lernte daraus immer vorsichtig zu sein, denn man kann ja nie wissen. Vorsicht ist ein festes Teil unseres Verhaltens geworden. Wir lieben deshalb die uns so vertraute Umgebung und unsere Rituale. Veränderung heißt ein Risiko eingehen und warum sollte man so etwas zwangslos tun?
Eine oft bevorzugte Haltung ist das Leugnen des Zufalls: Wenn es nicht existiert brauchen wir uns darüber auch keine Gedanken zu machen und ist alles planbar und vorhersehbar. Ein irrealer Gedanke denn der Zufall übt sicherlich einen großen Einfluss auf unser Leben aus. Eine unheimliche Idee, denn das würde bedeuten dass wir nicht das selbstdenkende, autonome Wesen sind für das wir uns gerne halten, sondern eher ein Spielball des Schicksals. Wir verschwenden mit Begeisterung viel Zeit um Pläne zu erstellen und Ziele abzustecken. Sieht alles sehr durchdacht aus, ist aber oft bloß ein Mittel um die Angst vor Risiken zu verstecken. Diese Furcht zeigt sich ganz unterschiedlich: Einige haben die Neigung immer weiter neue Informationen zu suchen und Pläne zu machen um am Ende nichts zu unternehmen. Andere gehen sogar soweit gefährliche und negative Informationen zu leugnen. Ein ausgeglichenes Verhalten mit Unsicherheit ist schwierig zu erreichen, wir neigen oft dazu die sichere Seite zu wählen mit verpassten Chancen und suboptimalen Ergebnissen zur Folge.
Übertriebenes Selbstvertrauen
Psychologisch heißt es der Dunning-Kruger-Effekt: inkompetente Menschen die ihr Wissen und Können maßlos überschätzen. Wir sind alle irgendwie inkompetent, möchten das aber niemals zugeben. Bei den Pharmazeuten ist der Placebo-Effekt wohlbekannt: Wenn du fest an ein gewisses Ergebnis (eine Genesung) glaubst, dann findet es dir zufolge auch statt. Es zeigt die Kraft unserer Überzeugung und Selbstvertrauen. Wir denken nicht gerne an alles das schief gehen kann. Aus demselben Grund überbewerten wir Innovationen. Mit einer zielgerichteten Werbung macht man uns leicht zu Kunden, die gerne ihr Geld »für das beste und neueste« ausgeben. Wenn wir fremden Personen begegnen teilen wir sie leichtsinnig in Stereotypen ein, statt uns mal in ihren wahren Persönlichkeiten zu vertiefen. Das Denken in Stereotypen ist übrigens eine Denkweise die uns gut gefällt: ein Mangel an zuverlässigen Informationen kann leicht umgangen werden indem wir bewiesene Standardprofile einsetzen. Ob sie der Wirklichkeit entsprechen bleibt eine offene Frage. Eine gesunde Dosis Optimismus ist völlig in Ordnung und bringt den Fortschritt voran, aber es gibt auch »Risiken und Nebenwirkungen«. In Forschung und Technik kann es Anlass für ernsthafte Fehler sein: Nämlich dann wenn unsere Erwartungen unsere Wahrnehmungen beeinflussen. Ein gefürchtetes Phänomen das sich regelmäßig zeigt. Besonders wenn Forscher dermaßen von der Richtigkeit ihrer Theorie überzeugt sind, können ihre Wahrnehmungen unbewusst in die Richtung der erhofften Ergebnisse korrigiert werden. So wie Goethe es sagt: »Es irrt der Mensch so lang er strebt«. Diese Fehlerquellen finden ihren Ursprung in unserem Körper. Ein Gehirn nimmt viel Energie, ungefähr 20% des gesamten Bedarfs, deshalb ist ein sparsames Verhalten von Vorteil. Das bestätigen von Vorurteilen und Stereotypen ist weniger energieaufwändig als sich auf etwas Neues einzustellen. Außerdem hat die Mehrheit der Menschen eine optimistische Natur und wird deshalb schnell von möglichen Erfolgen begeistert. Es kommt auf ein vernünftiges und vertrauensvolles Gleichgewicht an. Wie der polnische Science-Fiction-Autor Stanislav Lem es sagt »der Pessimismus der Vernunft verpflichtet zum Optimismus des Willens«.
Verfügbare Information überbewerten.
Es ist gegenwärtig äußerst schwierig zuverlässige Informationen zu bekommen. Wenn wir die einmal haben, halten wir daran fest als wären sie ein Goldschatz. Wir überbewerten unsere Information, obwohl jedem klar sein sollte, dass Informationen veralten. Nur wenn neue Informationen gut in unser Weltbild passen, oder mit unseren Vorurteilen übereinstimmen, sind wir gerne bereit sie für wahr zu halten. Alles andere betrachten wir argwöhnisch. Das zugrunde liegende Problem ist dass wir nicht wissen welche Informationen uns noch fehlen um ein abgewogenes Urteil zu bilden. Deshalb überbewerten wir die verfügbaren Fakten und rechtfertigen damit leichtsinnig unsere Handelsweise. Dieses Verhalten zeigt sich in den Vorurteilen, die wir natürlich leugnen, in Wirklichkeit aber sorgfältig pflegen. Auch das Festhalten an die schon gemachten Entscheidungen, obwohl die sich als falsch erwiesen haben, oder das starrköpfige Verteidigen gebildeter Meinungen sind ein Zeichen dafür, dass wir vollstes Vertrauen hatten in den damals verfügbaren Fakten und uns immer noch danach richten (10). Eine besondere Form ist das s.g. Halo-Effekt, auf Deutsch der Heiligenscheineffekt. Psychologen haben entdeckt dass wir Menschen die z.B. gut aussehen, gerne andere ebenfalls positive Eigenschaften wie Intelligenz zuschreiben (11). Das wirkt sich sowohl im Positiven als auch im Negativen aus und ist einer der Gründe warum wir zu Rassismus (12) neigen. Wenn wir als weiße Westeuropäer einer unbekannte dunkelhäutige Person begegnen assoziieren wir sie sofort mit einer Menge Vorurteilen. Die sind meistens nicht positiv, denn bloß die Tatsache dass diese Person anders als wir ist macht uns argwöhnisch. Geistige Bequemlichkeit festigt diese Meinung und einen ersten Eindruck korrigieren wir nicht gerne. Wir dürfen natürlich dieser Neigung nicht nachgeben und sollten über unsere Urteile immer kritisch bleiben.
Zusammenhänge sehen, die nicht existieren.
In »Der Mythos des Sisyphe« beschreibt Albert Camus (1913-1960) den Mensch, der versucht in einer Welt, die selber sinnlos ist, den Sinn des Lebens zu finden. Eine Suche die nur in Absurdität münden kann. Wir Menschen leben gerne in einer Welt die wir verstehen. Etwas Unverständliches wird schnell mit düsteren Erklärungen umwoben damit wir es wieder in den Griff bekommen. Falls man daran festhalten würde, ist das die Geburtsstunde einer Verschwörungsgeschichte, die sich als Fakenews verbreiten könnte. Der Zufall als Erklärung genügt nur selten, obwohl vieles in Natur und Gesellschaft von unbestimmten Abläufen beeinflusst wird. Mithilfe unserer Vorstellungskraft gelingt es meistens eine für uns »glaubwürdige« Erklärung zu finden. Ein bisschen Überzeugungsarbeit macht danach das Bild komplett. Man könnte meinen dass Fehler notwendig sind um neue Wege zu entdecken und die Kreativität herauszufordern. Frei spekulieren über eine mögliche Ursache liefert uns aber öfters Fehlinformation und führt mithin zu Verschwörungstheorien, Falschmeldungen und Irrwege.
Wenn die Phantasie uns mitreißt, können merkwürdige Phänomene auftreten. Wenn wir mit jemandem der eine seltene Krankheit hat gesprochen haben, meinen wir oft selber auch daran zu leiden oder mindestens die ersten Anzeichen zu haben. Psychologen nennen das »salience« (Auffälligkeit): Weil es so besonders ist bleibt es in unserem Gedächtnis und wir halten es demzufolge für eine Wahrscheinlichkeit.
Die Folgen
Nicht nur die genannten Emotionen bemühen sich unser Verhalten zu beeinflussen, auch die gegenüberliegenden Standpunkte, die im Allgemeinen allerdings weniger oft vorkommen, spielen eine derartige Rolle. Eine hedonistische Tretmühle wird dann durch Schuldgefühle ersetzt. Der innere Schweinehund entartet sich zur Hyperaktivität; die Neigung etwas tun zu wollen um das Gewissen zu beruhigen. Eine Eigenschaft die bei Spendenaktionen eine große Rolle spielt. Loyalität wird zum Narzissmus und kurzfristiges Denken einem zwangsläufigen Glauben an mathematische Rechenmodelle. Unsicherheiten überbewerten und übertriebenes Selbstvertrauen sind bereits zwei Extreme, so wie das Über- oder Unterbewerten von verfügbaren Informationen, das Glauben an nichtbestehende Zusammenhänge oder das Leugnen vorhandener Beziehungen. Diese extremen Standpunkte führen selten zum Erfolg; bereits Aristoteles hat uns gezeigt dass der richtige Weg oft durch die Mitte führt.
Bemerkenswert ist wie diese einander ausschließenden Intuitionen einander bekämpfen. Ein Austausch von rationellen Argumenten ist in einer Diskussion, die von Emotionen beherrscht wird, nicht mehr sinnvoll. Bei dem Thema Umweltschutz beispielsweise sind ausgeklügelte Rechenmodelle nicht das richtige Argument Zweifler zu überzeugen.
Die genannten Beispiele zeigen uns wie unser Bauchgefühl manchmal verrücktspielt. Problem ist nur dass wir nicht genau wissen wann das der Fall ist. Ich könnte genauso eine Liste von Beispielen, wo unsere Intuition eine besonders positive Rolle gespielt hat, erstellen. Außerdem nehmen wir nicht alle für uns relevante Informationen bewusst wahr und wir können deshalb auch nicht rationell analysieren. Manchmal verarbeiten wir diese Signale unbewusst und fragen uns hinterher warum wir so gehandelt haben. Manches Warnsignal wird ohne unser bewusstes Mitwissen registriert: die Wahrnehmung eines gefährlichen Schlaglochs in der Straße wo wir fahren, der Geruch eines Feuers, oder Schüsse die unbewusst wahrgenommen wurden. Wir fühlen uns gewarnt, wissen jedoch nichts Konkretes.
Die folgende Schlussfolgerung aus dem vorhergehenden Text ist auf jeden Fall zulässig: Der Mensch ist nicht ein harmonisch denkendes Wesen. Es gibt mehrere Trennlinien, die mehr oder weniger selbständig taktierende Teile markieren: Das sind die Ursachen für einen ständigen Kampf zwischen unterschiedlichen Interessen. Konflikte die uns erschöpfen und daran hindern konsequent Schritte vorwärts zu machen. All dies hat Immanuel Kant mal veranlasst zu seufzen dass aus so einem krummen Holz woraus der Mensch gemacht ist, nichts ganz Gerades gezimmert werden kann. Vollkommene Lösungen den Mensch betreffend sind ihm zufolge dann auch ausgeschlossen.
Besonders brisant wird es wenn mehrere Intuitionen einander verstärken; das kann leicht zu einer Selbstsabotage führen. Die gibt es sowohl in einer persönlichen als auch in einer kollektiven Variante. Folgende Beispiele werden das verdeutlichen.
Wir wissen, dass rauchen ungesund ist, dennoch verharren viele in dieser Gewohnheit. Das wird von folgenden Intuitionen verursacht: Die hedonistische Tretmühle (es ist in bestimmten Momenten einfach angenehm), kurzfristiges Denken (die Nachteile treten erst später auf und sind außerdem nicht sicher) und übertriebenes Selbstvertrauen (diese Krankheiten werden mir nicht passieren, denn ich lebe ja weiterhin gesund).
Wir sollten uns eigentlich mehr bewegen und gesunder ernähren: Die hedonistische Tretmühle (muss man sich wirklich von einem angenehmen Lebensstil verabschieden?), der innere Schweinehund (ich denke nicht dass so viel Anstrengung gut für mich ist), kurzfristiges Denken (warum sollte ich mir jetzt Vielem entsagen wenn ich mir überhaupt nicht sicher bin ob es etwas bringt?), verfügbare Information überbewerten (es ist ja immer gut gegangen, warum sollte ich etwas ändern?), übertriebenes Selbstvertrauen (ich bin stark genug um diesen Lebensstil auszuhalten).
Die Qualität der Umwelt wird zunehmend schlechter; wir müssen etwas tun, bleiben aber passiv: Die hedonistische Tretmühle (ich möchte meine angenehme Art zu leben nicht aufgeben, lass die Anderen mal ein Opfer bringen), Loyalität (Ich bin ja gezwungen mitzumachen ein dickes Auto zu kaufen oder eine Flugreise zu buchen. Alle andere machen das auch), kurzfristiges Denken (wie es mir im Moment geht ist mir wichtiger als eventuelles späteres Wohlbefinden), mit Risiken umgehen (von Umweltschutz habe ich manchmal die Schnauze voll, meine Interessen liegen jetzt irgendwo anders), verfügbare Information überbewerten (Ich soll Vorurteile haben?), übertriebenes Selbstvertrauen (die Wissenschaft wird’s schon richten).
Mancher ist empfindlich für Fakenews. In den Medien und sozialen Foren sind Unmengen unbewiesener Behauptungen zu finden. Themen wie Gesundheit, Politik oder Umwelt sind außerordentlich beliebt weil Schulmedizin oder Forschung (noch) keine schlüssige Erklärung geben können. Man sieht Zusammenhänge die rationell nicht existieren, überbewertet schon vorhandene Information und sucht Sicherheit wo es sie nicht gibt.
Die Schlussfolgerung der erwähnten Gedankenstreitpunkte ist meistens: »Wir brauchen uns nicht zu ändern (oder weiter nachzudenken), sondern können einfach weitermachen«. Natürlich verursacht dieses Verhalten nicht selten eine kognitive Dissonanz die sich mit einer innerlichen Unruhe bemerkbar macht. Bevor wir die wahre Lösung akzeptiert haben und danach handeln, versuchen wir dennoch Scheinlösungen oder legen unsere Themen auf etwas weniger Bedrohliches um. Inzwischen wachsen die Risiken und steigen die Kosten um sie zu neutralisieren.
Wir alle sind Manipulationsopfer
In Wirtschaft und Politik hat sich eine neue Disziplin entwickelt: die »public relations«. Deren Vertreter sind als Marketing- und PR-Experten oder als »Spindoctor« bekannt; man könnte sie auch einfach Manipulatoren der Öffentlichkeit nennen. Als ihr Gründer gilt Edward Bernays (1891-1995), ein Neffe von Sigmund Freud. Seine Grundidee war dass der Mensch ein irrationales Wesen ist, das sich von unbewussten Trieben führen lässt. Bernays meinte dass man die öffentliche Meinung in jede gewünschte Richtung umformen kann wenn man diese Emotionen versteht und bewusst einsetzt.
Natürlich muss man nicht sofort alle Öffentlichkeitsarbeit unter Verdacht stellen, dennoch sind viele Beispiele bekannt wie die Meinung der Masse bewusst in eine bestimmte Richtung gedrängt wurde. Die Industrie sah sofort ihre Chancen und kreierte neue Kaufmotive für ihre Kunden, z.B. mit dem Slogan: »express yourself« (mache klar wer du bist). Die führenden Marken bekamen ein neues Aushängeschild: zum Beispiel »reach for a lucky« oder »torches of freedom« für Zigaretten der Marke Lucky Strike (13). Gegenwärtig kann kein Politiker Erfolg haben ohne über PR Strategien nachzudenken. Dann gilt: Erstens nicht zu viel Inhalt kommunizieren denn das erregt Langeweile, zweitens die Person muss stimmen. Persönlichkeitsschwächen sollten umgebildet oder kaschiert werden.
Klar dürfte sein dass die Wahrheit nicht immer an erster Stelle steht. Es geht um das Gefühl und die Stimmung um die Rationalität, wenn nötig, auszuschalten. Man kauft nicht mehr was gebraucht wird und wählt nicht was die beste Option darstellt, sondern das was ein gutes Gefühl gibt. Oder was negative Gefühle wie die Angst unterdrückt.
Der Marketing Experte Baba Shiv hat in einem Experiment nachgewiesen dass unsere Emotionen und unser diskursives Denken stark miteinander zusammenhängen. Er ließ seinen Probanden die Wahl zwischen einem ungesunden aber leckeren Schokosnack oder einem Stück gesundem aber langweiligem Obst. Die eine Gruppe bat er, sich vor dem Essen eine Telefonnummer zu merken. Diese Teilnehmenden wählten 50% öfter den Schokosnack als die anderen. Offensichtlich waren die Personen die sich eine Telefonnummer merken sollten abgelenkt und ließen ihre Emotionen entscheiden was sie essen wollten. Shiv meint dass wir sogar 90% unserer Entscheidungen größtenteils mit unseren Emotionen treffen und Meister darin sind sie hinterher rationell zu rechtfertigen.
Später wurden diese Marketingprinzipien weiter ausgebaut und sie bekamen ebenfalls politische Zwecke. Wir reden dann über »nudging« und »framing«. Mit nudging (von »nudges«, hier: Denkanstöße) wird eine Umgebung kreiert die dazu beiträgt das gewünschte Verhalten zu fördern. Z.B. indem die bevorzugte Entscheidung viel einfacher zu erreichen ist als andere Optionen. Natürlich gibt es gute und schlechte Anwendungen: Man kann entweder Menschen manipulieren oder helfen Dinge zu tun die sie sich eigentlich gewünscht hatten zu tun, z.B. achtgeben und gefährliche Situationen vermeiden statt gedankenlos routinemäßige Fehler machen. Framing (von »frame«, Rahmen) ist eine Beeinflussungstechnik wobei komplexe (politische) Probleme vereinfacht aber oft auch verzerrt dargestellt werden um eine bestimmte Schlussfolgerung annehmbar zu machen. Das politische Problem der Steuerhinterziehung kann man z.B. aus zwei unterschiedlichen Perspektiven beleuchten; die des Steuerzahlers (der meint dass er ohnehin schon zu viel zahlen muss und der Staat verschwenderisch ist) oder die des Finanzamtes (dem die Steuergerechtigkeit wichtig ist). Die Frage ob die Steuern gerecht sind kann so unterschiedlich beantwortet werden. Das Framen bringt Menschen dazu ein bestimmtes Weltbild zu adoptieren. Allerdings kann so auch Tür und Tor für Missbrauch und Manipulation geöffnet werden.
In der Psychotherapie des Neuro-Linguistischen Programmierens kann reframing benutzt werden um negative Erlebnisse in einem anderen Hintergrund zu positionieren mit dem Ziel davon auch positive Aspekte ableiten zu können und Traumen abzuschwächen.
Das rationale Denksystem steht mehrfach unter Beschuss; entweder wird es zielgerichtet manipuliert und von Emotionen überschattet, oder sogar die Wirklichkeit kann diese Arbeit erledigen. Es gibt immer einen grundlegenden, philosophischen Zweifel ob wir die Wirklichkeit eindeutig wahrnehmen und interpretieren können. Klar ist jedenfalls dass jeder die Umgebung auf seiner Art und Weise wahrnimmt und interpretiert.
Auch die auf Rationalität stützende Wissenschaft gibt uns keine Sicherheit immer die Wahrheit aufzudecken. Die in Band zwei behandelte Quantenmechanik liefert uns zahllose Beispiele von mangelhaften Theorien die wir bloß benutzen weil uns etwas Besseres fehlt.
Die Schlussfolgerung
Wir müssen einfach damit auskommen mehrere intelligente Subsysteme, die einander widersprechen können, zu haben. Wären wir Wesen mit nur dem rationalen Denksystem, dann wären wir den Robotern oder anderen KI-Systemen gleich. Gerade diese innerlichen Streitigkeiten und die daraus folgende Unvorhersagbarkeit machen den Mensch interessant. So wie der Philosoph Markus Gabriel es radikalerweise ausdrückt: »Der Sinn des Denkens ist das machen von Fehlern« (14). Man muss sich auch mal fragen weshalb die Computer mit Brettspielen, wo die Logik die Überhand hat, besser als der Mensch sind. Die Antwort ist ganz einfach: Weil diese KI-Geräte mit ihrer unfassbaren Rechenkraft und unfehlbarem Gedächtnis uns weit überlegen sind. Die einzige Chance den Unterschied zu machen ist unsere Kreativität, Intuition und Optimismus. Kurz gesagt: das Überraschende.
Dennoch gibt es Fehler die wir besser vermeiden können. Einer davon betrifft die Art und Weise wie wir uns das Führungspersonal aussuchen oder wem wir unser Vertrauen schenken. Objektiv gesprochen dürfte man erwarten dass der klügste und meist geeignete Mensch den Führungsauftrag bekommt oder unsere Zustimmung erhält; die Praxis ist leider oft eine andere. Das Phänomen »Influencer« ist ein deutlicher Beweis dafür wie bekannte Personen fast vergöttert werden. Sogar in Wirtschaft und im Finanzwesen kann man beobachten wie z.B. Elon Musk oder Jeff Bezos mit einigen einfachen, beiläufigen Bemerkungen Kurse beeinflussen und Milliarden Dollar an Wert verdampfen lassen können. Wir lassen uns leicht von Charisma und einem übermäßig großen Selbstbewusstsein ablenken und beeindrucken, und verleihen derartigen Personen einen unantastbaren Kultstatus.
Diese Figuren zeigen als Führungskraft jedoch risikovolles Verhalten. Sie gehen oft nur eigenen Vorteilen nach, auch auf Kosten der Gesellschaft oder des Unternehmens. Sie sind übermutig und gehen Risiken ein die man besser vermeiden sollte, und geben gerne anderen die Schuld wenn etwas schief läuft. Derartiges Führungspersonal hat meistens zwei Probleme: Erstens gehen sie unvernünftige Risiken ein uns zweitens haben sie nicht die Fähigkeit ihre Fehler einzusehen (15). Kompetenz als Anführer zeigt sich eher als Bescheidenheit und Lernfähigkeit. Nur wenn man seine Grenze kennt ist man bereit anderen zuzuhören und daraus zu lernen.
Unsere Intuition führt uns bei der Auswahl in die Irre, weil wir die wichtigen Führungseigenschaften nicht rechtzeitig erkennen und gelten lassen. Die Folge ist ein schlechter Führungsstil wodurch ein Großteil der Betroffenen sich unwohl fühlt.
Ein zweiter vielgemachte Fehler betrifft die Fakenews. Besonders wenn man viel im Internet unterwegs ist, wird man damit konfrontiert. Wenn man jedoch sein eigenes Denkmuster kennt hat man eine effektive Waffe um gegen Falschmeldungen vorzugehen. Der Psychologe Markus Knauff hat die zugrunde liegenden Denkfehler mal aufgelistet (16). Die wichtigsten gebe ich hier gerne wieder:
Achte auf die verwendeten Wörter: wenn ein Autor eine bestimmte aber nicht offengelegte Nachricht übermitteln will, kann eine solche an Hand seiner Wortwahl zurückverfolgt werden. Dieser
Framing
-Effekt wird mit emotional aufgeladenen Wörtern wie »Tod, Katastrophe, Anschlag, Fehlverhalten« usw. initiiert. Bedenke dass bestimmte Personen oder Organisatoren ein Interesse daran haben Menschen in eine bestimmte Richtung zu drängen.
Vermeide meinungslastige Foren weil dort meistens nur einseitige Berichte zu finden sind. Verschwörungsmeldungen hören sich manchmal sehr interessant an, zuverlässige Fakten sind aber Fehlanzeige.
Sei bereit deine eigene Meinung kritisch zu untersuchen. Wieviel weißt du schon über das Thema. Kannst du alle Begriffe ordentlich erklären? Ein gesunder Menschenverstand reicht nicht aus!
Achte auf die verwendete Logik. Kausale Zusammenhänge werden oft als »Wenn …dann« Sätze dargestellt. Aber das ist selten immer der Fall. Der Satz: »
Wenn ich Brot benötige, dann gehe ich zum Bäcker
« hört sich logisch an, ist aber nicht immer Tatsache. Ich könnte auch zum Supermarkt oder Kaufhaus gehen. Denke also immer an Ausnahmen oder Alternativen.
Überprüfe das Thema im Internet. Gebe ein: »Fact checking: <dein Thema>? Und finde heraus wie die anderen Meinungen lauten. Überprüfe besonders die Veröffentlichungen offizieller Instanzen.
Zusammengefasst kann man sagen: »