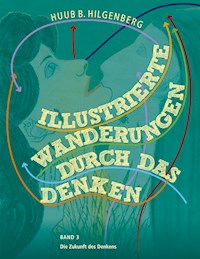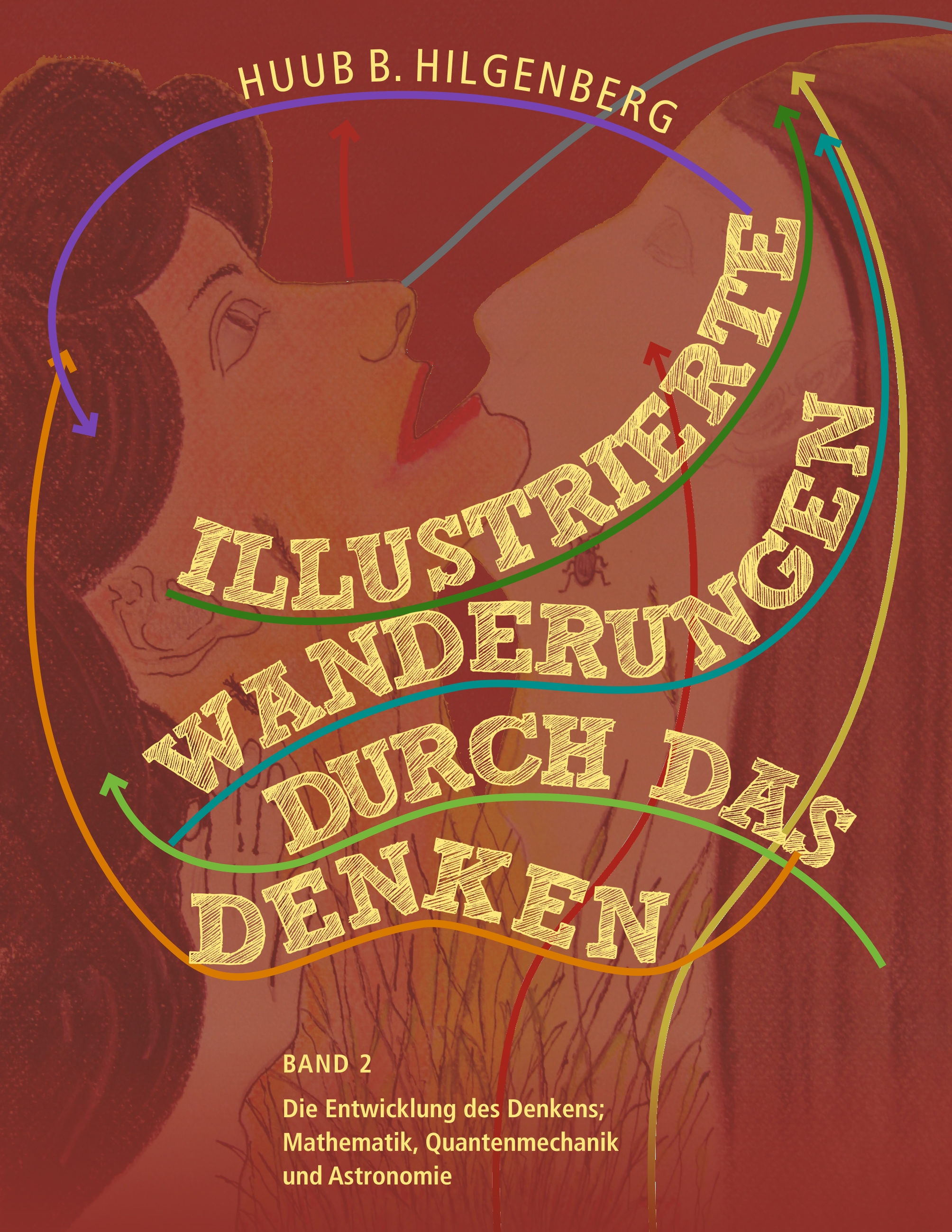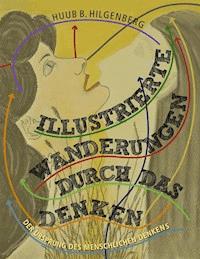
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Eine Wanderung durch das Denken" führt Sie durch eine abwechslungsreiche Landschaft. Wer ist der Mensch? Ist er zum Guten oder zum Bösen geneigt? Warum haben wir ein Bewusstsein? Was bedeutet eine Gemeinschaft für uns? Was heißt Gerechtigkeit? Wie können wir unsere Demokratie retten? Das alles sind Fragen, womit viele sich schon längere Zeit herumschlagen und gerne eine Antwort bekommen würden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Der Anlass
Danksagung
Einführung
Philosophie und Wissenschaft
Der Surrealismus
Das Gesamtkunstwerk
Das Denken in Philosophie und Wissenschaft
Denkfehler
Aberglauben und pseudointellektuelles Gelaber
Falsche Aussagen entlarven
Hegels Dialektik
Religion, Ethik und Wissenschaft
Fehlerkultur
Das Denken in postfaktischen Zeiten
Evolution
Charles Darwin
Wie der Mensch geworden ist, wie er ist
Der Darwinismus und seine Weiterentwicklung
Ist der Mensch zum Guten oder zum Bösen geneigt?
Genetic editing
Die Evolution des Bewusstseins
Das menschliche Gehirn; wie es sich zeigt
Hormone und Neurotransmitter
Der eiserne Vorhang in unserem Kopf
Das Bewusstsein
Gibt es einen freien Willen?
Verantwortlich sein, Schuld und Sühne
Wie man sein Leben kontrollieren kann
Evolution und Gesellschaft
Gesellschaft und Kultur
Die Frauenemanzipation
Die Emanzipation von Minderheiten
Kann eine gerechte Gesellschaft bestehen?
Eine gesunde Demokratie
Chancengleichheit und Transparenz
Finanzielle Ungleichheit
Eine Kehrtwende?
Die technologisierte Gesellschaft
Ein Lösungsvorschlag
Das Tier, das denken kann
Körper und Geist
Körper, Geist und Gesellschaft
Immer weiter so?
Empfehlungen zum Weiterlesen
Literaturliste
Der Anlass
Das Denken ist eine faszinierende Tätigkeit; sie ist voll mit Geheimnissen und Widersprüchen. Ein Leben ohne Denken könnten wir uns gar nicht vorstellen … Gerade heute lohnt es, sich über das Denken Gedanken zu machen: Die Hirnforschung bietet uns komplett neue Einsichten, warum und wie wir denken. Außerdem leben wir in einer Zeit, wo das selbständige Denken wie nie zuvor beansprucht wird. Es ist eine spannende Zeit: »Never a dull moment«, würden die Engländer sagen, niemals ein Moment von Langeweile. Das hat so seine Vorteile, aber auch »Risiken und Nebenwirkungen«. In dieser heutigen Zeit ist es besonders interessant, den wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen zu folgen, denn Probleme und (vermeinte) Lösungen folgen einander in einem nie dagewesenen raschen Tempo. Das heißt nicht, dass wir alle Probleme in Eiltempo loswerden, denn fast jede Lösung verspricht wieder neue Probleme oder die alten zeigen sich doch schwieriger lösbar als gedacht. Aber das Wichtigste ist, es bewegt sich etwas. Dementsprechend viele Informationen gibt es. Die Vielzahl von Veröffentlichungen hat sich explosionsartig vermehrt, niemals waren so viele Wissenschaftler und Forscher tätig als heutzutage: Neben Büchern, Zeitschriften und Zeitungen ist auch digital eine ganze Menge an Informationen zugänglich geworden, sowohl im öffentlichen Bereich als auch in privaten oder halb privaten sozialen Foren. Leider entspricht nicht alles, was gemeldet wird, auch der Wahrheit. Manche stört das leider schon längst nicht mehr: die suchen nur eine Bestätigung ihres eigenen Weltbildes. Ist sicherlich sehr komfortabel, aber nicht ungefährlich: Bevor man es weiß, steckt man gedanklich in einer Sackgasse und am Ende verliert man seine Fähigkeit, selbständig und objektiv zu denken. Man lebt gefangen im jetzigen Augenblick und reagiert nur auf kurzfristige Impulse: »Oh, das liebe ich!!!« oder »Bah, das verabscheue ich!!!«. Man äußert sich nur noch in Superlativen, jegliche Nuance fehlt. Was bleibt, sind die drei Urkräfte die, dem Physiker Albert Einstein zufolge, die Welt beherrschen: Unwissenheit, Angst und Gier. Das ist in diesem Kontext natürlich etwas übertrieben, aber anzunehmen ist, dass die Innovation das erste Opfer sein wird, wenn man sich, generell gesprochen, gegen andere Meinungen abschottet. Bis zum achtzehnten Jahrhundert war man überhaupt nicht so begeistert von Innovationen. Es würde nur die bestehenden Verhältnisse durcheinanderbringen und die Tradition vernichten, meinte man damals. Edmund Burke (1729–1797) kann man als Vertreter dieser Meinung sehen, wenn er in seinem »Reflections on the revolution in France« sagt, dass die Basis einer erfolgreichen Gesellschaft nicht abstrakte Begriffe wie Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit oder Gleichheit sein sollten, sondern Gesellschaften funktionieren am besten, wenn Traditionen, deren Wirksamkeit bewiesen wurden, von Generation auf Generation weitergegeben werden. Wir sollten uns hüten in derartig düstere Zeiten zurückzufallen, wir würden alle darunter leiden.
Erst die Französische Revolution und die Aufklärung brachten eine andere Kultur mit sich: Man wagte sich außerhalb gebahnter Wege und machte Fortschritte in Philosophie, Wissenschaft und Technik. Das hat vielen Menschen sehr viel Gutes gebracht: Krankheiten wurden besser bekämpft, die Einkommen stiegen kräftig an; man lebte länger und wohlhabender; nicht nur die privilegierten Eliten, sondern breite Schichten der gesamten Bevölkerung. Außerdem war man besser informiert: Aberglauben wie der Hexenjagd wurde ein Ende gesetzt, obwohl es ein zähes Kämpfen war, denn auch heutzutage trifft man noch Menschen mit merkwürdigen und unwissenschaftlichen Überzeugungen, wir werden in diesem Buch mehreren begegnen. Es ist also keine Selbstverständlichkeit, dass wissenschaftliches Denken und Fortschrittlichkeit von allen positiv bewertet werden.
Das heißt nicht, dass Innovationen immer nur Vorteile bringen; wissenschaftliche Arbeit, wie Forschung und Entwicklung, sollte immer kritisch hinterfragt werden, damit es keine unzweckmäßige oder sogar schädliche Innovationen gibt. Leider wird erst später klar, ob eine Innovation tatsächlich bringt, was wir uns davon versprechen und dann ist schon manches Übel geschehen; ein Grund mehr, um die Entwicklungen mit gesunder Skepsis zu verfolgen. Innovationen sind zu wichtig, um sie nur den Wissenschaftlern und Technikern zu überlassen, genauso wie wir unsere Gesellschaft nicht an den Politikern veräußern können. Jeder hat die Pflicht, interessiert und kritisch zu bleiben. Man sollte seiner eigenen Urteilskraft trauen und offen bleiben für andere Meinungen.
Mensch zu sein fängt an mit Mündigkeit: wissen, was man will, und dieses Wissen fundiert seinem Mitmenschen klarmachen. Nur so kann man seine Freiheit genießen und seinem Lebensziel ein bisschen näherkommen, denn wir leben ja nicht alle auf einer weiter unbewohnten Insel. Dazu braucht man Fakten und die Fähigkeit, die richtigen Konsequenzen daraus zu ziehen. Klingt ganz einfach, ist aber schwieriger, als man denkt. Dieses Buch ist kein Kochrezept, womit man einfach und sicher zum Ziel kommt. Es ist mehr ein Werkzeug, um besser denken zu können. Dazu braucht man Inspiration, Kreativität, eine sichere Methode und Verständnis. Oder anders gesagt: Kunstbegriff, Wissenschaft und Philosophie. Ob das tatsächlich so wirkt, weiß man leider nur, wenn man ein oder mehrere Kapitel dieses Buchs gelesen hat, aber die Chancen stehen gut: Viele haben schon gute Erfahrungen gemacht, Garantien gibt es aber nicht. Ein bisschen Vertrauen soll man doch noch haben, oder?
Wir leben auch in einer Zeit, in der alles seinen Nutzen haben soll. Nutzlose Tätigkeiten haben offensichtlich keinen Sinn. Sogar das Nichtstun wird umgetauft in Meditation; der Nutzen ist, dass man zur Ruhe kommen soll, um neue Kräfte zu sammeln. Was ist der Nutzen vom Lesen dieses Buches, könnte man sich also fragen. Ich denke, es gibt mehrere: Erstens kann das Lesen an sich einfach Spaß machen, das Buch ist so aufgegliedert, dass man sich die interessantesten Kapitel aussuchen kann. Für Entspannung und Anregung verborgener Kreativität sorgen die Abbildungen, die zwischen den Texten auftauchen. Zweitens ist das Lesen eine Einladung, selbständig und grenzüberquerend zu denken. Natürlich tut jeder das schon (sic!), aber es kann immer noch ein bisschen selbständiger und breiter orientiert sein. Du wirst dich wundern, wie viele Zusammenhänge es gibt, wenn man anscheinend komplett unterschiedliche Wissenschaftsbereiche miteinander vergleicht. Drittens bekommt man mehr Einblick in spektakuläre wissenschaftliche Fortschritte. Wenn man unter Freunden über Quanten-mechanik, Astronomie oder genetic editing spricht, weiß man immer eine kluge Bemerkung zu machen (vorausgesetzt, man hat auch Teil zwei gelesen). Und viertens liest man, wie die Philosophie auch ganz praktisch angewandt werden kann, nämlich in Verbindung mit moderner Forschung oder den aktuellen Themen unserer Gesellschaft. Wenn du bisher noch keine feste Beziehung zur Philosophie hast, könnte ab jetzt etwas Schönes aufblühen! Und wenn du etwas Sinnvolles über die Zukunft erfahren möchtest, höre dann auf den Science-Fiction-Autor und Futurologen Bruce Sterling. Der sagt, dass man die besten Vorhersagen machen kann, wenn man in mehreren Bereichen, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, zuhause ist. Wir werden seine Meinung in Teil drei auf Wahrheit überprüfen. Fünf gute Gründe also, es sich bequem zu machen und diesen Anlass zum Lesen in die Hand zu nehmen!
Die Geschichte des menschlichen Denkens
In diesem ersten Teil handelt es sich um die Entwicklungsgeschichte des Denkens und welchen Einfluss sie auf Mensch und Gesellschaft hatte. Dennoch müssen wir uns selbst gestehen, dass unser Körper und die Gesellschaft einen großen Einfluss auf unser Denken ausüben. Gerade dieser Austausch von Kräften zwischen dem Körper, dem Denken und der Gesellschaft ist der rote Faden dieses Buches. Der Homo sapiens hat die am weitesten entwickelten Denkfähigkeiten aller Tierarten: Er kann sich eine andere Welt vorstellen als die, in der er lebt, er beherrscht eine Sprache und er hat ein (manchmal großes) Selbstbewusstsein. Außerdem kann er Gutes von Bösem unterscheiden; er hat demzufolge eine Moral, die er leider nicht immer befolgt. Dass er so weit gekommen ist, hat er der Evolution zu verdanken. Wenn wir unser Denken richtig verstehen wollen, dürfen wir unsere Evolutionsgeschichte nicht aus dem Auge verlieren, denn vieles von dem, was und wie wir heutzutage bewusst oder unbewusst denken, stammt aus der Prähistorie. Aus demselben Grund ist es interessant, das Verhalten von dem Menschen nah verwandten Tierarten, wie Primaten, zu analysieren. Es erleichtert die Frage zu beantworten, wo unsere Moral herkommt und warum wir uns manchmal Fremden gegenüber abweisend verhalten, obwohl wir das eigentlich gar nicht wollen. Wir werden uns auch die Frage stellen, was die Entwicklung unserer Gesellschaft bestimmt hat und weiter bestimmen wird.
Gerne bewahren wir eine Vorstellung von uns Menschen, wie wir uns gerne selber sehen: weltoffen, neugierig, nachdenklich und kreativ. Dass die Wirklichkeit oft anders aussieht, möchten wir nur ungerne wahrhaben. Können wir uns ändern, damit wir unserem Selbstbild näherkommen? Dazu muss man sich zuerst besser kennenlernen und verstehen, wie und warum wir so geworden sind. Erst wenn wir wissen, wo und warum wir an unsere Grenze stoßen, können wir etwas daran ändern. In erster Linie als individueller Mensch, danach als Gesellschaft und vielleicht sehr viel später auch als Spezies.
Aufbau des Buches
Das Denken der Menschen wird in zwei Perspektiven untersucht: einerseits mit Hinsicht auf die Evolution, andererseits ist die Gesellschaft Gegenstand unserer Untersuchung. Beide Perspektiven nehmen einen großen Einfluss auf unser Denken. Die Evolution, weil wir immer noch biologische Kreaturen sind und unser Gehirn eine lange Evolutionsgeschichte hat. Die Gesellschaft, weil wir als Sozialwesen ein starkes Interesse daran haben, einer Gruppe anzugehören.
Die zwei vorbereitenden Kapitel bringen uns einige wichtige Merkmale des Denkens näher: Die Einführung behandelt die Verhältnisse zwischen Kunst, Wissenschaft und Philosophie. Im zweiten Kapitel »Das Denken in Wissenschaft und Philosophie« wird untersucht, wie wahres Wissen von scheinbarem Wissen unterschieden werden kann. Die Evolutionstheorie und besonders die Entwicklung der Menschen werden im dritten Kapitel beschrieben. Die Evolution des Bewusstseins verdient, weil es für den zentralen Punkt des Buches wichtig ist, ein eigenes Kapitel: Kapitel vier ist dieser Thematik gewidmet. In dem vorletzten Kapitel »Evolution und Gesellschaft« kommt die Frage nach der Beziehung zwischen Mensch und Gesellschaft an die Reihe. Das Buch endet mit einer Zusammenfassung der Hauptthemen und führt uns zu den Fragen, die ich in den Teilen zwei und drei versuche zu beantworten.
Am Ende jedes Kapitels werden die in dem Text als (n) gekennzeichneten Verweisungen und Noten erwähnt. Zum Weiterlesen habe ich auf den letzten Seiten einige Empfehlungen aufgenommen.
Geplant sind noch zwei Teile; Teil zwei befasst sich mit der Entwicklung des Denkens und behandelt drei bedeutende Bereiche: Mathematik, Quantenmechanik und Astronomie. Teil drei ist reserviert für einen Blick in die Zukunft und heißt »Die Zukunft des Denkens«. Zentral steht die Frage, wie und in wie fern wir mit unseren Denkfähigkeiten unsere Zukunft gestalten können.
Liste der Abbildungen:
Umschlag: Die Geschwister
Seite → Der Baum
Seite →: Der flüchtige Leser
Seite →: Die Entscheidung
Seite →: Der versteckte Mensch
Seite →: Fata Morgana
Seite →: Innen- und Außenwelt
Seite →: Bedrängnis
Seite →: Das unbesiegbare Wort
Danksagung
Dieses Buch wäre niemals zustande gekommen ohne die Unterstützung meiner Frau Marjan und mehrerer Freunde. Insbesondere möchte ich Eckhard Froese danksagen, der mir mit viel Geduld die Grundlagen und Geheimnisse der deutschen Grammatik und Rechtschreibung beigebracht hat und mein Manuskript dementsprechend zu korrigieren wusste. Die Geheimnisse der deutschen Sprache sind für Nichtmuttersprachler kaum zu durchschauen; manchmal sieht es so aus, als ob es mehr Ausnahmen als Regeln gibt. Ein Buch schreiben fordert viel Arbeit, ein Buch korrigieren wahrscheinlich noch mehr.
Den Mitgliedern der philosophischen Runde in Hirtscheid (WW) danke ich für die inspirierenden Diskussionen über ein weitgefächertes Spektrum an Themen. Sie haben mich ferngehalten von voreiligen Schlussfolgerungen und meine Philosophie wieder zurückgebracht, dort, wo sie hingehört: mitten in der Gemeinschaft. Die Runde war wie eine Reisegesellschaft, eine Metapher, die ich gerne übernommen habe.
Alle Namen, Äußerungen und Beschreibungen über die Wandergemeinschaft und deren Mitglieder sind die reine Phantasie des Autors, jegliche Übereinstimmung mit der Wirklichkeit beruht auf Zufall.
Einführung
Wo Wissenschaft, Philosophie und Kunst einander begegnen.
Eine Einladung zu einer Wanderung, das ist dieses Buch. Entspannt die Landschaften genießen, Fernblicke bewundern, merkwürdigen Pflanzen und Tieren begegnen. Blumen pflücken unterwegs ist erlaubt, für kleine Pausen ist immer Zeit, denn wir haben keinen festen Fahrplan. Wir lassen die Umgebung einfach auf uns einwirken und sind dann verwundert, wie die Welt so funktioniert. Tiefgreifende Untersuchungen werden wir nicht durchführen, denn es bleibt eine Wanderung. Wir möchten uns beeindrucken lassen, um demnächst zu versuchen, es zu verstehen. Es kommt mehr auf den Zusammenhang an als auf die unterschiedlichen Feinheiten. Ein Aha-Erlebnis, das genügt, denn es gibt noch so vieles zu entdecken.
Die Reisegeschichte unserer Wanderung wurde aufgeteilt in mehrere Etappen. Die Vorbereitung auf die erste Etappe betrifft die Positionierung des Denkens und versucht die Fragen zu beantworten, wie Philosophie und Wissenschaft sich unterscheiden, wie das Denken überhaupt entstanden ist und warum wir so oft Denkfehler begehen. Die ersten Etappen führen uns durch den Wald und betreffen die Entstehungsgeschichten des Menschen und seine Gesellschaft. Die nächsten Etappen, wie beschrieben in Teil zwei des Buches, befassen sich mit einigen Wissenschaftsbereichen, in denen spektakuläre Fortschritte gemacht wurden, die unser ganzes Weltbild erschüttern könnten: die Mathematik, die Quantenmechanik und die Astronomie. Es gibt uns auch einen Einblick, wie die Evolution unser Wahrnehmen und Denken beeinflusst hat. Die letzten Etappen in Teil drei führen uns zu der künstlichen Intelligenz und deren Prägung der modernen Zeit. Ein Forschungsgebiet, wo mehrere Wissenschaftsbereiche zusammenkommen, nicht nur weil es eine komplexe Materie betrifft, ebenso weil die Konsequenzen für uns alle tiefgreifend sind. Am Ende des dritten Teiles kommen wir wieder heim und gönnen uns selbstverständlich die Zeit, alles noch mal zu überdenken und zu überprüfen, was das alles zu bedeuten hat für unseren Blick auf uns selbst, die Gegenwart und unsere Zukunft.
Philosophie und Wissenschaft
Das humane Denken umfasst zwei nah verwandte Bereiche, die Art und Weise, wie wir leben und denken, bestimmen: den Bereich der Wissenschaften und das Ressort der Philosophie. Warum sind beide Bereiche eigentlich voneinander getrennt? Ist die Philosophie eigentlich nur eine besondere Art, Wissenschaft zu betreiben? Die Denkmethode ist ja im Grunde weitgehend identisch: Beide sind durch Logik verbunden. Die Logik bestimmt, wie wir Fakten sammeln und interpretieren, wenn man unlogisch denkt, führt das zu Fehlschlüssen. Den Wissenschaften und der damit verbundenen Technologie haben wir Forttschritte, die unser Leben eingreifend verbessert haben, zu verdanken. Der Philosophie haben wir zu verdanken … ja was eigentlich? Neue Konzepte, neue Sichtweisen? Ideen, worauf sich alle Denker bisher niemals einigen konnten? Hat das reine Denken überhaupt noch einen Nutzen?
Mancher sagt, dass Wissenschaft und Philosophie wenig miteinander zu tun haben, ja sogar einander gegenüberstehen. Dort, wo die Wissenschaft sich strenger Regeln und Prozedere bedient, um Theorien zu formulieren, Experimente durchzuführen und auszuwerten, ist es, als ob die Philosophie sich wie ein Vogel ins Blaue hinein führen lässt, nur getrieben von Neugier, Spekulation und manchmal auch fern von Fakten. Man ist entweder Wissenschaftler oder Philosoph, beides zusammen ist eine »contradictio in terminis«; ein Widerspruch und ein Verstoß gegen die Aufgliederung unserer Kenntnisse, eine Aufgliederung, die schon hunderte von Jahren alt ist. Schon in der Antike machte man einen Unterschied zwischen der Philosophie, den sieben freien Künsten und den praktischen Künsten. Im Mittelalter hat man unter den praktischen Künsten das technische Handwerk verstanden, wie Bildhauerei, Waffenschmieden, Kochkunst und Agrarwirtschaft. Die sieben freien Künste hatten keine Verbindung mit Erwerbstätigkeiten und umfassten: Grammatik, Logik und Rhetorik und weiterhin: Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. Im siebzehnten Jahrhundert hat René Descartes (1) diese Aufgliederung wieder zusammengebracht, indem er eine Metapher benutzte, womit er sowohl die Philosophie als auch alle bekannten Künste abbilden konnte: den Baum. Der Stamm ist das reine Denken, die alle Wissenschaften zu tragen hat. Die Wissenschaften selbst sind die Äste und Zweige, die in alle Richtungen wachsen können. Gelehrte und Studierende konnten sich dementsprechend spezialisieren, weil Universitäten diese Aufgliederung gleichermaßen benutzten. Dieser Vorgehensweise haben wir die Forttschritte in den unterschiedlichsten Fachrichtungen zu verdanken, nicht zuletzt in den Naturwissenschaften und der Technik. Zu oft vergessen wir aber, dass die Wissenschaft aus der Philosophie hervorgegangen ist und mit ihr immer noch viele Gemeinsamkeiten hat.
Dass man manchmal die Grenzen des eigenen Fachbereichs überschreiten muss, um eine standhafte Erklärung zu finden, zeigt folgendes Beispiel. Jahrtausendelang hat man versucht die einfache Frage zu beantworten, warum der Himmel blau ist. Kinder bringen auch heutzutage ihre Eltern zum Wahnsinn anlässlich dieser naheliegenden und scheinbar einfachen Frage. Schon der Philosoph Aristoteles hat sich vor 2.000 Jahren mit dieser Frage beschäftigt, indem er den Himmel verglich mit einem tiefen Brunnen. Er stellte fest, dass das Wasser in größeren Tiefen wie schwarz aussieht, obwohl es ohne Farbe ist, etwas Ähnliches passiere mit Luft. Diese Erklärung hat sich jahrhundertlang gehalten. Erst Leonardo da Vinci hatte eine weitere Erklärung, warum der Himmel blau ist. Er suchte sie in den kleinen Wasserteilchen, die sich von der Sonnenwärme in der Luft auflösten und in dem Tageslicht hell aufleuchteten. Isaac Newton ergänzte diesen Gedanken und wies durch Experimente nach, dass weißes Licht aus mehreren Farben besteht. Aber warum sehen wir nur die blaue Farbe? Der Mathematiker Leonard Euler versuchte im achtzehnten Jahrhundert die Erklärung über die Wellentheorie des Lichts zu finden und berechnete mehrere Brechungsindizes. Man vermutete, dass eine unbekannte Substanz, aufgelöst in der Luftmasse, verantwortlich war für die blaue Farbe. Die Entdeckung von Atomen bestätigte diese Hypothese. Sogar Albert Einstein beschäftigte sich mit der Frage des Blauseins, ohne aber wichtige Forttschritte zu erzielen. Lord Rayleigh schaffte den Durchbruch und wies nach, dass die Intensität des Streulichtes zusammenhängt mit den Abmessungen der Gasmoleküle. Kurze Wellenlängen, wie von der Farbe Blau, werden mehr zerstreut und werden dann wahrgenommen als blaues Licht. Aber warum sehen wir keinen violetten Himmel? Die violette Farbe hat eine noch kürzere Wellenlänge. Diese Erklärung können Biologie und Evolutionstheorie liefern, denn unsere Augen haben sich so entwickelt, dass wir empfindlicher für blau als für violett sind. Man sieht, dass bei der Beantwortung dieser einfachen Frage verschiedene Fachrichtungen zusammenkommen: Lichttheorie, Kenntnisse von Atomen und Molekülen, die Mathematik von Streuung, Biologie und Evolutionstheorie.
Inspiriert von Beispielen wie diesen versuche ich in diesem Buch auf die Brücken zwischen den Kenntnisdomänen hinzuweisen, denn die sind schon längst da, werden aber zu wenig benutzt, ganz besonders die Brücke zwischen Wissenschaft und Philosophie. Denn dort, wo die Wissenschaft an ihre Grenze stößt, kann die Philosophie, indem sie die richtigen Fragen stellt, einen Durchbruch ermöglichen. Umgekehrt liefert die Wissenschaft Fakten, worüber die Philosophie sich wundern kann und die Anlass sind, neue Fragen zu formulieren. In der Hirnforschung zum Beispiel tut man sich schwer mit dem Begriff »Selbstbewusstsein«. Ist Bewusstsein eine andere Kategorie als die vernetzten Neuronen im Gehirn, die man wahrnehmen kann? In der Quantenmechanik, der Wissenschaft der allerkleinsten Teilchen, stellt sich die Frage nach der Natur der Materie; was sind eigentlich die sogenannten »Strings« (2), die möglicherweise die Bausteine der subatomaren Teilchen sind? Existieren die eigentlich so, wie wir das von der uns umgebenden Materie gewöhnt sind, oder ist ihre Existenz nur als pure Mathematik zu begreifen? Seit die Astronomie die Schwarzen Löcher entdeckt hat, fragt man sich, was passiert, wenn man in solch ein Monster geraten würde. Sind unsere vertrauten physischen Gesetze dann immer noch gültig oder gelten ganz andere? Und kann man die Evolutionstheorie tatsächlich als eine wissenschaftliche Theorie betrachten? Die normalen Bedingungen in der Wissenschaft können ja kaum erfüllt werden, weil Experimente in voller Breite nicht durchführbar sind. Einerseits würde es zu viel Zeit in Anspruch nehmen, um die auftretenden Mutationen während mehrerer Generationen zu beobachten, andererseits gibt es manchmal gewiss ethische Eingrenzungen, insbesondere wenn es um Lebensmittel, höher entwickelte Lebensformen oder den Menschen selbst geht.
Probleme kann man manchmal besser verstehen und lösen, wenn man sich die richtigen Fragen stellt; außerdem kann die Philosophie helfen, die Ergebnisse von Experimenten richtig zu interpretieren. Schöne Beispiele dafür sind im Bereich der Quantenmechanik vorhanden, denn die subatomaren Teilchen zeigen ein Verhalten, das unserer vertrauten Welt total fremd ist. Wenn gerüttelt wird an den Grundsteinen unseres Wissens, muss eine grundlegende Diskussion geführt werden und die Grenzen der Wissenschaftsbereiche sollten überschritten werden. Eine grundlegende Diskussion betrifft die Frage, ob unserem Wissen Grenzen gesetzt sind. Gibt es Tatsachen, die wir nicht wissen können? Klar, unser Wissen hat seine Grenzen, aber bis heute hat die Wissenschaft diese Grenzen immer noch verschieben können: Die Wissenschaft schreitet sozusagen fort. Manchmal aber schreitet sie dito rückwärts, wenn sich herausstellt, dass angenommene Theorien unwahr sind. Die Kernfrage ist, ob es Wissensgrenzen gibt, die wir nicht mehr aufschieben können. Es gibt Indizien, dass dies tatsächlich der Fall sein könnte. Wir haben zum Beispiel große Mühe, uns eine Vorstellung von Unendlichkeit in Raum und Zeit zu machen. Das unendlich Große oder das unendlich Kleine entgeht unserer Vorstellungskraft. Ebenso die Frage, was sich vor dem Anfang des Universums abgespielt hat oder sich außerhalb des Universums befindet, ist nicht zu beantworten, weil wir gefesselt sind an dem Universum, wie wir es kennen. Ich werde die Frage nach der Grenze des Wissens am Ende noch mal stellen, nachdem wir eine kurze Entdeckungsreise durch Mathematik, Quantenmechanik, Astronomie und künstliche Intelligenz gemacht haben. Vielleicht finden wir dann bessere Antworten.
Die Philosophie kann der Wissenschaft helfen voranzukommen, es gibt desgleichen viele Beispiele, wie die Wissenschaft jahrhundertlange philosophische Diskussionen beenden konnte. Wenn Demokritos im vierten Jahrhundert v.Chr. seinen atomistischen Materialismus postulierte, konnte er nicht wissen, dass dieses Thema noch Tausende Jahre aktuell bleiben würde. Erst durch moderne wissenschaftliche Experimente wissen wir, wie Atome und Moleküle die Eigenschaften verschiedener Materialien bestimmen. Leider nur, dass jede Antwort wieder neue Fragen aufwirft. Denn seit wir wissen, dass Atome nicht unteilbar sind, sondern sich aus subatomaren Teilchen zusammensetzen, den sogenannten Quantenteilchen, fragt man sich, ob diese Teilchen vielleicht unteilbar sind oder ob es unendlich weitergeht wie (im Prinzip) mit den russischen Matrjoschka-Puppen (3).
Mit dem Fortschreiten der Wissenschaften könnte man sich fragen, ob sich die Philosophie auf einem toten Ast befindet und es nicht lange dauert, bis dieser Ast zu Boden stürzt, weil die Wissenschaft auf Dauer alle Fragen beantworten wird. Es kann nicht geleugnet werden, dass viele philosophische Fragen aufgekommen sind, weil man einfach zu wenige Fakten zur Verfügung hatte oder die Fakten nicht anerkennen wollte. Andrerseits kennt jeder das philosophische Gespür, man nennt es nur anders. Sich selbst kritisch hinterfragen, ob man das Richtige tut, ob die eigene Überzeugung sich wirklich auf Fakten stützt, ob man die Meinungen anderer richtig beurteilen kann: Das alles sind Themen, die zu Philosophiethemen führen werden, wenn man die nur weiterdenkt. Nicht alle Fragen führen zu philosophischen Themen. Nur wenn eine Frage grundsätzlich und allgemein genug ist, könnte sie philosophisch interessant werden, um sie mit einer bestimmten Methode zu überdenken, der philosophischen Methode.
Viele finden diese Methode und die erzielten Ergebnisse unübersichtlich, unverständlich oder sogar bedrohlich. Das folgende Beispiel wird das illustrieren. Zwei Studenten unterhalten sich. Der Student der Soziologie hat gerade ein »Paper« über Demokratie vervollständigt. Ein Student der Philosophie fragt ihn, was Demokratie bedeutet. Stolz erklärt ihm der Verfasser: »Das habe ich in einem Wörterbuch nachgeschlagen und es bedeutet, dass das Volk sich selbst betreut.« Der Philosophiestudent gibt sich damit aber nicht zufrieden und sagt, dass verschiedene Wörterbücher wohl unterschiedliche Definitionen enthalten. Außerdem ändern sich die Begriffsinhalte ja dauernd; die alten Griechen zum Beispiel hatten eine ganz andere Art von Demokratie: Nur ein begrenzter Kreis von Leuten durfte damals mitreden. Also ein Wort wie Demokratie hat mehrere Definitionen, man macht sich einfach seine eigene Vorstellung! Die zwei Studenten beenden nicht gerade freundschaftlich ihre Unterhaltung, nachdem der Philosophiestudent, kritisch veranlagt, aber diplomatisch nicht sehr begabt, mehrere derartige Fragen abgefeuert hat.
Aus diesem Gespräch kann man mehrere Schlussfolgerungen ziehen. Eine ist ganz klar: Die Philosophie fragt immer weiter, bis die zutreffende Wahrheit oder die berechtigten Zweifel eindeutig klar festgestellt sind. Das kann manchmal einen langen Weg bedeuten, denn Unwahrheiten tarnen sich oft als Wahrheit, wie Friedrich Nietzsche schreibt: »Die Wahrheiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie welche sind« (4). Der Prüfstein der Wahrheit ist immer die Logik; jeder Gedankenschritt soll logisch aus dem vorhergehenden folgen und für jeden nachvollziehbar sein.
Der Baum
Für René Descartes steht der Baum für die Entwicklung der Wissenschaft. Der Stamm, woraus alles entstanden ist, bildet die Philosophie ab. Sie ist gewissermaßen die tragende Kraft für die unterschiedlichen Wissenschaften, die, ähnlich wie die Äste, wachsen und Früchte tragen.
In diesem surrealistischen Bild ist der Baum angesägt: Der Philosoph hat die Saftströme durch den Stamm unterbrochen und etwas Neues hingelegt: ein Ei. Ein Versprechen für neues Leben und neues Denken. Der Stamm ist nicht ganz durch, der Baum wird weiter wachsen, aber etwas anders als vorher.
Wenn Philosophen es sich abgewöhnen könnten, schnell in ihre Fachsprache zu flüchten, würden sich sehr viel mehr Menschen für ihre Fragen interessieren. Denn es macht richtig Spaß, die Wahrheit zu suchen, auch wenn es sie mal nicht gibt, denn die Suche kann schon lehrreich sein. Die Philosophie hat also keinen guten Ruf, aber hat sie trotzdem ihren Nutzen? Auf der persönlichen Ebene, würde ich sagen, gibt es drei Vorteile, die sich alle auf Klarheit im Denken beziehen. Man bekommt erstens Klarheit über die eigenen Überzeugungen: Woran glaube ich und warum? Zweitens weiß man besser, ob die eigenen Überzeugungen rational zu rechtfertigen sind; kann man seine Überzeugungen verständlich anderen vermitteln? Drittens kann man überprüfen, ob seine Überzeugungen konsistent sind; sie wachsen über mehrere Jahre und anlässlich unterschiedlichster Ereignisse, oft ist es ein unbewusstes Geschehen. Man muss sozusagen manchmal einfach »aufräumen«.
Und der Nutzen für die Wissenschaft? Erinnere dich an Demokritos; seine Idee über die Materie war und ist immer noch der Anstoß für viel Forschungsarbeit. Um unsere Einsichten, entweder persönliche oder allgemein geteilte, weiter zu vertiefen, braucht man einfach die richtige Fragen, über das eigene Fachgebiet oder Fragen, die über die eigenen Interessen hinauswachsen. Kurz gesagt: Wissenschaft ohne Philosophie ist richtungslos, Philosophie ohne Wissenschaft ist blind. Richard Feynman (1918–1988), ein bekannter Physiker, auf den wir noch zu sprechen kommen, hat mal gesagt:
»Wir müssen unbedingt Raum für Zweifel lassen, sonst gibt es keinen Fortschritt, kein Dazulernen. Man kann nichts Neues heraus-finden, wenn man nicht vorher eine Frage stellt. Und um zu fragen, bedarf es des Zweifelns.«
Wissenschaftler und Philosophen schlagen sich öfter mit scheinbar unlösbaren Problemen herum. Sich außerhalb des eigenen Fachgebietes zu begeben würde helfen, ist aber nicht einfach, die Spezialisierung schreitet immer weiter fort. Wenn es schon kaum möglich ist, die eigene Disziplin zu überblicken, ist ein Ausflug in andere Wissenschaften oder Denkrichtungen zu vergleichen mit einer Reise ohne jegliche Navigation: höchst interessant diese neuen Landschaften, aber die Reise ist wenig zielgerichtet, wenn man die Wahrheit näher kennenlernen möchte. Eine Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams würde sicherlich helfen den Horizont auf das notwendige Maß zu erweitern. Darüber hinaus spricht jede Disziplin ihre eigene Fachsprache, von Missverständnissen zwischen Philosophen und Wissenschaftler wegen der vermeintlichen unterschiedlichen Denkweisen ganz zu schweigen. Ich betrachte es als meine Aufgabe, komplizierte Probleme so einfach wie möglich darzustellen und die Theorien der Philosophie ohne Fachbegriffe zu erklären, damit Lesbarkeit und Verständlichkeit gewährleistet sind. Damit es dem Leser nicht geht wie Johann Wolfgang von Goethe, wenn er sagt:
»Es ist mir in den Wissenschaften gegangen wie einem, der früh aufsteht, in der Dämmerung die Morgenröte, sodann aber die Sonne ungeduldig erwartet und doch, wie sie hervortritt, geblendet wird.« (5)
Was übrigens hilft, ist, die Sache mit Humor zu betrachten. Humor ist eine ausgezeichnete Hilfe, um sich selbst und seine Tätigkeiten zu relativieren. Lachen ist gut für die Gesundheit, schafft Abstand zu unangenehmen Erfahrungen und stärkt das Gefühl der Gemeinsamkeit. Auch beim Lernen hilft Humor die Aufmerksamkeit zu fördern: Komische Sachen bleiben einfach länger im Gedächtnis. Und, wer lacht nicht gerne? Der Humor ist sowieso ein wesentlicher Bestandteil dieses Buches. Anekdoten über die Forscher, die Beschreibung von irrem Verhalten elementarer Teilchen, Theorien, die sich widersprechen, das alles sind nicht nur amüsante Ereignisse, sie sind bekanntermaßen sehr lehrreich. Ab und zu muss Zeit sein für einen kleinen Witz, zum Beispiel die folgende Geschichte: Drei Wissenschaftler beobachten einen Bus mit zehn Passagieren. Wenn der Bus anhält, steigen aber elf Passagiere aus. Der Biologe wird sagen: »Die haben sich unterwegs vermehrt.« Der Physiker sagt: »Ach, eine Messungenauigkeit von 10 %, was soll’s.« Der Mathematiker: »Wenn einer wieder einsteigt, ist der Bus leer.«
In diesem Buch werden Wissenschaft und Philosophie in ihrem Zusammenhang betrachtet, wobei interessante Einblicke erörtert werden, um den Akteuren als Person kennenzulernen. Versucht wird, die Untersuchung oder Entdeckung in einem größeren Rahmen zu platzieren. Als Wissenschaftsbereiche kommen vor: die Evolutionstheorie, die Physik und Quantenmechanik, die Mathematik, die Astronomie und die Hirnforschung in Beziehung zur künstlichen Intelligenz. Nicht zufällig sind das alles Gebiete, wo grundlegende Forschung betrieben wird und die Philosophie eine bedeutende Rolle spielt oder spielen könnte. Dass man im Umgang mit Philosophen immer den gesunden Menschenverstand bewahren sollte, zeigt die folgende Geschichte. Ein Philosoph wird von seinem Kollegen eingeladen. Der Gastgeber fragt: »Kaffee oder Tee?« Er bekommt (nach einer langen Pause) als Antwort: »Kaffee regt an zum Nachdenken, und bekannt ist, dass beim Denken viele Fehler gemacht werden, was meines Erachtens zur heutigen katastrophalen Lage der Menschheit geführt hat. Also lieber Tee.«
Natürlich werden beim Denken viele Fehler gemacht, und weil man erwarten darf, dass Philosophen viel denken, liegt es in der Logik, dass Philosophen sodann viele Fehler machen. Betrachte es als einen Hinweis, sich bescheiden zu geben. In dem Kapitel über das Denken in Philosophie und Wissenschaft werden die Quellen der Denkfehler noch ausführlich diskutiert.
Der Surrealismus
Mancher denkt, die Kunst sei gerade der Bereich, wo der Mensch sich von den Tieren unterscheidet; in der Kunst muss man sich Vorstellungen machen von dem, was nicht direkt vorhanden ist und man muss über Kreativität verfügen, um seine Anschauungen und Gedanken zum Ausdruck bringen zu können. Wir werden dieses Thema weiter vertiefen, aber im Moment ist schon klar, dass wir uns in der Kunst als Spezies besser kennenlernen können. Während einer illustrierten Wanderung erwartet man, ab und zu einer Abbildung zu begegnen. Eine Art Atempause und Anregung zum Überdenken. Manchmal übernimmt das Lesen eines Buches die gleiche Eigenartigkeiten wie das Leben selbst: Man verliert sich in Buchstaben, Begriffen und Sätzen, ohne die tiefere Bedeutung zu erfassen. Wir lassen uns mitführen von unserem Unwissen und unserem Verlangen, diesem Unwissen ein Ende zu setzen. Die Befriedigung unserer Neugier kann aber niemals dauerhaft sein, denn es kommen immer wieder neue Fragen auf. Man könnte es vergleichen mit der Unmöglichkeit, den Weltwillen zu befriedigen, ein Thema, das Arthur Schopenhauer (6) zum Kern seiner Philosophie gemacht hat. Das Einzige, meint er, womit man Dürftigkeit, Mangel und Leiden überwinden kann, ist die Kunst. Die Kunst ermöglicht uns, dem Weltwillen vorübergehend zu entkommen und sich von sich selber, seiner inneren Idee bewusst zu werden. Analog hoffe ich, dass der Leser sich seiner Neugier widersetzen kann, indem er regelmäßige Pausen einlegt, mindestens dann, sobald er auf ein Bild stößt.
Ich habe surrealistische Illustrationen gewählt. Surrealistisch bedeutet: »über die Wirklichkeit hinaus«. Vor fast hundert Jahren ist die surrealistische Bewegung in Frankreich gegründet worden und hat seitdem einen festen Platz in der Kunstszene erobert. Im Surrealismus haben viele berühmte Künstler ihre Ideen und Träume zum Ausdruck gebracht: Max Ernst, René Magritte, Salvador Dalí, Joan Miró und Alberto Giacometti, um einige Beispiele zu nennen. Als Nachfolger des Dadaismus (7) hat der Surrealismus die freie Kreativität in das Zentrum des künstlerischen Schaffens gestellt, wobei der Rebellion, dem Zufall, der Ironie und dem Spiel führende Rollen zugeteilt wurden. Die vertraute Harmonie und die gängige idealisierende Lüge über die Wirklichkeit sollten beseitigt werden, um Platz zu bekommen für neue Verbindungen. Unsere Gesellschaft ist nicht gerecht, unser Zusammenleben nicht immer harmonisch, die Welt kann schon übel sein. Den Surrealismus kann man also ebenfalls als sozialkritische Kunstrichtung begreifen. Manchmal entfernen die Künstler sich sogar ganz von der förmlichen Malerei und werden damit zum Vorläufer der Performance Art und der Konzeptkunst. Dieser Charakter des Surrealismus ist genau das, was ich auch bezwecken möchte: mit surrealistischen Bildern das Bewusstsein zu erweitern, nicht ohne kritisch zu hinterfragen, die sich darstellende Wirklichkeit als wahr und unumgänglich anzunehmen, sondern zu versuchen, zusätzliche Freiheitsgrade zu öffnen und neue Perspektiven zu erkunden. Wenn man sich surrealistische Bilder anschaut, ist man gezwungen ausgetretene Pfade zu verlassen, um zusammen mit dem Künstler neues Gebiet zu entdecken, wobei entdecken eigentlich geschrieben werden soll als »entdecken«; ein Verb, für das man sich Zeit nehmen sollte. Ein surrealistisches Gemälde versucht immer eine Geschichte zu erzählen, manchmal einfach komisch, manchmal kritisch, weil bestimmte Ideen und Objekte zusammengefügt werden, die in erster Linie nicht zusammengehören. Oder weil die uns so vertrauten Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden. So wird eine neue Welt geschaffen, eine alternative Welt, nicht die unsere, sondern eine vorstellbare. Ob die besser oder schlechter ist, soll der Betrachter herausfinden.
Ist dieses Entdecken nicht in gleicher Weise das Ziel von wissenschaftlicher Forschung? Und versucht die Philosophie nicht ebenfalls das Verständnis für die Welt zu verbessern, indem sie neue Hypothesen über Wahrheit und Wirklichkeit poniert? Philosophieren sollte man am besten mit geschlossenen Augen: unabhängig von momentanen Eindrücken, manchmal sogar unabhängig von der üblichen Sprache, mit der wir unsere Auffassung zum Ausdruck bringen. Die hiermit entstandenen, manchmal absurden und traumhaften Ideen bewirken genau das, was der Surrealismus bezweckt: die herrschenden Auffassungen in Frage stellen, es gilt das Neue zu entdecken. Kann man Wissenschaft auch mit geschlossenen Augen betreiben? Manchmal schon; wenn es darum geht, den richtigen Ansatz zu finden oder um ein Experimentierergebnis richtig zu interpretieren. Die besten Ideen hat man in den unmöglichsten Momenten, eher nicht, wenn man sich als Naturforscher konzentriert im Labor beschäftigt. Dann liegt die Priorität bei den kurzfristigen Zielen: Die Arbeit soll fertiggebracht werden, die Ergebnisse sollen auf den Tisch, die Veröffentlichung soll rechtzeitig verschickt werden. Für gute Ideen braucht man die richtige Mischung aus Zeit und Abstand. Wissenschaft bedeutet oft, festen Regeln zu folgen, aber manchmal hindern diese Regeln uns daran, den Durchbruch zu erzielen. Die genialen Gedanken entstehen nicht, wenn wir wie besessen Experimente durchführen, nein, sie entstehen, wenn wir ruhig sind, Abstand nehmen, beschaulich sein können: surreal sein können. Diese Gedanken sind anfangs anarchistisch, satirisch, gewagt und wenig begründet. Wenn man sich Zeit lässt, können sie sich entwickeln, und manchmal findet man tatsächlich festen Boden und Anschluss. Dann hat man, kurz gesagt, etwas Neues entdeckt.
Dem Leser wird geraten dieses Buch bei Zeit und Weile auch »mit den Augen zu« zu lesen. Erst dann können sich neue Ideen entwickeln, der Keim braucht einfach seine Zeit. Die Bildbeigaben können ein guter Anlass sein, das Buch während des Lesens mal zu schließen, um seine Meinungen zu überdenken. Erst dann kann mein Ziel erreicht werden, nämlich den Leser zum Nachdenken anzuregen und seine Perspektiven zu erweitern. Es gilt immer noch: Die beste Perspektive ist die Perspektive, die man selbst entdeckt hat.
Das Gesamtkunstwerk
Wien, während der Zeitenwende vom neunzehnten zum zwanzigsten Jahrhundert, war wie ein Braukessel, in dem Künstler aller Art zusammenlebten und arbeiteten. Dort lebte Sigmund Freud (1856–1939) als Psychoanalytiker, der als Erster die humane Psyche auf wissenschaftliche Weise analysiert und beschrieben hat. Der Wiener Kreis, eine Gruppe Philosophen und Analytiker, zieht auch heute noch seine Spuren durch die Welt des Wissens und Denkens. Ludwig Wittgenstein (1889–1951), der ebenfalls als Architekt tätig war, schrieb 1921 seine Abhandlung »Tractatus logico-philosophicus«, ein Meilenstein der analytischen Philosophie.
Die Verbindung von Architekten, Musikern, Denkern, Mathematikern und Kunstgewerblern führte zu einer gegenseitigen Inspiration. Es herrschte eine Vielseitigkeit an Gedanken, Ideen und Überzeugungen und gerade das führte zu einer großen Kreativität. Künstler, Wissenschaftler und Philosophen wagten sich über ihre vermeintlichen Grenzen hinaus und erkundeten neue Bereiche. Die Konfrontation mit anderen Fachbereichen fügte etwas Neues an das eigene Werk hinzu: Es wurde erweitert, manchmal entstand sogar ein Gesamtkunstwerk. Ein schönes Beispiel bietet das Ausstellungsprojekt von Josef Hoffmann in der Wiener Secession. Das Gesamte ist ein vorzügliches Kunstwerk mit Beiträgen von Gustav Klimt und Max Klinger in einem Ausstellungsgebäude, das selbst schon ein Kunstwerk genannt werden kann. Die Idee des Gesamtkunstwerks ist jedoch schon viel älter und geht zurück in die Romantik. Die Romantik hat viele Erscheinungsformen, was sie ständig verbindet, ist eine Sehnsucht nach Natur, manchmal unheimlich in der Form von Mooren und dunklen Wäldern, aber immer geprägt von einem Wunsch, Grenzen zu sprengen, Grenzen zwischen Wissenschaft und Kunst, zwischen Wissenschaft und Philosophie. Was diese beiden letzten Begriffe bedeuten, wird in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben, was Kunst bedeutet, ist eine viel schwierigere Sache. Unter dem Namen »moderne Kunst« werden ab und zu die merkwürdigsten Sachen kreiert. Schulterzucken und Kopfschütteln sind keine selten gesehenen Reaktionen. Dennoch lohnt es sich nicht selten, länger bei diesen Kunstäußerungen zu verweilen. Es gibt noch einen Grund, sich mal in die Gedankenwelt des Künstlers zu vertiefen, denn manches Kunstwerk ist nicht, was es scheint. Weil wir ja doch in Wien verbleiben, nehme ich als Beispiel das 1909 entstandene Gemälde »Der Kuss« von Gustav Klimt. Wahrscheinlich sein bekanntestes und berühmtestes Werk. In erster Instanz sieht man einen Mann und eine Frau, die sich liebevoll umarmen. Die Goldtöne verdeutlichen die Liebe zwischen Mann und Frau, eine fast unendliche Liebe. Bei näherer Betrachtung sieht man jedoch, wie der Mann die Frau mit seiner Körperhaltung unterwirft. Außerdem fällt plötzlich auf, dass die beiden vor einem Abgrund stehen: Vielleicht ist die Liebe doch nicht so dauerhaft, wie wir denken. Ohnehin scheint die persönliche Identität der Geliebten komplett zu verschwinden, es gibt eigentlich nur noch eine Verschmelzung der beiden Körper. Wollte Klimt uns bewusst darauf hinweisen? Die Popularität des Werks ist aus diesen Widersprüchlichkeiten und verborgenen Mitteilungen gut zu erklären. Kunst- und Kulturwissenschaftler werden sich noch mehrere Generationen in Spekulationen über dieses Gemälde verlieren.
Muss Kunst heutzutage schockieren, um Aufmerksamkeit zu erregen, oder ist eine Anregung zum Nachdenken ausreichend? Ich meine, das Überdenken aufgebauter Vorurteile ist die eigentliche Aufgabe des Kunstwerks. Welchen Weg der Künstler geht, sollte ihm überlassen sein: ob ästhetisch, hässlich, überraschend, konfrontierend oder schockierend. Kunst gedeiht nur, wenn es keine erstickenden Regeln gibt. Ist man nur dann Künstler, wenn man eine bezügliche Berufsausbildung absolviert hat? Francis Bacon, Vincent van Gogh und Max Ernst bezeugen das Gegenteil. Nicht selten begrenzt eine berufliche Lehrzeit die ursprünglich veranlagte Kreativität, indem sie zu viel Regeln und Techniken übermittelt. Der Weg, der zur Kunst führt, ist ein ganz persönlicher und enthält verschiedene Meilensteine. Am Anfang steht die Art und Weise, wie eine Vision oder etwas Wahrgenommenes transformiert wird in etwas, das gedacht wird. Demnächst wird der Gedanke erweitert oder eingeschränkt, werden Beziehungen gelegt und entsteht ein ganz persönliches Verständnis, das wiederum transformiert wird, um es zum Ausdruck bringen zu können. Das Denken spielt also in der Kunst eine zentrale Rolle und sie gehört deshalb wohl auch zur Welt des Denkens und Wissens. Aus wissenschaftlichem und kreativem Denken kann eine neue Harmonie entstehen, wobei die zusammengestellten Komponenten einander verstärken. Manchmal entsteht dann sogar etwas, das man als Gesamtkunstwerk bezeichnen kann. Der Wiener Kreis kreiselt immer weiter …
Verweisungen und Noten aus diesem Kapitel:
(1) René Descartes, französischer Philosoph, Mathematiker und Naturwissenschaftler (1596–1650). Er gilt als Gründer des modernen Rationalismus.
(2) Ein »String« (deutsch: »Saite«) ist ein Kandidat für die elementaren Bausteine von allem, das sich auf der Erde und im ganzen Weltall befindet. In der Physik der Elementarteilchen spricht man dementsprechend über die Stringtheorie.
(3) Mittlerweise hat man festgestellt, dass es eine kleinste Maßeinheit gibt, die sogenannte Plancklänge. Wird diese Länge unterschritten, dann hat der Begriff »Länge« keine Bedeutung mehr. Eine Plancklänge ist unglaublich klein und misst ungefähr 1,6*10-35Meter, das heißt 0,0000 … 000016 Meter (insgesamt stehen 34 Nullen zwischen dem Komma und der 16, denn 10-1=0,1; 10-2=0,01 usw.). Es hört also auf, es gibt keine Unendlichkeit in der Richtung von immer kleiner.
(4) Achte bitte darauf, dass Nietzsche den Plural benutzt, es gibt seines Erachtens also mehrere Wahrheiten. Ob das tatsächlich immer der Fall ist? Wir werden es sehen.
(5) Johann Wolfgang von Goethe, Maximen und Reflexionen 372 (aus einer Spruchsammlung, 1833 posthum erschienen).
(6) Arthur Schopenhauer: »Die Welt als Wille und Vorstellung« (1819).
(7) Dadaismus: eine Bewegung in der Kunstwelt, 1919 gegründet, die sich widersetzt gegen die üblichen gesellschaftlichen Werte. Kunstwerke des Dadaismus sind oft ironisch oder satirisch gemeint. Statt Disziplin und Tradition wird eine Art Anti-Kunst propagiert, geprägt von Revolte und Provokation.
Das Denken in Philosophie und Wissenschaft
Bevor wir loslegen und uns auf teils unbekannte Pfade begeben, sollten wir unsere Vorbereitungen treffen. Wir werden mehrere Tage unterwegs sein, komplett auf uns selbst gestellt, nur die Übernachtungen sind schon reserviert. Die Reise führt uns durch mehrere Landschaften: ein Wald, eine offene Landschaft mit weiten Ausblicken, ein Delta mit Flüssen und Mooren, hohe Berge und tiefe Täler und zum Abschluss als große Herausforderung eine Nachtwanderung bis zum Morgengrauen. Wanderungen wie diese sollte man nicht allein zurücklegen; man braucht eine Gesellschaft, um seine Eindrücke zu teilen und Kommentare von anderen anzuhören. Deshalb hat sich eine Gruppe von Interessierten zusammengestellt, alle neugierig auf neue Erfahrungen. Jeden Tag wird einer von uns die Reiseführerschaft auf sich nehmen. Jemand, der sich einigermaßen zuhause fühlt in dem Thema des Tages und uns aufmerksam machen kann, wo immer es sich die Mühe lohnt. Wir müssen fit sein und hoffen, dass es unterwegs keine ernsten Verletzungen geben wird, aber das Wichtigste ist, dass wir mit einem offenen Herzen unterwegs sind. Denn wir werden uns wundern; über neue Entdeckungen und die Art und Weise, wie sie zustande gekommen sind und über die Artgenossen, die in diesem Vorgehen eine Rolle gespielt haben. Wir werden das Phänomen »Mensch« besser kennenlernen: seine Besessenheit und Starrköpfigkeit, seine Vorurteile und die Mühe, die er sich gibt trotzdem logisch zu denken. Um das alles richtig zu bewerten, sollten wir uns Gedanken machen, wie gut wir, die Reisenden, in der Lage sind, einwandfreie Urteile zu bilden. Vielleicht werden wir herausfinden, dass ein einwandfreies Urteil eine Unmöglichkeit ist. Das zu wissen, könnte schon die beste Vorbereitung auf unsere Wanderung sein.
»Unabhängigkeit im Denken ist das erste Zeichen der Freiheit. Ohne sie bleibst du ein Sklave der Umstände« (1). Freiheit braucht jeder, denn Freiheit ist ein Wahrzeichen des Menschseins. Sich zu ermächtigen richtig und einwandfrei zu denken, sollte genau genommen das erste Gebot sein.
Man könnte denken, dass der Mensch denken kann, aber es gibt keine humane Tätigkeit, wobei so viele Fehler gemacht werden wie beim Denken. Man könnte meinen, dass schon ausreichend viel gedacht wird, denn es kommt ja auf die Taten an! Sicher, aber ob die Taten richtig sind, sollte vorher gedacht werden. Vielfach kann man feststellen, dass viel zu wenig nachgedacht wird; man übernimmt »un-nach-denk-lich« die Meinungen anderer und findet es einfach zu anstrengend, eine eigene Meinung zu entwickeln. Oder man findet, dass es schon zu viele unterschiedliche Meinungen gibt und man deshalb nicht weiterkommt. Oder das Problem sei ja ohnehin nicht lösbar. Es gibt immer scheinbar gute Gründe nicht nachzudenken, aber meistens betrifft es geistige Faulheit und einen Mangel an Mut. Manchmal denke ich, die Zeit der Aufklärung hat nie stattgefunden, obwohl der Philosoph Immanuel Kant uns mit seinem Aufsatz unter dem Titel »Was ist Aufklärung« deutlich die Ohren gewaschen hat. Kant fängt schon unmittelbar an klarzumachen, was er meint: »Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit« (2). Wenn wir nicht nachdenken, sind wir selbst daran schuld, unmündig zu sein. Da gibt es keine Entschuldigung: Wage es, selbst zu denken (»sapere aude«, wie schon die alten Römer sagten).
Um zu verstehen, weshalb unser Denken problematisch ist, kann eine kleine Reise durch die Entstehungsgeschichte des humanen Gehirns und damit des Denkens hilfreich sein. Die Entwicklungsgeschichte unserer Spezies wird in dem Kapitel über die Evolution weiter besprochen. In dem Teil über künstliche Intelligenz (Roboter und Co) werden wir das Gehirn weiter untersuchen, um festzustellen, wo der Unterschied liegt zwischen menschlichem und künstlichem Denken.
Es ist ein Irrtum zu meinen, dass der Mensch das größte Gehirn aller Säugetiere hat: Elefanten und bestimmte Walarten haben viel mehr Nervenzellen. Der Unterschied liegt nicht in der Quantität, sondern in der Qualität, Albert Einstein zum Beispiel hatte ein sehr leichtes Gehirn, fast 10 % leichter als der Durchschnitt. Besonders die Nervenzellen, die in Verbindung gebracht werden mit Emotionen, dem Kontrollieren von Impulsen und dem Organisieren und planmäßigen Handeln, haben sich bei Menschen viel ausgeprägter entwickelt. Man meint aus der Evolution ableiten zu können, wie das Gehirn sich während der Transformation vom Homo erectus bis zum Homo sapiens entwickelt hat. Man spricht dann über einen Zeitraum, der vor ungefähr 1,7 Millionen Jahren angefangen hat. Weil der Homo erectus, der aufrechtgehende Menschartige, Zugang hatte zu hochwertiger Nahrung, konnte das Gehirn sich weiterentwickeln. Das Hirn verbraucht viel Energie, durchschnittlich 20 % des gesamten Energieverbrauchs des Körpers, deshalb ist es wichtig, dass da beträchtliche evolutionäre Vorteile gegenüberstehen. Als die Vorgänger des Homo erectus, die Australopithecinen, den Wald verließen, kamen andere Bedürfnisse auf sie zu. Sie konnten wahrscheinlich schon aufrecht gehen, mussten ab dann aber größere Entfernungen bei der Jagd einschätzen und lernen, dass Zusammenarbeiten zu besseren Ergebnissen führt. Diese Umstände führten zu manchmal sprunghaften Entwicklungsstufen des Gehirns in den Bereichen Motorikbeherrschung, Wahrnehmungsverarbeitung und Sprachentwicklung.
Derartige Entwicklungen bedeuten nicht, dass alte Fähigkeiten plötzlich verloren gehen; letztlich tragen wir heute noch Reflexe in uns, die eine lange Geschichte von Tausenden Jahren haben. Wenn wir zum Beispiel in eine Notlage geraten, reagieren wir reflexartig wie in Zeiten der Neandertaler: sich verstecken, flüchten oder kämpfen. Nachdenken nimmt dann zu viel Zeit in Anspruch, man muss in der Lage sein, sofort die richtige Entscheidung zu treffen, um nicht als Beute für Raubtiere zu enden. Viele Reflexe, abgespeichert im Hirnstamm und Kleinhirn, spielen heute noch eine Rolle, nicht um vor Raubtieren zu flüchten, wohl eher um gefährliche Situationen im Verkehr meistern zu können. Interessanterweise spielen gedankliche Reflexe in tagtäglichen Situationen eine größere Rolle, als man erwartet. Mancher Denkfehler ist darauf zurückzuführen. Daniel Kahneman hat in seinem Buch »Thinking, fast and slow« einige markante Beispiele gesammelt, ich werde eines davon nacherzählen. Versuche mal binnen fünf Sekunden die folgende Rechenaufgabe (3) zu lösen: Ein Tischtennisschläger und ein Bällchen kosten zusammen 10,10 Euro. Der Schläger kostet 10 Euro mehr als das Bällchen. Wie viel kostet das Bällchen? Fast jeder gibt die falsche Antwort: 0,10 Euro. Wenn man aber genau nachliest und rechnet, kommt man auf die richtige Antwort: 0,05 Euro. Offensichtlich gönnen wir uns die Zeit nicht, um richtig zu lesen und nachzudenken und das passiert öfter, als man denkt. Was uns allen obendrein öfter passiert, ist die Tatsache, dass wir aufgrund unzureichender Information uns trotzdem in die Lage versetzen, eine plausible Geschichte zu konstruieren und diese für wahr zu halten. Beispiele kann man tagtäglich im Aktienhandel erleben. Wenn einer verkaufen will, kann dieses Vorhaben nur durchgesetzt werden, wenn ein anderer kaufen will. Beide, darf man annehmen, sind rational denkende Personen, die glauben Gewinn zu erzielen, wenn sie die Transaktion durchsetzen. Beide haben also eine eigene Geschichte konstruiert, teilweise basierend auf Fakten, teilweise auf Einschätzungen und Emotionen, woran so fest geglaubt wird, dass große Summen Geld aufs Spiel gesetzt werden. Wir finden es wichtiger, eine Erklärung zu haben oder eine Meinung zu äußern, damit wir handeln können, als zuzugeben, dass uns unzureichende Informationen zur Verfügung stehen. Warum werden viele Pläne nie Wirklichkeit? Weil wir hauptsächlich an unser Ziel denken und zu wenig an die Risiken. Denn Ziele sind klar und wichtig, Risiken sind zahlreich, aber unklar und öfters unwahrscheinlich. Außerdem ist es unangenehm, ständig daran zu denken, wie unsere Vorsätze misslingen könnten. Unser Hirn hat offensichtlich viel Mühe, mit Unsicherheiten umzugehen, gerne vereinfachen wir die Lage, um schnell unsere Aufgabe zu erfüllen.
Als Erklärung für solche Fehler unterscheidet Kahneman zwei Denksysteme innerhalb unseres Gehirns: System 1, das intuitiv und schnell zu Schlussfolgerungen kommt, die leider manchmal falsch sind, aber wenig Anstrengung erfordern, und System 2, das viel langsamer funktioniert, aber in der Lage ist, all unsere Intelligenz zu mobilisieren (4). Selbstverständlich liefert System 2 viel bessere Ergebnisse, aber öfter gönnen wir uns einfach die Zeit und die Mühe nicht, um System 2 einzusetzen. Das hat so seinen Grund: Wir sind alle durch der Evolution so programmiert, dass wir Energie sparen, wo immer wir können. Es muss also einen deutlichen Grund geben, um System 2 zu aktivieren, wenn nicht, dann sollten wir System 1 einfach vertrauen. Nichtsdestotrotz funktioniert selbst System 2 nicht immer einwandfrei; wir machen Denkfehler, weil wir Vorurteile pflegen, weil wir es nicht besser wissen oder weil wir falsch argumentieren.
Vorurteile haben immer etwas Negatives in sich; man gibt sich nicht die Mühe, etwas zu ergründen, und sucht sich einfach die bequemste Antwort oder Lösung aus. In vielen Fällen stimmt das auch, man muss realisieren, dass wir nicht jederzeit alles nachprüfen können, in vielen Fällen sind wir gezwungen, die Lage aufgrund unvollständiger Informationen einzuschätzen. Daran ist nichts Falsches, man sollte nur vermeiden, immer wieder dieselben Denkmuster zu wiederholen, denn die Folge wäre, dass sich ein Muster festigt, das wir nicht mehr loswerden. Wichtig ist außerdem, dass man die Grenzen seines Wissens richtig einschätzen kann. Viele Menschen neigen dazu, sich zu überschätzen, und meinen viel mehr zu wissen und zu verstehen, als wirklich der Fall ist. Wenn man zum Beispiel im Internet etwas zusammengesucht hat, heißt das nicht, dass man Bescheid weiß. Der Psychologe David Dunning, der dieses Phänomen untersucht hat, sagt: »Wir alle sind selbstsichere Idioten« (5)