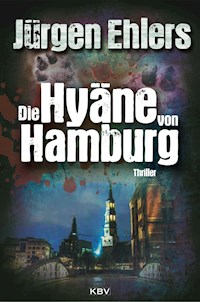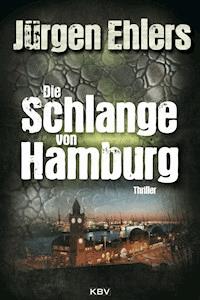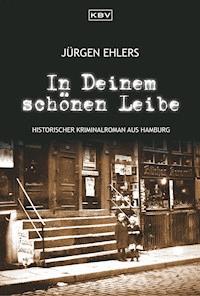Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Berger
- Sprache: Deutsch
Du kannst lügen, aber du kannst die Wahrheit nicht töten In einem Teich bei Hamburg wird 1947 in einem Seesack die nackte Leiche eines unbekannten Mannes gefunden. Kommissar Wilhelm Berger wird mit den Ermittlungen betraut. Handelt es sich womöglich um das fünfte Opfer des sogenannten "Trümmermörders", wie Bergers Vorgesetzter glaubt? Niemand scheint den Toten zu vermissen. Aber dann meldet sich eine Zeugin, und in einem Haus unweit des Teiches werden Blutspuren gefunden. Bergers Assistent glaubt an eine klassische Dreiecksgeschichte. Aber warum lügen alle Beteiligten? Jürgen Ehlers verfasste diesen Roman nach Motiven eines bekannten Kriminalfalls der Nachkriegszeit, der 1963 unter dem Titel "Das Haus an der Stör" für die berühmte Fernsehreihe "Stahlnetz" verfilmt wurde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Bisher vom Autor bei KBV erschienen:
Mann über Bord
Mitgegangen
Neben dem Gleis
Die Nacht von Barmbeck
In Deinem schönen Leibe
Blutrot blüht die Heide
Hamburg Krimi-Reiseführer
Nur ein gewöhnlicher Mord
Der Wolf von Hamburg
Die Hyäne von Hamburg
Die Schlange von Hamburg
Abmurksen und Gin trinken
Jürgen Ehlers wurde 1948 in Hamburg geboren und lebt heute mit seiner Familie auf dem Land. Seit 1992 schreibt er Kurzkrimis, die in verschiedenen Verlagen im In- und Ausland veröffentlicht wurden, und ist Herausgeber von Krimianthologien. Er ist Mitglied im »Syndikat« und in der »Crime Writers’ Association«. Sein erster Kriminalroman Mitgegangen wurde in der Sparte Debüt für den Friedrich-Glauser-Preis nominiert.
Jürgen Ehlers
Im Haus der Lügen
Originalausgabe
© 2019 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim
www.kbv-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0 65 93 - 998 96-0
Fax: 0 65 93 - 998 96-20
Umschlaggestaltung: Ralf Kramp
unter Verwendung von © LIGHTFIELD STUDIOS und © tiena
beide Fotolia.de
Lektorat: Volker Maria Neumann, Köln
Druck: CPI books, Ebner & Spiegel GmbH, Ulm
Printed in Germany
Print-ISBN 978-3-95441-454-3
E-Book-ISBN 978-3-95441-464-2
Inhalt
Waltraud Sievert
Januar 1947
Karl Kaufmann
Juni 1947
Vater Heine
März 1948
Nora Olafsen
Januar 1954
Peter Roeder
Oktober 1954
Wolfgang Trautwein
Oktober 1955
Dr. Hans Kolbe
November 1955
Cain
Ruth
Nachwort
Waltraud Sievert
Da war doch etwas! Waltraud Sievert schreckte aus dem Schlaf hoch. Irgendein Geräusch, das hier nicht hergehörte. Hatte sie vergessen, das Zimmer abzuschließen? Sie konnte sich nicht erinnern. Und jetzt – jetzt war es auf jeden Fall zu spät. Was immer es sein mochte, es war hier, bei ihr im Zimmer, ganz in der Nähe. Waltraud Sievert regte sich nicht. Auch ihr unheimlicher Besucher war jetzt ganz still. Hatte sie sich am Ende alles nur eingebildet?
Nein, da war es wieder. Ein ganz leises Scharren. Es kam vom Fußboden her. Und dann plötzlich ein lauter Schlag. Die Mausefalle war zugeschnappt.
Waltraud drehte den Lichtschalter. Sie zitterte am ganzen Körper. Ja, da war die Mausefalle, und da war die tote Maus, erschlagen, bevor sie noch das Stück Käse erreicht hatte. Sonst war niemand im Zimmer. Waltraud ging entschlossen zur Tür und drückte die Klinke herunter. Abgeschlossen. Alles in Ordnung. Die Tür war abgeschlossen.
Das Haus, in dem Waltraud Sievert wohnte, lag in Elmshorn, ganz am Ende der Ollnsstraße, eine halbe Stunde zu Fuß vom Stadtzentrum. Ein altes Haus, vor mehr als fünfzig Jahren gebaut. Die jetzigen Eigentümer, die Heines, hatten es vor dem Kriege gekauft.
Das Haus hatte drei Stockwerke. Im Erdgeschoss wohnte das Ehepaar Heine. Die oberen beiden Stockwerke hatten sie vermietet. Jetzt, nach Kriegsende, herrschte Wohnungsnot. Die Mieter wechselten rasch. Im ersten Stock wohnten unter anderem die Reumanns, die Witts, die Schneiders, aber mit denen hatte Waltraud Sievert nichts zu tun.
Im Dachgeschoss hatten John und Ruth Blaue eine kleine Wohnung bezogen. Ruth war die Tochter der Heines. In einer weiteren Dachkammer lebten zurzeit zwei junge Männer: Ernst Buchholz und Heinz Weinhold.
Waltraud Sievert, John Blaues Schwägerin, arbeitete für die Heines als Hausmädchen. Von irgendetwas musste sie ja leben. Sie war seit Kurzem geschieden. Hier bei den Heines hatte sie wenigstens Unterkunft und Verpflegung frei.
Es war schon spät. Waltraud Sievert schaltete das Licht aus. Doch bevor sie eingeschlafen war, gab es erneut ein Geräusch. Diesmal war es nicht bei ihr im Zimmer, sondern draußen auf der Treppe. Eine Tür schlug zu, und dann knarrten die Treppenstufen. Jemand fasste an ihre Türklinke, aber nichts geschah. Die Schritte entfernten sich.
Sie würde mit niemandem darüber reden. Sie würden behaupten, dass sie das alles nur geträumt habe. Alle wussten, dass sie Angst im Dunkeln hatte. Alle machten sich darüber lustig. John hatte sogar angeboten, mit ihr nachts in den dunklen Wald zu gehen, um ihr zu beweisen, dass es dort nichts gab, wovor man sich fürchten müsste. Sie hatte auch Angst vor John.
Wenn ihr jemand gesagt hätte, dass hier im Haus ein Mord passiere, sie wäre gestorben vor Angst.
Januar 1947
Kommissar Wilhelm Berger fror. Er war später als die meisten aus der Gefangenschaft heimgekehrt. Als er nach Hamburg zurückkam, war seine Stelle längst besetzt, und es hatte Monate gedauert, bis er wieder bei der Polizei arbeiten konnte. Das Gebäude am Karl-Muck-Platz war schlecht geheizt. Und dieser Winter war einer der kältesten seit Menschengedenken.
Es herrschte Frieden, und so, wie es aussah, gaben die Siegermächte allmählich einen Teil der Verantwortung für Deutschland an die Deutschen zurück. Die Bürgerschaftswahlen im Oktober 1946 hatten der SPD eine überwältigende Mehrheit gebracht. Dennoch hatte der neue Bürgermeister Max Brauer sich für eine Koalition mit den Freien Demokraten und den Kommunisten entschieden. In schweren Zeiten war es gut, wenn die Regierung eine breite Basis hatte.
Das neue Polizeipräsidium lag direkt gegenüber der Musikhalle. Das neunstöckige Gebäude hatte den Zweiten Weltkrieg ohne größere Beschädigungen überstanden. Die Unterbringung der Polizei in diesem Komplex war freilich ein Provisorium. Das Haus gehörte einer Versicherung, dem Deutschen Ring. Die Polizei war im neunten Stock untergebracht. Die dortigen Räumlichkeiten entsprachen nicht den Anforderungen an eine moderne Polizeibehörde, aber etwas Besseres war nicht zu haben. Sein Arbeitszimmer war kleiner als vor dem Krieg, und er musste es mit Pagels teilen. Pagels hatte dafür gesorgt, dass ein Foto des neuen Bürgermeisters die ansonsten kahlen Wände des Arbeitszimmers zierte.
Wilfried Pagels war der Einzige der Belegschaft, den Wilhelm Berger noch kannte. Ein kleiner, zäher Bursche, den sie 1939 als Ersatz für Fehlandt bekommen hatten. Ein Zyniker. Berger war es damals schwergefallen, sich an den neuen Mann zu gewöhnen, aber er hatte sehr rasch festgestellt, dass Pagels ein fähiger Kriminalist war. Außerdem war er jemand, der mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hielt, und wenn er mit irgendetwas nicht einverstanden war, dann machte er das sehr deutlich.
Bergers neuer Chef hieß Roeder. Er hatte zu Bergers Begrüßung eine Runde Kaffee spendiert, Muckefuck natürlich, etwas anderes gab es nicht. Er war deutlich jünger als er, aber im Gegensatz zu Berger war er inzwischen zum Oberkommissar befördert worden. Er wirkte etwas distanziert, aber wahrscheinlich war er kein schlechter Polizist. »Dann wünsche ich Ihnen jedenfalls, dass Sie sich rasch wieder eingewöhnen. Ich denke, wir werden gut zusammenarbeiten«, hatte er gesagt und sich anschließend in sein eigenes Zimmer zurückgezogen.
Als sich die Tür hinter ihm geschlossen hatte, zögerte Berger einen Moment lang. Dann fragte er: »War er in der Partei?«
»Später Mitläufer«, sagte Pagels. »Keine Probleme bei der Entnazifizierung. Aber die meisten anderen, die damals mit dabei waren, die sind entweder tot, oder sie mussten sich eine neue Arbeit suchen.«
»Was ist eigentlich aus Fehlandt geworden?«, wollte Berger wissen.
»Das weißt du nicht?«
»Ich habe keine Ahnung, Wilfried. Ich bin doch gerade erst wieder hier bei der Polizei gelandet. Das Letzte, was ich von Fehlandt gehört habe, war im Herbst 1939, da war er auf dem Wege der Besserung, jedenfalls hatte ich den Eindruck.«
Pagels zündete sich eine Zigarette an. Er sagte: »Auf dem Wege der Besserung – das ist eine Übertreibung. Es ist richtig, er fing wieder an, halbwegs normal zu funktionieren. Aber wer von der Gestapo gefoltert worden ist, der ist hinterher nie wieder vollkommen gesund geworden.«
»Das war eine verdammte Sauerei, was die Schweine mit ihm gemacht haben«, stellte Berger fest.
»Ja, Wilhelm, das war es.«
Das klang wie ein Vorwurf. Berger begriff, dass Pagels noch immer der Meinung war, dass er an Fehlandts Verhaftung nicht ganz unschuldig gewesen sei. »Und was macht er heute?«
»Er ist tot. Du weißt ja, dass sie ihn ins Archiv abgeschoben hatten. Und als die Bombenangriffe auf Hamburg im Ernst losgingen, da hat er sich freiwillig als Feuerwache gemeldet. Das habe ich selbst nicht miterlebt, ich war ja zu der Zeit längst bei der Luftwaffe, aber die anderen haben es mir berichtet. Bei jedem Angriff hat er auf dem Dach gestanden, mit ein paar Eimern voll Sand. Auch am 25. Juli 1943, als die Innenstadt abgebrannt ist. Es war von vornherein klar, dass die Lage für das Stadthaus aussichtslos war. Alles ringsumher brannte. Und Fehlandt, der stand als Letzter noch auf dem Dach, als einsamer Held, und er hat versucht, die Brandbomben, die er mit dem Sand nicht löschen konnte, herunterzuwerfen. Er war verloren. Am Ende war er selbst eine brennende Fackel. Das gesamte Stadthaus ist niedergebrannt. Alle Unterlagen vernichtet. Aus. Ende.«
»Es ging ihm um das Archiv«, mutmaßte Wilhelm Berger. »Er hat versucht, das Archiv zu retten.«
Pagels nickte. »Er hat geglaubt, er könnte nachweisen, dass der Anschlag auf den Gauleiter damals von Karl Kaufmann selbst inszeniert war. – Ich habe die Unterlagen gesehen, Wilhelm. Es waren Indizien, die er hatte, mehr nicht. Da hätte man ansetzen können, aber nach allem, was inzwischen passiert ist, würde das sowieso keiner mehr tun. Er ist umsonst gestorben. Wie so viele andere.«
»Und Kaufmann? Ich nehme an, den haben sie aufgehängt?«
Pagels lachte. »Sie haben ihn nicht einmal angeklagt, Wilhelm!«
»Was?«
»Wundert dich das? Er war doch immer beliebt bei den Hamburgern. Zum Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher in Nürnberg war er nur als Zeuge geladen. Er hat bei der Gelegenheit ausgesagt, dass er von der Reichskristallnacht gar nichts gewusst hat. Als man ihn schließlich ins Bild gesetzt hat, habe er, wie er sagt, den Unsinn bei sich in Hamburg sofort unterbunden. Im Krieg hat er dafür gesorgt, dass die armen, ausgebombten Hamburger neue Wohnungen gekriegt haben, indem er die Evakuierung der Juden beschleunigt hat. So hat er es genannt. Natürlich hatte er keine Ahnung, was dann mit den Juden passiert ist. Und Extra-Lebensmittelrationen nach den Bombennächten hat er auch durchgesetzt. Und schließlich hat er dafür gesorgt, dass Hamburg am Ende des Krieges kampflos übergeben wurde. Kurzum: Er war ein Wohltäter der Hamburger.«
»Das war er nicht«, widersprach Berger erregt. »Er war der oberste Nazi der Stadt, und alle Verbrechen, die die Nazis begangen haben, die gehen letzten Endes auf sein Konto.«
»Sagen wir so: Diejenigen, denen er genützt hat, die sind ihm heute noch dankbar. Und diejenigen, die die Nazis umgebracht haben, die beschweren sich nicht mehr. – Aber eigentlich wundere ich mich über dein hartes Urteil, Wilhelm. Bist du nicht auch ein Nutznießer deiner Beziehungen zum Gauleiter?«
»Wie kommst du darauf?« Wilhelm Berger war fassungslos. Er sah zu, wie Pagels einen Rauchring in die Luft blies. Schließlich sagte er: »Ich habe keine besonderen Beziehungen zu Karl Kaufmann. Mein Vater hat vor 1933 die Nazis finanziell unterstützt. Als sie schließlich an die Macht kamen, war mein alter Herr schon tot. Ich habe mit dem Gauleiter nichts zu tun gehabt.« Aber während er dies sagte, wurde ihm schlagartig bewusst, dass diese Darstellung seinem Wunschdenken entsprach. Wenn Karl Kaufmann nicht gewesen wäre, hätte er schon im Herbst 1933 den Polizeidienst quittieren müssen. Wenn Karl Kaufmann nicht gewesen wäre, hätte seine Tochter Susanne nicht nach Amerika auswandern können. Und wenn Karl Kaufmann nicht gewesen wäre, hätten Dagmar und Horst 1939 überhaupt gar nicht erst den Versuch unternehmen können, Deutschland zu verlassen.
Pagels lächelte. »Für einen Mann ohne Beziehungen bist du erstaunlich gut durchgekommen«, sagte er.
»Was meinst du damit?«
»Ich habe mich schon gewundert, als Fehlandt verhaftet worden ist, und als die Gestapo ihn gefoltert hat, dass du auf freiem Fuß geblieben bist. Fehlandt hat mir hinterher gesagt, dass du ursprünglich den Kommunisten in deinem Keller versteckt hattest. Aber vielleicht hast du ja einfach nur Glück gehabt.«
»Es geht nicht«, sagte Ernst Buchholz. Es war schon der zweite Morgen, an dem er vor Tau und Tag mit dem Fahrrad unterwegs gewesen war, um einen passenden Platz für die Leiche zu finden. Ursprünglich hatten sie beabsichtigt, den Sack mit dem Toten knapp unterhalb von Elmshorn in die Krückau zu werfen. Aber sie hatten nicht bedacht, dass der Nebenfluss der Elbe gezeitenabhängig war und bei Niedrigwasser beinahe trockenfiel, sodass man den Sack sofort gefunden hätte.
»Was war in Lieth?«, fragte seine Partnerin. In Lieth gab es eine große Tongrube; dort musste es zahlreiche Möglichkeiten geben, eine Leiche loszuwerden.
Ernst setzte sich zu ihr auf die Bettkante. »Sie haben einen Hund«, sagte er. »Sowie ich mich der Grube genähert habe, hat das Viech angefangen zu kläffen und überhaupt nicht wieder aufgehört. Dabei bin ich schon von der Rückseite an die Grube herangefahren. Es geht nicht.«
»Es gibt bestimmt noch andere Möglichkeiten«, sagte seine Partnerin. Sie wirkte vollkommen ruhig. »Wir müssen einfach weitersuchen.«
Ja, etwas anderes blieb ihnen nicht übrig. Es wurde wirklich Zeit, dass die Leiche verschwand. Vielleicht bildete er es sich nur ein, aber er hatte das Gefühl, dass der Sack allmählich zu stinken begann. Er hatte die beiden Fenster im Schuppen geöffnet, aber das war auf die Dauer auch keine Lösung.
Waltraud hatte gefragt, warum er das Loch im Schuppen gegraben habe. Er hatte vereinbarungsgemäß geantwortet, dass er Kartoffeln einlagern wolle. Aber natürlich hatte er keine Kartoffeln, und er musste jetzt sehen, dass er die Grube so schnell wie möglich zuschaufelte. Das Wasser, das sich da angesammelt hatte, war inzwischen versickert. Die letzten Tage hatte es nicht geregnet.
»Es gibt eine alte Sandgrube«, sagte seine Freundin. »An der Straße nach Wedel. Auf der linken Seite, gar nicht weit von hier. Ich glaube, da wird nicht mehr abgebaut. Ich glaube, da gibt es auch einen Teich.«
Sie war sich sicher, dass es dort einen Teich gab. Sie hatte dort an einem der heißen Tage im letzten Sommer nackt gebadet, aber das wusste niemand außer ihr.
Wilhelm Berger fühlte sich müde und mutlos. Die Rückkehr nach Hause war anders verlaufen, als er es sich gedacht hatte. Dass Dagmar, seine Frau, sich umgebracht hatte, hatte in dem Brief gestanden, den das Rote Kreuz ihm ins Gefangenenlager geschickt hatte. Ihr gemeinsamer Sohn Horst war noch ein Kind gewesen, als er ihn zuletzt gesehen hatte. Im Krieg hatten die Nachbarn sich um ihn gekümmert. Jetzt war Horst siebzehn Jahre alt, ein erwachsener Mann. Das war zu schnell gegangen. Er hatte längst eine Freundin, lebte mit ihr zusammen in Harburg. Wilhelm Berger hatte mit einiger Mühe durchsetzen können, dass er selbst jedenfalls ein Zimmer in seinem Haus in Wandsbek beziehen konnte. Im Rest des Hauses waren Flüchtlinge untergebracht.
Jetzt war Berger auf den Weg nach Sinstorf. Sinstorf war ein Vorort von Harburg, und Harburg war ein Vorort von Hamburg.
Eine junge Frau öffnete die Tür. »Sie müssen Horsts Vater sein!«, sagte sie. »Herzlich willkommen!« Sie hatte einen festen Händedruck.
Horst erschien hinter ihr. »Das ist Monika«, sagte er. »Wir haben uns beim Tanzen kennengelernt.« Monika war größer als er und hatte lange, strohblonde Haare.
»Es freut mich, Sie kennenzulernen.« Dass sie älter sei als Horst, dachte Wilhelm Berger, und dass sie mindestens zwanzig sein müsse.
»Sie sind also der berühmte Mörderjäger«, sagte Monika. Sie hatte ein spitzbübisches Lächeln. Wilhelm Berger war sich nicht sicher, ob er das mochte.
»Mörderjäger und Pirat«, ergänzte Horst. »Pirat im Namen des Führers!«
Das mochte Wilhelm Berger schon gar nicht. Er hatte als Offizier auf dem Hilfskreuzer Atlantis gedient. Er sah sich nicht als Pirat, und schon gar nicht als Pirat im Namen des Führers. Aber er wollte keinen Streit vom Zaun brechen. Er sagte: »In den letzten Jahren bin ich weder Mörderjäger noch Pirat gewesen. In den letzten Jahren war ich schlicht und ergreifend Kriegsgefangener – wie viele andere Deutsche auch.«
»Darf ich dir widersprechen?«, sagte sein Sohn. »Die wenigsten unserer Landsleute hatten das Glück, die meiste Zeit des Krieges in einem tropischen Inselparadies zu verbringen.«
»Das schönste Paradies ist nichts wert, wenn man in einem Gefängnis sitzt«, konterte Wilhelm.
Das ließ Horst nicht gelten. »Ich denke, es ist im Krieg sehr viel wert, wenn man genügend zu essen hat und wenn man sich ganz sicher sein kann, dass in absehbarer Zeit niemand einen umbringen wird.«
»Was verstehst du davon?« Jetzt war Wilhelm Bergers Erwiderung doch schärfer ausgefallen, als er beabsichtigt hatte.
Horst konterte: »Ich habe den Krieg erlebt«, sagte er. »Ich habe erlebt, wie Hamburg bombardiert worden ist. Ich habe die letzten Jahre als Flakhelfer miterlebt, wie wir gar nichts machen konnten, um unsere Stadt zu schützen.« Horst Berger brach unvermittelt ab. Jetzt hätte er beinahe im Zorn angefangen, über Dinge zu sprechen, die er für immer für sich behalten wollte. Die schrecklichsten Erlebnisse seines Lebens.
»Entschuldige«, lenkte Wilhelm Berger ein. »Das war ungerecht von mir.«
»Wir sollten uns nicht streiten«, sagte Monika mit sanfter Zunge. Dabei war sie sich sehr wohl bewusst, dass sie diesen Streit mit ausgelöst hatte. »Ich habe ein kleines Abendessen für uns vorbereitet, und das sollten wir jetzt genießen.«
Sie genossen das Abendessen. Das Zimmer im Dachgeschoss eines älteren Hauses in Hamburg-Sinstorf enthielt all die Dinge, von denen Horst und Monika glaubten, dass sie sie zum Leben brauchten. Das war nicht allzu viel. Allzu viel durfte es auch nicht sein, denn das Zimmer war klein genug. Die beiden jungen Leute hatten nur zwei Stühle; Wilhelm Berger musste auf dem Bett sitzen. Für ihn war der Tisch zu hoch, sodass er eine sehr unbequeme Haltung einnehmen musste.
»Die Kartoffeln sind vom schwarzen Markt«, erläuterte Monika.
Wilhelm Berger nickte. Sie waren nicht so weich gekocht, wie er es von früher gewohnt war, und Monika hatte im Gegensatz zu Dagmar darauf verzichtet, sämtliche schwarzen Augen herauszuschneiden. Das Getränk, das Monika großzügig einschenkte, sah auf den ersten Blick aus wie Rotwein, aber es war doch nur Johannisbeersaft, saurer als der sauerste Wein, den Wilhelm Berger je getrunken hatte.
Das Bett, auf dem er saß, war ziemlich ausgeleiert. Außerdem war es sehr schmal. Wenn sie zu zweit darauf schliefen, und daran bestand kein Zweifel, dann würde es auf jeden Fall sehr, sehr eng sein.
»Wir wollen übrigens heiraten«, sagte Horst.
Das hatte Wilhelm befürchtet. »Und wovon wollt ihr leben?«, fragte er.
»Ich habe einen Aushilfsjob bei der Sparkasse«, sagte Monika. »Und wenn die Heimkehrer endlich alle versorgt sind, dann wird sicher auch Horst eine Stelle bekommen.«
In dem Herd brannte ein munteres Kohlefeuer. Nach der Wärme im Zimmer zu urteilen, musste es schon viele Stunden gebrannt haben.
Monika bemerkte Wilhelm Bergers Blick und sagte: »Die Kohlen sind natürlich geklaut.«
»Vorsicht!«, warf Horst ein. »Papa ist Polizist, vergiss das nicht!«
»Glaubst du, dass er mich jetzt festnehmen wird?«, fragte Monika in gespielter Besorgnis.
Horst sah seinen Vater kritisch an. »Nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich traut er sich nicht, zwei Schwerverbrechern allein gegenüberzutreten. Und er kann keine Hilfe herbeitelefonieren, denn natürlich gibt es hier kein Telefon.«
Wilhelm Berger seufzte. »Das ist kein Witz«, sagte er. »Auch in schlechten Zeiten müssen die Gesetze eingehalten werden. Dazu sind sie da.«
Monika sah ihn ernst an. »Es ist kalt«, sagte sie. »Es ist der kälteste Winter seit vielen, vielen Jahren. Und ich bin schwanger. Du willst doch nicht, dass unser Baby erfriert, bevor es überhaupt geboren ist?«
Es war spät geworden. Die Lage hatte sich entspannt. Sie hatten über die Hochzeit gesprochen und über das Baby, das noch nicht da war. Monika schlief jetzt, in dicke Decken eingehüllt. Wilhelm und Horst Berger saßen vor dem Ofen.
Wilhelm erzählte von früher. »Im März ist das gewesen«, sagte er. »Im März 1940. Da sind wir ausgelaufen.«
»Ich weiß«, sagte Horst. »Wir haben euch gesehen.«
Davon wusste Wilhelm Berger nichts. Er hatte zwar Dagmar informiert, wann die Reise losgehen sollte; das war von Kiel aus noch möglich gewesen, obwohl es eigentlich verboten war. Er hatte nicht damit gerechnet, dass seine Frau kommen würde.
»Am 10. März ist das gewesen«, sagte Horst. Ich hätte eigentlich in der Schule sein sollen, aber Mama hat mich früher aufgeweckt als sonst. Ich war hundemüde, aber sie hat gesagt: ›Komm mit. Papa fährt jetzt in den Krieg. Wir wollen ihn wenigstens noch einmal sehen.‹ Wir sind dann mit der Bahn nach Rendsburg gefahren und vom Bahnhof aus endlos lange zu Fuß gegangen. Schließlich standen wir am Kaiser-Wilhelm-Kanal. Es war entsetzlich kalt, und auf dem Wasser war alles voller Eis.«
Wilhelm Berger nickte. Die Atlantis musste damals mithilfe von Schleppern in die Schleuse von Kiel-Holtenau manövriert werden, um die empfindliche Schraube nicht zu gefährden. Es war auch so noch schwierig genug gewesen.
»Wir haben gestanden und gestanden«, sagte Horst. »Es passierte nichts, und ich hatte schon gedacht, dass eure Abreise wahrscheinlich verschoben worden war, aber dann endlich kamen die Schiffe. Es war nicht nur die Atlantis. Es war eine regelrechte Flotte.«
Wilhelm erinnerte sich noch genau. An der Spitze war das alte Linienschiff Hessen gefahren, das eigentlich nur noch bei Schießübungen als Zielschiff diente. Aber der gepanzerte Riese war allein schon aufgrund seiner Form hervorragend geeignet, um Eis von beliebiger Dicke aufzubrechen. Direkt dahinter fuhr die Widder, anschließend die Atlantis und am Ende des Zuges die Orion.
»Mama hat natürlich gehofft, dass sie dich sehen würde. Aber wir haben dich nicht gesehen.«
»Ich war unter Deck«, sagte Wilhelm.
»Wir haben nicht einmal gewusst, welches der Schiffe denn nun die Atlantis ist. Mama hatte unser Fernglas dabei, aber das hat nichts genützt. Wir haben Leute gesehen, die auf der Brücke gestanden haben, aber natürlich konnten wir niemand erkennen. Es waren ja alle dick eingemummelt.«
»Bernhard Rogge hat auf der Brücke gestanden«, behauptete Wilhelm. »Unser Kommandant. Den hätte Dagmar wahrscheinlich erkannt, aber vielleicht habt ihr auf der falschen Seite gestanden.«
»Schon möglich«, sagte Horst.
Wilhelm Berger erinnerte sich sehr gut an die Fahrt durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal. Es war ein riskantes Unternehmen, bei Tag zu fahren. In der Enge des Kanals gab es keine Ausweichmöglichkeiten. Ein Fliegerangriff hätte gleich drei Hilfskreuzer auf einmal ausschalten können. Aber so früh im Krieg, im März 1940, gab es nur selten Luftangriffe.
Horst dachte an die Kälte und an die Kolonne der namenlosen, grauen Schiffe, die an ihnen vorübergefahren waren. Er hätte gern seinem Papa noch einmal zugewunken. Mama auch. Sie hatte nicht gesagt, dass sie enttäuscht war, aber Horst hatte gesehen, dass sie sich Mühe gab, nicht zu weinen. Da hatte sie noch nicht gewusst, dass sie ihren Mann niemals wiedersehen würde.
In Wirklichkeit hatte Bernhard Rogge bei der Fahrt durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal nicht auf der Brücke gestanden. Berger war überrascht gewesen, als er den Kommandanten stattdessen in seiner Kajüte antraf. Auf dem Tisch stand eine Flasche Rotwein, zu zwei Dritteln geleert.
»Oh«, sagte Berger. »Ich will nicht stören.«
»Du störst nicht«, erwiderte Rogge. »Komm rein und mach die Tür zu.«
Berger wusste nicht, was er sagen sollte.
Rogge war drei Jahre jünger als Berger. Wilhelm kannte ihn schon aus der Zeit vor dem Weltkrieg. Sein Vater war Pastor gewesen. Sie hatten nie darüber gesprochen, aber Wilhelm war sich ziemlich sicher, dass Bernhard tief religiös war.
»Setz dich.«
Wilhelm Berger nahm Platz.
»Du wunderst dich, dass du deinen Kommandanten hier in diesem Zustand antriffst«, sagte Rogge. Er sprach völlig normal, aber die fast geleerte Flasche belegte, dass er betrunken war. »Dies ist das erste Mal, Wilhelm, dass du mich besoffen siehst. Und es wird auch das letzte Mal sein. Ab morgen sind wir im Krieg, und dann müssen wir alles, was bisher gewesen ist, hinter uns lassen.«
»Ja.«
Rogge sah Wilhelm an: »Du denkst an deine Familie.«
Wilhelm nickte.
»Ihr Schicksal liegt in Gottes Hand«, sagte Rogge. »Ihres und unseres. Meines auch.«
»Die Marine setzt großes Vertrauen in dich«, sagte Berger.
»Die Marine, ja, aber die hat uns nicht schützen können. Meine Anneliese war Jüdin. Sie hat sich letztes Jahr umgebracht. Am 4. September, drei Tage nach Kriegsausbruch.«
»Mein Gott!«, sagte Berger erschrocken. »Das habe ich nicht gewusst. Das tut mir leid. Die Anneliese, die war so eine – eine liebenswerte Frau …«
»Ja, Wilhelm, das war sie.«
»Diese Scheiß-Nazis!«, rief Berger. Er sah, dass sein Freund feuchte Augen hatte. »Und jetzt fahren wir auch noch für sie in den Krieg. Wie hältst du das aus, Bernhard?«
Rogge schüttelte den Kopf. »Wir fahren nicht für die Nazis in den Krieg«, sagte er. »Wir tun es für Deutschland. Wir tun es, weil das Vaterland es von uns verlangt. Weil der Anstand es von uns verlangt.«
»Der Anstand verlangt gar nichts von uns«, erwiderte Berger. »Wer selbst nicht anständig ist, wie diese Nazis, der kann von anderen auch keinen Anstand fordern.« Er überlegte, ob er seinem Freund vorschlagen sollte, statt in den Krieg zu ziehen einfach einen neutralen Hafen anzulaufen und das Schiff und seine Besatzung internieren zu lassen.
»Ich bin durch einen Eid gebunden, Wilhelm. So etwas nehme ich sehr ernst. Ich werde diesen Auftrag ausführen. – Und wie ich eben schon gesagt habe, bin ich der Kommandant auf diesem Schiff, und ich werde dafür sorgen, dass wir unseren Auftrag so gut und so menschlich wie möglich erledigen. Aber es gibt noch etwas anderes, was ich dir sagen muss: Wir haben jetzt beide etwas getan, was wir nicht tun dürfen. Ich habe mich betrunken, und du hast die Politik ins Spiel gebracht. Das geht nicht. Die Politik hat auf diesem Schiff nichts zu suchen. Für die Dauer unserer Reise ist es egal, ob jemand ein Nazi ist oder nicht. Von mir aus kann er auch Kommunist sein. Für die Dauer unserer Reise ist er einfach nur ein Mitglied der Atlantis-Familie, und in der gibt es keinen Streit. Wir halten zusammen, wir müssen zusammenhalten, koste was wolle, denn sonst sind wir verloren, sonst gehen wir alle unter.«
Wilhelm Berger nickte, aber seine Zweifel waren damit nicht ausgeräumt. ›Sonst gehen wir unter‹, hatte Rogge gesagt. Wilhelm fragte sich, ob sein Kommandant nach all dem, was er erlebt hatte, nicht genau diesen Untergang jetzt anstrebte.
Als Bergers Wache beendet war, war er todmüde. Eigentlich hätte er sich sofort in die Koje legen sollen, aber auf dem Weg dorthin kam er an der Schiffsbibliothek vorbei, und er warf einen Blick hinein. Was hatte Rogge für seine Besatzung zusammengestellt? Berger wusste, dass er alles selbst ausgesucht hatte. Nazi-Literatur fehlte. Aber verbotene Bücher gab es natürlich auch nicht.
Die Regale enthielten sehr viele Romane, teils war das romantischer Kitsch wie Ganghofers Schloss Hubertus und Das Schweigen im Walde, teils anspruchsvolle Literatur. Goethe, Schiller, Kleist. Kriegsbücher nahmen einen sehr geringen Raum ein, obwohl natürlich in Anbetracht ihres vorgesehenen Einsatzes Semsrotts Der Durchbruch der Möwe und das Kaperschiff Möwe nicht fehlen durften. Auch Die glückhafte Emden war vertreten; der zweite Band mit dem Titel Kampf und Untergang der Emden fehlte aus begreiflichen Gründen. Es gab zahlreiche Sachbücher, und offenbar hatte Rogge auch daran gedacht, dass etwaige gefangene, englische Seeleute etwas zu lesen haben mussten. Cronins The Stars Look Down und The Citadel. Kriminalromane von einer gewissen Dorothy Sayers, die Berger nicht kannte. Direkt daneben stand Lord Byrons Cain. A Mystery. Aber das war kein Kriminalroman; genau wie The Corsair kein Piratenbuch im eigentlichen Sinne war. Wilhelm Berger schlug die letzte Seite auf. Ja, da standen die Zeilen, an die er sich erinnerte:
He left a Corsair’s name to other times,
Linked with one virtue and a thousand crimes.
Von dem Korsaren wird man lang noch sprechen
Von seiner einen Tugend und seinen tausend Verbrechen.
Die Hamburger Mordkommission befasste sich jetzt, Ende Februar 1947, ausschließlich mit dem Trümmermörder. Vier Menschen hatte er umgebracht, ihre Leichen auf Trümmergrundstücken in verschiedenen Stadtteilen zurückgelassen. Für Hinweise, die zu seiner Ergreifung führten, hatte die Polizei eine Belohnung von 5000 Reichsmark und tausend Zigaretten ausgesetzt. Die Zigaretten waren jetzt so wertvoll wie der Geldbetrag. 50.000 Fahndungsplakate waren gedruckt worden. Diese Plakate waren in allen vier Besatzungszonen geklebt worden, also auch in der russischen Zone. Es hatte sich niemand gemeldet, der Auskünfte über den Täter hätte geben können.
Ernst Buchholz war mit dem Fahrrad hinausgefahren nach Klein-Nordende. Er hatte es einfach nicht mehr ausgehalten. Seit Wochen schon herrschte strenger Frost, und er war sich sicher, dass der Kiessee mit einer dicken Eisschicht bedeckt war. Das bedeutete, dass man jetzt trockenen Fußes auf den See hinauslaufen konnte, und er war sich sicher, dass die Kinder nach der Schule auf dem Eis Schlittschuh laufen würden.
Jetzt war später Vormittag. Eigentlich hätte er sich, schon bevor es hell wurde, auf den Weg machen wollen, aber er hatte die Zeit verschlafen. Wahrscheinlich machte es nicht viel. Um diese Zeit waren die Kinder in der Schule, und sonst würde niemand unnötigerweise bei dieser Kälte draußen herumlaufen. Er würde die ehemalige Kiesgrube für sich allein haben.
Er stellte das Fahrrad beim Eingang ab und schlenderte hinunter in die Sandgrube. Aber schon als er um die Kurve ging, hörte er, dass Kinder auf dem Eis waren. Er zögerte einen Moment, aber nun gab es kein Zurück. Die Kinder unterbrachen ihr Eishockeyspiel; sie hatten ihn gesehen.
»Hallo«, sagte Ernst Buchholz. Er hob die Hand, um anzudeuten, dass er in freundlicher Absicht kam und nicht etwa vorhatte, sie von ihrem Spielplatz zu vertreiben. Zögernd ging er hinaus auf das Eis. Er hatte keine Schlittschuhe; er trug normale Straßenschuhe. Aber zum Glück war die Oberfläche nicht so glatt, wie er befürchtet hatte. Nur draußen, in der Mitte des Teiches, wo die Kinder ihr Eishockeyfeld markiert hatten, sah es anders aus. Dort hatten sie den Schnee weggefegt, und das blanke Eis lag an der Oberfläche.
Die Kinder starrten ihn an. »Müsstet ihr nicht eigentlich jetzt in der Schule sein?«, erkundigte sich Ernst Buchholz.
Einer der Jungen, offenbar der Anführer, schüttelte den Kopf: »Die Schule fällt aus«, sagte er. »Die ganze letzte Woche schon. Die Kohlen sind alle. Es kann nicht mehr geheizt werden.«
»Da habt ihr ja Glück gehabt«, sagte Buchholz. »Ist das Eis denn dick genug, um euch zu tragen?«
»Ja, natürlich.« Das war eine dumme Frage.
Die Kinder sahen verblüfft zu, wie Ernst Buchholz mit vorsichtigen Schritten über das Eis zur Mitte des Teiches ging, dort ein wenig hin und her lief, probeweise ein bisschen hopste, als wollte er testen, ob das Eis auch wirklich hielt. Das Eis rührte sich nicht. Und Ernst Buchholz sah, was er befürchtet hatte. Zwar konnte man selbst hier, wo die Oberfläche spiegelblank geputzt war, nicht gut durch das Eis hindurchsehen, aber eine Stelle sah doch anders aus als der Rest der Eisfläche. Kein Zweifel, da unten lag der Sack mit dem Toten. Aber konnte man das ahnen, wenn man nichts davon wusste?
Ernst Buchholz war sich ziemlich sicher, dass die Kinder nichts bemerkt hatten. »Denn man noch viel Spaß«, sagte er. Er machte sich auf den Heimweg. Auf halbem Wege nach Elmshorn bemerkte er, dass sein Hinterreifen schon wieder Luft verlor. Er würde ihn erneut flicken müssen. Eigentlich wäre längst ein neuer Schlauch fällig gewesen, aber neue Fahrradschläuche gab es nicht.
Als Ernst Buchholz zurückkam, lag Ruth noch immer im Bett. »Guck mal, was ich gefunden habe«, sagte sie. Es war eine kleine, norwegische Münze.
Ernst war uninteressiert. »Die wird John damals verloren haben«, sagte er.
Ruth schüttelte den Kopf. »Sie ist von 1946.«
Ernst zuckte mit den Achseln.
»Du hättest da nicht hingehen sollen«, sagte Ruth.
»Ich weiß. Aber ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten, diese Unsicherheit.«
Seine Partnerin schüttelte den Kopf. »Du darfst dich nicht nervös machen lassen. Es wird alles gutgehen.«
Aber Ernst Buchholz war nervös. »Es waren so viele Kinder draußen auf dem Eis«, sagte er. »Bestimmt gehen die auch im Sommer zum Baden in diesen See. Und was dann passiert, das ist ja wohl klar.«
»Nichts wird passieren«, widersprach seine Partnerin. »Der Sack liegt tief am Grunde des Sees. Wenn wirklich jemand beim Baden mit dem Fuß dagegen stößt, dann denkt er: Das ist ein alter Sack. Hochheben kann er ihn nicht; dazu ist er zu schwer. Und warum sollte jemand einen dreckigen, alten Sack hochheben?«
Buchholz war nicht überzeugt. »Ich wünschte, wir würden einfach zur Polizei gehen«, sagte er.
Seine Partnerin richtete sich abrupt auf. »Willst du mich im Stich lassen?«
Er schüttelte den Kopf. »Ich lasse dich niemals im Stich«, sagte er. Aber es klang nicht kämpferisch, es klang eher verzweifelt.
Ruth fasste seine Hand. »Du bist ja ganz kalt«, sagte sie. »Du wirst dir eine Erkältung holen, wenn du so weitermachst. Komm zu mir ins Bett, ich wärme dich.«
Wilhelm Berger war erneut zu Besuch in Sinstorf. Monika hatte ihn im Präsidium angerufen, er müsse dringend kommen. Auf sein Läuten hin geschah zunächst gar nichts. Aus der Wohnung drang laute Schlagermusik. Berger läutete noch einmal.
Monika riss die Tür auf. »Ach, da bist du ja«, sagte sie. »Komm rein.«
Horst lag auf dem Sofa. »Es tut mir leid«, sagte er, »dass wir dich um Hilfe bitten müssen.« Er wies auf sein eingegipstes Bein.
»Soll ich das Radio leiser stellen?«, fragte Monika.
»Ja, bitte. Was ist das überhaupt für ein Zeugs, was ihr da hört?«
»BFN«, verkündete Monika. »Die deutschen Sender bringen ja nichts Vernünftiges.« Sie schaltete das Radio aus.
»Wie ist das passiert mit deinem Bein, Horst?«, wollte sein Vater wissen.
»Beim Kohlenklauen. Ich musste ja den Abhang runter, und der war verreist, und ehe ich mich versehen habe, lag ich schon im Dreck.«
»Als sie ihn gebracht haben, da habe ich gleich gesehen, dass da etwas nicht stimmt«, ergänzte Monika. »Sein linkes Bein sah irgendwie verdreht aus, und er konnte nicht von allein aufstehen. Zum Glück waren ja genügend andere Leute unterwegs. Marek, der wohnt nebenan, der hat Horst gesehen, und mit einem anderen Mann zusammen haben sie es dann geschafft, ihn den Berg hochzuschleppen und nach Hause zu bringen.«
Horst ergänzte: »Tja, und jetzt ist das Bein in Gips, und ich liege hier dumm herum und kann gar nichts machen. Und wir haben doch keine Kohlen mehr. Da ist Monika losgelaufen, zur Post, und hat dich angerufen.«
»Ich hoffe, du hast die Sache mit den Kohlen nicht erwähnt«, fragte Wilhelm Berger besorgt, »als du bei uns im Präsidium angerufen hast.«
»Ich bin doch nicht doof«, empörte sich Monika.
»Ich hatte neulich, als ich bei euch war, sowieso das Gefühl, dass ihr ein bisschen zu viel heizt«, sagte Wilhelm.
»Ist es dir so lieber?«, fragte Monika schnippisch. Es war empfindlich kalt in der Wohnung. Das Dachfenster war von Eisblumen bedeckt.
Wilhelm Berger schüttelte den Kopf. »Wenn ihr vorher etwas mehr gespart hättet …«
»Hättet!«, sagte Horst. »Haben wir aber nicht.«
»Tatsache ist«, sagte Monika, »dass diese unglaubliche Kälte immer noch weiter anhält, jedenfalls sagen sie das im Radio. Und wenn wir nicht heizen können, dann erfrieren wir.«
»So schlimm wird es nicht gleich kommen«, wandte Wilhelm ein. Aber natürlich war es vollkommen unmöglich, dass sein Sohn und seine Freundin hier in einer ungeheizten Wohnung hausten. »Könnt ihr nicht für ein paar Wochen zu Monikas Verwandten ziehen?«
»Ich komme aus Magdeburg«, sagte Monika. »Meine Verwandten sind noch drüben. Da können wir nicht hin. Und zu Freunden – das geht auch nicht. Mareks zum Beispiel, die sitzen mit acht Leuten in ihrer kleinen Wohnung. Im Stockwerk unter uns wohnt eine Pastorenfamilie. Zu denen haben wir gar keinen Kontakt. Und das Ehepaar, dem das Haus gehört, das hat nur noch Kammer und Küche im Erdgeschoss. Den Rest mussten sie abgeben.«
Wilhelm zögerte. Er registrierte, dass seine Hände kalt waren. Schließlich sagte er: »Ich mach das.«
»Ich habe gewusst, dass du uns nicht im Stich lässt«, sagte Monika. Es klang überzeugend.
Auch Horst sagte: »Wir haben gewusst, dass wir uns auf dich verlassen können.« Es klang weniger überzeugend.
Wilhelm sagte: »Wenn ich Leute verhaften soll, dann muss ich auch wissen, wie das aussieht, wenn man auf der anderen Seite steht. – Was muss ich tun?«
Horst sagte: »Du musst runter zum Güterbahnhof. Da stehen die Züge mit den Kohlen. Nicht immer, aber meistens. Das siehst du dann schon. Du kannst die Leute fragen, die dir entgegenkommen. Die wissen auch, ob die Luft rein ist. Wenn Polizei auftaucht, musst du abhauen.«
»Mich haben Sie mal erwischt«, sagte Monika. »Manche Waggons haben ja so ein Bremserhäuschen, weißt du? Und auf einmal hat jemand gerufen: ›Da hinten kommt einer mit einem Hund!‹ – ›Wo denn?‹, hab ich gesagt, aber da habe ich ihn auch schon kommen sehen. Da bin ich dann schnell rein in das Bremserhäuschen. Tür zu, ganz leise. Aber es hat gar nicht lange gedauert, da macht der Polizist plötzlich von außen die Tür auf und sagt: ›Guten Abend, junge Frau!‹ – Ich hab ihn nur angestarrt, so erschrocken war ich. – ›Jetzt gehen Sie am besten schnell nach Hause‹, hat er gesagt. – ›Ja‹, hab ich gesagt, und dann hab ich gemacht, dass ich wegkomme. An dem Abend hab ich keine Kohlen mehr geholt.«
Dass in einer solchen Situation eine junge Frau sicher bessere Karten hatte als ein Mann von sechzig Jahren, dachte Berger.
»Wir sind zu zweit gegangen damals«, ergänzte Horst. »Aber wir waren ja verschieden schnell. Deshalb waren wir nicht zusammen, als das mit dem Polizisten passiert ist. Zum Glück. Da musst du wirklich aufpassen. Die Bahnpolizei ist schon schlimm, aber die sind wenigstens unbewaffnet. Schlimmer sind die Engländer. Die machen auch gelegentliche Kontrollen. Und bei denen darfst du nicht weglaufen. Die schießen scharf.«
Wilhelm Berger schluckte. Das fehlte ja noch, dass er sich jetzt, zwei Jahre nach Kriegsende, von den Engländern totschießen ließ!
»Wird schon gutgehen«, sagte Monika. »Ich würde ja gern mitkommen, aber seit Horst weiß, dass ich schwanger bin, hat er mir das verboten.«
Ja, inzwischen konnte man wirklich sehen, dass Monika schwanger war.
Sie warteten zusammen in der Küche. Wilhelm wollte losgehen, als es dunkel wurde, aber Horst hielt ihn zurück: »Noch nicht. Nicht vor Mitternacht.«
Die Warterei schien Wilhelm endlos. Der Gesprächsstoff war ihnen rasch ausgegangen, und jetzt saßen sie nur noch da und warteten. Als es endlich 24:00 Uhr war, machte Wilhelm sich auf den Weg.
»Viel Glück!«, sagte Monika.
Der Himmel war bewölkt, aber es war draußen nicht vollständig dunkel. Überall lag Schnee. Wilhelm hatte den Mantel von Horst über seinen eigenen gezogen, und er trug Handschuhe, die Monika gestrickt hatte. Dennoch war es empfindlich kalt. Als Wilhelm das Wohngebiet verließ, spürte er auch den eisigen Wind. Er stapfte die Landstraße entlang durch die Felder, hielt den Kopf gesenkt und sah sich nur von Zeit zu Zeit um, aber es war nichts Verdächtiges zu sehen.
Zwei Männer mit Rucksäcken kamen ihm entgegen. Wilhelm fragte nach dem Weg.
»Hinten rum«, sagte einer der beiden. »Über die Brücke, das ist heute am besten. Da steht ein Zug mit Kohlen.«
Wilhelm bedankte sich. Er hatte nur eine ungefähre Vorstellung, wo diese Brücke sein mochte, aber nachdem er links abgebogen war und das Gelände mit den Schrebergärten durchquert hatte, sah er schon die Stahlkonstruktion vor sich. Ja, hier stand ein ganzer Güterzug voller Kohlen. Die Eisenbahner hatten ihn sicher nicht ohne Grund ans äußerste Ende des Güterbahnhofs geschoben, aber die Kohlendiebe hatten ihn doch gefunden. Von der Brücke her sah es aus, als hätte sich eine Schar schwarzer Ameisen über die Ladung hergemacht.
Berger stieg hinunter auf das Bahngelände. Er bemühte sich, die Gleise so leise wie möglich zu überqueren, aber ganz ohne Geräusch ging das nicht. Die Männer am Waggon warfen ihm ärgerliche Blicke zu. »Leise!«, fauchte einer. Berger registrierte, dass die meisten sich dicke Socken über die Stiefel gezogen hatten, um sich so geräuschlos wie möglich bewegen zu können.
Wilhelm Berger hatte Glück. Auf dem Waggon, auf den sich die Diebe konzentriert hatten, lagen sogenannte Eisenbahnerbriketts, immer vier aneinander. Die wurden von oben heruntergeworfen, und Berger brauchte sie nur in den Sack zu stecken. Wenn es stattdessen die kleinen Eierkohlen gewesen wären, hätte er selbst nach oben gemusst, um dort seinen Sack zu befüllen. Die ganze Aktion ging zügig voran, aber sie war auch mit Geräusch verbunden. Berger war froh, als nach wenigen Minuten sein Sack komplett gefüllt war.
»Danke!«, sagte er. Dann machte er sich auf den Heimweg.
Der Rückweg verlief ohne Zwischenfälle. Horst und Monika freuten sich sichtlich, dass alles so gut geklappt hatte. Horst sah auf die Uhr: »Es ist noch früh genug«, sagte er. »Du könntest noch ein zweites Mal gehen.«
»Dein Vater wird müde sein«, gab Monika zu bedenken.
»Ich bin nicht müde«, behauptete Wilhelm. Das war gelogen, aber er war sich sicher, dass er noch eine zweite Tour schaffen würde. »Habt ihr vielleicht ein paar dicke Socken, die ich über die Stiefel ziehen könnte?«
Horst gab ihm seine Socken. Die waren zwar nicht besonders dick und hatten mehrere Löcher, aber wahrscheinlich würden sie ausreichen, um den Lärm ein wenig zu dämpfen.
Der zweite Ausflug zum Güterbahnhof ging nicht ganz so glatt wie der erste. Von der Brücke aus bot sich jetzt ein anderes Bild als zuvor. Niemand war auf den Waggons; stattdessen schlenderten zahlreiche Menschen in beiden Richtungen am Rande des Bahngeländes entlang.
»Ist Bahnpolizei da?«, fragte Wilhelm Berger den ersten Spaziergänger, dem er begegnete.
Der Mann nickte. »Die wissen natürlich genau, warum wir hier sind, aber sie können nichts machen, solange wir nur spazieren gehen.«
Wilhelm reihte sich ein in die große Gruppe der Spaziergänger. Auf dem Bahngelände kamen ihm zwei Männer mit einem Hund entgegen. »Guten Abend«, sagte er.
Die Männer grüßten höflich zurück. Nur der Hund knurrte verärgert, aber der war angeleint.
»Was machen Sie denn so spät in der Nacht hier draußen?«, fragte einer der Polizisten.
»Spazieren gehen«, erwiderte Berger.
»Ausgerechnet hier auf dem Bahngelände?«, fragte der andere.
»Dies ist solch ein schöner Weg. Und außerdem bin ich außerhalb des Bahngeländes.« Berger war sich zwar nicht sicher, ob das stimmte, aber die Bahnpolizisten gaben sich mit seiner Antwort zufrieden.
Wilhelm Berger fühlte sich jetzt wesentlich sicherer. Er hatte den Eindruck gewonnen, dass es zwischen der Bahnpolizei und den Kohlendieben so eine Art stiller Übereinkunft gab, dass man sich gegenseitig nicht in die Quere kam. Er ging weiter in Richtung Harburg bis ans nordwestliche Ende des Güterbahnhofs und dann schließlich wieder zurück. Inzwischen waren kaum noch Menschen unterwegs. Wilhelm sah auf die Uhr. Ja, jetzt wurde es Zeit, entweder zum Kohlenzug zurückzugehen, oder die Aktion abzubrechen.
Er wollte nicht aufgeben. Horst und Monika brauchten die Kohlen, und er konnte schließlich nicht jede Nacht losziehen. Er musste sich beeilen. Er sah sich noch einmal um. Von der Bahnpolizei keine Spur.
Da vorn standen die Waggons. Wilhelm Berger überquerte die Gleise. Er war allein. Jetzt blieb ihm nichts anderes übrig, als nach oben zu klettern. Hier waren die Wollsocken von Nachteil. Er rutschte ab, schlug mit dem Knie gegen die Wand. Ein heftiger Schmerz, aber er hatte keine Zeit, sich darum zu kümmern. Er nahm Anlauf, sprang, bekam den Rand des offenen Güterwagens zu fassen, zog sich nach oben und schwang sich über die Kante.
Der Waggon war inzwischen deutlich leerer geworden. Rasch füllte Wilhelm Berger seinen Sack. Die Eisenbahnerbriketts waren zwar groß, aber auch sehr sperrig. Er brach einige davon auseinander, damit mehr in den Sack passten. Als er schließlich genug hatte, ließ er den Sack nach unten fallen. Er sprang hinterher und landete direkt vor den Füßen eines Bahnpolizisten. »Oh!«, sagte er.
»Das war jetzt etwas zu dreist«, sagte der Mann. »Leeren Sie den Sack aus, und dann kommen Sie mit zur Wache.«
Während Berger sich bückte und den Sack ergriff, sah er sich unauffällig um. Die Polizisten waren zu zweit, aber keiner von ihnen hielt eine Waffe in der Hand. Es waren ältere, eher gemütlich wirkende Beamte. Berger schmiss dem ihm am nächsten stehenden die Briketts vor die Füße und rannte los.
»Halt, stehen bleiben!«
Berger dachte nicht daran. Schon war er um den Güterwagen herum und außer Sicht. Er hatte es geschafft! – Den Hund bemerkte er erst, als der ihn an der Hose packte.
Wilfried Pagels und seine Familie wohnten in einer Nissenhütte in einem Lager an der Burgstraße, mitten zwischen den Trümmern.
»Mach die Tür zu«, war das Erste, was Pagels sagte. »Entschuldige, dass ich so direkt bin, aber du siehst ja, wie wir hier wohnen. Und dass es kalt ist, das spürst du ja selbst.«